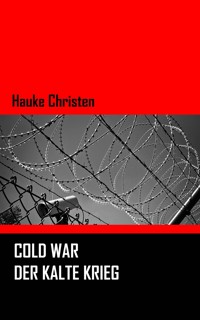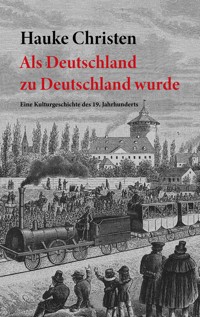
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Malerei, Musik, Literatur, Philosophie - die Reihe lässt sich bequem weiter fortsetzen. Was Kulturschaffende aus dem deutschen Sprachraum im 19. Jahrhundert an Kreativleistungen erbracht haben, ist enorm. Gründlich recherchiert werden herausragende und auch weniger bekannte heimische Kulturleistungen Leserinnen und Lesern im historischen Kontext näher gebracht. Wer erfahren möchte, was dem Komponisten Richard Wagner in seiner Kindheit an prägenden Dingen widerfahren ist oder ob das deutsche Kaiserreich unter Friedrich III. einen glücklicheren Verlauf als unter seinem unbescheideneren Sohn genommen hätte, wird so manche überraschende und erhellende Einsicht bei der Lektüre dieses Buches gewinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In Deutschland tut man alles mit Gewissenhaftigkeit, und in der Tat kann diese Eigenschaft nirgends entbehrt werden.
Germaine de Staël, 1813
Was verlor Deutschland in seinem Staube? Eben was der Diamant in dem seinigen: Die dunkle Schlackenrinde; und dann erschien der Glanz.
Jean Paul, 1814
Meine Herren, arbeiten wir rasch! Setzen wir Deutschland, sozusagen, in den Sattel; reiten wird es schon können.
Otto von Bismarck, 1867
Welches Bild können wir uns von einer Zeit machen, wenn wir darin keine Menschen sehen? Wenn wir nur eine allgemeine Darstellung geben, schaffen wir nur eine Wüste, die wir dann Geschichte nennen.
Johan Huizinga, niederländischer Kulturhistoriker, 1919
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Veränderungen in Gesellschaft und Umwelt
a.) Industrielle Revolution
b.) Aufstieg der Naturwissenschaften
c.) Die Stadt
3. Aneignung und Vergegenwärtigung der Vergangenheit
a.) Hölderlin
b.) Mommsen und die römische Geschichte
c.) Auf der Suche nach Troja
d.) Historismus
4. Kunst und Kultur
a.) Die Romantik
b.) Kunstraub in Napoleonischer Zeit
c.) Von Beethoven zu Wagner
d.) Cocooning: Die Kultur des Biedermeier
e.) Die Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff als Repräsentantin des Biedermeier
f.) Ein englischer Garten mitten in der Stadt: der Hofgarten in Düsseldorf
g.) In der Welt von Friedrich Nietzsche
h.) Wien, Aufbruch der Kunst in die Moderne
5. Auf dem Weg zur staatlichen Einheit
a.) Liberalismus und liberale Ideen
b.) Otto von Bismarck: Familiärer Hintergrund und politischer Aufstieg bis 1862
c.) Der Deutsch-Dänische Krieg 1864
d.) Nur ein Mythos? Die 1871 mit der Ausrufung des Kaiserreichs und Begründung des Nationalstaats gewonnene deutsche Einheit
e.) Kaiser Friedrich III: Ein (fast) vergessener Herrscher
f.) Der Gründerkrach 1873: Ökonomische Verwerfungen im noch jungen deutschen Kaiserreich
g.) Kulturkampf
h.) Die Kongo-Konferenz 1884/85 in Berlin und der Wettlauf um Afrika
6. Exkurs
a.) Schwieriges Erbe der Kolonialzeit: Afrikanische Raubkunst in europäischen Museen
7. Nachwort
8. Auswahlbibliografie
9. Bildnachweis
1. Einleitung
Das lange 19. Jahrhundert
Wer vom „langen 19. Jahrhundert“ spricht, bezieht sich üblicherweise auf den zwischen dem Beginn der Französischen Revolution und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs aufgespannten rund 125 Jahre währenden Zeitrahmen.
Den Begriff geprägt hat der im Oktober 2012 verstorbene britische Sozialhistoriker Eric J. Hobsbawm. Das „lange 19. Jahrhundert“ ist dabei viel mehr als eine ebenso prägnante wie griffige Formel, sie ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Beschäftigung Hobsbawms mit europäischer Geschichte, die ihren verschriftlichten Ausdruck insbesondere in der von 1962 bis 1987 im englischsprachigen Original erschienenen Trilogie "The Age of Revolution", "The Age of Capital" und "The Age of Empire" gefunden hat. Ausgangspunkt der Analyse des Autors ist dabei die Feststellung, dass sich zeitgleich eine Doppelrevolution zugetragen habe. Einerseits die zunächst von Forderungen nach breiterer politischer Teilhabe angetriebene revolutionäre Bewegung in Frankreich und zum zweiten die Industrielle Revolution in Großbritannien, deren wirtschaftliche und soziale Auswirkungen die traditionellen gesellschaftlichen Muster ähnlich radikal für die Zukunft verändert haben.
Hobsbawm ist zwar zeitlebens für seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei Großbritanniens (CPGB) harsch kritisiert worden, hat deswegen auch so manche berufliche Benachteiligungen erfahren und in Kauf nehmen müssen, doch sein Konzept vom „langen 19. Jahrhundert“ hat die strengen Grenzen des auf einhundert Jahre festgelegten kalendarischen Korsetts erfolgreich zu sprengen verstanden. Jedenfalls in den Augen einer Vielzahl von Fachleuten, die ihm wie auch eine an historischen Prozessen interessierte breitere Öffentlichkeit darin bereitwillig gefolgt sind. Es ist also zu fragen, welche inneren Zusammenhänge und welche Gemeinsamkeiten - in den Worten Leopold von Rankes die "leitenden Ideen" und "herrschenden Tendenzen" - die allgemein akzeptierte und dennoch eigenwillige Periodisierung rechtfertigen?
Zunächst bedarf es jedoch der Klärung des geographischräumlichen Geltungsbereichs. Es liegt nahe, dass in dem Jahrhundert, das Europa mit einer solchen Bedeutung wie niemals zuvor und danach versah, andere Weltregionen sich zeitgleich auf davon abweichenden Entwicklungsniveaus und Kulturstufen befunden haben, was vollkommen wertfrei zu verstehen ist. Mit Blick auf Afrika hat der mit einer monumentalen Monographie als Universalhistoriker hervorgetretene Jürgen Osterhammel dazu festgestellt, dass für den gesamten Kontinent mit der Ausnahme von Ägypten und Südafrika sowohl die traditionelle chronologische Einteilung wie auch Hobsbawms These vom „langen 19. Jahrhundert“ irrelevant wären. Das hat nach Einschätzung des Autors von „Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts“ vor allem damit zu tun, dass mit der kolonialen Invasion der 1880er Jahre ein Epochenabschnitt eröffnet worden sei, der sich noch bis zum Höhepunkt der Dekolonisation der 1960er Jahre erstreckt habe.
Außerhalb Europas gelangt Hobsbawms These ergo sehr leicht an ihre Grenzen, was eigentlich nicht weiter erstaunt, da ureuropäische Ereignisse ihr Ausgangspunkt sind. Ureuropäische Ereignisse, die in ihrer Kombination zu spezifischen Auswirkungen geführt haben, wie sie auf anderen Kontinenten zeitnah eben einfach nicht stattgefunden haben. Mit der einen Ausnahme Nordamerikas versteht sich. Der dort entschieden gegen Bevormundung durch das Königreich Großbritannien gerichtete Siedlerprotest wies selbst genügend revolutionäre Züge auf. Die abgesehen von Sachbeschädigungen gewaltfreie Boston Tea Party vom Dezember 1773 bildete den friedfertigen Auftakt, die Ouvertüre zum ungleich blutigeren transatlantischen Geschehen in den Straßen von Paris fünfzehn Jahre später im Juli 1789 mit mehr als 90 Getöteten anlässlich des Sturms auf die Bastille.
Nationalstaat, Nation und nationales Denken
Die Ursprünge des Nationalstaats reichen bis weit in die Vergangenheit ins Spätmittelalter zurück. Als frühe Beispiele dafür können fraglos bereits die Königreiche Frankreich, England, Schottland und Portugal gelten. Im Zeitalter des Absolutismus ist schließlich im Unterschied zu vorhergehenden Zeiträumen eine qualitative Veränderung hin zu gesteigerten Aktivitäten und organisatorischen Verbesserungen auf staatlicher Ebene zu beobachten. In seinem Klassiker "Aufstieg und Fall der großen Mächte" hat schon Paul Kennedy für das Frankreich des als Sonnenkönig bekannten Ludwig XIV. Monopolisierung und Bürokratisierung der militärischen Macht durch den Staat als zentralen Teil der Nationalstaatsbildung betont. Ob nun durch stehende Armeen, königliche Flotten, eine besser entwickelte Infrastruktur mit Militärakademien, Kasernen, Werften und Verwaltern, die sie leiteten; Macht war jetzt nationale Macht geworden. Auf wirtschaftlichem Gebiet illustrieren die neuartigen der Denkschule des Merkantilismus verpflichteten Ideen einer anzustrebenden aktiven Handelsbilanz durch den Export hochwertiger Güter, denen im Idealfall erheblich geringere Importe gegenüber zu stehen hätten, anschaulich das Ausmaß des Willens zur Veränderung. Wirkungsvoll in Szene gesetzt vom seinerzeitigen Finanzminister Colbert.
Doch von Nationen im modernen Sinne sprechen wir erst seit der Französischen Revolution. Bei der Nationenbildung wirken ganz allgemein Faktoren wie gemeinsame Abstammung, Sprache, Kultur und auch Religion zusammen. Elemente sozialer Gruppenbildung wie Heimatliebe, Mißtrauen gegen Fremde, Überlegenheitsgefühle der eigenen Gruppe treten zumeist - in unterschiedlicher Intensität ausgeprägt - ergänzend hinzu. "Nationen, so sieht man auf den ersten Blick, sind große mächtige Lebenszusammenhänge, die geschichtlich in langer Entwicklung entstanden und in unausgesetzter Bewegung und Veränderung begriffen sind," hat der Ideenhistoriker Friedrich Meinecke eine wesentliche Erkenntnis dazu auf einen allgemeinen Nenner gebracht.
Während das vorrevolutionäre Frankreich eine Ständegesellschaft mit einem Herrscher von Gottes Gnaden an der Spitze des Staates gewesen ist, wurde durch die Revolution das Volk oberster Souverän. In der Volkssouveränität verkörperte sich demzufolge die Legitimationsidee des Nationalstaats. Eine bekannte politische Flugschrift vom Januar 1789, aus der Anfangszeit des „langen 19. Jahrhunderts“, in der Abbé Sieyès seine berühmt gewordenen Forderungen erhoben hat, verdeutlicht den Gedanken. Auf dem festen Fundament der Philosophie der Aufklärung basierend, wird die gottgegebene ständische Ordnung in "Qu' est-ce que le tiers état?" ("Was ist der Dritte Stand?") angezweifelt. Mit Blick auf den die umfangreichen finanziellen Lasten des Staates tragenden Dritten Stand konnte Sieyès fragen: "Was ist er bisher in der politischen Ordnung gewesen?", und ein lapidares "Nichts!" anfügen. Anders formuliert: Das durch persönliche Leistungen zu einigem Wohlstand gelangte Stadtbürgertum, sich darin von den qua Geburt ererbten Privilegien des Ersten und Zweiten Standes unterscheidend, hat ein politisches Äquivalent für seine Pflicht und Bereitschaft, Steuern zu zahlen und damit Lasten zugunsten des Gemeinwesens zu übernehmen, verlangt. Was bereits für die Entwicklung der attischen Demokratie der Antike im Griechenland des 6./5. Jahrhundert v. Chr. mitentscheidend war, sollte für das Frankreich des späten 18. Jahrhunderts ähnlich bedeutungsvoll werden.
Wie sah es nun östlich des Rheins aus, nachdem aus der französischen Republik - den ursprünglichen revolutionären Absichten ganz offensichtlich widersprechend - das Kaiserreich Napoleons I. hervorgegangen war? Weil der Habsburger Franz II. am 6. August 1806 auf die Kaiserkrone verzichtet hatte, war das Heilige Römische Reich deutscher Nation nach vielen Jahrhunderten Fortdauer und Bestehen an sein unwiderrufliches Ende gelangt. Der im selben Jahr gegründete Rheinbund und ein nach Jena und Auerstedt gezwungenermaßen nur noch rudimentäres Preußen bildeten augenfällig keine angemessene staatliche Ersatzexistenz. In diesem folgenreichen Ergebnis hatten sich die nur locker verbundenen und fragmentierten deutschsprachigen Einzelstaaten gegenüber dem zentralisierten französischen Nationalstaat als nicht durchsetzungsfähig genug erwiesen. Allmählich brach sich jedoch jenseits eifersüchtig gehüteter Partikularinteressen nationales Denken Bahn. Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte veröffentlichte 1808 seine "Reden an die deutsche Nation", zwei Jahre darauf erschien "Deutsches Volkstum" vom als Turnvater bekannten Friedrich Ludwig Jahn. Mit der größten Emphase ging wohl der evangelische Theologe Ernst Moritz Arndt zu Werke. Sein Patriotismus äußerte sich offen revanchistisch und nach Rache und Befreiung, wie Arndt schrieb, wollte er unter grünen Eichen auf dem Altar des Vaterlandes dem schützenden Gotte die fröhlichen Opfer dargebracht wissen.
Als die klassischen Texte des deutschen Nationalismus entstanden, war das alte Reich nur noch Erinnerung und nicht mehr existent. Der Historiker Heinrich August Winkler hat das Wirken von Arndt, Fichte, Jahn und Publizisten ähnlicher Gesinnung dahin gehend gedeutet, dass sie in ihren phantasievollen Vorstellungen ein neues Reich des deutschen Volkes zu begründen erstrebten. In Anlehnung an die Weltreichsträume der hochmittelalterlichen Stauferzeit sei es, um den ehrgeizigen Vergleich mit der glorreichen Vergangenheit zu bestehen, zu einer Art von Heiligung des nationalen Gedankens, einer Mission, einem Sendungsbewusstsein gekommen. Die Tristesse der eigenen Gegenwart wurde in hoffnungsvollen Zukunftsentwürfen kompensiert.
Die Realisierung des nationalstaatlichen Prinzips ist de facto zu einer der leitenden Ideen des 19. Jahrhunderts in Europa geworden. Griechenland erkämpfte nach zähem Ringen mit äußerer Unterstützung seine Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Die Souveränität wurde schließlich im Londoner Protokoll vom 3. Februar 1830 bestätigt. In demselben Jahr proklamierte auch Belgien seine Unabhängigkeit. Drei Jahrzehnte darauf ist am 17. März 1861 in Turin Viktor Emanuel II. zum König Italiens ausgerufen worden. Bis zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs sollten weitere zehn Jahre vergehen. Die in Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg aus den Trümmern der zaristischen, habsburgischen und osmanischen Monarchien schließlich entstehende Nationalstaats-Bewegung liegt freilich außerhalb des hier diskutierten Zeitrahmens.
Seit einer Reihe von Jahren mehren sich die Anzeichen in Europa und auch anderswo, die im Ergebnis in Multilateralismus und der Zusammenarbeit in internationalen Organisationen keinen besonderen Wert mehr erkennen wollen. Stattdessen predigen Populisten allenthalben die Rückbesinnung auf nationale Eigenart und vermeintliche Größe. Komplexe Probleme wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Natur werden gerne simplifiziert dargestellt. Alternative Fakten als Ausdrucksform einer vorsätzlich reduzierten Wirklichkeit machen die Runde. Vollends in den verderblichen Chauvinismus vergangener, überwunden geglaubter Tage abzugleiten, ist es nur noch ein kleiner Schritt. Wohin ein derart eingeschlagener Weg mit hinreichendem ideellen Ballast im Marschgepäck führen kann, haben die „Schlafwandler“ im Sommer 1914 nachdrücklich gezeigt.
Säkularisierung und Wissenschaft
Demografischer Wandel und rasantes Bevölkerungswachstum in vielen Gegenden der Welt sind keineswegs nur Erscheinungen unserer ebenso krisengeplagten wie - erprobten Gegenwart, sondern eben auch des 19. Jahrhunderts. Binnen- und Auswanderung ist eine mögliche Antwort auf lokal nicht zufriedenstellende Lebensbedingungen gewesen. Daneben jedoch ist eine rasch zunehmende Verstädterung und Urbanisierung wahrzunehmen. Der erhebliche Zuwachs in den Einwohnerzahlen zwischen 1700 und 1800 bei den heute fünf größten Städten des Landes zeigt es deutlich:
Jahr
1700
1800
Berlin
30.000
172.000
Hamburg
70.000
130.000
München
24.000
40.000
Köln
39.000
41.000
Frankfurt am Main
28.000
35.000
Eine Abnahme der Einwohnerzahl ist anhand der angeführten Beispiele nirgendwo festzustellen. Das Gegenteil ist der Fall. Die von dem Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler für Deutschland in den Grenzen von 1914 errechnete Gesamtzahl der Bevölkerung beträgt rund 16 Millionen Einwohner für das Jahr 1700. Einhundert Jahre später an der Wende zum 19. Jahrhundert sind es bereits 24,5 Millionen. Der Anstieg beträgt mehr als 50 Prozent. Zum Vergleich: Zu dieser Zeit lebten in Russland etwa 38 Millionen Menschen, in Großbritannien ca. 11 Millionen und in Frankreich rund 27 Millionen.
Von der zunehmenden Säkularisierung ist zunächst die rechtlich-politische Bedeutung aufweisende Säkularisation zu unterscheiden, die mit der Revolution zunächst in Frankreich, mit den Napoleonischen Eroberungen bald darauf in den unterjochten - in anderer Sichtweise in den befreiten - Gebieten ins Werk gesetzt wurde. Damit gemeint ist die staatliche Einziehung oder Nutzung von aus Land oder Vermögen bestehendem Kirchenbesitz und die rigide Aufhebung von zum Teil bereits seit dem Frühmittelalter bestehenden kirchlichen Einrichtungen wie Abteien, Klöstern und Stiften. Für die deutschen Lande hat beispielsweise im Jahr 1803 Artikel 35 des Reichsdeputationshauptschlusses vorgesehen, dass derart aufgehobene Institute der Verfügungsgewalt des jeweiligen Landesherrn zu unterstellen waren.
Der geschichtsphilosophische Begriff Säkularisierung dagegen hat viel mit dem unaufhaltsamen Aufstieg des Bürgertums im 19. Jahrhundert und dem in ihm verinnerlichten Fortschrittsdenken, den unerschütterlichen Glauben daran, dass durch vermehrtes Wissen in den Naturwissenschaften und Erfindungen technischer Art das Leben für die Menschheit besser würde, zu tun. Die zunehmende Entchristianisierung und Verweltlichung ist später vom Soziologen Max Weber in seinem 1922 gehaltenen Vortrag „Wissenschaft als Beruf“ mit dem Thema der Rationalisierung in Verbindung gebracht und ausgeleuchtet worden: "Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon oder den Glauben daran: dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge - im Prinzip - durch Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet: die Entzauberung der Welt." Auf diesen Gedanken werde ich später im Kapitel „Aufstieg der Naturwissenschaften“ (s. S. 32 ff.) ausführlicher zurückkommen. Dass Wissenschaft, deren Auswirkungen und Fortschritte wir nahezu tagtäglich in unserem Leben erfahren, zu den bedeutendsten menschlichen Kulturleistungen zu rechnen ist, steht außer Frage.
Linearität in dem von Weber behaupteten Sinne gab es natürlich nicht, dafür waren die gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen – wenig überraschend - zu vielfältig. Eine kleine, der Volksfrömmigkeit und Volkskultur zuzuordnende Episode aus dem traditionell katholischen, nach dem Wiener Kongress jedoch preußisch gewordenen Rheinland mag das belegen. Was in diesem Fall als Kombination von naiver Leichtgläubigkeit und mittelalterlichem Aberglauben wirkt, hat sich geradezu entgegen wissenschaftlichem Fortschrittsdenken zunächst seinen Weg gebahnt. Eine Vielzahl von Menschen angesprochen. Es war im Spätsommer 1822, als Meldungen von einem „wundersamen Feuerschein“ über einem Marienbild der kleinen Kirche von Zons am Niederrhein, einem überschaubaren Städtchen zwischen Köln und Düsseldorf, anfingen die Runde zu machen. Zahlreiche Pilger in nicht geringer Zahl haben sich auf den Weg gemacht, um Zeuge des Wunders zu werden. Solange bis die zuständigen Kirchenbehörden eine Untersuchung in die Wege geleitet haben, deren Ergebnissen zufolge, der „wundersame Feuerschein“ lediglich auf eine natürliche Lichtbrechung der Sonnenstrahlen durch ein Kirchenfenster zurückzuführen sei.
Der "wundersame Feuerschein" in der kleinen Kirche von Zons, der darin zum Ausdruck kommende Glaube, ein Wunder sei geschehen, steht in deutlichem, auffälligen Kontrast zu dem, was die Bürger von Göttingen elf Jahre später, im Frühsommer 1833, an der Turmspitze ihrer Johanniskirche mitten in der Stadt erblickten. Es handelte sich dabei um den metallisch aufblitzenden Strang einer Leitung, die hoch über den Dächern der Stadt von dem Astronomen und Mathematiker Carl Friedrich Gauß und dem Physiker Wilhelm Weber aufgespannt worden war. Der elektromagnetische Telegraph war damit entdeckt und der uralte Menschheitstraum einer beschleunigten Nachrichtenübertragung verwirklicht worden.
Hierzulande wie auch anderenorts im westlichen Europa steht das 19. Jahrhundert für durch die eingangs erwähnte Doppelrevolution hervorgerufene epochale Veränderungen in vielen Bereichen. Ihren relevanten Auswirkungen in Gesellschaft und Umwelt nachzuspüren, wird die erste Aufgabe des vorliegenden Buches sein.
2. Veränderungen in Gesellschaft und Umwelt
a.) Industrielle Revolution
Als „Siamesische Zwillinge der deutschen Wirtschaftsgeschichte“ hat der 1789 im Jahr des Sturms auf die Bastille in Reutlingen geborene Ökonom Friedrich List die parallel erfolgende Gründung des Zollvereins und den Beginn des heimischen Eisenbahnbaus bezeichnet. Während der 1834 ins Leben gerufene Zollverein die Idee des Freihandels im Landesinneren verwirklicht sehen wollte, ist der Eisenbahnbau nach der erfolgreichen Premierenfahrt des „Adler“ im Dezember 1835 im weiteren Verlauf des Jahrhunderts zu einem wesentlichen Bestandteil des aus Eisen- und Stahlindustrie, Steinkohlenbergbau und Maschinenbau bestehenden schwerindustriellen Führungssektors hierzulande geworden. Einmal als Leitbranche etabliert, hat speziell der Maschinenbau bis heute nichts von seiner Bedeutung eingebüßt und repräsentiert - am Umsatz 2022 gemessen - nach der Automobilindustrie und dem Chemisch-pharmazeutischen Sektor immerhin die drittwichtigste Industriebranche der Gegenwart in Europas leistungsstärkster Volkswirtschaft.
Doch wo sind die Anfänge jenes vielfach als revolutionär bezeichneten Prozesses zu verorten, den wir im weiteren Verlauf Industrialisierung nennen, und woher kamen die benötigten Arbeitskräfte? Warum ist in diesem Zusammenhang überhaupt von einer „Industriellen Revolution“ die Rede und welche Bedeutung hat sie?
Der nachholenden Entwicklung auf dem Gebiet des seit 1815 bestehenden Deutschen Bundes, eines aus 35 Einzelstaaten und vier Freien Städten bestehenden Staatenbundes, ging diejenige Englands um mehrere Jahrzehnte voraus. Zum „take-off“, einem beschleunigten Abheben, in der Theorie der in vorgezeichneten Stadien ablaufenden Modellvorstellung des US-amerikanischen Ökonomen und Wirtschaftshistorikers Walt W. Rostow kam es dort bereits in den frühen 1780er Jahren, und zwar anfangs eben nicht im Eisenbahn- oder Bergbau, sondern in der Konsumgüterindustrie. Innerhalb des in den westlichen und östlichen Midlands entstehenden Textil- und Bekleidungssektors sollte sich die Baumwollindustrie, die sich auf einen stetig über den Hafen von Liverpool abgewickelten Import des begehrten Rohstoffs verlassen konnte, zur Leitbranche entwickeln. Die Gründe dafür liegen offen zu Tage. Durch Nutzung der Dampfmaschine als Antriebsquelle für automatische Webstühle und Spinnmaschinen konnte nämlich das Produktionsvolumen erheblich erhöht werden. Im Ergebnis wurden Arbeitsgeräte wie die zunächst rein durch Muskelkraft betriebene „Spinning Jenny“ nunmehr sukzessive von technologischen Innovationen, ermöglicht durch den parallel erfolgenden rasanten Aufstieg der Naturwissenschaften, ersetzt. Mit einer zeitlichen Verzögerung von ungefähr sechzig Jahren erleben wir den „take-off“ schließlich im deutschsprachigen Raum.
Die Bedeutung der Industriellen Revolution
Insbesondere die mit quantifizierenden Methoden arbeitenden Kliometriker haben jedoch mit Verweis auf zu geringe Wachstumsraten des Nettosozialprodukts pro Kopf der Bevölkerung den sich abzeichnenden Wandel im fraglichen Zeitraum nicht revolutionär, sondern evolutionär deuten wollen. In diesem Sinne hat sich beispielsweise der Ökonom, Wirtschaftshistoriker und Nobelpreisträger Douglass North in "Theorie des institutionellen Wandels" geäußert: "Die Zeit, die wir als Industrielle Revolution zu bezeichnen gewöhnt sind, war nicht der radikale Bruch mit der Vergangenheit, für den wir sie manchmal halten." (Übers. v. Monika Streissler)
Derart formulierte Einschränkungen sind natürlich nicht nur auf das Ziel hin ausgerichtet, bestehende und fraglos vorhandene begriffliche Unschärfen zu erfassen. Daher hat sich diese Denkschule als sehr einflussreich erwiesen, und sie ist es noch. Stellvertretend für in der heutigen Forschung nach wie vor bestehende unterschiedliche Auffassungen in der Beurteilung des Tempos der industriellen Entwicklung wird deshalb auf sie verwiesen.
Verlässt man jedoch den verdichteten Zeitansatz der mathematisch-statistisch orientierten Wirtschaftsgeschichte und nimmt eine universalhistorische Deutungsperspektive ein, wie es etwa Werner Conze in den 1950er Jahren getan hat, erscheint der Stellenwert der Veränderungen in einem anderen Licht. Der deutsche Historiker Conze hat in diesem Sinne einen großen Dreischritt primärer weltgeschichtlicher Epochen herausgearbeitet. Danach hat der Mensch innerhalb der ersten vorgeschichtlichen und damit schriftlosen Stufe der Entwicklung über Jahrtausende hinweg in naturhafter Gebundenheit verbracht. Der jagende und sammelnde, durch die Wälder umherstreifende Wildbeuter entspricht diesem Bild. Das zweite Stadium in dieser Konzeption setzt dann mit dem Auftreten der Hochkulturen im 4. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung an und dauert schließlich unter Einbeziehung des Mittelalters und der Frühen Neuzeit bis ins 18. Jahrhundert an. Die danach seit dem späten 18. Jahrhundert von Europa ausgehenden wissenschaftlich-technischen, ökonomischen und politisch-sozialen Revolutionen haben endlich die dritte Weltepoche unserer neuesten Zeit, in der wir uns - global gesehen - immer noch befinden, eingeleitet. Aus dieser Makroperspektive nimmt die „Industrielle Revolution“ unabhängig vom konkreten Entwicklungstempo in ihrer Relevanz und Bedeutung für die gesamte Geschichte der Menschheit eher den ihr zukommenden Stellenwert ein. Selbst und gerade dann, wenn es um die von ihr ausgelösten zerstörerischen Auswirkungen für die Umwelt geht.
1. Textilfabrik Cromford, Ratingen.
Fabrik, Manufaktur und Verlag
Als typischer Ort der neuen maschinengestützten Arbeitsweise entsteht die Fabrik. In ihr werden zentralisiert in einer unterschiedlichen Anzahl von arbeitsteiligen Produktionsprozessen von freien Lohnarbeitern unter der Oberleitung eines Unternehmers auf neuartige Weise Erzeugnisse hergestellt, die sich auf regionalen und überregionalen Märkten, in der Absicht Gewinne zu erzielen, vertreiben lassen.
Noch zu Zeiten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ist im Jahr 1784 von dem Pionier Johann Gottfried Brügelmann im südlich des Ruhrgebiets gelegenen Städtchen Ratingen die erste Betriebstätte dieser Art hierzulande errichtet worden. Die Namensbezeichnung „Cromford“ (s. Abb. 1) verweist dabei auf Verbindungen in den englischen Sprachraum.
In der dogmatischen Sichtweise von Karl Marx hätte sich „Cromford“ innerhalb der von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum letzten Drittel des 18. Jahrhunderts dauernden Manufakturepoche aus der vorgezeichneten Stufenfolge Manufaktur>Fabrik entwickeln müssen. Sehr viel differenzierter hat hingegen der Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler in seiner „Deutsche(n) Gesellschaftsgeschichte 1700-1815“ die Genese der Fabrik erklärt: Fünf Ursprungsformen der modernen Fabrik müsse man Wehler zufolge dabei unterscheiden: Erstens: Neben dem großen Handwerksbetrieb des Zunftmeisters (für Papiererzeugung, Buchdruck, Optikwaren, Porzellan, Möbel, Maschinenbau) habe zweitens die unzünftige mechanische Werkstatt (z. B. als Gießerei oder Eisenhütte) existiert. Drittens: Neben dem Verlagsbetrieb als Endstation dezentralisierter Produktionsabläufe habe es viertens die Manufaktur als zentralisierte Werkstätte (für Woll-, Baumwoll-, Seidenherstellung, Kattundruck, Waffen, Messer, Kutschen) gegeben. Und fünftens sei zu diesen Varianten die frühe Fabrik selbst als jüngster, unmittelbarer Vorläufer des entwickelten Industrieunternehmens getreten. Dabei hätten diese Betriebe oft genug gleichzeitig nebeneinander bestanden, da die Entwicklung des gewerblichen Großbetriebs auf mehreren Gleisen parallel verlaufen sei. Jede der fünf Ursprungsformen trug das Potenzial in sich, dass aus ihnen heraus die entscheidenden Schritte zur modernen Fabrik unternommen wurden.
Regionale Entwicklungen
Auch nach Gründung des Kaiserreichs 1871 gab es Gegenden, die von der Industrialisierung weitestgehend unberührt geblieben sind wie etwa Schleswig-Holstein, Mecklenburg oder Ostpreußen. Andererseits hat die neuartige, auf einer Vielzahl technischer Erfindungen beruhende industrielle Veränderung in bestimmten Regionen besonders intensiv Einzug gehalten. Dies gilt etwa für das Königreich Sachsen bereits für das erste Drittel des 19. Jahrhunderts und natürlich für das teilweise der Rheinprovinz und teilweise Westfalen zugehörige Ruhrgebiet, das im Zuge der territorialen Neuordnung nach dem Wiener Kongress 1814/15 Preußen zugeschlagen worden ist.
Ein stetig zunehmendes Bevölkerungswachstum ist ein Kennzeichen jener Zeit. Für Deutschland insgesamt um das Jahr 1700 sind rund 16 Millionen Einwohner festgestellt worden, einhundert Jahre später sind es um das Jahr 1800 bereits ca. 24,5 Millionen Menschen (s. S. 16f.) gewesen. Für die bereits erwähnte Region Ostpreußen ergibt sich in demselben Zeitraum durch Zunahme von 400.00 auf 931.000 Einwohner mehr als eine Verdoppelung.
2. A. von Menzel, Eisenwalzwerk, 1875.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts gewinnt der demographische Wandel zusehends an so bisher nicht gekannter Dynamik. Wie immer in der Geschichte ist Auswanderung eine unmittelbar naheliegende mögliche Antwort auf derartige Herausforderungen gewesen. Waren zwischen 1820 und 1830 jährlich 3000 bis 5000 Personen als Emigranten zu verzeichnen, so stieg die Zahl dieses Personenkreises nach der schwerwiegenden Agrarkrise von 1847 auf 80.000 an.
Um die alternative Antwort seitens der ländlichen Bevölkerung im Sinne einer Binnenwanderung in wirtschaftlich chancenreichere Gegenden überhaupt erwägen zu können - Freizügigkeit für Arbeitnehmer wie heute in der Europäischen Union war unbekannt -, bedurfte es zunächst weitreichender gesellschaftspolitischer Maßnahmen. Sie haben ihren anerkannten Ausdruck in dem Reformwerk des seit den Tagen Friedrichs des Großen in preußischen Staatsdiensten stehenden Freiherrn vom Stein gefunden, in dessen Zeit als Minister vom September 1807 bis zum Tag seiner Entlassung am 24. November 1808 eine Reihe modernisierender Verordnungen ins Werk gesetzt worden sind. In diesem Zusammenhang ist vor allem das die Sozialstruktur des flachen Landes entscheidend verändernde „Edikt, den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums sowie die persönlichen Verhältnisse der Landbewohner betreffend“ vom 9. Oktober 1807 zu nennen. Es gipfelte in der mit jahrhundertealten Gewohnheiten brechenden Feststellung: „Mit dem Martinitag eintausendachthundertzehn hört alle Gutsuntertänigkeit in unseren sämtlichen Staaten auf. Nach dem Martinitag 1810 gibt es nur noch freie Leute.“ Der wackere, vom französischen Kaiser Napoleon
I. geächtete und zum Staatsfeind erklärte Freiherr und seine Mitstreiter wollten mit Maßnahmen wie dieser den Aufstieg eines selbständigeren, freien Bauerntums ermöglichen und die bis dahin immer noch bestehenden Relikte des Feudalstaates endlich beseitigen. Denn die Bauern in Ostelbien waren in aller Regel nicht Eigentümer der von ihnen bewohnten Höfe, sondern sie waren lediglich verfügungsberechtigt. Im Gegenzug waren sie ihren Gutsherren dienst- und steuerpflichtig. Als wichtigste Einzelmaßnahmen in diesem Kontext hat der Historiker Hans-Joachim Schoeps die Aufhebung der Erbuntertänigkeit, die Freiheit vom Gesindedienst, das Recht des Abzugs von der Scholle sowie die Freiheit des Güterverkehrs, das heißt, dass Adelsgüter nunmehr auch von mit der dafür notwendigen Finanzkraft ausgestatteten Bürgerlichen erworben werden konnten, hervorgehoben.
Das bedeutete natürlich nicht das Ende der Existenz der ostelbischen Rittergüter und des dort beheimateten, heute durchweg negativ konnotierten Typus des Junkers. Wie er uns später im Buch in Person des jungen ungestümen Bismarck wiederbegegnen wird (s. S. 224ff.) Wer aber wollte, der konnte ab jetzt in den allmählich aufstrebenden, mehr industriell geprägten Regionen des Westens, etwa im Ruhrgebiet, versuchen, sein gedeihliches Auskommen als Fabrikarbeiter zu finden. Die Arbeit an sich war schließlich hinreichend schwer und gefahrenvoll genug. Lärm und Schmutz dominierten den grauen Alltag, Arbeitsschutz galt vielen als Fremdwort.
Den Unternehmern stand andererseits nunmehr ein erheblich vergrößerter Pool an Arbeitskräften zur Verfügung, - um 1800 wies das traditionelle Handwerk mehr als 1,2 Millionen Beschäftigte auf, in der Landwirtschaft waren jedoch zwischen 60 und 62 Prozent aller Beschäftigten tätig - die kaum Bedingungen stellen und mit Minimallöhnen abgespeist werden konnten. Die Arbeiterklasse musste ihr Bewusstsein erst noch entwickeln. Für ihre Angehörigen waren nicht mehr die Agrarkrisen alten Typs, sondern konjunkturelle Zyklen wie sie sich in den 1870er Jahren in der Abfolge Gründerboom und Gründerkrach (s. S. 263 – 271) dann Bahn brachen daseins- und existenzbestimmend geworden.
b.) Aufstieg der Naturwissenschaften
Ein neues Weltbild
350 Jahre waren vergangen, als der rechte Zeitpunkt gekommen schien, nach sorgfältigen Vorarbeiten eine Entschuldigung auszusprechen. Das Oberhaupt der römischkatholischen Kirche, Papst Johannes Paul II., drückte im Oktober 1992 im Rahmen einer historischen Wiedergutmachungsrede sein Bedauern darüber aus, dass der toskanische Naturforscher Galileo Galilei durch die römische Inquisition in mehrere Gerichtsprozesse verstrickt worden war. Als "tragisches gegenseitiges Unverständnis" bezeichnete der Nachfolger Petri die Verurteilung des gebürtigen Pisaners, der gleichwohl nicht frei von Mitschuld gewesen wäre, da er sich geweigert habe, seine 1633 noch nicht bewiesenen wissenschaftlichen Theorien lediglich als Hypothesen zu vertreten.
Ganze 200 Jahre hat es die Arbeit "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano" in das Verzeichnis der verbotenen Bücher geschafft. Dort, auf dem berüchtigten "Index librorum prohibitorum", befand es sich von 1634 bis 1835. Man könnte sagen: Es befand sich in guter Gesellschaft. Denn schließlich ist das epochale astronomische Hauptwerk "De revolutionibus orbium coelestium" von Nikolaus Kopernikus aus dem Jahr 1543, dessen neuartige Sichtweise Galilei zu ausgiebigen Himmelsbeobachtungen mit dem Teleskop angeregt hat, ebenfalls hier gelandet. Aufgrund welchen Vergehens?
Es war das von Kopernikus als erstem nach Aristarch von Samos und Seleukos von Seleukia vertretene neue Weltbild, das mit der traditionellen Anschauung brach, die ruhende Erde befinde sich im Zentrum des Universums, das weder die Römische Kurie noch die seit Luther sich formierenden verschiedenen evangelischen Kirchen lange nicht akzeptieren konnten und wollten. Statt des seit Urzeiten gültigen aristotelisch-ptolemäischen geozentrischen Weltbildes sollte nun nach den Vorstellungen einiger weniger exzentrischer Forscher und Gelehrter alles anders sein. Die Sonne als Mittelpunkt des Universums! Und die Planeten einschließlich der sich um sich selbst drehenden Erde auf elliptischen Umlaufbahnen um die Sonne, wenn man den Berechnungen Johannes Keplers aus dem Jahr 1609 auf der Grundlage der vom dänischen Astronomen Tycho Brahe zur Verfügung gestellten Daten bereitwillig folgte. Was ergab sich daraus für die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft der Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis am Anfang des Alten Testaments? Danach hat Gott am vierten Tag die Sonne, den Mond und alle Sterne gemacht, sie an das Himmelsgewölbe gesetzt, damit sie der Erde Licht geben. Das geozentrische Weltbild war damit in Übereinstimmung zu bringen, das neue heliozentrische, das kopernikanische Weltbild im Grunde nicht mehr. Das war der scharfe Konflikt, der sich seit der frühen Neuzeit zwischen der alle menschlichen Lebensbereiche dominierenden Theologie und einer den Kinderschuhen noch nicht entwachsenen Naturwissenschaft entspann, und der im Extremfall mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen enden konnte, wie bei dem aufmüpfigen italienischen Gelehrten Giordano Bruno im Jahr 1600 geschehen. Die diesem Konflikt innewohnenden Widersprüchlichkeiten führten schließlich im
19. Jahrhundert zu einer an Geschwindigkeit zunehmenden Entchristianisierung der Welt, ein bis in unsere Gegenwart nicht endender Prozess.
Im 19. Jahrhundert und darüber hinaus
Während in den Anfangsjahren von Astronomie und Physik verstreut über den europäischen Kontinent geniale Einzelkönner Bahnbrechendes zu leisten vermochten, steht das 19. Jahrhundert für eine umfassende Ausweitung und systematische Institutionalisierung der Naturwissenschaften. Chemie, Biologie und Geowissenschaften, zu denen etwa Geologie oder Meteorologie zählen, kommen eigentlich erst jetzt dazu. Beobachten, Messen und Analysieren des Verhaltens oder von Zuständen der Natur mit Methoden, die im Idealfall beliebig wiederholbar sind und trotzdem zu demselben Ergebnis führen, dem einer erkennbaren Regelmäßigkeit, das unterscheidet die jungen Natur- von den bereits seit alters her etablierten Geisteswissenschaften. Beschreibung und Deutung der Welt allein aus dem Geist des Christentums heraus entgleiten den religiösen Instanzen mit zunehmender Rationalisierung jedoch nach und nach immer mehr, so dass der Soziologe Max Weber ganz am Ende des „langen“ 19. Jahrhunderts von einer "Entzauberung der Welt" gesprochen hat. In seinem Aufsatz "Wissenschaft als Beruf" aus dem Jahr 1919 heißt es: "Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon oder den Glauben daran: dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge - im Prinzip - durch Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet: die Entzauberung der Welt. Nicht mehr, wie der Wilde, für den es solche Mächte gab, muss man zu magischen Mitteln greifen, um die Geister zu beherrschen oder zu erbitten. Sondern technische Mittel und Berechnung leisten das. Dies vor allem bedeutet die Intellektualisierung als solche." Webers Weitsicht, die sich keineswegs von den Segnungen des seinerzeitigen wissenschaftlich-technischen Fortschritts blenden ließ, wird an anderer Stelle dieses Textes deutlich: "Alle Naturwissenschaften geben uns Antwort auf die Frage: Was sollen wir tun, wenn wir das Leben technisch beherrschen wollen? Ob wir es aber technisch beherrschen sollen und wollen, und ob das letztlich eigentlich Sinn hat: - das lassen sie ganz dahingestellt oder setzen es für ihre Zwecke voraus." Der weitere Verlauf des 20. und 21. Jahrhunderts und die militärische wie die zivile Nutzung von Erkenntnissen der Atomphysik und ihre in Hiroshima, Nagasaki und Tschernobyl bzw. Fukushima zu besichtigenden Folgen führen einen am Ende des Tages wohl oder übel zu dem einschränkenden Ergebnis, dass nicht alles das, was naturwissenschaftlich prinzipiell richtig erkannt wird und dessen technische Umsetzung in Apparate und Anlagen anschließend gelingen mag, ethisch und moralisch gerechtfertigt und wünschenswert ist. In Ansätzen hat der Atomphysiker Julius Robert Oppenheimer, wissenschaftlicher Leiter des mit der Entwicklung der Atombombe betrauten Manhattan-Projekts, diesen Standpunkt mutmaßlich geteilt, seine ablehnende Haltung zum Thema der noch zerstörerischen Wasserstoffbombe spricht jedenfalls dafür. Doch kehren wir nun zurück ins Jahr 1818!
Universitätsgründungen im Geiste Wilhelm von Humboldts
Die Anzahl wichtiger naturwissenschaftlicher Entdeckungen war ganz zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Frankreich und Großbritannien sehr viel größer als auf dem Territorium des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, so umständlich wurde damals das Gebiet des heutigen Deutschland bezeichnet. Erst die unter dem Eindruck der Expansionsbestrebungen Napoleons erfolgende Niederlegung der Kaiserkrone durch Kaiser Franz II. im August 1806 hat dem offensichtlichen Anachronismus ein Ende bereitet.
Der Wissenschaftssoziologe Joseph Ben-David hat den Anteil der Franzosen und Engländer an Entdeckungen in Wärme-, Elektrizitäts- und Magnetismuslehre sowie in der Optik im Zeitraum von 1806 bis 1815 mit 75 beziffert,