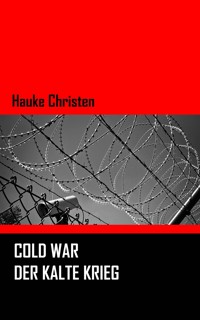
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als vor dreißig Jahren das Ende der Sowjetunion kam, war plötzlich auch der Kalte Krieg vorbei. Der Eiserne Vorhang, der sich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg mitten durch Europa abgesenkt hatte, hob sich zur Freude aller in Ost und West Lebenden ganz unversehens. Welche historisch-politischen Ereignisse und Themen in den Jahren zwischen 1947 und 1991 für die Menschen von grundlegender Bedeutung waren, davon berichtet dieses eBook in Form von chronologisch geordneten Aufsätzen. Die seit einigen Jahren zusehends intensiver geführte Debatte, ob denn ein Neuer Kalter Krieg bevorsteht, möglicherweise bereits stattfindet, wird vom Autor nicht ausgeblendet, sondern in den drei abschließenden Kapiteln eingehend beleuchtet. Als neuer Gegenspieler der arrivierten Weltmacht USA tritt die aufstrebende fernöstliche Großmacht China immer deutlicher hervor. Schnappt die Thukydides-Falle etwa zu?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hauke Christen
Cold War - Der Kalte Krieg
Ausgewählte Aufsätze
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Beginn des Kalten Krieges
Über die Staatssicherheit der DDR
Neues Geld!
Das Aufbegehren
Bundeskanzler Konrad Adenauer
Mythos Kennedy
Wettlauf in den Weltraum
Der Kalte Krieg in 5 Filmen
Südostasiatisches Dilemma
Eine Buchkritik
Eine neue Medienlandschaft und ein neuer Kunststil entstehen
Der britische Geheimdienst MI 5 im Kalten Krieg
Ausbreitung des Neoliberalismus seit den späten 1970ern
Auf dem Weg zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten
Die Sowjetunion zerfällt und der Kalte Krieg endet
Neuer Kalter Krieg und Thukydides-Falle
China in Vergangenheit und Gegenwart
Seidenstraße
Auswahlbibliografie und Bildnachweis
Impressum
Vorwort
Der Konfrontationskurs auf dem sich die Vereinigten Staaten von Amerika und die Volksrepublik China seit einer Reihe von Jahren befinden, wird von manchen Experten als Neuer Kalter Krieg bezeichnet. Die Errichtung von Handelshindernissen und die Erhebung zusätzlicher Importzölle sind offensichtliche Anzeichen einer sich verschärfenden Tonlage. Droht Deutschland als europäische Mittelmacht hier etwa zwischen die Fronten zu geraten? Sollte die hiesige Politik sich noch klarer positionieren oder liegen die besten Erfolgsaussichten gerade darin, ein gutes Einvernehmen zu beiden Wettbewerbern um den Status der führenden globalen Supermacht des 21. Jahrhunderts zu pflegen?
Niemand wird einfache Antworten auf die hier gestellten Fragen geben können. Auch die zukünftige Entwicklung ist nicht seriös prognostizierbar. Als Leitfaden zur Orientierung wie mit zwei konkurrierenden Supermächten im Sinne eines gedeihlichen Miteinander umzugehen ist, können jedoch die Erfahrungen herangezogen werden, die während des vor drei Jahrzehnten zu Ende gegangenen Kalten Krieges gemacht worden sind. Das seinerzeit in Ost und West geteilte Deutschland war neben den beiden Koreas einer der globalen Frontstaaten schlechthin und im Ergebnis durchaus imstande gewesen, seine berechtigten Interessen zielführend zu vertreten.
Verzagtheit war indessen noch nie ein guter Ratgeber, wird es auch zukünftig nicht sein. Die hier vorgelegte Sammlung von Aufsätzen möchte daher näherbringen und verdeutlichen, worum es im Kalten Krieg ging. Was waren die Herausforderungen und wie hat man sie bewältigt?
Auch die umgangssprachlich mit dem Gleichgewicht des Schreckens identifizierte MAD-Doktrin, in der eine Nuklearmacht vom Ersteinsatz von Nuklearwaffen dadurch abgehalten wird, dass der angegriffene Staat über die Fähigkeit zum vernichtenden Zurückschlagen verfügt, ist mit der Auflösung der Sowjetunion 1991 nicht in der Mottenkiste der Geschichte verschwunden. Sie genießt zwar derzeit keinerlei militärstrategische Priorität mehr, sie könnte aber unter veränderten Vorzeichen bei weiterer Eskalation wieder aktiviert werden.
Die Diskussion atomarer Kapazitäten und von Erst- und Zweitschlagsfähigkeiten führt indes dorthin zurück, wo alles anfing, an den Beginn des Kalten Krieges.
Beginn des Kalten Krieges
Als die Kriegsgegner nicht mehr da waren, gelangte eine ungewöhnliche Allianz, die sich angesichts der vorhandenen Bedrohung notgedrungen zusammengefunden hatte, rasch an ihr Ende. Ihre Existenz war ohnehin allein den gemeinsamen Feinden geschuldet: Nachdem Italien 1943 die Achse verlassen hatte, waren die bedingungslose Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands und des japanischen Kaiserreichs das verabredete Ziel.
Die USA hatten ihre eindrucksvolle und allen anderen überlegene ökonomische Leistungsfähigkeit durch Hilfslieferungen von Waffen, Ausrüstung und Nahrungsmitteln im Rahmen des Land-Lease Act an die mit ihnen verbündeten Großmächte Großbritannien samt seinem Empire und die Sowjetunion hinreichend unter Beweis gestellt. Der technologische Vorsprung schien durch die Abwürfe der Atombomben Little Boy und Fat Man und die von ihnen ausgelöste apokalyptische Zerstörung der japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 auf lange Zeit unangefochten gesichert. Doch noch bevor der ehemalige Priesterseminarist und seinerzeitige Diktator Stalin seinen siebzigsten Geburtstag feierlich begehen konnte - der 21. Dezember 1949 war als Planungsziel ausgegeben worden - wurde die erste sowjetische Atombombe namens Tatjana am 29. August 1949 gezündet.
Atomares Wettrüsten und Gleichgewicht des Schreckens waren seitdem Themen, die für mehr als vier Jahrzehnte die Menschheit fast pausenlos in Atem hielten. Welche Vorstellungen und Ideen aber waren für die Anfangszeit dieses global ausgetragenen Konflikts maßgeblich, der überraschenderweise von dem US-Historiker John Lewis Gaddis in den späten 1980er Jahren als langer Frieden bezeichnet worden ist? Was waren die in eine bipolare Weltordnung zweier so verschiedener Systeme, beide von der unbedingten Richtigkeit des jeweils favorisierten eigenen Gesellschaftsmodells überzeugt, einmündenden Grundgedanken?
Wo Zweifel und Misstrauen gedeihen
Trotz empfangener Hilfslieferungen blickte Stalin schon während des in seiner Heimat noch heute so bezeichneten Großen Vaterländischen Krieges stets mit Misstrauen auf die kapitalistischen Bündnispartner im Westen. Schließlich hatte er seit 1941 immer wieder und nicht erst seit der Konferenz von Teheran im November/Dezember 1943 die Errichtung einer zweiten Front in Kontinentaleuropa zur Entlastung der Roten Armee gefordert. Die im Juli 1943 mit der Operation Husky in Sizilien eingeleitete Rückeroberung Italiens war sicherlich sehr willkommen, erschien Moskau aber nicht hinreichend zu sein. Letztlich musste man sich bis zum D-Day in der Normandie am 6. Juni 1944 gedulden.
Ein Blick auf das Verhältnis der Opferzahlen - hinter jeder einzelnen verbirgt sich ein bedauernswertes menschliches Schicksal - gibt einen ernstzunehmenden Hinweis auf die Einstellung der Sowjets nach Kriegsende. Während Großbritannien und die USA jeweils mehr als 300.000 militärische und zivile Opfer zu beklagen hatten, waren es in der UdSSR bis zu neunzigmal mehr. Daraus resultierte die Vorstellung, dieser schier unvorstellbare Blutzoll müsse irgendwie kompensiert werden, und zwar durch Forderungen nach Reparationen, territorialen Verschiebungen nach Westen zugunsten der Sowjetunion und der Erweiterung der eigenen Einflusssphäre in Osteuropa, einer Region der zugleich die Funktion eines Sicherheitsgürtels zukommen sollte.
Hier vor Ort sah der britische Premier Churchill in seiner berühmt gewordenen Metapher einen „eisernen Vorhang“ niedergehen, wie er in einem Telegramm an den gerade erst einen Monat im Amt befindlichen US-Präsidenten Harry S. Truman am 12. Mai 1945 mitteilte. Was hinter dem eisernen Vorhang vor sich gehe, wisse man nicht und es sei kaum zu bezweifeln, dass der gesamte Raum östlich der Linie Lübeck-Triest-Korfu bald völlig in sowjetischer Hand sein werde. Die Befürchtungen des alten konservativen Haudegens sollten sich bewahrheiten, wenn auch er selbst Downing Street zwei Monate später verlassen musste, um seinem Amtsnachfolger Clement Attlee von der Labour Party Platz zu machen.
Internationale Konflikte wie der ab Juni 1950 ausgetragene Koreakrieg oder auch die ab Juni 1948 in die Wege geleitete Blockade von Berlin lagen da noch in der Zukunft, doch schon in den Jahren zuvor waren die globalen außenpolitischen Spannungen mit Händen zu greifen. Ihren sichtbarsten Ausdruck haben sie im seit März 1946 ausgefochtenen griechischen Bürgerkrieg, bei weitem keine nur innere Angelegenheit, und der seit Dezember 1945 ihrem Siedepunkt entgegenstrebenden Irankrise gefunden. Wie so oft im Nahen und Mittleren Osten ging es auch in diesem Fall um die im Erdinneren schlummernden Vorräte an Erdöl und die Sicherung entsprechender Zugriffsrechte.
George F. Kennans „langes Telegramm“
In dieser Situation erreichte den 1904 in Milwaukee, Wisconsin, geborenen Diplomaten George Frost Kennan, Mitarbeiter in der zivilen Abteilung der US-Botschaft in Moskau, eine Anfrage seines heimischen Finanzministeriums. Dort mochte man in Erfahrung bringen, warum die Sowjets offensichtlich nicht dazu bereit seien, der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds angehören zu wollen. Die Antwort des versierten Osteuropaexperten, der auch einige Zeit in Deutschland verbracht hatte und hier mit dem literarischen Werk Goethes und der Geschichtsphilosophie Oswald Spenglers Vertrautheit erlangte, ist das „lange Telegramm" vom 22. Februar 1946, eine rund 5500 Worte umfassende Ausarbeitung. Gegliedert in fünf Abschnitte geht es darin inhaltlich zunächst um die Grundzüge sowjetischen Verhaltens seit Kriegsende und deren Voraussetzungen bzw. Hintergründe. Der dritte und vierte Abschnitt beschäftigen sich mit der Umwandlung dieses Verhaltens in offizielle und inoffizielle Politik, bevor abschließend die Bedeutung all der Dinge für die amerikanische Politik erörtert wird. Um der damaligen Atmosphäre möglichst unverfälscht und authentisch nahe zu kommen, gebe ich „Part 5 (Practical deductions from Standpoint of US Policy)“ nachfolgend auszugsweise in der Originalsprache wider.
„In summary, we have here a political force committed fanatically to the belief, that with US can be no permanent modus vivendi, that it is desirable and necessary, that the internal harmony of our society be disrupted, our traditional way of life be destroyed, the international authority of our state be broken, if Soviet power is to be secure. This political force has complete power of disposition over energies of one of world's greatest peoples and resources of world's richest national territory, and is borne along by deep and powerful currents of Russian nationalism. In addition, it has an elaborate and far-flung apparatus for exertion of its influence in other countries, an apparatus of amazing flexibility and versatility, managed by people whose experience and skill in underground methods are presumably without parallel in history. Finally, it is seemingly inaccessible to considerations of reality in its basic reactions. For it, the vast fund of objective fact about human society is not, as with us, the measure against which outlook is constantly being tested and re-formed, but a grab bag from which individual items are selected arbitrarily and tendenciously to bolster an outlook already preconceived. This is admittedly not a pleasant picture. Problem of how to cope with this force is undoubtedly greatest task our diplomacy has ever faced and probably greatest it will ever have to face. It should be point of departure from which our political general staff work at present juncture should proceed. It should be approached with same thoroughness and care as solution of major strategic problem in war and, if necessary, with no smaller outlay in planning effort. I cannot attempt to suggest all answers here. But I would like to record my conviction that problem is within our power to solve - and that without recourse to any military conflict. And in support of this conviction there are certain observations for a more encouraging nature I should like to make. (…)“
Wenig später wurde George Kennan zum Chef des im Washingtoner Außenministerium angesiedelten Planungsstabes ernannt. In dieser angesehenen Funktion ist er unter anderem mit dem auch als Marshallplan bekannten Plan zum Wiederaufbau Europas beschäftigt gewesen. Darüber hinaus wurde er als Autor eines eminent wichtigen Artikels in der Juliausgabe 1947 der Zeitschrift Foreign Affairs identifiziert, der unter dem Pseudonym „X“ veröffentlicht worden ist. „The Sources of Soviet Conduct“ oder kurz „X-Artikel“ genannt, gilt als ideologischer Meilenstein des Kalten Krieges, der wesentliche Aspekte der sich entwickelnden US-Strategie des „Containment“ (Eindämmung) zusammenfasst und einem breiteren Publikum aufgezeigt hat. Wiederum im Original ist hier zu lesen: „This would of itself warrant the United States entering with reasonable confidence upon a policy of firm containment, designed to confront the Russians with unalterable counter-force at every point where they show signs of encroaching upon the interests of a peaceful and stable world.“
Truman-Doktrin
Ohne Übertreibung kann man davon sprechen, dass die Geburtsstunde der Containment-Politik und damit die Abkehr von isolationistischen Bestrebungen auf der Basis der Vorstellungen George Kennans stattgefunden hat. Am 12. März 1947 hat Präsident Truman persönlich in einer Rede vor beiden Häusern des Kongresses von einer Zweiteilung der Welt in eine freie und eine totalitäre Sphäre gesprochen und die Eindämmungsstrategie damit zum ersten Mal offiziell vorgestellt. Er wolle den freien Völkern beistehen und jedwede Art kommunistischer Expansion verhindern. Auszugsweise heißt es:
„In der aktuellen weltgeschichtlichen Situation ist es die Aufgabe beinahe jeder Nation, zwischen unterschiedlichen Lebensformen wählen zu müssen. Diese Auswahl ist häufig nicht frei. Die eine der beiden Lebensformen basiert auf dem Willen der Majorität und ist charakterisiert durch freie Institutionen, eine repräsentative Regierungsform, freie Wahlen, Garantien für die persönliche Freiheit, Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit vor politischer Verfolgung. Die andere Lebensform basiert auf dem Willen einer Minorität, den diese der Mehrheit zu oktroyieren versucht. Sie stützt sich dabei auf die Mittel von Terror und Unterdrückung, auf die Zensur von Presse und Rundfunk, auf manipulierte Wahlen und auf den Entzug der persönlichen Freiheiten. Ich bin der Meinung, es hat die Politik der Vereinigten Staaten zu sein, freien Völkern beizustehen, die sich der angestrebten Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch Druck von außen widersetzen. Ich glaube, es ist unsere Pflicht allen freien Völkern zu helfen, damit sie ihr Dasein auf ihre Weise selbst bestimmen können. Unter einem solchen Beistand verstehe ich vor allem wirtschaftliche und finanzielle Hilfe, die die Grundlage für ökonomische Stabilität und solide politische Verhältnisse bildet. Die Welt ist nicht statisch, und der Status quo ist nicht sakrosankt. Aber wir können keine Veränderungen des Status quo dulden, die durch Zwangsmethoden oder mit Heimlichtuereien wie die der politischen Infiltration unter Verletzung der Charta der Vereinten Nationen durchgeführt werden. Wenn sie freie und unabhängige Nationen dabei unterstützen, ihre Freiheit zu sichern, realisieren die Vereinigten Staaten die Prinzipien der Vereinten Nationen. Die freien Völker der Welt rechnen auf unsere Hilfe in ihrem jeweiligen eigenen Kampf um die Freiheit. Wenn wir in unserer Führungsrolle wanken und zögern, gefährden wir den Frieden der Welt - und wir beschädigen sehr wahrscheinlich die Wohlfahrt unserer eigenen Nation."
Gemeinsam mit der von dem republikanischen Außenpolitikexperten John Foster Dulles 1947 entwickelten und mehr offensiv ausgerichteten Konzeption der „Liberation Policy“ waren die theoretischen Grundpfeiler in der Auseinandersetzung westlicher Demokratien mit dem Kommunismus errichtet. Sie sind naturgemäß von den Führungspersönlichkeiten im Kreml aufmerksam zur Kenntnis genommen worden und sollten im Kern bis zum Ende des Kalten Krieges Bestand haben.
Andrei Schdanows Zwei-Lager-Theorie
Ein halbes Jahr nach Trumans Rede legte das Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) Andrei Alexandrowitsch Schdanow, ein enger Vertrauter Stalins, nach, um Moskaus Standpunkt zu verdeutlichen. Auf der Gründungsversammlung der Kominform, dem Kommunistischen Informationsbüro, das als Nachfolgeorganisation der 1943 aufgelösten Komintern ins Leben gerufen worden ist, hat Schdanow am 30. September 1947 seine Rede zur Zwei-Lager-Theorie gehalten. Darin wurden die USA und ihre Verbündeten als Imperialisten und Kriegstreiber gebrandmarkt und der ökonomische und humanitäre Hilfe nach Europa bringende Marshallplan als Ausdruck imperialistischer Expansion und Versklavung Europas gewertet. Darüber hinaus wurde von Schdanow festgestellt und anerkannt, dass die Welt in ein imperialistisches, antidemokratisches Lager und ein antiimperialistisches, demokratisches Lager zweigeteilt sei.
Wer wo zu verorten war, an der Beantwortung dieser Frage schieden sich für die kommenden vier Jahrzehnte die Geister!
Über die Staatssicherheit der DDR
Ungerührt oder indifferent haben sich ihr gegenüber wohl nur die wenigsten verhalten. Der als Stasi bekannten Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik ist man in den allermeisten Fällen entweder mit entschiedener Ablehnung oder mit Wohlwollen begegnet. Wer dort Familienangehörige, Verwandte oder Freunde als hauptamtlich Beschäftigte untergebracht wusste, wird naturgemäß eine andere Einstellung an den Tag gelegt haben als diejenigen, die als Verdächtige in die Fänge des allgegenwärtigen Überwachungsapparates geraten sind.
Dabei haben Staaten in Vergangenheit und Gegenwart die Frage, ob sie überhaupt eine Geheimpolizei benötigen unterschiedlich beantwortet. In der Bundesrepublik Deutschland von heute wird peinlich genau darauf geachtet, dass nachrichtendienstliche und polizeiliche Aufgabenbereiche strikt voneinander getrennt sind. Die Auslandsaufklärung ist dabei dem Bundesnachrichtendienst (BND) zugeordnet, während die Spionageabwehr im Inneren Sache des Verfassungsschutzes ist. Polizeiarbeit ist ganz im Zeichen des Föderalismus Angelegenheit der einzelnen Bundesländer, sofern nicht die Zuständigkeiten des in Wiesbaden ansässigen Bundeskriminalamtes (BKA) oder der aus dem Bundesgrenzschutz (BGS) hervorgegangenen Bundespolizei berührt werden. Das in derartigen Sachverhalten juristisch maßgebliche Bundesverfassungsgericht hat dazu mehrfach ausgeführt, dass sich das Trennungsgebot aus dem Grundgesetz herleiten lässt. Eine uneingeschränkte Weitergabe von Informationen zwischen Nachrichtendiensten und Polizeibehörden ist somit rechtlich unzulässig.
Dasselbe Land, eine andere Zeit. Im nationalsozialistischen Deutschland ist mit der Gründung des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) im September 1939 durch Zusammenlegung von gemeinsam zur Sicherheitspolizei gehörender Kriminalpolizei und Geheimer Staatspolizei (Gestapo) sowie dem Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (SD) eine Organisationsstruktur geschaffen worden, in der ganz gezielt polizeiliche und nachrichtendienstliche Tätigkeitsbereiche zusammengeführt worden sind. Während etwa die Auslandsgliederungen des SD für Spionage und verdeckte Operationen zuständig waren, ist es im Inland vorrangig um die Bekämpfung und Verfolgung regimekritischer politischer Gegner wie Kommunisten, Sozialdemokraten, Angehörige von Minderheiten und anderer gegangen. Ähnlich gelagerte Aufgaben sind auch von der berüchtigten Gestapo wahrgenommen worden, die sich bei den von ihr oft aufgrund von Denunziationen Verfolgten wie selbstverständlich des Instruments der unbefristeten Schutzhaft ohne richterliche Überprüfung bedient hat. Physische und psychische Folter waren im Rahmen der verschärften Vernehmung an der Tagesordnung. Die Namen einiger Angehörigen der Dachorganisation RSHA sind dazu geeignet, in einer Horrorshow des Schreckens vordere Plätze einzunehmen: Reinhard Heydrich, Ernst Kaltenbrunner, Werner Best und nicht zuletzt Adolf Eichmann. Die Nürnberger Prozesse haben sowohl SD als auch Gestapo zu verbrecherischen Organisationen erklärt.
Ohne aus den genannten Beispielen Gesetzmäßigkeiten herleiten zu wollen, liegt die begründete Vermutung nahe, liberale Demokratien westlichen Zuschnitts, die sich verfassungskonform alle paar Jahre dem Votum ihrer Bürgerinnen und Bürger in freien Wahlen zu stellen haben, benötigen keinen Repressionsapparat gegenüber ihren eigenen Staatsangehörigen. Für sie stellen geschützte Rechte wie Meinungs-, Presse- oder Versammlungsfreiheit Güter von hohem Wert dar. Anders herum: Wo bewaffnete revolutionäre Gruppierungen die politische Macht erobert haben, in totalitären oder autoritären Staaten, ist eine den eigenen Zwecken oder programmatischen Absichten, die nur vorgeblich mit allgemeinen Interessen oder dem Gemeinwohl übereinstimmen, dienstbare Sicherheitsarchitektur notwendige Voraussetzung für dauerhaften Machterhalt. In diesem Sinne machten sich die Bolschewisten bald nach der Oktoberrevolution 1917 daran, die Außerordentliche Allrussische Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage zu gründen. Als Tscheka ist diese Geheimpolizei bekannt geworden.
"Auferstanden aus Ruinen" - Von der SBZ zur DDR
Die Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) am 8. Februar 1950 ist nur vier Monate nach der Entstehung der Deutschen Demokratischen Republik erfolgt. Gemäß der Logik des Kalten Krieges ist damit die Teilung Deutschlands vorläufig zementiert worden. Im Inneren des Landes östlich der Elbe hatte man sich schon zu Zeiten der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) daran gemacht, die Gesellschaft klassenkämpferisch zu verändern. Der Parole „Junkerland in Bauernhand“ entsprechend hat die Bodenreform vom September 1945 vorgesehen und auch in die Praxis umgesetzt, Großgrundbesitz entschädigungslos zu enteignen und an diejenigen umzuverteilen, die über kein Land verfügten. Erst danach erfolgten schrittweise die freiwillige und zwangsweise Kollektivierung des Landbesitzes.





























