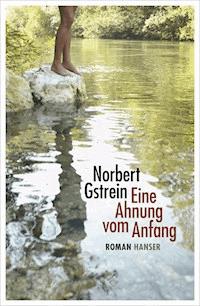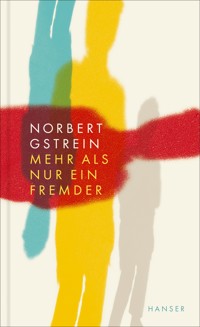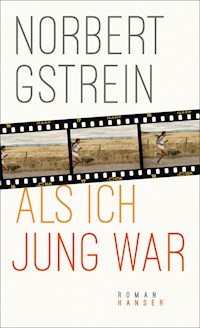
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Norbert Gstrein ist ein Meister des 'zwielichtigen' Erzählens. Er setzt Zeichen um Zeichen. Man folgt seinem Konstrukt und seinem bewundernswert klaren Satzbau mit Spannung." Aus der Jurybegründung zur Verleihung des Österreichischen Buchpreises 2019 Am Anfang ist da nur ein Kuss. Aber gibt es das überhaupt, nur ein Kuss? Franz wächst im hintersten Tirol auf. Er fotografiert Paare "am schönsten Tag ihres Lebens", bis bei einer Hochzeitsfeier die Braut ums Leben kommt. Was hat das mit ihm zu tun? Was damit, dass er nur Wochen zuvor am selben Ort ein Mädchen geküsst hat? Vor diesen Fragen flieht er bis nach Amerika. Doch dann stirbt auch dort jemand: ein Freund, in dessen Leben sich ebenfalls mögliche Gewalt und mögliche Unschuld die Waage halten. Was wissen wir von den anderen? Was von uns selbst? Hungrig nach Leben und sehnsüchtig nach Glück findet sich Franz in Norbert Gstreins Roman auf Wegen, bei denen alle Gewissheiten fraglich werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Am Anfang ist da nur ein Kuss. Aber gibt es das überhaupt, nur ein Kuss? Franz wächst im hintersten Tirol auf. Er fotografiert Paare »am schönsten Tag ihres Lebens«, bis bei einer Hochzeitsfeier die Braut ums Leben kommt. Was hat das mit ihm zu tun? Was damit, dass er nur Wochen zuvor am selben Ort ein Mädchen geküsst hat? Vor diesen Fragen flieht er bis nach Amerika. Doch dann stirbt auch dort jemand: ein Freund, in dessen Leben sich ebenfalls mögliche Gewalt und mögliche Unschuld die Waage halten. Was wissen wir von den anderen? Was von uns selbst? Hungrig nach Leben und sehnsüchtig nach Glück findet sich Franz in Norbert Gstreins Roman auf Wegen, bei denen alle Gewissheiten fraglich werden.
Norbert Gstrein
Als ich jung war
Roman
Carl Hanser Verlag
Inhalt
I DIESE FREUDEN
II DIE NICHT ERZÄHLTE GESCHICHTE
III SARAH FLARER
A lot remained to be explained.
Louis L’Amour
I
DIESE FREUDEN
ERSTES KAPITEL
Nach dem Unglück, das dort vor dreizehn Jahren passiert ist, hätte ich nie gedacht, dass im Schlossrestaurant jemals wieder Hochzeitsfeiern stattfinden würden, und schon gar nicht, dass ausgerechnet mein Bruder sie von neuem anbieten könnte. Bis dahin und noch ein Jahr darüber hinaus, weil so lange der Vertrag lief, war unser Vater der Pächter gewesen. Danach hatte sich über Monate kein Nachfolger gefunden, und dann fand sich einer, der auf eine ganz andere Klientel aus war, eine Pizzeria eröffnete, im Keller eine Kegelbahn einrichtete, zwei Zielscheiben für Darts aufhängte und darauf setzte, dass die Geschichte mit der toten Braut entweder in Vergessenheit geraten oder im Gegenteil sogar eine makabere Attraktion werden würde. Man hatte meinem Bruder gegenüber mehreren Mitbewerbern den Vorzug gegeben, als die Pacht im vergangenen Jahr erneut ausgeschrieben worden war, und er hatte das Restaurant in kürzester Zeit zu seinem früheren Ruf geführt, ja, sich sogar weit über die Region hinaus Anerkennung erkocht, wie es hieß, und wollte deswegen in Zukunft auch wieder an die alte Tradition mit der Heiraterei anschließen.
In meiner Kindheit hatten wir gewöhnlich zwei oder drei Wochen nach Ostern, wenn die Wintersaison vorbei war, unser Hotel in den Bergen verlassen und das Restaurant bezogen, und dann begann es auch schon mit den Hochzeiten, Wochenende für Wochenende, oft zwei, eine am Freitag, eine am Samstag, bis in den September hinein oder gar bis Anfang Oktober. Das Hotel blieb im Sommer geschlossen, unser Vater fuhr alle paar Tage hin, um nach dem Rechten zu sehen, und erst nach Allerheiligen, wenn es oft schon wieder schneite, packten wir unsere Sachen zusammen, verriegelten alles und kehrten nach Hause zurück. Ich war damit aufgewachsen, im Winter das Hotel und die Skischule, im Sommer die Hochzeitsfabrik, wie zuerst unser Vater sie ironisch nannte, wie sie dann aber von allen ernsthaft tituliert wurde, ohne dass dadurch die Anziehungskraft litt. Man heiratete im Schloss, auch wenn es in Wirklichkeit keines war und nur so hieß, man heiratete bei unserem Vater, der diese Position irgendwann ein für alle Mal besetzt hatte. Kaum jemand aus den umliegenden Dörfern schlug sein Angebot aus, aber die Leute kamen auch aus der Stadt, entschieden sich für eine der drei Möglichkeiten, Standard, Medium oder Extraklasse, und ließen sich von unserem Vater beraten, der für alles garantierte, nur nicht für das Glück. Er warb leicht anzüglich damit, dass er den Brautpaaren an ihrem Freudentag abnehmen würde, was er ihnen abnehmen könne, damit sie für das, was er ihnen nicht abnehmen konnte, Kopf und Hände frei hätten. Dazu versprach er ihnen sogar schönes Wetter oder bei Schlechtwetter einen satten Rabatt, und sie wählten ein oder zwei kleine Extravaganzen, die Fahrt in der offenen Kutsche die Serpentinen zu dem kleinen Plateau herauf, von dem sich der sogenannte Schlossberg mit der Burgruine aus dem vierzehnten Jahrhundert erhebt, das Engelsspalier mit dem geflügelten Kinderchor oder den Schleiertanz. Den hatte unser Vater allerdings erst in den allerletzten Jahren angeboten, und es war ein zweifelhaftes Erlebnis, zuzuschauen, wie sich eine Schauspielerin aus dem Landestheater auf dem Boden wand und räkelte, als hätte sie den Verstand verloren.
Ich war fünfzehn, Internatsschüler, und hatte noch kein Mädchen geküsst, als ich bei den Feiern zu fotografieren begann. Zwei Jahre davor hatte mir unser Vater zum Geburtstag eine Kamera geschenkt, und weil er auf alles mit dem Blick des Geschäftsmannes sah und gleichzeitig keinen falschen Respekt vor den falschen Künsten hatte, wie er sagte, wunderte ich mich nicht, dass er irgendwann mit dem Vorschlag kam, wir könnten das Fotografieren inklusive anbieten, das bisschen Knipserei würde ich schon zustande bringen. Zuerst wehrte ich mich, wie ich mich gewehrt hatte, im Hotel beim Servieren zu helfen oder den Skischülern die ersten Schwünge im Schnee vorzuführen, aber wie auch sonst immer entkam ich unserem Vater nicht. Er setzte seinen Willen durch, und ich hatte neben meinen Tätigkeiten als aushilfsweiser Skilehrer und gelegentlicher Kellner zusätzlich die als Hochzeitsfotograf, für die er mich mit einem dunkelblauen Anzug und einer dezent weiß gepunkteten, dunkelblauen Krawatte verkleidete. Damit hätte ich mich auch bei einem Begräbnis nicht schlecht gemacht, und wenn man mich so ausstaffiert sah, konnte man leicht vergessen, dass ich in Wirklichkeit noch zur Schule ging und in den Unterrichtsstunden am Samstag mit dem Schlaf kämpfte, sooft ich am Freitag engagiert gewesen war und unser Vater mich nicht wieder krank melden konnte, weil er es bereits an so vielen Wochenenden davor getan hatte.
Ich besaß eine Leica, alles, was ich über das Fotografieren wusste, hatte ich mir selber beigebracht, und mein Glück am Anfang war, dass die Paare, die ich vor die Kamera bekam, kaum weniger verlegen waren als ich oder vielleicht auch nur abgelenkt und deshalb gar nicht merkten, dass sie es mit einem zitternden Amateur zu tun hatten. Die ersten Aufnahmen machte ich bei ihrer Ankunft, wenn sie aus dem Auto oder aus der Kutsche stiegen und sich umsahen auf dem Vorplatz, hinauf zur Burgruine blickten und hinunter ins Tal, aus dem sie gekommen waren, und ich einen Eindruck von ihnen zu gewinnen versuchte, in meinem Kopf auf ihr Glück oder ihr Unglück setzte. Auf den letzten Bildern, gewöhnlich lange nach Mitternacht, hatten sich meine Ahnungen in der Regel verfestigt oder waren widerlegt worden. Fast alle heirateten auch kirchlich, und die Zeremonie fand in der Kapelle der Barmherzigen Schwestern statt, die nur ein paar Schritte von unserem Restaurant ihr Mutterhaus hatten. Aus dem kleinen, wie ein Kinderspielzeug in der Landschaft stehenden Kirchlein mit dem Schwesternfriedhof rundum, der mit seinen Reih in Reih ausgerichteten Gräbern nicht zufällig einem Soldatenfriedhof glich, traten sie wie geblendet ins Freie. Mein Standardbild in diesem Augenblick ging haarscharf an den Holzkreuzen vorbei, manchmal so knapp, dass ich nachträglich noch Reste wegschneiden musste, und zeigte sie überrascht und mit nackten Gesichtern in ihrer himmlischen Freude. Dann fotografierte ich sie auf der Wiese daneben, und ich musste ihnen nicht sagen, dass sie sich ins Gras setzen könnten, ich fotografierte sie vor dem Brunnen, der zum Kloster gehörte, und sie spritzten sich ohne ein Wort von mir nass, ich fotografierte sie am Waldrand, und am Ende waren die Motive schnell durchdekliniert. Ob sie einander tief in die Augen blickten oder in die Ferne, ob sie sich küssten oder nicht, ob die Braut ein Bein entblößte oder sich mit einer Hand ins Haar fuhr, ob der Bräutigam sie am Arm fasste, ihren Rücken durchbog wie bei einer Tänzerin oder sie gar hochhob, sie verhielten sich brav wie nach einem unveränderlichen Drehbuch und waren schließlich kaum mehr voneinander unterscheidbar.
Obwohl ich allen vorschlug, zur Ruine hinaufzusteigen und in ihrem Gemäuer Bilder zu machen, gingen die wenigsten darauf ein, weil der Aufstieg zu mühsam war und sie nicht das richtige Schuhwerk dafür hatten und unbewusst wohl auch die düstere Atmosphäre fürchteten. Zuerst nur für die Extraklasse, bald aber schon für alle, hatte unser Vater im ersten Stock über dem Restaurant ein Zimmer eingerichtet, in das sie sich zum Entspannen zurückziehen konnten, wenn sie mit mir im Gelände gewesen waren, und es hatte sich eingebürgert, dass ich sie noch einmal fotografierte, sobald sie wieder daraus hervorkamen. Dann versuchte ich an ihren Mienen abzulesen, was ihr Lächeln bedeutete, oder fragte mich, warum sie mir, einem Fünfzehn-, später Sechzehn-, Siebzehnjährigen, so deutlich zu verstehen gaben, was alles sie in der vergangenen halben Stunde hinter der verschlossenen Tür miteinander getan haben könnten.
Es gab eine Stelle, zu der ich sie danach immer führte. Man ging vom Restaurant nur einen schmalen Weg durch den Wald, und dort tat sich noch einmal eine kleine Lichtung auf. Ich stellte sie alle auf den genau gleichen Platz und fotografierte leicht erhöht von einem Baumstumpf, weil dadurch im Hintergrund des Bildes gut sichtbar die Achterschleife erkennbar war, die Fluss und Autobahn weit unten im Tal bildeten und die mein Markenzeichen wurde, ein Blick in die Unendlichkeit. Sie mussten dazu an den Abgrund herantreten, immer noch weit genug weg, dass es gefahrlos war, aber doch so nah, dass ihnen die mögliche Gefahr nicht entging. Dabei verließen sie gleichzeitig die Stille, die im Schatten des Schlossbergs herrschte, und wurden mit einem Schlag vom Lärm der in langen Kolonnen nord- und südwärts ziehenden Sattelzüge erfasst. In diesem Moment konnte ich ganze Romane an ihren Augen ablesen, und fast alle äußerten auch etwas, und wenn es nur die Frage an mich war, ob ich sie am schönsten Tag ihres Lebens umbringen wolle.
Als ich jung war, glaubte ich an fast alles, und später an fast gar nichts mehr, und irgendwann in dieser Zeit dürfte mir der Glaube, dürfte mir das Glauben abhanden gekommen sein. Natürlich war es eine Anmaßung, aber als ich zum ersten Mal von einer Braut dachte, sie müsste eigentlich davonlaufen, wenn sie nur einen Augenblick überlegen würde, war ein Damm gebrochen, und ich konnte bei den vielen folgenden Hochzeiten den Gedanken kaum je wieder verscheuchen. Mit einem Mann an ihrer Seite, und es brauchte gar kein schlimmer Zeitgenosse zu sein, sahen die Frauen gleich viel sterblicher aus, und dabei hätten sie alle noch ein paar Jahre haben können, in denen sie nicht so offensichtlich in den Lauf der Zeit verstrickt gewesen wären, wie sie es mit ihren blind oder sehenden Auges eingegangenen Ehen von einem Tag auf den anderen waren.
Gewöhnlich war es auch die Braut, die mit einem schaudernden Blick in die Tiefe zu ihrem Mann sagte: »Du könntest mich immer noch loswerden«, was einiges über die Macht- und Unterwerfungsverhältnisse, die Unterdrückungs- und Überlebensstrategien dieses Paares preisgab, kaum je der Bräutigam, der die Frau aber wie auf Kommando umarmte, als hätte er gerade dasselbe gedacht oder als wäre er zu einfältig für einen solchen Gedanken. Ich beeilte mich dann, möglichst unbeeindruckt meine Bilder zu machen. Später konnte ich auf den Abzügen in den Gesichtern noch einmal alles sehen, Schmerz und Versöhnung, als hätten sie Streit gehabt, Anspannung und Erleichterung, Bedenken und ihr Zerstreutwerden, panische Schicksalsgläubigkeit und ein hilfloses Aufbäumen dagegen. Das Minimalziel verfehlte ich fast nie, sie wollten alle auf den Fotos besser dastehen als in Wirklichkeit, aber dazu brauchte es nicht viel, dazu brauchte ich nur die billigsten Tricks anzuwenden, oder ich fotografierte einfach an ihren Unvollkommenheiten und Menschlichkeiten vorbei.
Die tote Braut wäre mir auch ohne ihr schreckliches Ende allein deshalb in Erinnerung geblieben, weil sie an der Stelle auch etwas sagte, aber etwas ganz anderes als die anderen. Zu der Zeit hatte ich schon lange bei keiner Hochzeit mehr fotografiert und war in diesem Herbst nur für zwei Anlässe wieder eingesprungen, weil der Berufsfotograf, der meine Arbeit übernommen hatte, krank geworden war und sich auf die Schnelle kein Ersatz hatte finden lassen. Ich hatte am Tag meiner Matura zu unserem Vater gesagt, dass er in Zukunft auf meine Dienste verzichten müsse, ich hätte für mein Leben genug Hochzeiten gesehen, und seinem Drängen all die Jahre standgehalten, war aber dann doch weich geworden. Da hatte ich mein Medizinstudium längst abgebrochen gehabt und lustlos mit Germanistik und Anglistik angefangen, weshalb mir die Ablenkung gar nicht ungelegen kam. Es sollte sich auf ein einziges Mal beschränken, aber weil dieses eine Mal wider Erwarten so schön gewesen war und weil ich ganz anders als sonst auch ein richtiges Honorar erhalten hatte, war wenige Wochen später ein zweites Mal dazugekommen, und so war ich der Fotograf bei der Hochzeit der toten Braut geworden.
Selbstverständlich war sie noch am Leben gewesen, als wir auf die Lichtung gingen, um dort meine Unendlichkeitsbilder zu machen, aber sie hatte da nur mehr sechzehn Stunden, vielleicht eine Stunde mehr, vielleicht eine weniger, je nachdem, wie man die späteren Zeugenaussagen und die Befunde des obduzierenden Arztes gewichtete. Sie hatte davor schon mit ihrem Mann gestritten und mich in ihren Streit zu verwickeln versucht, als bereitete es ihr das größte Vergnügen, ihn bloßzustellen, ja, ihn zu demütigen. Ich hatte zum vereinbarten Zeitpunkt vor dem Entspannungszimmer gewartet und von drinnen deutlich ihre Stimmen gehört, und als sie plötzlich herausstürmte, ihr weißes, paillettenbesetztes Kleid mit beiden Händen an den Knien gerafft und die hohen Stöckelschuhe wild in die Luft stoßend, schnappte sie bissig zu ihm zurück: »Wir können es auch überhaupt seinlassen, wenn du willst. Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Wenn du sie noch einmal erwähnst …« Genau in dieser Sekunde fiel ihr Blick auf mich, und sie unterbrach sich. Sie hatte dunkle, fast schwarze Augen und ein Muttermal auf der Oberlippe, das mir wie ein drittes Auge vorkam. Ihr Gesicht war gerötet, die Frisur, ein kompliziertes Gesteck und Gehänge, durcheinandergebracht, und sie lachte, als verwandelte meine Anwesenheit für sie von einem Augenblick auf den anderen alles in eine Komödie.
»Wie oft haben Sie das schon gemacht?« fragte sie mich, während sie sich wieder zu ihrem Mann umdrehte, der ihr zaghaft folgte, mit hilflosen Handbewegungen die Luft zerteilte und mich an einen Dirigenten denken ließ, dem sie die falschen Noten hingelegt hatten. »Ihr verheiratet hier doch alles und jeden.«
Sie hob ihre Stimme, damit ihm ja nichts entging und damit ihm nur nicht entging, dass auch mir nichts entgehen konnte.
»Wie oft ist es vorgekommen, dass eine Frau es sich in letzter Sekunde anders überlegt hat?«
»Nie«, sagte ich. »Kein einziges Mal.«
»Wie oft haben Sie einen Mann gesehen, der seiner Braut an ihrem Hochzeitstag gestanden hat, dass er eigentlich mit seiner Mutter verheiratet ist?«
Sie wollte diese Szene, sie wollte sie so sehr, dass ihr jeder als Publikum recht gewesen wäre, und sie wollte sie um so mehr, je mehr sie ihren Mann damit in Verlegenheit bringen konnte. Ich wusste nicht, was hinter der verschlossenen Tür zwischen ihnen vorgefallen war, aber es musste etwas gewesen sein, durch das sie sich ihm gegenüber zu diesem absurden Verhalten berechtigt fühlte. Als er ihr nachkam und versuchte, sie an der Hand zu fassen, stieß sie ihn zurück. Er war ein feingliedriger Mann mit ausgeprägter Stirnglatze und einem von seiner Weste kaum gebändigten Bäuchlein in seinen späten Vierzigern und damit fünfzehn, vielleicht sogar zwanzig Jahre älter als sie, und er wusste keine andere Methode, sich gegen ihre Grobheiten zu wehren, als ihren Blick zu suchen, sie flehend anzusehen und zu bitten, keinen Skandal zu provozieren.
»Aber Iris!« sagte er ein ums andere Mal mit resignierter, fast lautloser Stimme. »Du hast mir versprochen, dass du dich zusammenreißt.«
Ich schlug vor, die geplanten Bilder später aufzunehmen oder den Termin an meiner Lieblingsstelle ganz ausfallen zu lassen, aber sie bestand darauf, weiter nach Protokoll zu verfahren, wie sie sich ausdrückte, man dürfe nicht davon abweichen, wenn man nicht von Anfang an alles in den Sand setzen wolle.
»Gehen Sie nur voraus«, sagte sie. »Ich folge Ihnen. Mein Mann muss selber die Entscheidung treffen, ob er sich uns anschließen oder sich lieber bei seiner Mutter ausweinen will. Lassen wir uns überraschen.«
Sie sagte das wirklich, während sie irgendwo aus den Falten ihres Kleides ein Päckchen Zigaretten hervornestelte und sich an mich wandte.
»Möchten Sie eine?«
Dabei deutete sie auf ihren Mann.
»Er mag nicht, wenn ich rauche.«
Ich reagierte nicht, und sie hatte sich ihre Zigarette noch gar nicht richtig zwischen die Lippen gesteckt, als ihr Mann auch schon ein Feuerzeug in der Hand hielt, der Reflex eines Kavaliers der alten Schule, der gar nicht anders konnte, als ihr zu Diensten zu stehen.
»Muss das sein, Iris?«
Sie fummelte wieder in ihrem Kleid herum, und im nächsten Augenblick hob sie triumphierend einen kleinen Flachmann in die Höhe und bot mir einen Schluck an.
»Ich habe ihm versprochen, dass ich seiner Mutter nicht den Tag verderbe«, sagte sie über die Einwände ihres Mannes hinweg, als ich ablehnte, und nippte mit geschlossenen Augen an dem Fläschchen. »Selbstverständlich werde ich ein braves Mädchen sein.«
Wir hatten uns indessen in Bewegung gesetzt, und als wir die kleine Lichtung erreichten, trat sie ohne zu zögern ganz vor an den Rand. Es hatte erst vor ein paar Stunden geregnet, die Luft war rein, es roch nach Feuchtigkeit und Moos, und der Lärm, der plötzlich von der Autobahn heraufdrang, schien noch stärker als an anderen Tagen, ein anhaltendes Tosen, in dem man sich halb schreiend verständigen musste. Wind war aufgekommen, der sich zuerst nur in ihrem Haar verfing und gleich darauf in ihr Kleid fuhr und den schweren Stoff ein paarmal hob und wieder fallen ließ, zwei, drei matte Schläge auf den immer noch nassen Waldboden. Sie schaute in den Abgrund und dann zu ihrem Mann und mir zurück, und ihr Gesicht hatte einen angestrengten Ausdruck angenommen, als würde sie eine schwierige Rechnung anstellen und zu keinem befriedigenden Ergebnis gelangen.
»Sie sind mir einer«, sagte sie, als sie wahrnahm, dass ich sie beobachtete. »Hat Ihnen noch niemand unterstellt, dass mit Ihnen vielleicht etwas nicht in Ordnung ist?«
Dann trat sie zu ihrem Mann und ließ sich von ihm in die Arme nehmen, auf einmal auf übertriebene Weise fügsam, nur um ihn im nächsten Augenblick bereits wieder aufzuziehen.
»Wenn ich dich hier hinunterstoßen würde, würde mich unser Fotograf bestimmt nicht verraten. Ich könnte sagen, du bist zu weit vorgetreten und gestolpert, Schatz, und er würde meine Aussage decken. Dir ist es wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber er hat sich ein bisschen in mich verliebt.«
Damit wandte sie sich wieder an mich, ihre Miene plötzlich schalkhaft, das Muttermal auf der Oberlippe mit jedem Zucken der Mundwinkel in Bewegung, die Augen weit offen in gespielter Erwartung.
»Das haben Sie doch, stimmt’s?«
Um mich diesen Neckereien nicht länger aussetzen zu müssen, nahm ich nicht mehr als eine Handvoll Bilder auf, und zu meiner Verwunderung war den Abzügen später nicht das geringste von der Szene anzumerken. Hatte die Frau gerade noch angriffslustig und wütend gewirkt, war das wie weggewischt und machte einer Umgänglichkeit Platz, die mir in ihrem Gesicht in Wirklichkeit nie aufgefallen war. Sie blickte sanft in die Kamera, die vollen Wangen gaben ihr einen mädchenhaften Anstrich, und sie fasste nach der Hand ihres Mannes, der ihr den Arm um die Schultern gelegt hatte, eine joviale, beinahe kumpelhafte Geste, die auch ihn sofort aufleben ließ. Er hatte nichts Zerknirschtes mehr an sich, nichts Zaghaftes, und ich konnte mir erst anhand der Bilder vorstellen, dass er überhaupt jemals für sie in Frage gekommen war. Sie waren zu dunkel geworden, weil ich nicht genug mitbedacht hatte, dass von neuem Wolken aufgezogen waren, nachdem es eine Weile aufgerissen hatte, aber seine Augen strahlten, als hätte sich alles Licht darin verfangen.
Auf dem Rückweg hatte sie ihren Arm um seine Schultern gelegt, und ich hörte hinter ihnen gehend deutlich, dass sie zu ihm sagte, wie glücklich sie sei, und das wollte dem ermittelnden Kommissar, der gleich am nächsten Vormittag auftauchte, nicht in den Kopf. Weil ich als Student kein eigenes Bett im Haus mehr beanspruchen konnte, hatte ich im Entspannungszimmer übernachtet und war ihm in die Arme gelaufen, als ich spät zum Frühstück hinunterging und er gerade ankam, weshalb ich ihm als erster Rede und Antwort stehen musste. Ich war insgesamt nicht mehr als eine knappe halbe Stunde mit dem Paar allein gewesen, gerade lange genug für den schrägen Auftritt der Frau, bis wir wieder zur Hochzeitsgesellschaft zurückkehrten, Braut und Bräutigam mit einem lauten Hallo empfangen wurden und ich in den Hintergrund treten und von dort weiter meiner Arbeit nachgehen konnte, aber der Kommissar war überzeugt, dass sich vor meinen Augen Entscheidendes abgespielt hatte und dass er nur den Schlüssel dazu finden musste. Er ging mit mir Minute um Minute durch, am liebsten hätte er gehabt, wenn ich ihm über jede Sekunde Rechenschaft abgelegt hätte, und er hatte recht, wenn er feststellte, es folge keiner Logik, wie die Frau den Mann zuerst vorgeführt und wie sie sich dann buchstäblich wie ein schnurrendes Kätzchen verhalten habe, obwohl dazwischen kaum Zeit vergangen sei.
Ich verschwieg ihm anfangs, dass sie gesagt hatte, ich hätte mich in sie verliebt, weil es mir zu aberwitzig vorkam, und als ich es schließlich doch vorbrachte, nachdem er ein ums andere Mal nachgehakt hatte, ob ich mich nicht an noch etwas erinnerte, ob ich nicht Dinge vergessen hätte, die mir vielleicht unwichtig erschienen, aber womöglich von größter Wichtigkeit seien, musterte er mich und wollte wissen, ob ich den Eindruck gehabt hätte, sie sei betrunken gewesen, unter Drogen oder einfach nur verrückt. In dem Augenblick sah ich ihn selbst zum ersten Mal richtig an, und er erwiderte meinen Blick. Er war ein korpulenter Mann, noch nicht alt, aber mit müden Augen, einer Stirnfransen-Frisur und einem Mund, den er immer wieder zu einem Strich zusammenpresste, damit er ihm nicht in alle Richtungen entglitt, einem enttäuschten Mund, wie ich dachte, dem Mund einer zu lange auf ihr Glück wartenden Frau.
»Sie hat tatsächlich gesagt, Sie könnten sich in sie verliebt haben?« sagte er. »Und sie hat Sie davor noch nie gesehen? Die beiden waren doch keinen Tag verheiratet? Wie soll das gehen?«
Man hatte die Braut erst vor eineinhalb Stunden mit gebrochenem Genick am Fuß des Schlossbergs gefunden, aber er gab sich überzeugt, den Fall noch am selben Tag aufklären zu können. Er würde alles systematisch untersuchen, Schritt für Schritt ermitteln, wer sie zuletzt gesehen hatte und wer zuletzt mit ihr gesehen worden war, und dann die Gästeliste durchgehen und einen nach dem anderen die Eingeladenen ausfindig machen, die in ihren Unterkünften noch schliefen und nicht einmal ahnten, was geschehen war. Auch der Bräutigam wusste noch nichts. Angeblich war er gegen halb vier am Morgen sturzbetrunken in sein Hotel verfrachtet worden und sofort eingeschlafen, ohne die Braut auch nur zu vermissen, und ihn wollte der Kommissar als ersten aufsuchen, wenn alles Erkennungsdienstliche an der Leiche getan war, an der schon die Spezialisten von der Spurensicherung arbeiteten, wollte ihm persönlich die Nachricht überbringen und schauen, wie er darauf reagierte. Er bat mich, ihm alle Filme von der Hochzeit zu überlassen, und ich händigte sie ihm aus und sah die Bilder selbst erst zwei Wochen danach, als ich die Negative zurückbekam. Auf dem ersten, das ich von dem Paar aufgenommen hatte, ist in Wirklichkeit allein die Braut zu sehen oder genaugenommen nur ihr Bein mit dem hohen Stöckelschuh und der wallende Stoff ihres Kleides beim Aussteigen aus der gerade vorgefahrenen, blumengeschmückten Limousine, ein Klischee, gewiss, aber ein immer gern gesehenes. Hingegen sitzt sie auf dem letzten, Stunden später, lachend neben ihrem Mann, und im Hintergrund drängen die vier Männer ins Bild, die davor schon versucht hatten, sie zu entführen, und jetzt noch einen Versuch unternahmen, sich diesmal nicht abwimmeln ließen und sie wenige Minuten später in ihr Auto setzten und in dem offenen Wagen davonfuhren, die Musik so laut gedreht, dass man sie noch die Serpentinen den Hang hinunter hören konnte.
Das war kurz vor Mitternacht gewesen, und als sie nach vier Stunden wieder zurückkamen, war ich längst im Bett und schlief. Sie hatten nicht auf dem großen Parkplatz vorn geparkt, sondern waren um das Haus herumgefahren und hatten das Auto hinten abgestellt, direkt unter dem offenen Fenster des Entspannungszimmers. Die Musik hatten sie leiser gedreht, jedoch immer noch laut genug, um mich zu wecken, und als ich mich erhob und hinter dem Vorhang versteckt hinausschaute, sah ich, dass sie das Verdeck geschlossen hatten. Der Morgen war frisch, es regnete wieder, aber über dem Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern schien bereits die erste Helligkeit auf.
Das Auto stand eine ganze Weile da, ohne dass etwas geschah, doch konnte ich dem Kommissar beim besten Willen nicht sagen, wie lange. Dann ging die Fahrertür auf, und als die Braut ausstieg, schien das Weiß ihres Kleides in der Dunkelheit zu zerrinnen. Beim Aufbruch war sie nicht am Steuer, sondern hinten gesessen, aber der Wechsel wunderte mich nicht, und jetzt war auch ihre Stimme zu hören und wie sie die anderen auffordernd fragte, ob sie sitzen bleiben wollten. Aus dem Wageninneren schallte ihr Gelächter entgegen, gefolgt von den mühsamen Worten eines Betrunkenen.
»Magst du nicht lieber schauen gehen, ob dein Mann schon im Bett ist, und wir warten so lange hier?«
»Ach was!« sagte sie. »Er wird euch nicht umbringen.«
Sie war ins Licht getreten, das von der Lampe kam, die über dem Hintereingang hing, und im Glitzern der Pailletten sah ich einen Augenblick ihr Gesicht und das Muttermal auf ihrer Oberlippe.
»Wir sagen, wir haben eine Panne gehabt.«
Jetzt ging die Beifahrertür auf, und die betrunkene Stimme war wieder zu hören, schleppend, rauh und mit einem absichtlich vulgären Unterton.
»Eine Panne? Genausogut können wir sagen, deine Großmutter ist gestorben, Iris! Wer soll uns das glauben?«
Die Gestalt arbeitete sich schwerfällig heraus, tat ein paar Schritte auf das Haus zu und stützte sich direkt unter mir, den Arm über dem Kopf, an der Wand ab.
»Besser, wir verziehen uns.«
»Auf keinen Fall«, sagte die Braut. »Ihr bleibt!«
Dann kiekste sie hell auf.
»Was tust du da?«
Ich beugte mich vor, konnte aber nichts erkennen.
»Sag, dass du das nicht tust, Michi!«
Im selben Augenblick hörte ich das Plätschern gegen die Wand, und während mir der Geruch von Urin in die Nase stieg, protestierte sie schrill.
»Das ist eine schöne Sauerei! Wem willst du damit etwas beweisen, Michi? Ich kann nicht glauben, dass du das tust!«
Indessen hatten sich die anderen aus dem Fond gehievt. Sie reihten sich vor dem Auto auf, einer den Arm um die Schultern seines Nebenmannes, standen da wie die Überreste einer geschlagenen Fußballmannschaft nach dem Elfmeterschießen und beobachteten ihren Freund. Ihr Kichern war das Kichern von Flegeln, und während ich instinktiv einen Schritt zurücktrat, fehlte nur, dass sie ihn anfeuerten.
Das Ganze hatte kaum mehr als eine Minute gedauert, aber der Kommissar ließ mich die Worte, die gefallen waren, ein ums andere Mal wiederholen und wollte dann wissen, wie spät es genau gewesen sei.
»Vor oder nach vier?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»Herrgott!« sagte er. »Sie haben doch auf die Uhr geschaut. Ungefähr vier reicht nicht. Denken Sie nach.«
Dann erging er sich wieder in der Frage, die er mir schon einmal gestellt hatte und auf die er keine Antwort erwartete.
»Hat das Schwein wirklich vor der Braut gegen die Wand gepinkelt, und die anderen haben ihm lachend zugeschaut?«
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wer sie waren, und wahrscheinlich hatten es auch die wenigsten Hochzeitsgäste gewusst, womöglich nicht einmal der Bräutigam, aber es stellte sich schnell heraus, dass es sich bei allen vieren um ehemalige Verehrer der Braut handelte, wie der gängige Ausdruck war, bei mindestens zweien sogar um Liebhaber. Sie hatte sie eingeladen, und die Herren hatten sich zu einem Club der Abgewiesenen zusammengeschlossen, die derb damit prahlten, dass sie ja nur ihre alten Rechte geltend machten, wenn sie mit ihr in die Nacht entschwanden. Es waren alles Sprösslinge der besseren Gesellschaft, sofern der Begriff noch einen Sinn ergibt oder überhaupt je einen Sinn ergeben hat, Burschen aus gutem oder jedenfalls wohlhabendem Haus, die nach diesen Kategorien als ansprechende Partien durchgehen konnten, und wo auch immer ich sie auf meinen Bildern erfasst hatte, schienen sie das auch auszustrahlen. Darauf standen sie, Champagnergläser in den Händen, in einer Runde, stießen mit dem Bräutigam an, redeten mit der Braut oder tanzten mit ihr, waren hier in einer Gruppe zu entdecken oder dort, junge Männer, die sicher in lautes Lachen ausgebrochen wären, hätte man ihnen gesagt, dass sie wenigstens für ein paar Tage als Hauptverdächtige und später immerhin noch als Beteiligte und wohl nicht ganz Unschuldige in einem Fall galten, der bis heute nicht aufgeklärt wurde.
Die Zeitung brachte in den folgenden beiden Wochen fast täglich Berichte und versuchte nicht nur zu rekonstruieren, was in der Nacht beziehungsweise in den frühen Morgenstunden bei der Hochzeit geschehen war, sondern lieferte auch Hintergründe und Klatsch sowohl über Braut und Bräutigam als auch über die sogenannten Verehrer. Dabei war immer wieder die Rede von einer Traumhochzeit oder sogar der Hochzeit des Jahres, die so schrecklich zu Ende gegangen sei. Die Braut wurde nicht nur einmal als Partygirl bezeichnet, was angesichts ihres Todes etwas Frivoles hatte, ihr Beruf als der einer Eventmanagerin angegeben, was kaum weniger trist klang, der Bräutigam firmierte als Millionenerbe aus Wien, aber auch als Immobilien- und Waldbesitzer in der Steiermark und Enkel eines langjährigen Nationalrats gleichen Namens. Die Verehrer waren ein Professoren- oder Herzchirurgensohn, wie es hieß, der Juniorchef eines europaweit operierenden Transportunternehmens, der Besitzer eines Viersternehotels in bester Lage und Michael »Michi« Mattlinger, Fernsehsprecher, Moderator, Entertainer und, was mir bei der Feier gar nicht aufgefallen war, dem abgedruckten Bild nach zu schließen ein unerträglicher Schönling mit Fönwelle, Grübchen und einem sanft vernebelten Schlafzimmerblick.
Ich musste lachen, wie sehr sich der Kommissar über den Begriff »Jeunesse dorée« ärgerte. Er meinte, kein Mensch verwende ihn mehr ernsthaft und nur die Zeitung glaube, sich damit schmücken zu können. Das allein reichte ihm, um sich über die ganze Berichterstattung zu echauffieren.
»Die lassen immer größere Trottel schreiben«, sagte er. »Je mehr Fremdwörter einer verwendet, um so sicherer können Sie sein, dass er in Wirklichkeit Analphabet ist und seine ganze Arbeit darin besteht, das mühsam zu kaschieren. Dazu dieser widerwärtige Kleinbürgermief und die Bereitschaft, alles, was so einer für oben hält, zu bewundern, bis er die eigene Bewunderung satthat oder sich selbst derart dafür hasst, dass er irgend etwas kaputtschlagen muss.«
Er hatte mich eine Woche nach dem Unglück von neuem aufgesucht und ging alles noch einmal mit mir durch. Da standen die Fakten, soweit sie überhaupt ans Tageslicht kamen, überwiegend bereits fest, und soviel Zeit er danach für seine Ermittlungen auch aufwenden mochte, es kam kaum etwas Neues hinzu. Nicht nur der Bräutigam, auch seine Mutter hatte die Festgesellschaft zu der späten Stunde schon verlassen gehabt, als die Braut mit den Verehrern wieder im Saal aufgetaucht war. Unser Vater war ihnen entgegengetreten und hatte die vier Männer hinauskomplimentiert, als sie auftrumpfend eine Flasche Champagner bestellt hatten und mit ihm umgesprungen waren, als wäre er nur der Hausmeister im eigenen Restaurant. Er hatte gesagt, sie sollten sofort gehen, wenn sie ihn nicht kennenlernen wollten, eine Brautentführung sei ja schön und gut, aber nicht eine, die sich über vier Stunden hinziehe, sie hätten mit ihrer Rücksichtslosigkeit die Hochzeit gesprengt, und damit hatte er angefangen, sie zu schubsen und zu stoßen, und es wäre fast zu einem Handgemenge gekommen.
Der Kommissar wollte von mir wissen, ob ich sie wegfahren gehört hätte, aber ich hatte nach ihrer Ankunft das Fenster geschlossen, und außerdem war der Regen so stark geworden, dass sein Prasseln den Lärm des Motors sicher überdeckt hatte. Die Braut war nicht mit ihnen gegangen, war noch eine Weile am Tisch ihrer Eltern gesessen, die ihr Vorwürfe machten, und hatte dann ein Taxi genommen. Natürlich hatte der Kommissar den Fahrer ausfindig gemacht, und der hatte ihm erzählt, ja, hatte ihm Stein und Bein geschworen, er sei mit ihr nur so weit gefahren, bis sie außer Sichtweite des Restaurants gewesen seien, und habe sie dort trotz des Unwetters und trotz ihrer unzureichenden Kleidung in die Nacht oder vielmehr in den anbrechenden Morgen hinausstaksen lassen.
»Er dürfte der letzte gewesen sein, der sie lebend gesehen hat«, sagte der Kommissar. »Bis auf vielleicht ihren Mörder.«
Wir saßen uns in meinem WG-Zimmer gegenüber, und er hatte endlich aufgehört, das Bücherregal zu studieren, als könnte er dort eine Antwort auf all die unbeantwortbaren Fragen finden. Ich hatte ihn auf meinen Schreibtischstuhl dirigiert und mich selbst auf das Bett gesetzt und bereute jetzt, dass ich nicht mehr auf Distanz geachtet hatte. So ungestüm, wie er an der Tür gefragt hatte, ob er hereinkommen könne, war ich nicht geistesgegenwärtig genug gewesen, ihm seine Grenzen aufzuzeigen. Er war in Zivil, trug Jeans und Pullover und gab sich Mühe, entspannt zu bleiben, als ich sagte, die Zeitung schreibe, alles deute darauf hin, dass es sich um einen Selbstmord handle.
»Glauben Sie doch nicht, was in der Zeitung steht«, sagte er. »Sie brauchen nur zu schauen, wofür die sich interessieren, und wissen Bescheid. Die Trauringe aus einer Werkstatt in Paris, das paillettenbesetzte Brautkleid mit Swarovski-Klunkern, das silbermetallicfarbene Cabriolet mit über zweihundert PS. Die schaffen es, sogar in einem Bericht über ein Unglück nur über ihre eigene Dummheit zu schreiben.«
Er machte eine Handbewegung, als wollte er nicht allein den Tisch leerfegen, sondern die ganze Welt von allem unnötigen Krempel befreien, und ließ auch weiter kein gutes Haar an den Schreibern.
»So, wie sie heute noch über Selbstmord reden, können sie morgen schon umschwenken, sobald sie nur einen Tropfen Blut geleckt haben. Dann ist es mit dem ekelhaften Geschmiere vorbei, und sie treten die ach so bewunderten Verehrer in die Hölle und hängen ihnen jedes Verbrechen an, das ihnen in den Sinn kommt. Keine Rede mehr davon, dass sie ihnen gerade noch am liebsten die Füße geküsst hätten.«
Er räusperte sich, und ich dachte, wenn wir im Freien gewesen wären, hätte er sich wahrscheinlich herausgenommen, vor mir auf den Boden zu spucken.
»Jeunesse dorée!«
Es hörte sich an, als würde er die Verehrer am liebsten vom Fleck weg verhaften, obwohl er keine Handhabe gegen sie hatte. Sie hatten das Gelände längst verlassen gehabt, als sich die Braut im strömenden Regen auf ihren Weg gemacht hatte. Dabei musste sie durch den Wald gegangen sein, einen Pfad abseits der Straße gewählt und den Parkplatz vor dem Restaurant gemieden haben, sonst hätte sie einer der im Aufbruch begriffenen Gäste sicher gesehen, und wohl nicht nur gesehen, sondern hätte angehalten und gefragt, was mit ihr los sei, wohin sie mitten in der Nacht wolle. Das bedeutete aber auch, dass sie wahrscheinlich noch einmal unter meinem Fenster vorbeigekommen war, weil sie so am leichtesten auf den Steig zum Schlossberg gelangte, und als der Kommissar das sagte, hätte ich ihm gern den Gefallen getan und ihm versichert, dass sie da noch ein letztes Mal in meinen Blick geraten sei, die Haare waschnass an den Kopf geklatscht, ein vorbeihuschender Schatten, ein Gespenst in ihrem weißen, paillettenbesetzten Kleid.
»Der Weg muss vom Regen ein einziger Matsch gewesen sein«, sagte er. »Sie ist ohne Schuhe gegangen. Die Kollegen haben festgestellt, dass sie die ausgezogen hat. Ihre Strümpfe waren an den Sohlen vollkommen durchlöchert, ihre Füße schmutzig vom Schlamm.«
Anders hätte sie den Steig auch gar nicht bewältigen können, und wenn mich etwas wunderte, dann eher, dass die Leiche die Schuhe angehabt hatte. Die Braut musste sie in der Hand getragen und oben wieder angezogen haben, die Riemchen penibel in die Schnallen gesteckt. So war sie gefunden worden, verdreckt und nass zwar im Regen, aber mit allen Kleidungsstücken am Körper und ihren Schuhen an den Füßen.
Am meisten zu denken gab dem Kommissar, dass zwischen dem Augenblick, in dem der Taxifahrer sie hatte aussteigen lassen, und dem Zeitpunkt, den der obduzierende Arzt als wahrscheinlichen Todeszeitpunkt angab, mehr als zwei volle Stunden vergangen waren.
»Das ist eine Ewigkeit für das Stückchen Weg«, sagte er. »In der Zeit wäre sie auf Knien den Berg hinaufgekommen.«
Wenn das eine Anspielung auf die Barmherzigen Schwestern und ihre Nachtwallfahrten war, die sie manchmal hoch zur Ruine unternahmen, schien ihm das nicht bewusst zu sein. Er sah mich verdattert an, als ich ihn fragte, ob er auch mit der Oberin gesprochen habe. Dann erst begriff er und lachte.
»Was soll das bringen?«
»Vielleicht war eine von den Schwestern draußen.«
»Um fünf Uhr am Morgen?«
»Ich weiß nicht, wann die ihren Tag beginnen«, sagte ich. »Aber um die Zeit dürften sie schon auf den Beinen sein und wohl auch ihre ersten Gebete bereits hinter sich haben.«
Er sagte, das möge ja stimmen, bringe ihn aber keinen Schritt weiter, es sei denn, ich wolle damit nahelegen, eine der Schwestern könnte die Braut vom Schlossberg in die Tiefe gestürzt haben, und ihm am besten auch noch ein vernünftiges Motiv dafür liefern.
»Helfen Sie mir lieber zu überlegen, was sie die ganze Zeit gemacht haben könnte. Zwei Stunden draußen im Regen. Das ist mir ein Rätsel. Außerdem hätte sie alles viel einfacher haben können.«
Sein Blick hatte jetzt etwas professionell Gequältes.
»Wenn sie sich schon umbringen wollte, hätte sie sich den mühsamen Aufstieg ersparen können«, sagte er. »Sie hätte nur die paar Schritte vor auf die Lichtung gehen müssen, wo Sie Ihre Fotos gemacht haben. Dort geht es auch ganz schön hinunter. Warum sollte sie da auf den Schlossberg hinauf?«
»Vielleicht wollte sie nur eine Weile allein sein«, sagte ich. »Vielleicht wollte sie von oben sehen, wie der Tag anbricht.«
»Um diese Uhrzeit, bei strömendem Regen? Ihren Humor möchte ich haben. Sie könnte längst im Bett gelegen sein und nimmt diese Unannehmlichkeiten in Kauf, weil sie hofft, dass es bald aufklart und sie in der Ferne die Morgenröte sieht?«
Ich war zu der Zeit vierundzwanzig, mit meinem verbummelten Studium auf eine Weise jung, wie ich es in keinem anderen Alter gewesen war, und wenn ich später in einer Runde erzählte, ich hätte in einem früheren Leben als Hochzeitsfotograf gearbeitet, und dann gebeten wurde, eine Anekdote zum besten zu geben oder gar das Verrückteste, was ich dabei jemals erlebt hätte, sprach ich nur selten von dem Unglück. Die Erwartung war immer, etwas Exaltiertes oder vielleicht Anrüchiges zu hören zu bekommen, und oft bediente ich sie auch, oft wollte ich die Stimmung nicht mit dieser finsteren Geschichte verderben und verlegte mich auf irgendwelche Missgeschicke, irgendwelche Verwechslungen, aber noch öfter kam ich einfach auf die zweite Feier zu sprechen, eigentlich die erste, ein paar Wochen davor, bei der ich in jenem Jahr fotografiert hatte, weil es da mehr Berechtigung gehabt hätte, zu sagen, dass ich mich verliebt hatte, wenn auch nicht in die Braut, sondern in ihre Cousine. Sie stand vorn in der Kapelle, ein wildes Sommersprossengesicht, die eine Hälfte des Schädels bis zur Schläfe rasiert, die andere ein Lockengekringel, trug ein knöchellanges, auf den ersten Blick weißes, auf den zweiten Blick hellrosafarbenes Kleid mit einem großen, weißen Spitzenkragen und einer weißen Schürze, wie eher ein Kind sie hätte tragen können, und hob gerade ihre Geige. Ich hatte sie sofort gesehen, meine Kamera mehrfach angesetzt und wieder sinken lassen, sie lange im Sucher behalten, ohne auf den Auslöser zu drücken, und hatte ihr dann untätig zugehört und zugeschaut, wie sie den Bogen über die Saiten führte und anscheinend selbst ins Schwingen geriet, als würde sie ihren eigenen Körper streichen. Sie spielte Schostakowitsch, die Augen geschlossen, mit Bewegungen wie unter Wasser, ohne Angst vor der Hingabe, ohne Angst vor dem Pathos, ohne Angst vor der Unschuld. Davor war ich drei Monate lang jeden Abend wegen einer Kellnerin, ihrem Lachen und der selbstvergessenen Art, wie sie hinter der Theke stand und rauchte, wenn es nichts zu tun gab, in dasselbe Café gegangen, ohne dass ich gewagt hätte, sie anzusprechen, aber jetzt konnte ich nicht erwarten, dass die Trauzeremonie vorbei war, die Leute sich zerstreuten und ich zu dem Mädchen eilen konnte, um ihr zu sagen, dass ich nie etwas Schöneres gehört hätte, und ihren Namen zu erfahren, der Sarah Flarer war.
ZWEITES KAPITEL
Vorausgesetzt, die tote Braut war nicht doch anders ums Leben gekommen, ist der Selbstmord des Professors in Jackson mein zweiter Selbstmord gewesen. Ich weiß, dass mit diesem Satz etwas nicht stimmt, aber in seiner paradoxen Formulierung trifft er meine Empfindungen am genauesten und verbindet die beiden tragischen Ereignisse, die eigentlich unverbunden sind oder nur verbunden durch mich, durch meine Anwesenheit in nächster Nähe, als sie geschahen. Bei dem Professor kommt hinzu, dass ich ihm in den Jahren, die ich ihn kannte, immer wieder einmal von Sarah erzählt hatte, immer wieder einmal von meinen paar Stunden mit ihr, denn mehr waren es nicht, vom ersten Anblick in der Kapelle bis zum Ende unseres Spaziergangs in der Nacht. Er hatte mich irgendwann gefragt, ob ich keine Freundin hätte, und sich, kaum dass ich Sarah erwähnt hatte, für sie in einer Weise interessiert, die auffällig war, die ich aber erst nach seinem Tod verstanden oder zumindest zu verstehen geglaubt habe. Ich hatte aus Verlegenheit von ihr zu sprechen begonnen, geradeso, als wollte ich mich dafür rechtfertigen, dass ich allein lebte, und die Begegnung immerhin so weit ausgeschmückt, dass er annehmen musste, dass ich von einer unerwiderten Liebe sprach. Dabei brachten meine Worte es mit sich, dass ich am Ende selbst mit einem noch wehmütigeren Blick auf die nicht einmal halb angefangene Geschichte sah, als ich es ohnehin schon tat.
Doch ich muss von Anfang an erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich war damals, bloß wenige Wochen nach dem Unglück mit der Braut, nach Amerika gegangen, ohne zu ahnen und ohne mir auch nur vorstellen zu können, dass es dreizehn Jahre werden würden, die ich blieb. Unser Vater hatte gesagt, wenn ich ein bisschen Abstand bräuchte, könnte ich den Winter in Wyoming verbringen und nachher sehen, was ich machen wolle, mit meinem Studium sei es ohnehin nicht weit her, und ich hatte mich auf den Vorschlag gestürzt, als wäre er meine Rettung. Dort hatte einer seiner Jugendfreunde, der in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausgewandert war, eine Skischule gegründet, und es bedurfte nur eines Anrufs, um mich ihm zu vermitteln. Dann war ein Winter zum anderen gekommen, Monate um Monate, die ich alle auf den Hängen von Jackson Hole abgedient hatte, und ich konnte mir nichts vormachen, aus mir war das geworden, was ich nie hatte werden wollen, ich war nicht mehr nur aushilfsweise Skilehrer, ich war es ganz und gar.
Der Professor war mein treuester Schüler gewesen. Ich hatte schon von ihm gehört, und wahrscheinlich hatte ich ihn auch schon gesehen, auf der Piste am Stadtrand, im viel größeren Skigebiet des benachbarten Teton Village oder in einer der Bars des überschaubaren Städtchens, bevor er mir in meinem dritten Jahr in den Rocky Mountains schließlich zufiel. Sein Stammskilehrer war krank geworden, und nach unseren ersten gemeinsamen Tagen bestand der Professor darauf, nur mehr mit mir zu fahren, er wolle den Österreicher, rief er zu meiner Beklemmung im Skischulbüro aus. Von da an wurde ich immer für ihn freigestellt, vier bis sechs Stunden Privatunterricht jeden Tag, und wir verbrachten oft auch die Abende zusammen, wenn er mich zu sich ins Hotel zum Essen einlud oder wenn wir zu Kathy hinausfuhren, die in einer Blockhütte außerhalb der Stadtgrenze, schon auf dem Weg zur Passhöhe nach Idaho hinüber, ein Diner und eine Bar betrieb, wo sich besonders im Spätwinter Leute aus der ganzen Umgebung versammelten. Er war einer der alleinreisenden Stammgäste, die gleichermaßen belächelt wie gefürchtet wurden, unkompliziert bis zur Selbstverleugnung, solange alles glattlief, und von einem Augenblick auf den anderen kompliziert wie eine Diva, sobald ihm etwas gegen den Strich ging, mit Sonderwünschen und einem aggressiv peniblen Pochen auf ihre augenblickliche Erfüllung. Sieben Jahre sind es geworden, die wir zusammen hatten, jedes Jahr zwei oder drei Wochen im Februar, manchmal noch eine Woche um Ostern herum, und manchmal kam er nur für ein Wochenende, scheute die lange Anreise nicht, so dass wir uns am Ende tatsächlich fast schon wie ein altes Ehepaar aneinander gewöhnt hatten.
Natürlich wurde gemunkelt, eigentlich von der ersten Woche an, warum er so versessen auf mich sei, ob er mir Avancen mache, aber davon konnte nicht die Rede sein, was jedoch nicht hieß, dass die Sprüche hinter unseren Rücken jemals ganz verstummten. Wir mussten ja auch ein merkwürdiges Bild abgegeben haben, wenn wir zusammen durch den Ort schlenderten, er in seinem roten Overall, der ein wenig schrill für sein Alter war, meistens seinen Helm noch auf dem Kopf und die Skier auf seine Weise geschultert, mit den Spitzen nach hinten, ich so früh wie möglich im Jahr nur im Pullover und, wenn es ging, ohne Mütze. Er ließ mir immer einen halben Schritt Vortritt, und auf der Piste unterwarf er sich wunschlos meinem Regime. Dort fuhr er am liebsten den ganzen Tag ohne viel Worte hinter mir her, wollte weder meine Tips oder Ratschläge hören noch meine Belobigungen, wie gut er sich mache, und sagte nicht nur einmal, er verbringe gern die Zeit mit mir, aber ich dürfe nicht glauben, er habe auch nur den geringsten Ehrgeiz, ein besserer Skifahrer zu werden. Ich sollte eine sichere Linie die Hänge hinunter finden oder eine Abfahrt außerhalb der Markierungen, ich sollte die Lawinengefahr einschätzen und dementsprechend meine erste Spur in den Tiefschnee legen, damit er dann seine parallel dazu ziehen konnte, doch im Grunde genügte es ihm, draußen zu sein, in meiner stillen Gesellschaft.