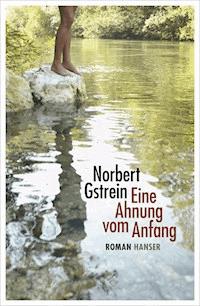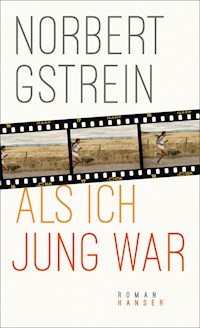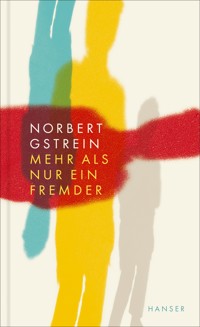
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Norbert Gstrein, dieser „elegante und anspruchsvolle Stilist“ (Carsten Otte, SWR2), über die Lektüren seines Lebens, sein Schreiben und sein Werk Zum ersten Mal gibt Norbert Gstrein Auskunft über sein Schreiben und sein Werk. Er spürt Empfindungen wie Scham, Schuld und Angst nach, und er erzählt von den Lektüren seines Lebens. "Jetzt kommen sie und holen Jakob" lautet der erste Satz seines ersten Buches, erschienen 1988. Von diesem Satz ausgehend spannt der Autor einen Bogen bis in die Gegenwart und leuchtet die Echoräume seines Erzählens aus. Wer ist das "Ich" in seinen Romanen? In welcher Verbindung stehen Schreiben und Moral? Was haben Gauß und die Mathematik mit allem zu tun? Und kann man ein amerikanischer Schriftsteller sein, obwohl man in Tirol aufgewachsen ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Norbert Gstrein, dieser »elegante und anspruchsvolle Stilist« (Carsten Otte, SWR2), über die Lektüren seines Lebens, sein Schreiben und sein WerkZum ersten Mal gibt Norbert Gstrein Auskunft über sein Schreiben und sein Werk. Er spürt Empfindungen wie Scham, Schuld und Angst nach, und er erzählt von den Lektüren seines Lebens. »Jetzt kommen sie und holen Jakob« lautet der erste Satz seines ersten Buches, erschienen 1988. Von diesem Satz ausgehend spannt der Autor einen Bogen bis in die Gegenwart und leuchtet die Echoräume seines Erzählens aus. Wer ist das »Ich« in seinen Romanen? In welcher Verbindung stehen Schreiben und Moral? Was haben Gauß und die Mathematik mit allem zu tun? Und kann man ein amerikanischer Schriftsteller sein, obwohl man in Tirol aufgewachsen ist?
Norbert Gstrein
Mehr als nur ein Fremder
Hanser
Nothing is my last word about anything.
Henry James
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Fußnoten
Über Norbert Gstrein
Impressum
Inhalt
Erster Teil
: DAS WUNDERKIND, DAS ICH NICHT WAR
Schmule
Zweiter Teil
: … UND EXISTIERE ODER EXISTIERE NICHT …
Die ohne Not gesagte Wahrheit
Der erste Satz
Dritter Teil
: KLARHEIT UND SEHNSUCHT
Ein Hund sein
Aus Kanaan hinaus
Das »O« bei Hölderlin
Vierter Teil
: DAS UNGLÜCKLICHE TERRITORIUM
Mehr als nur ein Fremder
Die afrikanistische Präsenz
Fünfter Teil
: FÜR MEINE BIOGRAFEN
Wo du wolle?
NACHWEISE
Abdrucke
Zitierte Übersetzungen
Erster Teil
DAS WUNDERKIND, DAS ICH NICHT WAR
Schmule
I had a good life.
Pepi Stiegler
Eine Zeitlang habe ich jetzt allen Leuten erzählt, ich sei im vergangenen Dezember nach Wyoming gefahren auf der Suche nach meiner Kindheit und auf der Suche nach Schnee, als wäre das eine nicht ohne das andere zu haben. Und ja, es stimmte, und doch war es auch ein Satz, der vom vielen Erzählen zu schön und zu glatt klang und mehr und mehr seinen harten Wahrheitskern verlor. Denn den gab es, einen wahren Kern, und tatsächlich hatte ich schon auf der Fahrt von Denver nach Jackson, wie der Ort in Wyoming hieß, immer mehr feststellen müssen, wie mir auf dem leeren Highway in der Prärie die Zeit abhanden kam, oder vielmehr, wie durchlässig die Zeit wurde, weil in der Weite der Landschaft alles nur mehr Raum war.
Ich war nach Jackson gefahren, weil der Ort, ohne dass ich damals seinen Namen gekannt hätte, mit einer meiner allerersten Erinnerungen zu tun hatte. Es war eine Auswanderergeschichte, die mir mein Vater als Vier- oder Fünfjährigem erzählt hatte, die Geschichte eines österreichischen Skirennläufers, der in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach Amerika gegangen war und dort eine Skischule gegründet hatte. Für meinen Vater, selbst Inhaber einer Skischule, war auszuwandern und an einem anderen Ende der Welt in seinem eigenen Metier gleich wieder Fuß zu fassen offensichtlich das Schönste und Größte gewesen, was man überhaupt tun konnte, und jetzt, fünfzig Jahre später, saß ich in den Rocky Mountains einem über achtzigjährigen Mann in seiner Küche gegenüber und bemühte mich, ihm zu erklären, was mich zu ihm geführt hatte.
Davor hatte ich ihn von Hamburg aus vergeblich zu kontaktieren versucht und war schließlich einfach nach Denver geflogen, hatte ein Auto gemietet, war stundenlang durch die sanft schneebestäubte Vorwinterlandschaft gefahren und hatte an seiner Tür geklopft. Nach einem Unfall geschwächt, hatte er eine Betreuerin zur Seite, und wir sprachen ihretwegen hauptsächlich englisch, aber zwischendurch gab es immer wieder Einsprengsel in dem Tiroler Dialekt, seinem Dialekt, der für mich so vertraut war, weil er sich in vielem wie der Dialekt meiner Kindheit anhörte. Er war als junger Mann Olympiasieger im Slalom gewesen, hatte mit mehr als sechzig Jahren noch ein Literaturstudium begonnen und auch abgeschlossen, und er hatte eine Cessna besessen, zeigte mir ein Foto von den Bergen, das er aus dem Flugzeug aufgenommen hatte, und sagte: »I had a good life.« Die Betreuerin versicherte mir, einem Besucher aus Europa, der aber gar nicht mit diesen Vorurteilen ins Haus gekommen war, er habe bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr nicht den Falschen gewählt, in dem Städtchen, das angeblich das höchste oder jedenfalls eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen in den USA hatte, nicht gerade die Norm. Dazu sagte sie: »Pepi has always been a nice and decent man.«
Später kam seine Tochter herein, sie unterhielten sich eine Weile, er forderte sie auf, mit mir deutsch zu sprechen, aber sie weigerte sich, und sie verabschiedete sich mit einem »I love you, Papa« von ihm. Natürlich kann man sagen, das sei die amerikanische Art, kann es auch amerikanische Oberflächlichkeit nennen, aber ich dachte im selben Augenblick, in Tirol, in dem Dialekt, in dem ich aufgewachsen bin und der dem Dialekt so ähnlich war, in dem er aufgewachsen ist und seine Tochter aufgewachsen wäre, wenn er sich nicht zum Weggehen entschlossen hätte, wäre ein solcher Satz nicht möglich gewesen, weil keine Wendung dafür vorgesehen war. Vielleicht hatte es allein schon deshalb mit dem Weggehen seine Richtigkeit gehabt, vielleicht auch hatte sich allein schon deshalb meine Reise in den amerikanischen Westen gelohnt.
Geschneit hat es nicht in den paar Tagen, die ich in Jackson verbracht habe, und es lag auch kaum Schnee dort, aber als ich von meinem Besuch ins Freie trat, waren auf der Piste am Rand des Städtchens die Schneekanonen in Betrieb. Ich hatte mich von dem alten Mann verabschiedet, zuerst auf englisch, aber dann sagte er »Pfiat di« zu mir, wie er es in Tirol getan hätte, und auch ich sagte »Pfiat di« zu ihm. Danach stand ich draußen in der Kälte, und es waren knapp minus zwanzig Grad, wenn ich die Fahrenheit richtig in Celsius umrechnete, zwei halbe Kontinente und ein Meer von zu Hause oder dem, was man so nannte, entfernt.
Es macht mir immer Mühe, die eigene Geschichte zu erzählen, ohne sofort auf den Gedanken zu verfallen, es könnte genausogut die Geschichte von jemand anderem sein und ich arbeitete statt einer Festschreibung einer Auslöschung zu. Wenn ich über meine Kindheit nachdenke, kann ich »ich« sagen oder »er«. Sooft ich »ich« sage, fällt mir als erstes ein, wie gut ich sein wollte, früh imprägniert mit Moral, vielleicht aus der Bibel, vielleicht aus einem kindlichen Wünschen und Glauben, mit dem wir Menschen, jedenfalls mit der Anlage dazu, womöglich schon auf die Welt kommen, und zudem ein langes Sündenregister, was ich alles angestellt hatte oder was mir vielleicht auch nur als Verfehlung angekreidet wurde und was ich am Ende zu allem Überfluss auch noch erfand, damit ich in der Beichte etwas vorzuweisen hatte. Wenn ich »er« sage, halte ich es fast nicht aus und denke: »Dieses Kind warst du«, »Dieses Kind sollst du gewesen sein«, und möchte noch heute meine schützende Hand über den Sechs-, Sieben- oder Achtjährigen halten in seiner Heimat- und Antiheimat-Gemengelage mit ihren Schrecknissen, aber auch Schönheiten und hänge gleichzeitig an der Nichtaustauschbarkeit meiner Kindheit, als würde ich, hätte ich die Wahl, paradoxerweise nicht einmal die Schrecknisse daraus verbannt haben wollen.
Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, gerade fünfhundert Meter von der Kirche am Dorfeingang bis zum letzten Haus, dem Haus hinter dem Hotel meiner Eltern, am Dorfende, wo die Straße nicht mehr weiterführte, war auch eine biblische Welt. In den Romanen von Willa Cather, die eine Präriekindheit in Nebraska hatte, gibt es Figuren, die in der Bibel lesen, als wären die darin geschilderten Ereignisse noch nicht so lange her, eine Empfindung, die ich nur zu gut kannte. Mehr noch als die Zeit aber betraf es den Ort, und das wiederum hatte ich später bei Lydia Davis gefunden, die in einer Erzählung nach den Erinnerungen eines Vorfahren eine Dorfwelt an der amerikanischen Ostküste beschreibt, eine jüdische Welt, neunzehntes Jahrhundert, die der Beschreibung nach genausogut meine katholische Kindheitswelt hundert Jahre später hätte sein können.
Zusammengefasst war das in ihren Worten eine Welt, in der Ägypten in einem nahe gelegenen Wäldchen lag, in der auch der Nil irgendwo in der Nähe vorbeifloss, in der das Rote Meer, nur gerade außer Sichtweite, irgendwo im Nordosten sein musste und der Palast des Pharaos nicht weit entfernt auf einer Anhöhe. Die Patriarchen lebten in den Feldern des Großvaters, und als Abraham in das Land kam, war es in der nordwestlichen Ecke einer Wiese, die jetzt dem Bruder gehörte. Jakob floh vor Esau und wurde in ebendieser Wiese von der Nacht eingeholt, in der Nähe eines Kirschbaums, und da sah er die Engel auf ihrer Leiter aus den Wolken herabsteigen und wieder in ihnen verschwinden.
Der Himmelsausschnitt, den man im Dorf meiner Kindheit zwischen den steil ansteigenden Hängen sehen konnte, war klein, aber der Himmel, den man nicht sah, war groß. Nach einer offiziellen Zählung lebten dort vier Jahre vor meiner Geburt, in dem Jahr, in dem mein Großvater starb, exakt hundert Leute, ob er da noch mitgerechnet worden war oder nicht. Dann schwankte die Zahl lange zwischen hundertzwanzig und hundertfünfzig, bis ich zuerst ins Internat und danach endgültig wegging, und mehr sind es auch seither nicht geworden.
Ich sitze im Hotel meines Großvaters, während ich dies schreibe, gegenüber steht das Hotel meiner Eltern, in dem ich aufgewachsen bin, Sommerbeginn, vor der offenen Balkontür das unaufhörliche Rauschen des Gebirgsbachs, das ich in meiner Kindheit nie richtig wahrgenommen habe, und ich habe gerade mit meinem Onkel Jakob gesprochen. Er hat mich, wie so oft, nach dem Buch gefragt, das er manchmal mein Buch nennt, manchmal sein Buch, manchmal unser Buch, und von dem ihm Leute sagen, ich hätte es nicht schreiben dürfen, während er selbst wohl nicht so recht weiß, was er davon halten soll, oder in seiner Meinung dazu hin und her wechselt, am Ende aber ganz offensichtlich auch stolz darauf ist. In dem Buch, bei dem es sich um mein erstes Buch handelt, in dem das Wort »Liebe« nur als Lexikoneintrag vorkommt, als ganzseitiges Zitat aus dem Duden, geht es um einen jungen Mann, der mit der Dorfwelt und mit sich selbst hadert, und die Hauptfigur trägt denselben Namen wie mein Onkel, sie heißt Jakob, und ja, es ist sein Name, und ich habe mir beim Schreiben hundertmal überlegt, ob ich sie nicht anders nennen soll, nicht anders nennen muss, bin aber zum Schluss gekommen, dass ich sie gar nicht anders nennen kann, weil sie auch meinen Namen trägt.
Denn ich bin mit der Prophezeiung großgeworden, ich sei der zweite Jakob und es werde schlimm mit mir kommen, wie es schon mit meinem Onkel schlimm gekommen sei, wenn ich mich weiter vor allen Leuten versteckte, wenn ich mich vor jeder Arbeit drückte, wenn ich mich anstellte wie ein Taugenichts und Tunichtgut und den ganzen Tag den Kopf nicht aus meinen Büchern bekäme. Ist es mir lange so erschienen, als könnte ich meine Kindheit allein erzählen als den Versuch, diese Prophezeiung von mir abzuwenden, kommt es mir mehr und mehr so vor, als ginge es eher darum, sie zu erfüllen. Mein Onkel Jakob ist nie einer geregelten Arbeit nachgegangen, außer vielleicht in seinen paar Jahren mit dem Saumpferd, das er in die Berge geführt hat, und den paar Jahren als Skilehrer in der Skischule meines Vaters, bis er dort nicht mehr zu haben war, wie es hieß, die paar Skilehrerjahre, die auch ich in meiner Biografie habe, auch mit dem ewigen Nachruhm im Dorf, dass ich eigentlich nicht dafür zu gebrauchen gewesen sei. Er hat davon geträumt zu singen, wie ich später davon geträumt habe zu schreiben, und ist meistens nur zum Gespött der Leute mit seiner Ziehharmonika in den Tanzlokalen des Dorfes aufgetreten, während ich jetzt mit meinen Lesungen meine eigenen Auftritte habe, manchmal womöglich genauso haarscharf am Spott vorbei.
Ich habe den Titel Jakob der Letzte von Peter Rosegger bislang nicht gekannt, aber gerade jetzt stoße ich auf einen Hinweis auf das Buch. Darin ist von einem »alpenländischen Desperado« die Rede, »der gegen die Mächte der Zeit aufbegehrt und unterliegt«, einem »›Modernisierungsverlierer‹ par excellence« und dem »Prototypen des Amokläufers«. So viel davon auch auf meinen Onkel Jakob zutreffen mag, letzteres ist er gewiss nicht, aber mit seinem wirren Haarschopf und dem wilden Blick erinnert er mich manchmal an einen, der lange Zeit in einer Hütte im Wald gelebt haben könnte und plötzlich ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt wird.
Schon über achtzig, ist er vor zwei Jahren noch zu Fuß die drei Stunden ins Nachbardorf gegangen, wenn ihn niemand im Auto mitgenommen hat, hat dort die Nacht durchgemacht und ist dann die drei Stunden zu Fuß wieder zurückgegangen, oft mitten auf der Straße. Unser Nachname kommt in der Gegend häufig vor, und heute trägt er eine Trainingsjacke mit den Riesenlettern GSTREIN auf dem Rücken, das Geschenk einer Installationsfirma gleichen Namens, er trägt sie stolz, ja, mit der stolzen Behauptung, wie viele Leute dieses Namens es auch immer geben möge, er sei das Original. Dazu hat er nagelneue Turnschuhe an den Füßen, die er vor dem ersten Tragen in dicken Schichten mit Wandfarbe angepinselt hat, weil er sich lange schon weiße Turnschuhe wünscht, die jetzt modern sein sollen, wie er sagt, und leider nur farbige bekommen hat.
Der zweite Name für mich, gegen den ich meine ganze Kindheit lang angekämpft habe, war »Schmule«. Der damit verbundene Spott war so groß, dass man mich als Kind mit nichts anderem wütender machen konnte als mit dem Verdikt, mich so zu nennen. Von den Erwachsenen musste ich es hinnehmen, aber bei den anderen Kindern war meine Reaktion, dass ich ihnen ihre Spitz- und Spottnamen an den Kopf warf, die sich aber nie auch nur annähernd so gemein anhörten wie mein Schmule, oder ich stürzte mich mit meinen Fäusten auf sie und prügelte auf sie ein. Ich habe lange nicht darüber nachgedacht, wie ich zu dem Namen gelangt bin, es ist niemand mehr da, den ich fragen könnte, und die Spekulationen, die sich anstellen lassen, sind mir nicht geheuer, denn ich rede von der Wirklichkeit und nicht von einem Roman, und mit dem Namen Schmule, selbst als brutaler Spott gemeint, ist schnell eine Anmaßung verbunden.
Zu verdanken könnte ich den Namen einem Hotelgast haben, einem Stammgast vielleicht, der dann was in mir gesehen hätte? Auch könnte ich ihn, womöglich sogar ins Positive gewendet, wenn das nicht schon zuviel Hoffnung ist, von meiner Großmutter bekommen haben, die Dorfschullehrerin war, bevor sie meinen Gastwirt-Großvater geheiratet hat und selbst Gastwirtin geworden ist, und von der es heißt, dass ich ihr Lieblingsenkel gewesen sei und dass sie mich deshalb mit Schokolade buchstäblich vollgestopft habe. Aber Schmule, warum sollte sie mich Schmule nennen? Nicht, dass ich mir etwas vormache. Ist vielleicht die schlimmste Erklärung die richtige, und würde die schlimmste Erklärung, wenn ich sie zuließe, nicht nur meine Kindheit, sondern mein ganzes Leben auf den Kopf stellen?
Das deutsche Verb »schmulen« habe ich nicht gekannt, und ich stoße erst jetzt bei meiner Suche im Internet darauf. »Heimlich schauen« finde ich als Bedeutung, beispielsweise wenn einer beim Kartenspielen einem anderen versteckt in die Karten blickt, aber auch »durch die Finger schauen«. Gebraucht wird oder gebraucht worden ist das Wort vor allem im Berlinerischen. Ich kann mir vorstellen, dass ich als Kind viel durch die Finger geschaut habe, schüchtern, verschämt und leutescheu, wie man es genannt hat, und ich wäre froh, wenn das schon die ganze, die ganze harmlose Erklärung wäre, aber dann steht bei der Herkunft des Wortes einerseits: »ungeklärt«, aber andererseits doch auch: »wahrscheinlich vom jüdischen Schmul, veraltete Bezeichnung für Jude.«
Ich sitze im Hotel meines Großvaters und weiß um die Schwierigkeit einer solchen Inanspruchnahme, es gibt längst schon wieder zu viele Deutsche in Deutschland und zu viele Österreicher in Österreich, die ihre Geschichte mit den Juden von der falschen Seite aufzäumen, und muss mich jetzt doch fragen, was wäre, wenn mich die Erwachsenen im Dorf in vollem Bewusstsein, woher das Wort kommt, meine ganze Kindheit lang Schmule genannt hätten, und in welchen Abgrund ich dann blicken würde. Würde das nicht erklären, warum ich damals intuitiv begriff, dass dieser Spottname die krasseste Ächtung bedeutete und dass ich mich deswegen mit Händen und Füßen dagegen wehrte, und müsste ich als Folge den allerersten Satz meines ersten Buches, der »Jetzt kommen sie und holen Jakob« lautet, nicht noch einmal ganz anders lesen, als ich ihn geschrieben habe? Draußen rauscht immer noch der Gebirgsbach, und ich frage mich, warum ich mir diese Frage nicht schon früher gestellt habe, warum mich erst das Verfertigen dieser Sätze auf diese Gedanken bringt, die einen Blick auf eine Welt vor meiner Geburt andeuten wie hinter Milchglas, eine Welt, die wirklich sichtbar zu machen mir die richtigen Gedanken und richtigen Sätze noch fehlen.
Es gibt ein Foto, auf dem mein Vater, meine Onkel und meine Tanten abgebildet sind, das einzige Foto, auf dem auch meine Tante Angela zu sehen ist, die mit zehn Jahren an einer Gehirnhautentzündung gestorben ist, und auf diesem Foto sieht mein Onkel Jakob auffallend anders aus als seine Geschwister. Er ist heller, hat helleres Haar, feinere Gesichtszüge, ist in seiner ganzen Anmutung weniger dorfjungenhaft, weniger bäurisch, mein Onkel Jakob, der gerade heute wieder von sich gesagt hat, dass die Leute von ihm gedacht hätten, er sei dumm, er sei nicht richtig im Kopf, und dass es sich in Wahrheit ganz anders verhalte, dass er sie alle in die Tasche stecke, wenn er nur wolle, um dann verschmitzt den Satz folgen zu lassen, den er schon oft geäußert hatte, der mich mit einschloss und den ich von ihm am meisten liebte: »Solche wie uns zwei hat es nie gegeben.« Auf diesem Foto, aufgenommen ziemlich genau zu Beginn des Krieges, auf dem sie alle mit kurzen Hosen und dicken, wahrscheinlich kratzigen Wollstrümpfen zu sehen sind, die beiden Mädchen mit dunklen Zöpfen, hat er beinahe etwas Städtisches, und wenn ich jetzt nur einen Gedanken weiter denken, einen Satz weiter schreiben würde, wäre das schon wieder der Anfang eines Romans, in dem meine Großmutter einen geheimen Liebhaber gehabt hätte, der irgendwann in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ins Dorf gekommen sein könnte, womöglich ein Amerikaner oder sonst einer, der später nach Amerika gegangen wäre.
Nur wenige Schritte vom Grab meiner Großeltern und vom Grab meiner Eltern gibt es auf dem Dorffriedhof direkt an der Friedhofsmauer auch ein amerikanisches Grab, jedenfalls für mich, während es in Wirklichkeit genausogut ein englisches sein könnte und ich mich nur nicht weiter erkundige, um meiner Phantasie nicht den Boden zu entziehen. Es hat ein schmiedeeisernes Kreuz wie alle anderen, und die halb verblasste Inschrift auf seinem Schild lautet: »In loving memory of Jack Howard and Kenneth Armstrong, who lost their lives in these mountains, January 3rd, 1935. Good friends they rest together.« Diese Worte waren wohl meine erste Berührung mit der englischen Sprache, die mir manchmal näher geht als das Deutsche und mich kindisch wünschen lässt, ein amerikanischer Schriftsteller zu sein, und ich kann mich schwindlig denken an dem Gedanken und an der Folgenlosigkeit des Gedankens, dass 1935, das Todesjahr von Jack Howard und Kenneth Armstrong, auch das Geburtsjahr des alten Mannes in Jackson, Wyoming, war und um ein einziges Jahr nur das Geburtsjahr meines Onkels Jakob, der 1934 geboren ist.
Das Grab meiner Eltern erinnert mich daran, dass ich fast auf den Tag gleich alt bin, wie mein Vater zum Zeitpunkt seines Todes war, und müßige Zahlenspielereien, aber ich phantasiere mir zusammen, dass erst jetzt, dreißig Jahre nach seinem Tod, dreißig Jahre auch nachdem mein Buch über Jakob erschienen ist, mit jedem Tag, den ich ihm im Alter vorangehe, die vaterlose Zeit erst richtig beginnt. Abgesehen davon, dass es sich dabei um einen fast schon zu hübschen, literarischen Gedanken handelt, ist es die Wahrheit, und ich kann nur schwer ausweichen, sollte ich gefragt werden, ob ich nicht endlich bereit sei, für mich selbst einzustehen. Denn ich bin demnach wohl wirklich kein Kind mehr, wenn ich im November wieder nach Wyoming fahre, auf der Suche nach der dort vielbeschworenen »solace of open spaces«, was ich lieber unübersetzt lasse, auf der Suche nach Schnee.
Zweiter Teil
… UND EXISTIERE ODER EXISTIERE NICHT …
Die ohne Not gesagte Wahrheit
Welterzeugung beginnt mit einer Version
und endet mit einer anderen.
Nelson Goodman, »Weisen der Welterzeugung«
Ich komme über einen sehr weiten Umweg nach Göttingen, und vielleicht kann dieser Umweg meinen ganzen Lebensweg beschreiben, ohne dass ich sagen könnte, ich hätte jeweils oder vielleicht auch nur je einmal die richtigen Entscheidungen getroffen, wenn es denn Entscheidungen waren. Eigentlich hätte ich schon vor vielen Jahren hier sein wollen, am Anfang meines Mathematikstudiums, als kindischer Schwärmer für Gauß, aber ich hatte mich trotz des Wunsches, in Göttingen zu studieren, von den wahrscheinlich gar nicht so hohen bürokratischen Hürden, die ich als Österreicher zu überwinden gehabt hätte, meiner Ängstlichkeit und der Aussicht, vielleicht abgelehnt zu werden, einschüchtern lassen. Denn noch lange, jedenfalls Jahrzehnte nach dem Tod von Gauß war es fast ein Muss gewesen, wenigstens ein paar Monate in Göttingen zu verbringen, wenn man als Mathematiker etwas auf sich hielt oder auch nur etwas werden wollte. Man pilgerte an den Ort, an dem der mit dem für heutige Verhältnisse etwas lächerlichen Titel »Fürst der Mathematiker« bedachte Gauß gelehrt hatte, wie man zu seinen Lebzeiten die eigenen Arbeiten an ihn schickte, manchmal ohne eine Antwort zu bekommen, und manchmal bekam man nur die niederschmetternden Zeilen, was man da gemacht habe, sei ja schön und gut, aber er, Gauß, habe das schon vor Jahren selbst gemacht. Zumindest war das der Mythos, der mich in der hundertmal abgeschwächten und gleichzeitig verstärkten Form eines Märchens in der Tiroler Provinz erreichte.
Wahrscheinlich hängt einem in Göttingen das ewige Reden von Gauß längst zum Hals oder zu den Ohren heraus, aber ich kann es immerhin damit rechtfertigen, dass ich, ein Manko und also mit allen Vorbehalten, dank Wikipedia einen eleganten kleinen Schlenker zu Lichtenberg zu machen vermag, dem Namensgeber dieser Poetikvorlesungen. Denn dort ist vermerkt, dass Gauß im Sommersemester 1796 bei Lichtenberg, der zu der Zeit Ordinarius für Physik war, Experimentalphysik und sehr wahrscheinlich im Wintersemester darauf Astronomie belegt hatte. Die Vorstellung ist schön, Gauß als Student bei Lichtenberg, der währenddessen seine Sudelbücher schrieb, mit Erkenntnissen, was er über sich wusste und was er über sich und erst recht über andere nicht wissen konnte, und der Überzeugung, dass das seinen Zeitgenossen nur in geringen Dosen zuzumuten wäre, weil er, Lichtenberg, selbst schon Entsetzen vor der eigenen Person empfand, sich schämte und fürchtete, seine Aufrichtigkeit würde bei Lesern nur um so mehr Unverständnis und Scham auslösen, »Mitscham«, wie er es nannte, das heutige Fremdschämen wohl.
Ich war jedenfalls ein vierzehn-, fünfzehn-, sechzehnjähriger Internatsschüler, sehr verschlossen, sehr auf mich gestellt, und verbrachte meine Nachmittage damit, mich mit ungelösten und tatsächlich unlösbaren mathematischen Problemen zu beschäftigen. Das war der Titel eines Bändchens gewesen, Ungelöste und unlösbare mathematische Probleme, das auf welchem Weg auch immer in die Papier- und Buchhandlung des Bezirksstädtchens gelangt war, in dem ich zur Schule ging. Dort hatte ich es entweder gekauft oder wie manche der von mir blindlings geliebten, aber damals für mich ebenso unerschwinglichen wie noch unverständlichen Mathematikbücher eher wohl geklaut, und selbstverständlich wollte ich mindestens eines der ungelösten und, noch besser, eines der unlösbaren Probleme lösen.
Außerdem war ich im Besitz eines schmalen Bandes mit Tagebuchaufzeichnungen von Gauß in lateinischer Sprache, mehr ein Arbeitsjournal als ein Tagebuch, das sich mit privaten Ereignissen beschäftigte, auch wenn ich mich vage an den Eintrag »Ein Kind ist uns geboren« erinnere, der neben irgendeiner mathematischen Großtat des Tages stand, und eine Weile trug ich eine Fünf-Mark-Münze mit dem Bildnis von Gauß offen über der Brust, um allen unmissverständlich klarzumachen, wer ich war und was mich antrieb. Ich habe keine Ahnung, woher ich den Wagemut nahm, sie mir umzuhängen. Die Vorstellung, dass ich so etwas einmal allen Ernstes getan hatte, lässt mich immer noch verschämt den Blick senken. Doch ich hatte sie mir lochen lassen und sie an einer Kette befestigt, und sie nahm eine Weile den Platz ein, den nicht lange davor noch der Schutzengel eingenommen hatte, allerdings unter dem Hemd, das Allerheiligste, an dessen Zügel ich seit meiner Geburt oder meiner Taufe hing und das ich bei einer Balgerei im Freibad verloren hatte.
Die Münze, es kommt noch dicker, fast schon wie in einem sehr schlechten, auf die falschen Effekte hingebogenen Roman, war das Geschenk eines Mönchs gewesen, der mir den Hof gemacht hatte. Ich hatte ihn ein paar Wochen lang getroffen und mir von seiner Aufmerksamkeit schmeicheln lassen, weil es doch einen Grund geben musste, dass er ausgerechnet mich auserwählt hatte. Dabei konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass er mehr von mir wollen könnte, als mit mir am Fluss spazieren zu gehen und mich in religiös esoterische Gespräche zu verwickeln, in denen es immer um das Ganze ging, um Sinn und Unsinn des Lebens.
Mit diesen Erinnerungen an meine Anfänge als Möchtegernmathematiker stehe ich als ziemlich verschwommene Erscheinung vor meinen eigenen Augen, alles in allem ein pathetisches Bild des Künstlers als junger Mann, wenn ich ein Künstler wäre oder auch nur einer sein wollte und nicht in Wirklichkeit den Begriff mehr fürchten würde als jede andere Zuschreibung, die ich mir einhandeln könnte. Alles durfte man mich nennen, selbst einen Verbrecher oder Versager, solange es nicht Künstler war, um gar nicht davon zu reden, dass ich zu Mordphantasien neigte, wenn mich jemand einen Kulturschaffenden nannte oder glaubte, ich würde zur Gruppe der Kulturschaffenden gehören, in der das immer bloß eingebildete Genie seinen Frieden mit der Beamtenseele schließt. Zudem würde ich liebend gern behaupten, ich hätte mich aus einer klaren Entscheidung von der Mathematik ab- und der Literatur zugewandt, aber das stimmt nicht, und es stimmt erst recht nicht, wenn ich daraus eine moralische Entscheidung machen oder nahelegen würde, ich hätte mich von einem weniger wahren Zugang zur Welt zu einem wahreren bekehrt.