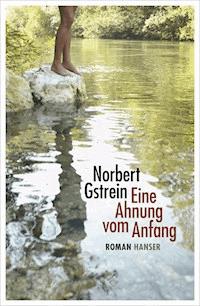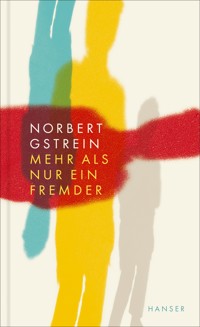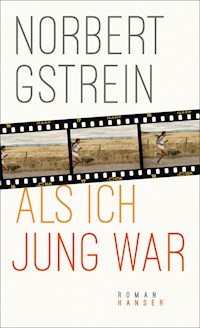Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Über Norbert Gstrein sprechen heißt über Identitätsspiele sprechen.“ Hubert Winkels in seiner Laudatio zum Düsseldorfer Literaturpreis 2021 Wer liebt Ines? Von all ihren Männern keiner so wie Elias. Bloß dass der ihr Bruder ist. Noch jeden Liebhaber seiner Schwester hat er an sich gezogen und wieder weggestoßen. Als alle zuhause bleiben sollen und die Welt kurz wie eingefroren ist, besucht Carl, der wie Elias Flugbegleiter ist, die Geschwister. Doch es streicht noch ein Mann ums Haus, und plötzlich sind jeder Blick und jede Berührung aufgeladen. Was alles hat Elias für seine unmögliche Liebe zu Ines in seinem Leben bereits getan? Was wird Ines Carl antun? Ein alles mit sich reißendes, weit in die Welt ausgreifendes Kammerspiel über Rassismus und Misogynie – ein Blitzlicht in unsere Tage, voller Schönheit und Provokation, Spannung und Trauer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Über Norbert Gstrein sprechen heißt über Identitätsspiele sprechen.« Hubert Winkels in seiner Laudatio zum Düsseldorfer Literaturpreis 2021Wer liebt Ines? Von all ihren Männern keiner so wie Elias. Bloß dass der ihr Bruder ist. Noch jeden Liebhaber seiner Schwester hat er an sich gezogen und wieder weggestoßen. Als alle zuhause bleiben sollen und die Welt kurz wie eingefroren ist, besucht Carl, der wie Elias Flugbegleiter ist, die Geschwister. Doch es streicht noch ein Mann ums Haus, und plötzlich sind jeder Blick und jede Berührung aufgeladen. Was alles hat Elias für seine unmögliche Liebe zu Ines in seinem Leben bereits getan? Was wird Ines Carl antun? Ein alles mit sich reißendes, weit in die Welt ausgreifendes Kammerspiel über Rassismus und Misogynie — ein Blitzlicht in unsere Tage, voller Schönheit und Provokation, Spannung und Trauer.
Norbert Gstrein
Vier Tage, drei Nächte
Roman
Hanser
Every now and then I fall apart.
Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart
Erster Teil
SIE IST MEINE SCHWESTER
ERSTES KAPITEL
Keiner von diesen Idioten hat Ines geliebt, wie ich sie geliebt habe und nach wie vor liebe, aber dass sich wiederholt einer fand, der sich das einbildete, ist eine andere Geschichte. Ich hatte oft mit ihr darüber gesprochen, ob sich heute überhaupt noch glaubwürdig ein solches Drama ausdenken lasse wie in einem der großen Ehebruchsromane des neunzehnten Jahrhunderts, wo es immer Frauen waren, die an ihren Sehnsüchten zugrunde gingen, ob in unserer Zeit so etwas geschrieben werden könne, ohne dass es von Grund auf lächerlich sei, und sie hatte stets gesagt, selbstverständlich nicht, Liebe in diesem Sinn gebe es ja nicht mehr und man sei gut beraten, sich in Sicherheit zu bringen, wenn einer davon spreche, weil sich dahinter meistens etwas anderes verberge, und das Drumherum, das ganze Gebräu aus Macht und Eifersucht, sei ekelhaft, unkontrollierte Leidenschaft, eine einzige Peinlichkeit. Man müsste die Geschichte hinter den Mond verlegen, aber die erdabgewandte Seite des Mondes interessiere einzig und allein die Sternengucker, und es ginge vielleicht nur mit einem Element von ganz außen, das auf unerwartete Weise eine Drucksituation erzeuge. Ich entgegnete dann jedesmal: »Und meine Liebe, Ines?«, und sie sagte: »Deine Liebe, Elias?«, sagte: »Unsere Liebe?«, und lachte: »Wie sollte die davon berührt sein?«
Natürlich gebrauchten wir das Wort immer in unterschiedlicher Weise. So, wie ich es tat, vermochte ich es nur auf sie anzuwenden, und es stimmte beides, ich liebte Ines, weil sie meine Schwester war, und ich liebte Ines, obwohl … während ich bei ihr nicht sicher war, ob sie es nicht auf die halbe Welt anwenden konnte. Auf jeden Fall musste sie wissen, wovon sie sprach, schließlich galt sie als Expertin. Denn sie war dabei, sich über die romantische Liebe in der deutschsprachigen Literatur zu habilitieren, und hielt seit Jahren einschlägige Vorlesungen zu dem Thema, aber ob sie das auch im Leben klüger machte, wage ich nicht zu beantworten. Ich hatte eine ganze Reihe ihrer Liebschaften aus allernächster Nähe mitbekommen, doch es bedeutete für mich nicht weniger als den Ausnahmezustand, dass sie sich mit ihren fünfunddreißig Jahren von neuem auf eine solche Affäre eingelassen hatte. Zu oft hatte ich ihr helfen müssen, die Dinge zu Ende zu bringen, nicht allein in unserer Studienzeit, sondern auch danach noch einmal, viel später, als sie auf diesen schockverliebten Schriftsteller hereingefallen war, der zum Dank tagelang ihr Haus belagert hatte, als sie ihn endlich loswerden wollte.
Aber eines nach dem anderen, und das eine war, dass ich meine Stelle, je nachdem, aufgegeben oder verloren hatte, wie auch nicht, als Flugbegleiter oder doch lieber Steward, wenn es seit Monaten kaum mehr Flugzeuge am Himmel gab, das andere, dass Ines mir angeboten hatte, ein paar Tage zu Besuch zu kommen oder überhaupt zu ihr nach Berlin zu ziehen, wenn ich meine Wohnung in München auflösen wolle, eine Weile bei ihr unterzuschlüpfen, bis ich wisse, wie es mit mir weitergehe, obwohl ich das auch ohne das Virus nicht gewusst hatte und in den letzten fünf Jahren einfach geflogen war und in jeder Beziehung viel Zeit in der Luft verbracht hatte. Ich war gleich im Frühjahr erkrankt, zuerst kaum Symptome, Kopfschmerzen und Müdigkeit, ja, dann wegen zu hohen Fiebers einer Einweisung in die Klinik nur gerade noch entkommen, und es waren Wochen geworden, bis ich wieder soweit gewesen wäre zu fliegen, aber da flog beinahe nichts mehr. Nicht, dass mich das sonderlich traf, ich hatte bereits davor immer wieder ein paar Monate ausgesetzt, wenn mich der Trott des Alltags unterzukriegen drohte, und entschloss mich, das auch jetzt zu tun, eine Durststrecke, die ich wie im Winterschlaf verbrachte, selbst wenn es Sommer war, und als ich endlich wieder aufwachte, gab es meine Stelle nicht mehr und war es Herbst, und die Zahlen, die viel zu lange schon das Leben aller bestimmten, gerade noch verschwindend klein, waren von neuem beängstigend in die Höhe geschossen.
Ich hätte mich auch ein paar Wochen zu Hause in Tirol verstecken können, wie ich es in den vergangenen Jahren bei Bedarf getan hatte, aber die Zusammenstöße mit meinem Vater waren so häufig und absehbar geworden, dass ich oft schon gedacht hatte, ein kleiner Anlass genügte und es würde zu Handgreiflichkeiten zwischen uns kommen, weshalb ich froh um Ines’ Angebot war. Dass er sein Blutdruckmessgerät aus der Schublade unter dem Fernseher hervorholte, wie er es in meiner Kindheit oft getan hatte, wollte ich mir gar nicht mehr ausmalen, seinen Blick, wenn er die Manschette um seinen Oberarm legte und mit der anderen Hand pumpte, als genügte meine Existenz, um ihn auf hundertachtzig oder zweihundert oder noch weiter zu bringen. Er hatte im März einen Hotspot im Haus gehabt, zehn Gäste, die sich dort angesteckt und das Virus über halb Europa verbreitet hatten, und dass er jetzt den Ausfall der Wintersaison befürchten musste, konnte ihn nur noch unberechenbarer machen, ein zusätzlicher Grund, seine Nähe bis auf weiteres zu meiden. Es war weniger, dass er das entgangene Geschäft nicht zu kompensieren vermochte, da fanden sich immer halb vergessene Konten, mit denen sich das ausgleichen ließe, weniger das Ökonomische, als dass er mit der vielen freien Zeit nichts anzufangen wüsste und ich sicher der erste gewesen wäre, an dem er sich abreagiert hätte.
Außerdem konnte ich sein ewiges Gejammer längst nicht mehr hören, wann ich endlich meinen Mann stünde und bereit sei, Verantwortung zu übernehmen, und hatte Erstickungsgefühle, wenn er das Wort »Gastbetrieb« oder das Wort »Familienbesitz« ins Spiel brachte oder mit dem Andenken meiner Mutter kam, die gar nichts damit zu tun hatte, und auf seine unnachahmliche Weise sagte, bloß um einen Servierwagen herumzuschieben, brauchte ich nicht sinnlos herumzufliegen, das könne ich auch in seinem Speisesaal tun, gern in einem verdammten Schürzchen, wenn mir das gefalle, für Turbulenzen würde schon er sorgen. Es langweilte mich eher, als dass es mich abstieß, wenn er sich im einen Augenblick darauf versteifte, ich solle die Hütte übernehmen, wie er sich ausdrückte, das Hotel, das in Wirklichkeit das beste Haus weitum war, in der Gegend das einzige mit fünf Sternen, und im nächsten zu dem Schluss kam, ich sei gar nicht fähig dazu. Das war leicht durchschaubares Patriarchengehabe, Angst und Wunsch in einem, und ich benötigte keine Erklärungen, um zu verstehen, dass solche Kaliber wie er Söhne nur in die Welt setzten, um ihnen systematisch zu beweisen, dass sie Versager waren, eigentlich nicht einmal eine Erkenntnis, sondern die ewige Prämisse, aus der die eigene Unersetzbarkeit folgte. Meine Ambitionen, ihn dereinst beerben zu wollen, hatte er auf eine Anekdote geschrumpft, die mich mit Scham erfüllte, wann immer er glaubte, sie erzählen zu müssen, und nach der ich als Vierjähriger mit vollen Hosen angeblich mein Kindermädchen angeherrscht hätte: »Hopp, marsch! Ausputzen! Ich bin der Chef!«
Zugegeben, er hatte mir geduldig zugeschaut, wie ich mein Studium verbummelte, und meine Ausrede hingenommen, ich würde nur deshalb nichts zustande bringen, weil ich ihm selbst mitten im Semester jederzeit zur Verfügung stehen müsse, wenn ihm Personal fehle. Er hatte gesagt, ich brauchte keinen Abschluss, er habe auch keinen und könne nicht sehen, dass ihm das schade, und hatte mir dann eine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten in Amerika verschafft, die ich jedoch abbrechen musste, und wenn er jetzt gefragt wurde, was ich machte, antwortete er mit dem Standardsatz: »Elias fliegt.« Dahinter steckte einerseits Sarkasmus, andererseits aber die Hoffnung, dass niemand genauer nachhakte und sich keiner etwas anderes vorstellen konnte, als dass der Spross eines Hoteliers in dritter Generation, wie er einer war, selbstverständlich Pilot wäre, wenn er schon professionell flog, und nicht eine lächerliche Luftkellnerin. Das sagte er immer in der weiblichen Form, auch weil ihm nicht entgangen war, dass die Leute irgendwann angefangen hatten, mich eher wegen meiner Art, mich zu bewegen, als wegen meiner Kleidung Styling zu nennen. Vor der »Stewardess« schreckte er zurück und blieb lieber beim »Steward«, bis er das andere Wort lernte. Denn dann titulierte er mich nur mehr als Saftschubse oder lästerte, bei dieser Tätigkeit reiche es nicht einmal für einen Hampelmann, weil ich dafür ein Mann sein müsste und nicht eine Witzfigur, die auf zehntausend Metern über dem Meer jederzeit aus ihrem Dösen gerissen werden konnte, bloß weil es einen Halbbetrunkenen in der Business Class nach einem letzten Gin Tonic verlangte.
Ines wusste natürlich von alldem und amüsierte sich darüber, weil sie sich weigerte, auf solche Spielchen einzugehen, bestand aber doch darauf, es sei ihre Pflicht, mich aus seinen Fängen zu retten. Wir hatten verschiedene Mütter, ihre Mutter stammte aus Koblenz und war zum Skifahren ins damals noch bezahlbare Hotel unseres Vaters gekommen, genau als meine Mutter mit mir schwanger war, und es lagen bloß vier Monate zwischen uns, was uns nicht nur zu Halbgeschwistern, sondern fast zu Halbzwillingen machte, ein Unding, nicht weniger scheußlich als zwei Doppelhaushälften. Das Wort war Ines eingefallen, und sie machte sich überhaupt gern über dieses Gepansche lustig, um den Ernst zu untergraben, meinte abwehrend, sie möchte mit diesem stickigen Milieu und dieser wahlweise Stall- oder Kuhwärme einer Familie, die keine war, nichts zu tun haben, und kehrte ihren Stolz als ungewolltes Kind hervor, das schon allein seinen Weg in der Welt finden und von niemandem etwas anderes verlangen würde, als mit dem ganzen Unsinn in Ruhe gelassen zu werden.
Die Geschichte dahinter war eine Geschichte aus einer anderen Zeit, und es brauchte schon einen Helden wie unseren Vater, damit die Hauptrolle glaubwürdig besetzt werden konnte. Er hatte auf die Nachricht von der Schwangerschaft kühl reagiert und zu Ines’ Mutter gesagt, er wolle sich nicht einmischen, es sei ihre Sache, sie müsse entscheiden, wie sie damit umgehe, er könne ihr weder raten, das Kind zu behalten, noch, es wegmachen zu lassen. Wie um ihr zu beweisen, dass sie jede Freiheit habe, hatte er hinzugefügt, zu welchem Schluss auch immer sie gelange, er unterstütze sie drei Jahre lang, unerschütterlich in seinem ewigen Glauben, dass sich mit Geld alles regeln lasse, und der Haltung, dass er zahlen konnte und damit das Sagen hatte und nur freiwillig darauf verzichtete.
Ines’ Mutter war davon so getroffen gewesen, dass sie ihn wissen ließ, sie würde abtreiben, und den Schein auch noch aufrechterhielt, als das Kind längst auf der Welt war, indem sie unserem Vater gegenüber genau drei Jahre lang behauptete, sie habe abgetrieben. Tatsächlich kam erst danach der Brief ihres Anwalts mit einer Kopie der Geburtsurkunde und der Aufforderung, zum Ersten des folgenden Monats mit den regulären Zahlungen zu beginnen. Dann dauerte es noch einmal drei Jahre, bis unser Vater Ines zum ersten Mal zu Gesicht bekam, sein fast abgetriebenes Kind, und bis auch ich sie zum ersten Mal sah, ohne dass wir eingeweiht wurden, weder sie noch ich wusste zu der Zeit und auch Jahre danach, dass wir Bruder und Schwester waren, um das unnötige »Halb-« ein für alle Mal wegzulassen.
Für unseren Vater, von eher schwächlicher Konstitution, aber in seinem Selbstverständnis trotzdem ein Rabauke, war es nicht die erste solche Angelegenheit. Denn er hatte davor schon seine sechzehnjährige Küchenhilfe von jenseits der Grenze geschwängert, von wo unsere Leute ursprünglich kamen und von wo sie anfangs noch lange ihre Frauen und später ihre Bediensteten holten, was manchmal ohnehin ein und dasselbe bedeutete, und wir hatten dort also noch eine Schwester, Emma mit Namen. Deren Mutter war zu spät ins Krankenhaus gebracht worden, deshalb hatte es bei ihrer Geburt Probleme mit der Sauerstoffversorgung des Gehirns gegeben, sie brauchte Betreuung und lebte in einem Heim, und das war etwas, dieses andere Kind, über das man mit unserem Vater nicht reden konnte und von dem ich zuerst auch nur gerüchteweise erfahren hatte. Er wurde fuchsteufelswild, wie es hieß, wenn man ihn darauf ansprach, und hatte Emma selbst nie gesehen, nur Jahr für Jahr, auch da, seine Überweisungen getätigt und mit regelmäßigen Extrabeträgen alles zuzudecken versucht, aber sonst jede Verbindung abgebrochen. Es waren keine fünfzig Kilometer über die Berge, in der Luftlinie weniger, in den schneefreien Monaten kaum eine Stunde über die Passhöhe, und das hieß, dass es in jedem Jahr viele Tage gab, an denen unser Vater bloß endlich den Entschluss hätte fassen und sich in sein Auto setzen müssen, um einen kleinen Ausflug zu unternehmen und sich um sie zu kümmern.
Vielleicht lag auch darin ein Grund, dass ich Ines später so oft erzählt hatte, und sie war nie müde geworden, es sich anzuhören, wie ich sie selbst an der Hand ihrer Mutter hatte in der Hotelhalle stehen sehen, als sie schließlich zu Besuch gekommen waren, ein sechsjähriges Mädchen mit dem blassesten Gesicht, das man sich vorstellen konnte. Die Haare von einem Blond, für das ich erst nachher das richtige Wort fand, »belgisch blond« für das »extra blond«, wie es auf belgischen Bierflaschen stand, die Augen gelblich grün, ein Gelb und ein Grün, die sich in ihrem Kleid wiederholten, und sie trug auffallend rote Schnallenschuhe wie aus dem Museum, die zu der Zeit ihr ganzer Stolz waren, die Schuhe einer Infantin. Ich hätte schwören können, dass sie ihre Fingernägel lackiert hatte, und wenn mich meine Erinnerung nicht trog und es nicht bloß eine nachträgliche Übermalung des Gesehenen war, die mehr erklären sollte, als sie konnte, betraf es nur die Nägel ihrer rechten Hand, während die der linken bis auf die Haut abgeknabbert und blutig verschorft waren, aber daran entzündete sich jedesmal unser spielerischer Streit.
»Willst du behaupten, dass ich eine Idiotin war?«
»Du warst ein sechsjähriges Kind, Ines.«
»Nur Idiotinnen lackieren sich die Nägel, und wie du dir denken kannst, war ich mit sechs Jahren längst kein Kind mehr, das auch noch so blöd ist, daran herumzuknabbern.«
Ich lachte und sagte, wie sie es sich erwartete, dass ich schon damals alles an ihr wahrgenommen hätte, was sie ausmache, ihre ganze Verrücktheit, ihre Zartheit und vermutlich, ohne mir darüber im klaren zu sein, auch schon eine Spur ihrer Kälte.
»Bin ich dumm, bin ich hässlich? Was ist los mit dir, Elias? Meine Klugheit und meine Schönheit sind dir keine Silbe wert?«
Auch darauf sagte ich, was ich sagen musste, es gebe keine Worte, und natürlich kannte ich ihre Antwort.
»Dann erfinde welche«, sagte sie. »Sag es in einer anderen Sprache. Das kann doch nicht so schwer sein! Nimm ein paar Buchstaben und setz sie neu zusammen.«
Wir hatten über die Jahre eine Regel daraus gemacht, uns durch dieses Frage-Antwort-Spiel zu hangeln, wenn wir uns länger nicht gesehen hatten, aber diesmal winkte sie ab und meinte, ich solle hereinkommen, wir könnten uns nachher beschnuppern, als ich unsinnig und sentimental wie im Schlager mit meinen Artigkeiten anfangen und dann auch noch zum gewiss hundertsten Mal sagen wollte, ich hätte sie bei unserem ersten Treffen kaum gesehen gehabt und mir schon gewünscht, sie wäre meine Schwester. Sie stand in der Tür, ihre Haare nachlässig zusammengebunden, in Trainingshose und Sweatshirt, wie immer, wenn sie zu Hause oder dort, wo sie sich gerade einquartiert hatte, arbeitete, hatte ihr Telefon am Ohr und hielt mir die Wange zum Kuss hin, während sie mir fröstelnd deutete, mich um die Abstandsregeln nicht zu scheren, und in den Hörer sprach: »Es ist mein Bruder«, und gleich darauf, leicht unwillig: »Ich habe dir doch von ihm erzählt.« Das hätte ich noch überhören können, aber nach ein oder zwei Sekunden war es bereits: »Warum sollte ich dir so etwas verschweigen?« Dabei klang ihre Stimme heiser, als hätte sie von einem Augenblick auf den anderen gefrorene Splitter in der Kehle, drohte diesen eisigen Ton anzunehmen, wie ich es oft erlebt hatte, so dass es ihr nur eben noch gelang, sich mit einem »Lass uns später weitersprechen!« zu verabschieden.
»Dein Neuer?«
Ich war eingetreten, und sie hatte kaum die Tür hinter uns zugedrückt, als sie das schon in Zweifel zog.
»Wenn er sich so aufführt, bin ich alles andere als sicher, ob er das ist«, sagte sie. »Ich muss mich vor dem Idioten doch nicht dafür rechtfertigen, dass ich jemanden im Haus habe.«
Ob ich wollte oder nicht, hatte ich damit sofort wieder meine alte Vermittlerrolle, die jederzeit in die eines Richters umschlagen konnte, wenn es nichts mehr zu vermitteln gab.
»Natürlich musst du nicht.«
»Sage ich doch!« sagte sie. »Aber wie soll ich das einem klarmachen, der mich rund um die Uhr aus der Ferne überwacht?«
Darauf umarmte sie mich richtig und meinte, wie ich wisse, sei sie hier in Klausur, was einer Quarantäne gleichkomme, und wie sie mich einschätze, hätte ich seit einer halben Ewigkeit mit keinem Menschen Kontakt gehabt, so viel zu erstens und zu zweitens, und drittens sollten wir wenigstens die Chance haben, gemeinsam zu sterben, am besten ohne die vier Monate Respektabstand wie bei unserer Geburt, wenn es schon soweit sei, wie sie einem in den Nachrichten jeden Abend weiszumachen versuchten.
»Also hör auf, dich zu zieren, und komm endlich her. Die Verordnung, die mich von dir fernhalten kann, muss erst erfunden werden, Elias! Es ist gut, dich zu spüren.«
Sie legte ihren Kopf auf meine Schulter, und ich atmete den Geruch ihres Shampoos ein, das sie sich aus England schicken ließ und das ich selbst verwendete, seit es für mich der Geruch geworden war, der mich an sie erinnerte. Dann beugte sie sich zurück, um mir in die Augen zu sehen, und ich war in der alten Zwickmühle. Ich versuchte ihrem Blick standzuhalten, diesem kaleidoskophaften Gefunkel, und kam gleichzeitig kaum gegen den Impuls an, wie hypnotisiert meine Lider zufallen zu lassen. Es war anders gewesen, als wir noch nicht gewusst hatten, was uns verband, jedesmal ein plötzlicher Schreck, anders auch in den Jahren danach, zuerst die ängstliche Freude, dann die zunehmende Schwere, und es war jetzt wieder anders und doch gleich, während sie sich von mir losmachte und mich sanft in die Rippen boxte.
»Nun sag schon, dass du mich vermisst hast!«
Ich sagte es, und sie sah mich abwartend an.
»Nur vermisst?«
»Ich habe dich sehr vermisst, Ines.«
»Das ist kein Grund, so zu schauen«, sagte sie. »Diese Wehmut steht dir nicht gut zu Gesicht. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht versuchen sollst, mich damit zu erpressen? Du tust ja, als könnte jederzeit die Welt untergehen und es läge an mir.«
Wir hatten uns Wochen nicht gesehen, und während wir uns warm redeten, erfuhr ich nach und nach mehr über ihren neuen Freund, der sich gleich darauf wieder telefonisch bemerkbar machte und so endgültig ihren Missmut zuzog. Angeblich war er Architekt, sie kannte ihn seit zwei Monaten, hatte ihn trotz der Kontaktbeschränkungen jeden Samstag getroffen und meinte jetzt, sie werde alles gestehen, bevor ich mit einem meiner Verhöre begänne. Dann sprach sie, als würde sie vom Blatt ablesen, setzte am Ende ein gelangweiltes Etcetera hinzu und beantwortete meine Fragen, ob er älter sei, ob verheiratet, jeweils mit einem Nicken, sagte, er lebe mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern, beide gerade im Schulalter, und sie selbst sei so blöd, sich das gefallen zu lassen.
»Sonst noch etwas Kompromittierendes, außer dass es offensichtlich wieder einmal der Falsche ist?«
Ich versuchte den notwendigen Ernst aufzubringen, den selbst der schalste Witz brauchte, aber es gelang mir nicht richtig.
»Sieht er etwa gut aus? Ein Mann, wie ihn die Frauen angeblich lieben, in seinen besten Jahren und trotzdem keine Glatze, kein Bauch? Hat er Geld?«
Wir hatten seit den zwei Jahren unseres Studiums, in denen wir in Innsbruck zusammengewohnt hatten, unsere Kategorien entwickelt, über ihre Freunde zu sprechen, und das waren die letzten Ausläufer davon, Unsinnsdialoge ohne Ziel und Zweck. Sie hatte mir oft vorgehalten, ich sei auf alle eifersüchtig gewesen, und nicht nur das, ich hätte mich dazu noch in jeden zweiten verliebt, kaum dass sie sich von ihm getrennt habe, oder wenn ich es nicht verliebt nennen wolle, dann eben etwas in der Richtung, und darum ging es auch jetzt bei dem Neuen. Jedenfalls verriet mir ihr Blick, dass sie genau daran dachte.
»Ich kann dir versichern, er ist nicht dein Typ«, sagte sie. »Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die du an ihm nicht mögen würdest, und wahrscheinlich sind es am Ende die gleichen, die auch ich nicht mag. Was soll ich sonst sagen? Dass er gerade im Begriff ist, sich wie der üblichste aller üblichen Idioten aufzuführen, bleibt dir ja nicht verborgen.«
Da war es wieder, das Wort, das sie in vielen Schattierungen verwenden konnte, von der anfänglichen Seligkeit, wenn sie einen Mann kennenlernte, bis zur schrillsten Verachtung, wenn sie ihn nur mehr loswerden wollte, doch so inflationär wie jetzt hatte sie es lange nicht mehr getan.
»Aber was heißt schon Idiot? Wart nur, wie er sich lächerlich macht! Ist er nicht ein Idiot der Sonderklasse?«
Wie um das zu bestätigen, klingelte erneut das Telefon und rettete mich vor der Fortführung dieses Geplänkels, dem wir nie ganz entkamen und in dessen Kern unsere jedenfalls für mich nicht aufgelöste Geschichte stand. Ich wusste nicht, ob das stimmte, aber wenn mich jemand fragte, warum ich keine Freundin hätte, machte ich mir weniger Gedanken darüber, ob die Frage nicht falsch gestellt war und ob es nicht darum gegangen wäre, nach einem Freund zu fragen und nicht nach einer Freundin, sondern darüber, dass ich nie von Ines losgekommen war, seit wir fast jedes Jahr im Sommer und im Winter ein paar Wochen miteinander verbracht hatten oder im Grunde schon seit meinem allerersten Blick auf die Sechsjährige in der Hotelhalle. Ich konnte das niemandem erzählen, oder nur unernst als Scherz, und hatte aus Verlegenheit so oft gesagt, ich sei unsterblich in meine Schwester verliebt und es gebe deshalb keinen Platz für eine andere Frau in meinem Leben, dass ich immer mehr Gefallen an der Erklärung fand und dann doch überrascht war, als ich endlich begriff, dass womöglich mehr daran sein könnte, immer noch, als ich mir eingestand. Die Leute, die uns kannten, lächelten überdrüssig, wenn sie das hörten, während diejenigen, die uns nicht kannten, in Ines’ Anwesenheit dachten, es sei ein missglücktes Kompliment, das ich ihr da machte, und mich in ihrer Abwesenheit ansahen, als wären sie derartiger Provokationen müde. Sie selbst nahm es als gegeben hin, dass ich von Zeit zu Zeit aus der Rolle fiel, und als ich jetzt sagte, sie wisse doch, wie sich die Dinge zwischen uns verhielten, erkannte ich nicht, ob es Ungeduld war, die sich in ihrem Gesicht breitmachte, oder ob sie geduldig gewillt war, meine Verdrehtheiten hinzunehmen, während sie endlich ans Telefon ging und den Anrufer brüsk abfertigte.
»Ich kann jetzt wirklich nicht. Begreifst du nicht, dass du mich überstrapazierst? Ich bin in einem Gespräch.«
Sie sah plötzlich angestrengt aus und verharrte ein paar Momente in einer abwartenden Stellung, bis sie ihren Blick auf mich richtete.
»Ich ahne, was du gleich sagen wirst«, sagte sie. »Ich müsste irgendwann schlauer werden. Es ist immer dasselbe. Er ruft mich alle zwei Stunden an, und wenn er es einmal vergisst, frage ich ihn, was los ist. Ich weiß nicht, was ich mir erwarte.«
Überrascht war ich nicht, so etwas von ihr zu hören, aber ich zögerte, bevor ich sagte, sie müsse mir nichts beweisen, und hatte kaum hinzugefügt, ich hoffte, das gelte auch für sie, als sie sich bereits dagegen verwahrte.
»Was soll für mich gelten?«
Ich meinte, dass sie sich selbst auch nichts beweisen müsse, und sagte es ihr, aber das war schon weniger klar. Schließlich ging es immer gleich um ihre Unabhängigkeit, wenn ein Mann im Spiel war, und die war leichter zu haben, wenn sie sich unfreundlich, als wenn sie sich freundlich gab. Etwas davon bekam auch ich jetzt zu spüren.
»Was sollte ich mir beweisen müssen?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»Also red auch nicht davon«, sagte sie. »Du weißt, wie sehr ich es hasse, wenn du glaubst, du hättest mich durchschaut.«
Es war Anfang Dezember, und obwohl sie sich mitten in Berlin mit einer Freundin eine Wohnung teilte, hatte sie, wie sie es häufig tat, wenn sie eine Arbeit fertigstellen wollte, über Airbnb in einer eher unansehnlichen Gegend in den westlichen Vororten für drei Monate ein Haus gemietet, um dort nicht nur ungestört zu sein, sondern gewissermaßen ganz aus der Welt zu verschwinden. Ob das im Augenblick legal war oder unter die Verbote fiel, wusste ich nicht, aber das spielte ohnehin keine Rolle, weil sie immer Erklärungen fand und sich, solange es niemandem schadete, auch über etwaige Bedenken hinwegsetzte. Sie hatte schon vor Jahren damit begonnen, diese Extravaganz auszuleben, und ich hatte sie in den verschiedensten Quartieren besucht, oft nur ein paar Straßenzüge von ihrer eigentlichen Adresse entfernt. Für jeden anderen wäre das zum Fenster hinausgeworfenes Geld gewesen, aber das machte es für sie nur attraktiver, und wenn sie von unserem Vater sonst kaum etwas hatte, hatte sie diese Eigenheit von ihm, in jeder Lebenslage so zu tun, als verfügte sie über unbeschränkte Reserven, und er war es auch, der ihr im Zweifelsfall jeden Spleen finanzierte.
Sie zeigte mir die Räume, und es war wie an den anderen Orten, die sie für ihre Arbeit in Beschlag genommen hatte. Denn sie zog immer mit ihrer halben Bibliothek und zwei riesigen Koffern aus Pappkarton voller Leintücher ein, aus dem Besitz unserer Großmutter, und allein dafür brauchte sie ihren Defender. Unser Vater hatte zwei von den Fahrzeugen gekauft, bevor das Modell aufgelassen wurde, und sie uns zu unseren dreißigsten Geburtstagen geschenkt, und während meines ungefahren in der Hotelgarage in Tirol stand, weil er gesagt hatte, ich müsse es mir zuvor noch verdienen, und ich es seither nicht anrührte, transportierte sie mit ihrem alle paar Monate ihr Hab und Gut von hier nach dort.
In der neuen Umgebung machte sie sich zuerst immer daran, jede persönliche Spur der Besitzer oder Vermieter zu tilgen und Raum für Raum zu anonymisieren, bis sie vergessen konnte, dass vielleicht gerade noch jemand darin gelebt hatte. Wenn sie damit fertig war, sah es aus, als wären die Leute vor langer Zeit verzogen oder, noch schlimmer oder womöglich auch besser, als wären sie tot. Dafür hatte sie ein eigenes System, nahm, je nachdem, ein Kabuff oder einen halben Saal als Rumpelkammer, und dort schleppte sie die unnötigen Gegenstände hin. Als nächstes drehte sie die Bücher in den Regalen um, so dass sie mit dem Schnitt nach vorn standen, und dann begann sie mit ihren Verhängungen, spannte ihre Leintücher über halbe Wände, befestigte sie notdürftig und hatte nach zwei oder drei Stunden alles soweit, dass es nach ihrem Geschmack war und sie, egal, wohin sie ihren Blick richtete, nicht fürchten musste, dass etwas Übersehenes sie ablenkte oder gar aus dem Konzept brachte.
Tatsächlich war ich immer beeindruckt gewesen, mit welcher Konsequenz sie das betrieb, und gleichzeitig hatte es mir angst gemacht, zu sehen, in welche Leere es sie jeweils bugsierte, welche Auslöschung dieses Weiß-in-Weiß bedeutete, das sie mit ein paar Handgriffen herstellte. Deshalb war ich froh, dass ich beim Eintreten sofort ihre da und dort verteilten Bücher entdeckte, die sie wie auch sonst überall auf jedem Tisch, auf jedem Stuhl und auf dem Boden liegen hatte. Manche aufgeschlagen, manche mit dem Rücken nach oben, hauchten sie dem Ganzen wieder Leben ein, und sie konnte jederzeit nach einem greifen, wenn ihr sonst das Licht oder die Luft gefehlt hätte.
Ich kannte nach wie vor fast alles, was sie las, seit ich im Studium begonnen hatte, hinter ihr herzulesen, statt mich meinen eigenen Aufgaben zu widmen. Damals hatte ich es aus Neugier, aber auch aus Anhänglichkeit getan, ich wollte wissen, was sie bewegte, es war mehr und mehr eine Möglichkeit geworden, ihr nahe zu sein, wie keine andere, wenn ich mit ihr darüber diskutierte und merkte, dass es nichts Schöneres gab als die richtigen Worte, und ich war immer noch besessen davon. Sie schickte mir unverändert Listen mit Büchern, und ich besorgte mir manche, so dass mir viele der herumliegenden Bände wenigstens dem Titel nach vertraut waren.
Gerade arbeitete sie an einem Buch über zwei längst vergessene Lyriker aus den fünfziger Jahren, beide auch damals wenig erfolgreich, die aber neuerdings eine gewisse Bekanntheit erlangt hatten, weil ihr Briefwechsel in Ausschnitten publiziert worden war. Sie hatten sich knapp zehn Jahre lang geschrieben, in den heißesten Phasen fast täglich und ohne größere Abstände als manchmal ein oder zwei Wochen, ein Mann und eine Frau, jeweils in einer unglücklichen oder vielleicht auch gar nicht so unglücklichen Ehe verheiratet, auf jeden Fall nicht imstande, sich daraus zu lösen. Es waren verzweifelte Liebesbriefe, die weit über alles hinausgingen, was sie in ihren Gedichten zustande gebracht hatten, und, selbst wenn sie sich auch im Privaten nicht ganz aus den Konventionen der Zeit zu befreien vermochten, eine Entdeckung bedeuteten, wie man so sagt, ein Glück in der fast nicht aushaltbaren Sehnsucht, die sich darin fand, der Zärtlichkeit und dann wieder Wildheit der Sprache, der Verschämtheit und Offenheit ihrer Vergleiche, der unterdrückten und plötzlich roh hervorbrechenden Sexualität.
Ines hatte Fotos von ihnen neben dem offenen Laptop auf dem Tisch im Wohnzimmer liegen, an dem sie schrieb, und als ich sie im Vorbeigehen in die Hand nahm und betrachtete, beobachtete sie mich. Offenbar in Studios aufgenommen, waren die Bilder auf die zeitübliche Adrettheit getrimmt, die ihnen fast jede Individualität austrieb, der Mann mit zu weit in der Mitte gezogenem Scheitel und Krawatte, die Frau mit einer Haarwelle, zu der ein Violinschlüssel das Vorbild hätte sein können, und einem Rüschenkragen, sowohl er als auch sie in den frühen Dreißigern, in unserem Alter also, aber unerreichbar weit weg. Ich schaute mit einem Bedauern darauf, das gar nicht zwingend ihnen galt, und als ich die Aufnahmen beiseite legte, sah ich, dass Ines auf einen Kommentar wartete, aber ich wollte nur die Geschichte dahinter erfahren und fragte sie, was aus den beiden geworden sei.
»Der Mann hat noch fünf Jahre gehabt, nachdem die Bilder gemacht worden sind«, sagte sie. »Ein Herzinfarkt, nichts Mysteriöses, eine Tragödie vielleicht, zumal in diesem Alter, aber so etwas passiert. Seine Frau hat die Briefe seiner Geliebten gefunden und sie ihr zurückgeschickt und kaum ein Jahr später wieder geheiratet. Dazugeschrieben hat sie nur, dass die ganze Heimlichtuerei gar nicht nötig gewesen wäre.«
Das war, Lyriker hin, Lyriker her, eher prosaisch, und Ines stimmte mir zu, als ich das sagte.
»Die Frau ist vor zwölf Jahren gestorben.«
Es gab keinen Grund zu flüstern, doch sie flüsterte jetzt, vielleicht, weil von Toten die Rede war, vielleicht aber auch bloß, weil sie damit doch noch ein Geheimnis herbeizubeschwören versuchte, wo keines existierte.
»Ihr Mann hat sie überlebt und nach ihrem Tod sowohl ihre Briefe als auch die ihres Geliebten dem Archiv übergeben. Es sieht so aus, als hätte er sie für seine eigenen gehalten, weil er denselben Vornamen gehabt hat wie sein früherer Nebenbuhler und weil er schon so vergesslich war. Zumindest kann man den Eindruck gewinnen, wenn man ihn darüber sprechen hört.«
»Er hat geglaubt, er selbst habe sie geschrieben?«
Ich wusste nicht zu sagen, ob das eine tröstliche Geschichte war oder herzzerreißend und kaum zu ertragen in seiner Untröstlichkeit.
»Er hat geglaubt, er selbst habe geschrieben, was in Wirklichkeit das Schwärmen und Säuseln des anderen Mannes war?«
Ich tat bestürzter, als ich sein konnte, und Ines lachte, wie wenn ich mich allen Ernstes darüber empört hätte.
»Warum nicht? Davon ist niemand zu Schaden gekommen. Wahrscheinlich wäre ihm selbst gar nie eingefallen, so etwas zu schreiben, und nun darf er sich in seinen letzten Lebensjahren als der an allen Ecken und Enden brennende Liebende erleben, der mit seiner Sprache die Welt auf den Kopf stellt, sofern er das überhaupt noch wahrnimmt. Phantastisch, nicht?«
Sie hatte sich einen Augenblick davontragen lassen, und wie um sich schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, meinte sie, wenn man das Zeug lesen wolle, dürfe man den wissenschaftlichen Blick nicht verlieren.
»Ohne den melodramatischen Aspekt bleibt am Ende vielleicht gar nicht so viel«, sagte sie. »Es ist nur ein besonders schönes Beispiel dafür, dass die meisten Dinge keine anhaltenden Erinnerungen erzeugen und dass Erinnerungen oder sogenannte Erinnerungen nicht unbedingt von nachweisbaren Dingen in der Realität ausgelöst sein müssen.«
Dabei griff sie sich ein paar der auf dem Tisch herumliegenden Blätter, als wollte sie nach einer bestimmten Stelle suchen, legte sie jedoch gleich wieder kopfschüttelnd hin.
»Alles Staub und Asche!«
Sie schlug mit der Hand darauf, dass es klatschte.
»Alles Papier!«
Ich war froh, dass ihr Telefon in diesem Augenblick wieder klingelte und ich hinausgehen konnte, damit sie beim Sprechen ungestört war. Immer wenn sie eine Diskussion begann, verlangte sie von mir Beiträge und reagierte unwirsch, sobald ich mich davonstahl, aber ich war müde und sagte bloß etwas Beliebiges über die Vergeblichkeit von allem. Um ihr zu gefallen, war ich über die Jahre selbst ein halber Literaturwissenschaftler geworden, zumindest gelang es mir notdürftig, einen zu imitieren, nicht nur mit meinen Lektüren und nicht nur, weil ich von ihr zu argumentieren gelernt hatte, sondern vor allem, weil ich die Argumente im richtigen Jargon zu simulieren vermochte, wenn es nicht anders ging. Es gab nicht so viele Sprechfiguren, die man beherrschen musste, und ich hätte jetzt auf Autopilot schalten können, um wenigstens die Minimalbedingungen zu erfüllen, doch sie achtete gar nicht darauf. Stattdessen betrachtete sie träge das Display ihres Telefons, bevor sie den Anruf annahm, und machte mir Zeichen, dass ich bleiben solle, aber ich war schon an der Tür. Vielleicht wollte sie meine Anwesenheit auch als Vorwand, doch den hätte sie erfinden können, vielleicht wollte sie mich als Zeugen, aber ich beeilte mich zu entkommen.
Draußen wurde es bereits dunkel, und ich schlenderte ein Stück die Straße hinunter, an ähnlichen Häusern vorbei, zwei oder drei Stockwerke, winzige Gärten und die Hecken davor nicht unmenschlich hoch. Es waren erst wenige Lichter an, sei es, dass die Leute nicht zu Hause waren oder die Lampen bloß nicht eingeschaltet hatten, und niemand hielt sich im Freien auf. Schließlich kehrte ich um und blieb so lange vor Ines’ hellerleuchteten Fenstern stehen, bis sie mich wahrnahm und unentwegt ansah, während sie weitertelefonierte und ich zum ersten Mal Glück darüber empfand, dass die Welt mit den neuen Verboten immer mehr zum Stillstand kam und die Zeit nicht allein länger schien, sondern dichter, als könnte sich tatsächlich noch einmal etwas darin verfangen und nicht alles, bevor es wirklich wurde, längst verflogen sein.
Nachher holte ich meine Sachen aus dem Auto und brachte sie in das Zimmer im oberen Stock, das sie für mich vorbereitet hatte, eines von den zwei Doppelzimmern, die unpersönlich und ohne Ausstrahlung wie in einem Vertreterhotel wirkten und nur durch einen schmalen Gang getrennt waren. Ich duschte, und als ich wieder hinunterging, war Ines entweder immer noch oder von neuem am Sprechen, und so, wie sie jetzt in einem der abgedeckten Sessel saß, ihre Beine über die Lehne geschlagen, hatte ich keinen Zweifel, dass es derselbe Anrufer war. Sie deutete mir erneut, dass ich nicht störte und ruhig zuhören könne, und während ich mich ihr gegenübersetzte, änderte sie nicht einmal den Tonfall ihrer Stimme.
»Ich kann nur schwer Besuch empfangen, solange er da ist, und komme auch nicht von hier fort«, sagte sie gerade. »Wie lange er bleibt, vermag ich nicht einzuschätzen, vielleicht bloß ein paar Tage, vielleicht auch zwei oder drei Wochen.«
Das Gespräch handelte offenbar wieder von mir, und sie unterstrich ihren Unwillen, indem sie die Augen verdrehte und sich zu mir beugte, um mir ins Ohr zu flüstern, wobei sie das Telefon weit von sich hielt.
»O Gott, was für eine Nervensäge!«
Dann ließ sie sich wieder zurücksinken, und ich hatte Zeit, sie anzusehen, aber sie registrierte sofort meinen Blick und hob neckisch die Schulter, was bedeutete, dass ich sie nur nicht taxieren solle.
»Fang nicht du auch noch an«, sagte sie kaum hörbar. »Es reicht, wenn ich einen an der Strippe habe.«
In dem Sommer bevor sie uns gesagt hatten, dass wir Bruder und Schwester waren, hätte ich Stunden damit zubringen können, ihr in die Augen zu blicken, und allein das hatte mich zu den größten Verstiegenheiten verleitet und verleitete mich nach wie vor dazu, dass ich die Worte kaum bei mir zu behalten vermochte, wenn ich nicht aufpasste, und mich selbst beschwichtigen musste.
»Aber ich sage ja nichts, Ines.«
Wir hatten die Nachmittage an einem Badesee verbracht, und es war ein einziges Schauen gewesen, bevor ich mit einem oder zwei Fingern die Formen ihres Gesichts nachzuzeichnen begann, zuerst nur über die feinen Härchen im Nacken und hinter den Ohren, als wollte ich ihr so nahe wie möglich kommen, jedoch jede Berührung vermeiden, und als könnte ich, je länger ich schaute, um so weniger glauben, dass sie überhaupt wirklich war.
»Ich habe gar nichts gesagt«, sagte ich. »Es ist bloß …«
Wenn ich damals ihre Wangen gestreichelt hatte, wenn ich über ihre Wangenknochen gefahren war, den Nasenbogen und die Augenlider, hätte ich eigentlich am liebsten ihr Gehirn liebkost, weil sie immer dafür gut war, etwas ganz und gar Unerwartetes zu sagen, und kam selbst nie richtig über das Erwartbare hinaus.
»Es ist bloß …«
Jetzt sah ich an ihr vorbei.
»Ines!«
Mehr brachte ich nicht hervor, und ich schwieg dann, bis sie zu Ende geredet hatte, und hielt mich den ganzen Abend zurück, statt mich näher nach diesem neuen Freund zu erkundigen. Dabei war er die meiste Zeit präsent, jetzt nicht weiter über Anrufe, sondern weil alle paar Minuten das Bling einer Nachricht ertönte und Ines fast nie zögerte, sondern sofort ein oder zwei Worte zurücktextete, manchmal mit einem entschuldigenden, oft auch mit einem leicht verärgerten Achselzucken, wofür sie unser Gespräch nicht unterbrechen musste. Immer wieder kommentierte sie einen Satz, der hereinkam, sie sagte: »Welcher Idiot verwendet noch ein Wort wie ›Liebste‹?«, sie sagte: »Was für eine Erkenntnis, dass er ohne mich ein Niemand ist!«, sie sagte: »Wann hat mir zum letzten Mal einer geschrieben, dass ich die Liebe seines Lebens bin, und dann auch noch auf englisch?«, und hielt mir die Zeilen hin, damit ich es selber lesen konnte, aber so aufgedreht sie da schon war, steuerte sie noch nicht auf den Ausbruch zu, den ich später am Abend mitbekommen sollte, nichts deutete darauf hin, dass sie in dieser Verfassung war, in der sie von einem Augenblick auf den anderen jede Zurückhaltung fallenließ und nur mehr attackierte.
Wir waren nach dem Abendessen, ein paar Reste ihrer letzten Mahlzeiten, zu denen wir nicht einmal eine Flasche Wein geleert hatten, früh in unsere Zimmer gegangen. Sie hatte mich gefragt, ob ich Lust auf einen Joint hätte, und mich dann gebeten, meine Tür offen zu lassen, es erinnere sie an unsere Innsbrucker Zeit, ihre stand auch offen, und die Betten waren so angeordnet, dass wir uns über den schmalen Gang hinweg sehen konnten. Ich versuchte zu lesen, nickte jedoch über den Seiten immer gleich ein, und jedesmal wenn ich wach wurde, sah ich ihre vom Licht des Telefons angestrahlten Augen und hörte, wie sie flüsterte. Was sie sagte, schien nicht weiter von Belang, sie rekapitulierte den vergangenen Tag und gab einen Ausblick auf den kommenden, und ich bemühte mich, gar nicht hinzuhören, aber schließlich horchte ich doch auf. Denn ihr Ton war jetzt ganz kindlich geworden, und sie sagte, was sie auch schon zu mir gesagt hatte, wenn sie nicht einschlafen konnte: »Noch zehn Minuten!«, und gleich darauf, einschmeichelnd, sanft und auf eine Weise nachgiebig, ja, wie zu jeder Unterwerfung bereit, die all ihre Überzeugungen verraten hätte, wenn es nicht ein Spiel gewesen wäre: »Noch zwanzig!, und schon war es: »Noch dreißig!«, ihre Art, eine Abweisung mit einer jeweils größeren Forderung zu erwidern. Sie nahm ihre Stimme zurück, aber ich hörte sie deutlich, und ich hörte auch schon das Poröse, das Brüchige darin und war dennoch überrascht von der Übergangslosigkeit, als sie im nächsten Augenblick losschrie.
»Du kannst krepieren, wenn du nicht zehn Minuten für mich hast. Es ist mir egal, ob deine Frau dich hört oder nicht. Ich habe gedacht, du verlässt das Haus, wenn wir telefonieren. Und versuch nur nicht, sie vor mir weiter mit ihrem Namen zu nennen! Blöder geht es ja nicht. Dann rufe ich sie selbst an und frage sie persönlich, wie es sich anfühlt, so zu heißen. Du weißt, dass ich den Namen nicht ausstehen kann, und das hat nichts damit zu tun, dass ich eifersüchtig bin, sondern ausschließlich mit der Tatsache, dass es ein Name ist, den ich nicht einmal einer Kuh geben würde.«
Ihre Stimme, gerade noch die eines Mädchens, war von einer Kühle, die selbst mich im meinem Bett zusammenfahren ließ.
»Es sind nur zehn Minuten, die ich von dir verlange, und du sagst mir, du musst schlafen, und begründest es mit dem Schwachsinn, dass du morgen einen schweren Tag hast.«
Sie setzte ganz auf ihren Hohn.
»Nur ein Vollidiot kann von einem schweren Tag reden und glauben, dass ihn das von allem freispricht!«
Ich hörte, wie sie ein gekünsteltes Lachen hervorpresste, das in ein Husten überging, was sie nur noch wütender machte.
»Tagaus, tagein habe ich für dein läppisches Gegreine Zeit, und dann willst ausgerechnet du mir sagen, wann es genug sein soll«, schrie sie, längst über jede Grenze hinweg und nur noch darauf aus, möglichst auszuteilen. »Ich bin doch nicht dein verdammter Mülleimer. Ihr könnt meinetwegen alle krepieren, du, deine beschissene Frau und deine genauso beschissenen Bälger! Heul dich bei ihr aus und fick sie, aber bild dir bloß nicht ein, ich mache auf, wenn du in Zukunft winselnd vor meiner Tür stehst.«
Damit schien sie abrupt in sich zusammenzufallen, und dann lag sie eine Weile nur da, und ich lauschte, während ihr Atem um so lauter ging, je mehr sie sich zu beruhigen versuchte. Das Telefon summte noch ein paarmal, ohne dass sie abnahm, und ich konnte ihr Gesicht im Dunkeln bloß ahnen. Darauf hörte ich, wie sie aufstand, das Tappen ihrer nackten Füße auf dem Holzboden, und wie sie näher kam, und sah im Licht, das durch das Dachfenster drang, ihre Silhouette in meiner Türöffnung. Sie wusste, dass ich wach war, aber es verging eine volle Minute, in der sie nur dalehnte und offensichtlich auf mein Bett starrte, während ich zu ihr hinübersah und, sosehr ich mich auch bemühte, nichts erkennen konnte als ihre Umrisse. Schon kehrte sie in ihr Zimmer zurück, erschien aber gleich darauf wieder an derselben Stelle und zündete sich in aller Ruhe eine Zigarette an.
»Tu nicht so, als würdest du schlafen«, sagte sie, wobei ihr Gesicht in der Flamme des Steichholzes aufleuchtete. »Willst du auch eine?«
Ich antwortete nicht, und sie kam an mein Bett, ließ sich an den Rand sacken, klopfte für mich eine aus dem Päckchen und gab mir Feuer, während ich mich aufsetzte.
»Frag mich nichts«, sagte sie, obwohl ich keine Anstalten dazu gemacht hatte. »Ich kann dir nichts erklären.«
Im nächsten Augenblick deutete sie mir, ein Stück zur Seite zu rücken, und zog ihre Beine auf das Bett, und wir rauchten schweigend, und als wir damit fertig waren, bat sie mich, bei mir schlafen zu dürfen. Noch bevor ich etwas erwidern konnte, streckte sie sich aus und zog mich zu sich herunter, und wir lagen uns Kopf an Kopf gegenüber. Ich wusste nicht, wohin mit meiner Hand, und legte sie zuerst auf ihre Hüfte, dann auf ihre Schulter. Sie trug den Schlafanzug aus Flanell, der auch ein Geschenk unseres Vaters war, und als sie mein Zögern spürte, lachte sie.
»Du weißt, dass ich es nicht mag, wenn du mir im Gesicht herumfummelst«, flüsterte sie. »Vielleicht willst du es trotzdem versuchen.«
Ich rührte mich nicht, weil ich wusste, dass sie mich bei der kleinsten Bewegung zurückweisen konnte, auch wenn sie mich gerade noch dazu aufgefordert hatte.
»Na, mach schon! Ich sage dir, wenn es mir zuviel wird. Du bist doch sonst nicht so zimperlich.«
Sie nahm meine Hand und legte sie sich auf das Gesicht, als wäre das Teil einer kultischen Handlung.
»Brauchst du eine amtliche Erlaubnis?«
Ich hatte begonnen, mit meinem Daumen ihren Hals entlangzufahren, und fuhr jetzt den Bogen ihres Kinns weiter und hinter ihrem Ohr hinauf über die Stirn. Sie hatte früher jedesmal gesagt, ich solle nicht vergessen zu atmen, wenn ich das tat, doch jetzt sagte sie nichts, lag schweigend da und hatte selbst genug mit ihrem Atem zu tun, und ich hielt inne und atmete tief ein und aus. Dann tippte ich einen Punkt genau zwischen ihren Augenbrauen an und wartete wieder. Sie streckte ihren Kopf kaum merklich meiner Hand entgegen, und ich zog mit dem Zeigefinger ein langes »I« über ihre Nase und ließ statt eines Querbalkens, der es zum Kreuz gemacht hätte, die anderen Buchstaben ihres Namens folgen, mit denen ich ein ums andere Mal ihr Gesicht beschriftete.
ZWEITES KAPITEL
Ich kann es heute selbst kaum mehr glauben, doch in den ersten fünf Monaten der beiden Innsbrucker Jahre zu Beginn unseres Studiums, in denen wir uns eine Wohnung teilten, muss ich mir manchmal eingebildet haben, Ines sei eher so etwas wie meine Freundin als meine Schwester, oder vielmehr machte ich mir einfach keine Gedanken über unser Verhältnis, bis sie ihren ersten Freund hatte und ich die Augen davor nicht verschließen konnte. Es mag Wunschdenken gewesen sein, zudem reichlich verquer, aber wir wohnten zu der Zeit nicht nur zusammen, wir gingen auch fast jeden Abend gemeinsam aus, und für Außenstehende machte die Verwirrung noch größer, dass Ines da ihr Haar kurz geschnitten hatte, während ich meines schulterlang trug, und sie als alles durchgegangen wäre mit ihren Männerhosen und Männerhemden, unter denen sie ihre Brüste verbarg, die sie mir in einem Sommer lange davor mit den Worten »Man kann nicht behaupten, dass sie nicht existieren« zum Betasten und Befühlen hingehalten hatte. Wenn wir jetzt irgendwo an einer Theke standen, unterhielten wir uns jedenfalls auf das selbstverständlichste über die anwesenden Männer, ja, soweit ich mich erinnere, kaum je über eine Frau, Ines mochte fragen: »Wie gefällt dir der?«, und es wäre mir gar nie in den Sinn gekommen, umgekehrt die Frage zu stellen: »Wie gefällt dir die?«, und dann konnte es geschehen, dass wir spätnachts, wenn wir nach Hause kamen, zueinander ins Bett krochen, engumschlungen einschliefen und genauso engumschlungen wieder wach wurden.