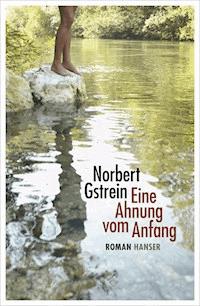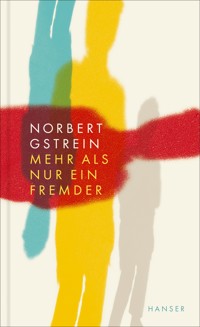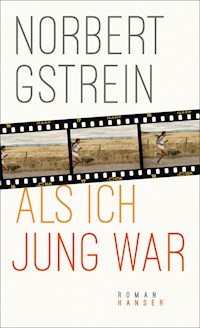Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach seinem gefeierten Roman „Als ich jung war“ – Norbert Gstreins atemberaubendes Buch über die Abgründe der Menschheit „Natürlich will niemand sechzig werden.“ Damit beginnt Jakobs Lebensgeständnis. Dem bekannten Schauspieler, über den ein Verlag eine Biografie plant, graust es vor dem Kommenden. Da stellt ihm seine Tochter die Frage, die alles sprengt: „Was ist das Schlimmste, das du je getan hast?“ Jakob erinnert sich an einen Filmdreh an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Die Morde an Frauen und das Elend dort bekam er bloß distanziert mit – aber zwei Mal war er plötzlich mittendrin. Er schämt sich, ringt mit den simplen Urteilen der Welt und sehnt sich in gleißenden Erinnerungen nach dem Glück. Warum ist er kein Original, sondern stets nur „der zweite Jakob“? Norbert Gstrein schreibt einen Roman, der mitreißende, große Kunst ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Nach seinem gefeierten Roman »Als ich jung war« — Norbert Gstreins atemberaubendes Buch über die Abgründe der Menschheit »Natürlich will niemand sechzig werden.« Damit beginnt Jakobs Lebensgeständnis. Dem bekannten Schauspieler, über den ein Verlag eine Biografie plant, graust es vor dem Kommenden. Da stellt ihm seine Tochter die Frage, die alles sprengt: »Was ist das Schlimmste, das du je getan hast?« Jakob erinnert sich an einen Filmdreh an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Die Morde an Frauen und das Elend dort bekam er bloß distanziert mit — aber zwei Mal war er plötzlich mittendrin. Er schämt sich, ringt mit den simplen Urteilen der Welt und sehnt sich in gleißenden Erinnerungen nach dem Glück. Warum ist er kein Original, sondern stets nur »der zweite Jakob«? Norbert Gstrein schreibt einen Roman, der mitreißende, große Kunst ist.
Norbert Gstrein
DER ZWEITE JAKOB
Roman
Carl Hanser Verlag
That’s me in the corner,
that’s me in the spotlight.
R. E. M., Losing my Religion
Erster Teil
SAG IHNEN, WER DU BIST
ERSTES KAPITEL
Natürlich will niemand sechzig werden, jedenfalls nicht als Jubilar, und natürlich will niemand, der bei Sinnen ist, ein Fest, um das auch noch zu feiern, aber obwohl ich alles darangesetzt hatte, es zu verhindern, war ich in die erwartbaren Abläufe geschlittert und musste mich am Ende vielleicht wirklich als bedeutender Künstler, verdienter Bürger, und was dergleichen sonst für Würdigungen kurz vor dem Grabstein und kurz vor dem Vergessen stehen, ganz nach dem Geschmack des Publikums wie ein Pfau ausstopfen und vorführen lassen. Gewöhnlich begann der Unsinn erst zehn oder fünfzehn Jahre später, doch weil sie in der Provinz sonst kaum jemanden fanden, kam ich ihnen zupass. Ich hatte bereits lange davor mit Luzie verabredet, dass wir in der kritischen Zeit gemeinsam durch Amerika fahren und am 21. Dezember irgendwo an der Westküste ankommen würden, nur sie und ich, Vater und Tochter, vielleicht in San Francisco, genau an dem Tag, an dem das große Ereignis eintreten sollte, aber dann zerschlug sich alles schon Monate davor.
Mein ganzes Leben war ich nicht ein Christkind, sondern nur annähernd eines gewesen, mit erwartetem Geburtstermin am Heiligen Abend, sofern man das noch sagen kann, doch dann hatte es Komplikationen gegeben, hatten die Wehen eingesetzt, und ich hatte drei Tage Leben gewonnen, Jahr für Jahr drei Tage zu verschenken, an denen ich mit Fug und Recht so tun konnte, als gäbe es mich nicht. Seit ich das begriffen hatte, waren es diese drei Tage im Jahr, die ich am meisten liebte, weil ich mir zugestand, in diesen drei oder sogar vier Tagen aus der Welt herauszufallen. Es hatte 21., 22., 23. und 24. Dezember in meinem Leben gegeben, von denen ich behaupten würde, dass ich glücklich war wie sonst nie, die kürzesten Tage des Jahres, die längsten Nächte, Nächte voller Lichter. Die Geburtstage im Flugzeug, auf dem Weg irgendwohin, mit weihnachtlich gestimmten Sitznachbarn auf ihrer Reise nach Hause, der Geburtstag in Brighton, meine plötzliche Gewissheit ganz draußen auf dem Pier, dass das Leben etwas Gutes sei, der Geburtstag in Tanger, der Schwindel des Glücks beim Blick hinüber nach Gibraltar, der Geburtstag in Nazaré, nördlich von Lissabon, wo sich die Wellenreiter auf die Saison der Riesenwellen vorbereiteten und ich ihnen bei ihren wilden Ritten zuschaute, ihren Kunststücken, wieder und wieder obenauf zu bleiben und nicht unter dem niederstürzenden Wasser begraben zu werden und sich das Rückgrat zu brechen. Immer musste es das Meer sein mit der Möglichkeit, mich nach dem anderen Ufer zu sehnen oder, wenn ich mich umdrehte und ins Landesinnere blickte, wenigstens meinen Rücken frei zu haben und nicht fürchten zu müssen, dass jemand von hinten kam, ein Feind, ein Widersacher, ein Landsmann oder Freund.
Bereits vor Jahren hatte ich angefangen, wenigstens einmal im Jahr, manchmal zweimal für zwei oder drei Wochen nach Amerika zu fliegen, dort ein Auto zu mieten und zwei- oder dreitausend Kilometer zu fahren. Befriedigend erzählen konnte ich niemandem davon, aber wenn ich die Routen im Atlas verfolgte, ergaben sie ein immer dichter werdendes Netz kreuz und quer über den Kontinent. Ich hatte vor einem halben Leben ein Schuljahr in Montana verbracht, und nur um irgend etwas zu sagen, sagte ich, ich führe diesem Jahr hinterher, weil dieses Jahr für mich das entscheidende Jahr gewesen sei. Denn auf die ewige Frage, warum ich Schauspieler geworden war, konnte die Antwort nur mit der Theatergruppe in Missoula beginnen und mit meinem Freund Stephen, der dort seine Karriere startete und nur wenige Jahre danach schon in einem halben Dutzend großer Filme gespielt hatte und mich später regelrecht in das Geschäft hineinzog. Wir behaupteten beide, wir seien bloß wegen der Mädchen zu dem etwas knöchernen Unterricht gegangen, den ein geradezu trotzig kultiviert wirkender ungarischer Immigrant nach guter Moskauer Tradition hielt, aber in Wirklichkeit stimmte das weder für ihn noch für mich, und was uns hingezogen hatte, war die übliche Mischung aus Langeweile und Zufall gewesen, die einen in der Jugend zu so vielen Dingen verführt, die man genausogut hätte unterlassen können und aus denen man später seine Notwendigkeit konstruiert.
Stephen war kein anderer als Stephen O’Shea, zu dem ich weiter Kontakt hielt, und als er mir zehn Jahre nach unserem gemeinsamen Schuljahr vorschlug, noch einmal für ein paar Wochen nach Montana zu kommen, war er längst eine Berühmtheit und ich erst Student mit bereits einigen Semestern über dem Plan und ungewissen Zukunftsaussichten. Ich dachte mir nicht viel dabei, als er mir anbot, in dem Stück, das er in seiner Heimatstadt bei einem Festival inszenierte, eine winzige Rolle zu übernehmen, und wäre, allein schon weil ich keine Ambitionen in diese Richtung hegte, nie auf die Idee verfallen, dass aus diesem ersten kleinen Auftritt auf der Bühne mein erster nicht mehr ganz so kleiner in einem Film folgen könnte. Spielen musste ich nur einen Barbesucher, nicht mehr als den lebenden Hintergrund für ein im Vordergrund streitendes Paar, einen zufällig Anwesenden, der mit dem Satz »Ich hoffe, du weißt, was du da tust« einschreitet, als der Mann seine Hand gegen die Frau erhebt, weshalb ich nur überrascht sein konnte, dass nach der Premiere ein in einem fort hüstelnder Krawattenträger auf mich zukam, der nicht unbedingt aussah wie jemand aus der Branche, sich jedoch als Regisseur vorstellte, mir seine Visitenkarte überreichte und mich beglückwünschte. Dann sagte er, meine Gelassenheit habe für die Glaubwürdigkeit dieser sonst nicht sehr glaubwürdigen Aufführung gesorgt, so selbstverständlich, wie ich dagesessen sei, müsse erst einmal einer dasitzen, manche Schauspieler brächten das nach einem ganzen Berufsleben nicht zustande, und ein halbes Jahr später besuchte er mich auf seiner Europareise, um mich nicht lange danach aus purer Extravaganz, wie mir schien, für die Rolle von Theodore Durrant in seinem Film über Maud Allan zu engagieren, die berühmte Salome-Tänzerin Anfang des vergangenen Jahrhunderts.
In dessen Gestalt, der Gestalt ihres Bruders, hatte ich meinen Einstand in der Filmwelt ausgerechnet als irrer Frauenmörder, der seine beiden Opfer aufschlitzt und zerstückelt und die eine kaum mehr kenntlich in einer Bibliothek, die andere ausgelegt wie für eine anatomische Untersuchung im Glockenturm der zugehörigen Kirche deponiert. Dafür brauchte ich gar nicht viel zu tun, weil die Morde selbst ausgespart blieben. Ich musste nur in die Haut eines introvertierten Medizinstudenten schlüpfen, der jungen Mädchen nachstellt, und seine klägliche Not im Umgang mit ihnen zeigen, um dann verschlossen im Gerichtssal zu sitzen, verschlossen im Gefängnis und ebenso verschlossen zu seiner Hinrichtung zu gehen und noch einen letzten wütenden Blick in die Welt zu werfen, bevor ihm die Schlinge um den Hals gelegt wird.
Amerika hatte mir dennoch Glück gebracht, und die Vorstellung, nun zum ersten Mal gemeinsam mit Luzie dorthin zu fahren, war etwas ganz Neues für mich, ich bildete mir ein, ich könnte ihr das Land vor seinem Sündenfall zeigen, geradeso, als hätte es den im Singular gegeben, als folgte nicht einer auf den anderen und als existierten nicht trotzdem noch da und dort Flecken, die aufzusuchen sich lohnte, weil an manchen Orten noch nicht alles verspielt war. Sie war nach vier Jahren, die sie bei mir gelebt hatte, erst vor etwas mehr als sechs Monaten ausgezogen, und es war für mich auch eine Möglichkeit, sie endlich wieder einmal von Tag zu Tag zu sehen und einen Blick darauf zu haben, wie sie sich machte. Obwohl es noch lange hin war, hatten wir gleich angefangen, Pläne für die Reise zu schmieden, und sie war wieder das Kind gewesen, das nicht aufhören konnte, nach immer neuen Alternativen zu fragen, und die Welt bis ins letzte Detail ausbuchstabiert haben wollte, bevor sie den ersten Schritt in sie hinein wagte. Zwar hatte sie daraus ein Spiel gemacht und gelacht, als sie meinen besorgten Blick sah, aber wir wussten beide, wie wenig es brauchte, dass es kippte und sie sich in ihren Eigenheiten festfraß und nicht mehr aus ihren Verstrickungen herausfand. Sie hatte als Vier-, Fünf- und Sechsjährige und auch danach noch als Schülerin, bevor sie mit dreizehn in das englische Internat ging, die Welt nur als Einzelfall verstanden, und wenn man ihr etwas erklärte, wollte sie Dutzende von Beispielen, die ihr die Erklärung illustrierten und Dutzende von Parallelwelten eröffneten, die nichts miteinander zu tun zu haben schienen, obwohl sie nur in einer geringfügigen Kleinigkeit voneinander abwichen.
»Was bedeutet Liebe, Papa?«
Ich versuchte es ihr zu erklären.
»Wie kann man das sehen?«
Ich sagte, man würde es spüren.
»Gib ein Beispiel.«
Ich sagte: »Wenn zwei sich umarmen«, ich sagte: »Wenn zwei sich küssen, wenn zwei sich an den Händen fassen, wenn sie gern zusammen sind, wenn sie es mögen, sich in die Augen zu schauen«, und sie wollte noch eine Variante und noch eine und hatte immer schon die größten Schwierigkeiten gehabt, mir in die Augen zu blicken, entzog mir die Hand, wenn ich nach ihr fasste, versteifte sich bei einer Umarmung und drehte bei jedem Kuss den Kopf weg.
»Ich liebe dich, Papa.«
Es war Anfang Juli, als sie verkündete, ich müsse die Reise allein unternehmen, sie werde nicht mitkommen. Ich hatte ihr drei Monate davor das Manuskript zu lesen gegeben, das meine Biografie hätte werden sollen, genau zum Geburtstag auf den Markt geworfen, wenn ich sie nicht vor Drucklegung gestoppt hätte, um es einmal so auzudrücken. Wir führten ein Gespräch darüber, bei dem sie sagte, was man daraus erfahre, sei nicht weiter schlimm, schlimm sei ihrer Meinung nach nur die bestürzende Harmlosigkeit des Ganzen, die mich zu einem blassen Zeitgenossen mache, und ich war in der Folge so unvorsichtig, ihr die Frage zu beantworten, was das Schlimmste sei, das ich in meinem Leben getan hätte. Ich hatte es zuerst mit Ausweichen versucht, aber sie hatte insisiert, und noch während ich mich hinreißen ließ, wusste ich, dass es ein Fehler war.
»Dass ich bei deiner Geburt nicht dabei war, Luzie.«
»Ich meine, etwas wirklich Schlimmes.«
»Dass ich in deinen ersten Jahren viel weg war.«
»Ach, Papa, wenn du dich hören könntest!«
»Dass wir dich nach England geschickt haben und ich nicht dagegen eingeschritten bin.«
»Du weißt, dass ich nicht das meine«, sagte sie. »Ich meine so etwas wie, ob du jemanden umgebracht oder ihn so weit getrieben hast, dass er sich selbst das Leben genommen hat.«
Sie war damals vor zwei Jahren bis auf einmal immer zugegen gewesen, wenn der Biograf mich aufgesucht hatte, wie anfangs meine stehende Bezeichnung für den jungen Mann war, der mein Leben festschreiben sollte. Ich hatte mich in einem unkonzentrierten Augenblick überreden lassen und einer Reihe von Interviews zugestimmt, die zu führen wären, und eines Nachmittags war er zu einer ersten Sitzung erschienen, nicht weiter auffällig, mit Jeans und Leinensakko und früh beginnender Stirnglatze. Vielleicht war er ein bisschen zu eilfertig, ein bisschen zu beflissen in seiner Halbschüchternheit, so, wie er aus seiner Umhängetasche ein Klemmbrett hervorholte, kaum dass er sich in den angebotenen Sessel gesetzt hatte, und augenblicklich betriebsbereit schien. Er hatte für die Buchserie lokaler Berühmtheiten, für die ich ihm Rede und Antwort stehen musste, bereits einen Herzchirurgen und einen Haubenkoch porträtiert, der zudem an einer Himalaja-Expedition teilgenommen und den Mount Everest bestiegen hatte, und die beiden Bücher, die mir zur Ansicht geschickt worden waren und in die ich nicht einmal hineingeschaut hatte, lagen vor uns auf dem Glastisch.
Wahrscheinlich hätte ich misstrauischer sein müssen, aber das war ganz zu Beginn, alles noch vage in der Verwirklichung, noch so weit weg zudem, dass ich den Biografen nur beobachtete, wie er sich umsah und dabei jeden Blick in meine Augen vermied. Ich wusste, dass er sich den Satz nicht würde verkneifen können, den ich bereits von so vielen anderen gehört hatte: »Schön haben Sie es hier«, aber ich ließ ihn hängen und sagte nicht, was ich sonst oft gesagt hatte, die Wohnung gehöre nicht mir, sie sei mir bloß zur Verfügung gestellt, ich könne sie mir mit meinen Mitteln unmöglich leisten. Man gab sich heutzutage besser nicht als Besitzer von knapp zweihundertfünfzig Quadratmetern mit unverbautem Blick über die Dächer der Stadt in alle Richtungen aus, wenn man nicht Neid und Ressentiment auf sich ziehen wollte, aber er sollte es schlucken. So vermochte ich auch leichter zu verschmerzen, wenn mich Kollegen aus Berlin oder München fragten, ob ich verrückt sei, in Innsbruck zu leben, was die beruflichen Möglichkeiten dort angehe, sei der Nordpol oder der Südpol auch nicht schlechter. Die Aussicht auf die Berge und über den Fluss war wie aus einem Prospekt, und im Winter konnte ich an den Wochenenden den Touristenbombern zusehen, die unaufhörlich ein- und ausflogen und eine Lärmschärpe über das Tal zogen, die mich hinter der doppelten Verglasung kaum erreichte.
Ich lehnte mich in meinem Sessel zurück, als der Biograf meinte, am besten fingen wir damit an, worüber ich alles nicht sprechen wolle, und fasste im selben Augenblick den Entschluss, ihm Hürden aufzustellen. Schließlich musste ich mich nicht von einem Dahergelaufenen auf diese Weise angehen lassen, und auch Luzie schien das zu denken. Sie hatte es sich auf einer Couch in der abseitigsten Ecke des Wohnzimmers bequem gemacht, und ich konnte sehen, wie sie bei seinen Worten aufhorchte.
»Man hat mir eine Liste gegeben, was ich Sie besser nicht fragen soll«, sagte er. »Sie wollen sicher nicht wissen, was alles darauf steht.«
Er hielt sich wohl für besonders schlau. Ich bot ihm einen Drink an, er wählte Wasser, und ich stand auf und holte für mich den Weißwein aus dem Kühlschrank, um erst nach ein paar Schlucken überhaupt etwas zu sagen. Natürlich wusste ich, dass ich mit dem Trinken aufpassen sollte, aber wenn ich strikt darauf achtete, würde ein Besucher wie er höchstens ein Ja oder ein Nein aus mir herausbringen oder nicht einmal das, und wir müssten unser Experiment abbrechen, bevor wir begonnen hätten. Als ich mich wieder zu ihm setzte, standen auf dem Blatt, das er in das Klemmbrett eingespannt hatte, schon ein paar Worte. Ich versuchte sie zu entziffern, wann immer er es so drehte, dass die Seite mir zugewandt war, aber es gelang mir nicht, und ich wurde den Gedanken nicht los, er könnte notiert haben, dass ich mitten am Tag bereits Alkohol trank und mir das Glas bis zum Rand vollgeschenkt hatte.
»Wie aufmerksam, dass Sie mir gleich mit den Problemen ins Gesicht springen«, sagte ich. »Machen Sie das immer so?«
»Ich will keinen Fehler begehen.«
»Kommt darauf an, was Sie darunter verstehen.«
Ich musterte ihn ostentativ, während er sagte, ich brauchte keine Angst zu haben, er empfinde sich nicht als meinen Gegner, seine Arbeit an meiner Biografie sei eine Dienstleistung, was auch immer ich ihm erzählte, er werde es mir später zur Bestätigung vorlegen und ich könne im Zweifelsfall alles modifizieren. Er drückte sich in seinen Sessel, wie um darin zu verschwinden, und sah abwechselnd links und rechts an mir vobei, und so, wie er das letzte Wort betonte, ließ tief blicken, wieviel Flexibilität er sich zugute hielt. Dann sprach er von Vertrauen, und allein das klang so süßlich, dass ich ihn unterbrach, bevor er es noch schlimmer machte.
»Entspannen Sie sich«, sagte ich. »Es gibt keine Tabus. Wenn ich über etwas nicht reden will, werden Sie es schon merken. Was steht denn auf Ihrer Liste?«
Jetzt entschuldigte er sich auch noch, und statt zu antworten, sagte er, es sei keine wirkliche Liste, man habe ihm nur ein paar Hinweise gegeben, und fing im nächsten Augenblick an, meine Daten abzufragen wie bei der Einwohnerbehörde oder der Polizei. Ich hatte immer schon das Gefühl gehabt, dass etwas nicht stimmte, wenn ich für meinen Geburtsort, für mein Alter, für die Schulen, die ich besucht hatte, und Ähnliches einstehen musste, aber war es sonst jeweils nur ein vages Unbehagen gewesen, hätte ich diesem jungen Mann gegenüber das meiste am liebsten sofort wieder zurückgenommen, was ich von mir preisgegeben hatte. Dabei war alles mit der Scham behaftet, tatsächlich der und der gewesen zu sein und nicht ernsthaft genug versucht zu haben, ein anderer oder gar Besserer zu werden und jeder Festgelegtheit zu entkommen. Zum Leugnen war es zu spät, aber statt auch nur einen Versuch zu unternehmen, seine Buchhaltung wenigstens zu unterlaufen, was es für eine Rolle spiele, wie viele Geschwister ich hätte, ob es stimme, dass ich nur ein einziges Jahr in den Kindergarten gegangen sei, ob ich in meiner Jugend wirklich davon geträumt hätte, Autorennfahrer zu werden, ergab ich mich viel zu treuherzig meinem Schicksal.
Als er nach diesem ersten Mal gegangen war, sagte Luzie, auf sie hätte ich gewirkt, als würde ich zum Schafott geführt und wollte vorher noch die Beichte ablegen, weshalb ich beim zweiten, dritten und vierten Termin vorsichtiger war, ohne dass es mir wirklich gelang, nicht auch da wieder viel zu viel zu erzählen. Ich beobachtete den Biografen, wie er sich jedesmal selbstverständlicher in der Wohnung bewegte, wie er beim zweiten Mal schon wirkte wie einer, der gar nicht auf die Idee käme, sich zu erkundigen, ob er die Schuhe ausziehen solle, nachdem ich beim ersten Mal gesagt hatte: »Bloß nicht!«, wie er beim dritten Mal aufstand und an mein Bücherregal trat, während ich wieder sein Wasser und meinen Wein holte, wie er beim vierten Mal ohne zu fragen das Fenster öffnete. Es war Sommer, drückend heiß, und er schwitzte so stark, dass sein Hintupfen, wenn er etwas auf dem Klemmbrett notierte, wie schwere körperliche Arbeit erschien. Ich hatte mich dagegen ausgesprochen, dass er das Gespräch aufzeichnete, gleichzeitig aber Luzie gebeten, dass sie zur Sicherheit eine Aufnahme machte, und so lag ohne sein Wissen neben den frischen Blumen, den Büchern und allerlei Krimskrams auch ein kleines Mikrofon auf dem Glastisch. Integriert in den Schlüsselanhänger, konnte es ihm nicht auffallen oder würde, wenn es ihm auffiele, wie eine Attrappe wirken. Ich hatte über die Jahre meine Erfahrungen mit Interviewern gemacht und immer wieder feststellen müssen, dass sie mit fertigen Meinungen zu mir kamen und dann meine Aussagen so schnitten und neu zusammensetzten, dass sie ihre Vorurteile bestätigten und mit dem, was ich gesagt hatte, oft wenig zu tun hatten.
Der Biograf hatte natürlich einen Namen, er hieß Elmar Pflegerl, wofür er nichts konnte, aber wenn ich mir seinen Namen über meinem Namen auf einem Buchcover vorstellte, wurde mir flau, weil ich dachte, diese »erl«-Endung strahle ungut auf mich aus und mache am Ende mein ganzes Leben zu einem kleinen Leberl. Für mein Ohr gab es keine grässlichere Tortur als all die »Schnitzerl«, »Beugerl«, »Kipferl«, um nur vom Kulinarischen zu reden, in wichtigeren Bereichen war es noch schlimmer, weil diese Verkleinerungsform nicht wie andere nur eine Verkleinerung in den Kitsch, sondern gleichzeitig auch eine in die Halbwelt und in die Korruption bedeuten konnte. Man ließ sich die ungeheuerlichsten Dinge zuschulden kommen und kringelte sich mit solchen Windungen und Wendungen aus dem Ärgsten hinaus, und ausgerechnet dieser Elmar Pflegerl tat sich immer selbstverständlicher in meinem Leben um, weil ich in einer schwachen Sekunde nicht nein gesagt hatte.
»Können wir über Ihre Frauen sprechen?«
Es war seine Formulierung, beim fünften Termin, nachdem er das Thema immer wieder einmal angeschnitten hatte, aber nie auf diese ausdrückliche Weise, und ich hätte mich wehren sollen, weil allein der Plural eine Zumutung darstellte, lächelte ihn aber nur an.
»Sie waren drei Mal verheiratet?«
Ich antwortete wieder nicht, und erst als er sagte: »Ihre erste Frau war Anwältin, Ihre zweite Frau Galeristin …«, fiel ich ihm brüsk ins Wort, weil er wieder in sein Datensammeln geraten war und es klang wie eine Aufzählung meiner Besitztümer und gerade in der faktischen Richtigkeit den Kern verfehlte.
»Wollen Sie Namen und Anschrift?«
Ich sagte das lauter, als mir lieb war.
»Wollen Sie mit ihnen über mich sprechen?«
»Ich muss gestehen, das ist meine Idee.«
»Sie werden nichts Schlechtes zu hören bekommen.«
Ich hatte überreagiert. Als ich es später in der Aufnahme überprüfte, die Luzie gemacht hatte, konnte ich ihm natürlich eine gewisse Steifheit und Förmlichkeit oder gar Behördenhaftigkeit und womöglich etwas Inquisitorisches im Ton vorwerfen, aus seiner Sicht jedoch hatte er kaum einen Fehler begangen. Ich hatte mich auf die Interviews eingelassen, er hatte gefragt und mit seinen Fragen, so ungeschickt er sie auch vorgebracht haben mochte, keinesfalls eine Grenze überschritten, und das galt auch, als er wenig später sagte, ich hätte in meinen Filmen auffallend oft Bösewichter gespielt und in drei Fällen Frauenmörder. Wir hatten längst über anderes gesprochen, aber weil mich die kleine Irritation immer noch beschäftigte, hörte es sich für mich an, als wollte er einen Zusammenhang damit herstellen, dass ich auch genau drei Mal verheiratet gewesen war, geradeso, als hätte ich für jede Ehe in der Wirklichkeit im Film eine Frau umgebracht oder umbringen müssen oder einmal gleich am Anfang als Theodore Durrant sogar zwei. Er hatte nichts davon nahegelegt und wahrscheinlich auch nichts Großartiges damit im Sinn, aber ich war trotzdem nur um so mehr alarmiert.
»Sie haben schon in Ihrem ersten Film den Bruder von Maud Allan gespielt«, sagte er. »Würden Sie sagen, das hat einen entscheidenden Einfluss auf alles Weitere in Ihrer Karriere gehabt?«
Ich hatte immer wieder zu Luzie hinübergeschaut, die auch diesmal auf ihrer Couch saß und sich den Anschein gab, sie höre nur mit einem Ohr zu. Nach dem ersten Termin hatte ich sie gebeten, sich in Zukunft weniger freizügig anzuziehen, wenn wir Besuch hatten, aber sie trug nur ein ärmelloses Kleid, fast ein T-Shirt, und keine Strümpfe, war barfuß und hatte ihre Füße auf die Lehne gelegt, als wären wir allein zu Hause. Sie war in diesen Wochen jeden Tag im Freibad gewesen, ihre Arme und Beine waren gebräunt, auf ihrer Nase ein paar Sommersprossen, und ihr ganzer Körper schien die Hitze der Tage aufgesogen und gespeichert zu haben. Jetzt hatte sie abwechselnd auf ihrem Handy herumgetippt und in einem Bildband geblättert, doch plötzlich fiel ihr das Buch aus der Hand und schlug auf den Boden. Der Biograf folgte meinem Blick und beobachtete, wie sie sich danach bückte und im Ausschnitt am Hals der Ansatz ihrer Brüste sichtbar wurde, während er einfach weitersprach.
»Glauben Sie, Sie haben deswegen später bestimmte Rollen bekommen und andere dafür nicht? Manche Schauspieler bleiben in gewisser Weise immer diejenigen, die sie in ihrem ersten Film gewesen sind. Gilt das auch für Sie und Ihr Debüt als Theodore Durrant?«
Ich konnte nicht heraushören, ob er das abfällig meinte, aber ich erwiderte, ich hätte viele Rollen zurückgewiesen, in denen ich einen Übeltäter, ja, manchmal ein richtiges Ungeheuer hätte spielen sollen. Es war klar, worauf das hinauslaufen musste, und ich hatte es auch kaum ausgesprochen, als er natürlich sofort auf John Malkovich kam und das Stück, eine Art Musical, über einen österreichischen Serienmörder, der in einem bestimmten Milieu eine Weile als Schriftsteller reüssiert hatte. Vor wenigen Wochen erst hatte es seine Premiere in Wien gehabt, und die Geschichte, die mich damit verband, war noch nicht lange publik. Seither definierte sie mich aber in der Öffentlichkeit wie kaum etwas anderes, und natürlich nahm auch einer wie Elmar Pflegerl die erste Gelegenheit wahr, sie ausgiebig zu zelebrieren, als läge darin das Größte, was ich jemals getan hatte.
»Man muss es sich schon leisten können, eine Rolle abzulehnen, die dann ein internationaler Star wie John Malkovich übernimmt«, sagte er. »Bereuen Sie Ihre Entscheidung eigentlich?«
Er hatte jetzt genau die roten Ohren, von denen Stephen immer gesagt hatte, das sei das SOS der Schwächlinge, deren Blut falsch zirkuliere. Wie der Biograf »John Malkovich« aussprach, hörte sich an, als würde er von einem Gott sprechen, und wer wäre dann ich erst, wenn mir eine Rolle angeboten wurde, bevor die maßgeblichen Leute überhaupt nur Wind davon bekamen, und ich sie auch noch ausschlagen konnte? Mehr ging für ihn nicht, doch zugleich musste ich ein Narr sein, der die Chance seines Lebens nicht erkannt hatte, weil er zu dumm oder zu arrogant dafür war.
»Das klingt alles viel beeindruckender, als es in Wirklichkeit gewesen ist«, sagte ich. »Ich habe der Rolle nichts abgewinnen können. Ein Prostituiertenmörder, der im Knast anfängt, ein bisschen zu schreiben, sich Schriftsteller nennt und von anderen Schriftstellern mit kitschigen Safthirnen hofiert wird, die sich erfolgreich für seine Freilassung einsetzen. So etwas hat man damals Literatur der Arbeitswelt genannt.«
»John Malkovich hat sich darum gerissen.«
»Das kann schon sein, aber mir war die Figur einfach zu abstoßend. Nicht, dass es um einen Mörder gegangen ist, sondern sein Schreiben und das ekelhafte Gewese darum. Welche Literatur und welche Arbeitswelt? Die Arbeitswelt und die Literatur eines Würgers? Da nennt sich einer Schriftsteller und soll deswegen gleich über dem Gesetz stehen. Am Ende belehrt er sie alle eines anderen und bringt in rascher Folge fast noch ein Dutzend Frauen um.«
Ich ließ ihn erneut ins Leere laufen, als er noch einmal mit Theodore Durrant anfing und wissen wollte, inwiefern es anders gewesen sei, ihn zu spielen, und behielt Luzie im Blick, die aufrecht dasaß und unverwandt zu uns herüberschaute. Sie hatte damals aus England angerufen, und es war wie ein Blitz durch mich gegangen, ihre Stimme so klein zu hören, dass der geringste Lufthauch sie hätte ersticken können. Wir hatten in der Zeit kaum je telefoniert, und wenn, hatte immer ich mich bei ihr gemeldet, so dass mir, noch bevor sie den ersten Satz formuliert hatte, schon klar gewesen war, dass etwas passiert sein musste. Eine ihrer Mitschülerinnen hatte eine DVD aufgetrieben, und Luzie, die noch so kindlich war, dass sie sich gar nicht richtig vorstellen konnte, dass es auf der Welt überhaupt etwas Böses gab, hatte ihren Vater in jungen Jahren als Mörder zweier Frauen mit blutigen Händen und einem Seziermesser gesehen. Ich hatte am nächsten Tag einen Flug nach London genommen und sie in ihrem Internat besucht, aber obwohl sie natürlich verstand, dass es ein Film war, war sie in den zwei Stunden, die wir hatten, ganz in sich gekehrt gewesen. Wir hatten uns im zugehörigen Park auf eine Bank gesetzt, und wenn sie sonst schon bis auf wenige Ausnahmefälle jede Berührung von mir nur über sich ergehen lassen hatte, war sie da an den äußersten Rand gerückt und aufgestanden, sowie mir bloß in den Sinn gekommen war, nachzurücken. Sie hatte sich bis dahin nie für meine Filme interessiert, immer mit Abwehr reagiert, wenn sich doch einmal die Gelegenheit bot, dass sie mich im Kino hätte sehen können, geradeso, als wäre es für sie, der jedes Im-Mittelpunkt-Stehen peinlich war, das Peinlichste überhaupt, ihren Vater auf der Leinwand zu erleben, weshalb der Schock für sie doppelt und dreifach sein musste. Blass, hell, fast durchsichtig in ihrer dunkelblauen Anstaltsuniform, war sie am Ende in ihrer zappligen Art vor mir hergehüpft, als ich sie zum Tor zurückgebracht hatte, ihren Blick auf den Kies vor sich gerichtet und kaum imstande, die Ungeduld zu verbergen, endlich dem fremden Mann an ihrer Seite zu entkommen, der ihr Vater und ein Monster war. Ich wusste nicht, ob Luzie jetzt an all das dachte, aber ich nahm wahr, dass in ihre Augen ein Ausdruck getreten war, den ich fürchtete, und sah zu, dass ich den Biografen so schnell wie möglich hinauskomplimentierte, sagte ansatzlos zu ihm, er müsse gehen, und machte ihm mit einer harschen Handbewegung die Dringlichkeit deutlich, als er überrascht wissen wollte, ob er etwas Falsches gesagt habe.
Da hatte ich schon länger nicht mehr erlebt, dass Luzie wirklich auffällig geworden war, aber plötzlich wirkte sie, als wäre sie kurz davor, ihren Kopf gegen die Wand zu schlagen oder aufzuspringen und mit beiden Händen an ihrem Gesicht herumzuzerren, als wäre es nur eine Maske, wie sie es früher gemacht hatte, wenn sie ihr Missfallen über etwas kundtun wollte und kein Wort hervorbrachte. Nach meinem Besuch in ihrem Internat in England war sie angeblich drei Tage lang bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Treppe zum ersten Stock hinaufgestiegen, indem sie jeweils zwei Schritte vor, einen zurück getan hatte, und hatte sich nach jedem Essen übergeben. Jetzt hatte sie sich auf der Couch aufgesetzt und saß stocksteif da, im Schneidersitz, mit durchgedrücktem Rücken, aber sie hatte mit diesem kaum merklichen Wippen begonnen, das für mich ein Alarmsignal war.
Der Biograf war an der Tür stehengeblieben, und als wollte sie ihn nicht einfach so gehen lassen, sagte sie auf einmal, ein Film sei ein Film und auch ein guter Mensch könne einen Dreckskerl wie Theodore Durrant spielen. Sie sagte es wie ein Kind, sie sagte es in der gleichen Art, wie ich es ihr erklärt hatte, als ich sie in ihrem englischen Internat aufgesucht hatte, aber seither waren Jahre vergangen, und sie war natürlich kein Kind mehr, oder vielleicht doch? In Anwesenheit des Biografen hatte sie bisher immer geschwiegen, und er sah sie jetzt mit wachsendem Entsetzen an, während sie nicht aufhörte mit ihren Tautologien, die nur den gleichen Effekt hatten wie seine allzu beckmesserischen Fragen nach meinem Leben, denn je zutreffender das war, was sie sagte, um so mehr musste er den Eindruck bekommen, dass etwas nicht stimmte.
»Aber ich habe das doch nicht behauptet«, sagte er schließlich, als sie zum dritten Mal wiederholte, ich hätte niemanden umgebracht. »Sollte ich den Anschein erweckt haben, tut es mir leid.«
Damit schlüpfte er hinaus, und das nächste Mal entschuldigte er sich, kaum dass er eingetreten war, als wären seither nicht Tage vergangen, sagte eilfertig, er hätte nicht von den Frauen anfangen dürfen, jedenfalls nicht auf diese Weise. Er war nicht so nachlässig gekleidet wie sonst, ja, er trug sogar einen Anzug, der an den Schultern spannte und den er vielleicht das letzte Mal bei seiner Matura angehabt hatte, und bewegte sich nicht mehr so selbstverständlich durch die Wohnung, saß am Ende mit zusammengepressten Beinen in seinem Sessel. Luzie hatte sich diesmal nicht auf ihrer Couch plaziert, sondern zu uns gesetzt, und dass sie den Kopf immer schiefer legte, während der Biograf lossprudelte, mochte der Grund für seine zunehmende Befangenheit sein.
»Ich hätte mich natürlich allemal daran gehalten, nicht darüber zu reden, worüber Sie nicht reden wollen«, sagte er zu mir. »Das müssen Sie mir glauben.«
Es war wieder diese Behauptung, dass es etwas gab, das er unter allen Umständen aussparen musste, und wieder wich er aus, als ich ihn fragte, worauf er anspiele, aber diesmal kam Luzie mir zu Hilfe, ließ dann nicht locker und nagelte ihn fest, sie wisse genau, was er meine, er solle mit seinen Halbheiten aufhören, nicht länger herumtaktieren und endlich offen sagen, was er auf dem Herzen habe.
»Sie möchten Schmutz hören«, sagte sie. »Geben Sie es zu! Sie wollen eigentlich nach meiner Mutter fragen und trauen sich nur nicht. Dieses Gedruckse bringt Sie aber nicht weit.«
Sie starrte ihn offen feindselig an, als er fragte, wie sie darauf komme, und lachte ihm mit erhobenem Kinn ins Gesicht.
»Die dritte Frau in Ihrer Zählung.«
»Ich habe nichts davon gesagt.«
»Drei Ehen im Leben, drei Mal …«
»Als ob das meine Worte wären.«
»Die erste Frau, die zweite Frau … Also wird es auch eine dritte Frau gegeben haben, die zufällig meine Mutter ist. Wie wäre es, wenn Sie es einmal mit dem Namen versuchen würden? Sie heißt Riccarda, mit Doppel-c, und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das gern buchstabieren.«
Dabei schnappte sie zwei- oder dreimal nach Luft, als käme die in unsichtbaren Blöcken angeliefert und sie müsste Stück für Stück davon abbeißen, statt einfach zu atmen. Sie sprach englisch, wie sie es immer tat, sobald sie sich aufregte, und wie sie und ich es längst auch angefangen hatten zu tun, wenn wir unter uns waren. In der fremden Sprache, die in nur zwei Jahren ihre eigentliche geworden war, hatte sie ganz andere Möglichkeiten, war nicht das ängstliche Kind, das kaum ein Wort hervorbrachte, sondern manchmal sogar laut, überdreht und von einem Augenblick auf den anderen nicht wiederzuerkennen. Das machte ihren Ausbruch jetzt nur noch verschrobener, als er ohnehin schon war.
»Es steht sogar bei Wikipedia«, sagte sie. »Was wollen Sie wissen, das Sie dort nicht finden können? Klatsch und Tratsch, den Sie sich wahrscheinlich ohnehin bereits anderswo zusammengeklaut haben und den Sie jetzt bestätigt oder widerlegt haben wollen! Ist es wahr, was man Ihnen erzählt hat, ist es falsch?«
Natürlich waren das Unterstellungen, und natürlich war Luzie ungerecht zu ihm, aber er war noch keine fünf Minuten da, als ich ihn wieder bitten musste zu gehen, wenn ich nicht wollte, dass sie ihm eine richtige Szene machte und nicht allein diese Vorhaltungen. Sie mochten für sich schon ans Groteske grenzen, aber ich kannte ihre Ausfälle, die weit darüber hinausreichten, und war froh, dass ich ihm das nicht zu erklären brauchte und er aufstand und ging, wobei er sich in einem fort entschuldigte. Ich dachte, dass damit das Projekt begraben wäre, und als er wenige Tage später am Telefon war, sagte ich ihm auch, dass ich zu keinen weiteren Interviews zur Verfügung stände, aber er beharrte darauf, schon genug Material gesammelt zu haben, mit den Archiven zu arbeiten und auf jeden Fall eine erste Fassung erstellen zu wollen, die er mir vorlegen werde, ich könne dann immer noch ja oder nein sagen. Der Verlag nahm die gleiche Haltung ein, als ich dort anrief und meine Position klarer formulierte, die Gespräche mit ihm seien gescheitert, und was auch immer er zustande bringen würde, ich würde auf jeden Fall gegen eine Publikation sein, so dass er sich die ganze Mühe am besten spare. Es dauerte dann fast zwei Jahre, bis sein Manuskript in der Post lag, das überhaupt nur zu lesen ich mich da noch weigerte und das Luzie deshalb an sich nahm, um wenigstens einen Blick hineinzuwerfen.
Den beiliegenden Brief konnte man nur als Frechheit bezeichnen. Denn darin schrieb er auf das selbstverständlichste, er habe ein Kapitel nicht abschließen oder genaugenommen gar nicht richtig anfangen können, das er behelfsmäßig tatsächlich »Die dritte Frau« nannte, und es offen gelassen, weil ihm zuviel Information fehle, er erlaube sich aber, mich um ein letztes Treffen zu bitten, von dem das Gelingen des Ganzen abhänge. Ich reagierte nicht darauf, teilte nur vorsichtshalber dem Verlag noch einmal mit, dass alles mit dieser Biografie Zusammenhängende gegen meinen Willen sei, und wunderte mich, woher er den Mut nahm, plötzlich über genau das mit mir reden zu wollen, was er so offensichtlich immer als Tabubereich apostrophiert hatte. Als Drohung empfand ich es nicht, jedenfalls da noch nicht, aber es blieb ein Gefühl nagenden Unbehagens zurück, mit dieser leidigen Geschichte jemanden an mir kleben zu haben, für den die Sache noch nicht abgeschlossen war, zumal ich wusste, dass es keine größere Hartnäckigkeit gibt als die eines Zurückgewiesenen, der sich gegen die Zurückweisung zu wehren versucht.
Das Gespräch mit Luzie hatte ich in dem Restaurant, in das wir zu der Zeit, als sie noch bei mir wohnte, oft gegangen waren, wenn weder sie sich noch ich mich aufraffen konnte, etwas zu kochen. Man kannte uns da und ließ uns in Frieden, keine Bücklinge vor dem ach so berühmten Schauspieler, wie ironisch auch immer sie gemeint sein mochten, kein übertriebenes Gegrüße, keine Anbiederungen, keine Vertraulichkeiten, und als sie hereinkam, setzte sie sich auf diese erwartungsvolle Weise mir gegenüber, mit der sie zeigen wollte, dass ich ihre ganze Aufmerksamkeit hatte. Seit unserem letzten Treffen hatte sie wieder eine andere Haarfarbe, sie hatte von Blond zu Brünett und wieder zu Blond gewechselt, und ein Piercing in der Oberlippe, auf das ich gegen meinen Willen offensichtlich so lange starrte, bis sie mich fragte, ob es mich störe, sie könne es abnehmen. Ich sagte nein, aber sie hatte sich schon in den Mund gefasst und es mit ein paar flinken Bewegungen entfernt, und jetzt war da eine Stelle, an der sich ein kleines Loch zusammenzog und öffnete, wenn sie sprach, und vor ihr auf dem Tisch lag ein Glitzerstein. Sie hatte das Manuskript gerade zu Ende gelesen und meinte, es sei gut, dass ich die Interviews damals abgebrochen und mich aus dem ganzen Vorhaben zurückgezogen hätte, denn dem Schreiben des Biografen fehle jeder Glanz und jeder Esprit.
»Kein Wunder, dass er vorher einen Herzchirurgen und einen Haubenkoch porträtiert hat«, sagte sie und sprach nach den ersten Worten auf deutsch jetzt schon wieder englisch. »Sein nächstes Opfer wird Friseurweltmeister oder etwas in der Liga sein. Es liest sich, als könnte er durch jedes Leben mit seiner Planierraupe fahren, seine Teilchen sammeln und sie zu einem kläglichen Häufchen zusammenschieben. Am Ende werden alle nach dem gleichen Schema zurechtgestutzt. Nirgendwo Liebe, nirgendwo Abscheu, nirgendwo auch nur der Funke einer Flamme.«
»So schlimm?«
»Viel schlimmer noch. Es könnte der Bericht eines Geheimdienstmitarbeiters sein, der sich bemüht, alles auch nur einigermaßen Interessante wegzulassen oder es so weit herunterzudimmen, dass es nicht mehr interessant ist. Wenn er sich in Zukunft rechtfertigen muss, kann er sagen, er habe mit seinen Denunziationen niemandem geschadet. Knieweich bis zum Erbrechen.«
Das war meine kluge Tochter. Sie konnte nicht anders, als ihre Gedanken um drei Ecken zu führen, weil sie nichts Triviales sagen wollte, und landete so oft bei den verrücktesten und belesensten Verdrehtheiten. Es musste wahr, aber es musste nicht nur wahr, sondern auch originell sein, um ihre Gnade zu finden.
»So, wie er alles einebnet, könnte man meinen, es hätte nichts Schönes in deinem Leben gegeben, Papa«, sagte sie. »Dabei erinnere ich mich an wenigstens einmal, wo du glücklich warst. Wir sind zusammen Karussell gefahren. Wir sind in Southend-on-Sea gewesen und auf die Strandpromenade gegangen. Wir haben Zuckerwatte gegessen. Was weiß der Idiot schon von dir?«
Wenigstens einmal glücklich! Das gehörte in die Abteilung »Britisches Understatement«, die sie sich eingerichtet hatte und mit dem zugehörigen Sarkasmus pflegte, wann und wo immer es ging. Ich hätte na ja sagen müssen und dass es vielleicht noch ein zweites Mal gegeben habe, um dann ein möglichst unspektakuläres Beispiel zu bringen, aber wenn sie gerade noch Spaß gemacht hatte, schwenkte sie plötzlich um, und der Ernst in ihrer Stimme war unüberhörbar.
»Was war das Schönste, das du jemals erlebt hast?«
»Du willst die Wahrheit hören?«
»Ich weiß, was du gleich sagen wirst, Papa«, sagte sie. »Ich bin das Schönste, was du jemals erlebt hast. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Ich meine, abgesehen davon und abgesehen von allen anderen Nettigkeiten und Banalitäten.«
Also dachte ich nach, und noch während ich nachdachte, korrigierte sie sich, wir könnten auch am anderen Ende beginnen und damit anfangen, was das Schlimmste gewesen sei, ausgenommen natürlich die ganz und gar unnötigen Begegnungen mit diesem ebenso unseligen wie uninspirierten Herrn Biografen, den sie in Zukunft auch nicht mehr so nennen wolle. Im nächsten Moment schränkte sie es ein von dem, was ich erlebt, auf das, was ich getan hätte. Dann sagte sie noch, vielleicht gebe es ja etwas in meiner Vergangenheit, wofür ich mich schämte, und schon ließ ich mich hinreißen, nach meinen ersten halb spielerischen Ausflüchten gewissenhaft darauf zu antworten.
»Ich habe niemanden umgebracht, und ich habe niemanden so weit getrieben, dass er sich selbst das Leben genommen hat«, sagte ich, als sie nicht aufhörte zu drängen. »Aber ich bin einmal bei einer Sache dabeigewesen, die nicht gut ausgegangen ist.«
Da hätte ich immer noch die Möglichkeit gehabt, einen Punkt zu machen, und der Ausdruck, der in Luzies Augen getreten war, hätte mich warnen müssen, eine Mischung aus Neugier und aufkommender Abwehr.
»Bei einer Sache?«
»Ich glaube nicht, dass du es hören willst.«
»Das kann schon sein«, sagte sie. »Aber jetzt hast du angefangen und musst es zu Ende bringen.«
Halb schien sie immer noch auf einen Scherz zu hoffen, halb darauf, dass ich ihr nur einen Schrecken einjagen wollte und sich alles in Wohlgefallen auflösen würde, und ich zögerte die Fortsetzung hinaus, indem ich versuchte, eine heile Welt zu errichten, und sagte, sie sei damals gerade erst fünf Jahre alt gewesen. Sie sah mich an, als würde ich damit das, was kommen würde, nur schlimmer machen. Ich unternahm eine letzte Ausflucht, blätterte in der Weinkarte herum und spielte den Abwesenden, aber sie wandte einfach nur ihre Augen nicht von mir, bis mir nichts mehr übrigblieb, als damit herauszurücken.
»Ich war Beifahrer bei einem Unfall«, sagte ich. »Eine Kollegin ist gefahren, und es hat eine Tote gegeben.«
»Was soll das heißen, eine Kollegin?«
»Eine Schauspielerin«, sagte ich. »Sie hat auf eine Frau am Straßenrand zu wenig achtgegeben, und ich bin daneben gesessen.«
Das war immer noch nicht die ganze Geschichte, und ich hätte immer noch einen Schwenk machen können, in meinem Erzählen immer noch abbiegen und so heil aus allem herauskommen, aber ihr Blick dirigierte mich, ihr Blick zwang mich weiter, und ich stolperte in mein Unheil hinein.
»Wir haben sie einfach liegen lassen.«
Ich dachte zuerst, der Laut würde von irgendwo unter dem Tisch kommen, aber dann sah ich, wie Luzie sich mit der Hand an den Mund fuhr, und obwohl sie ihre Lippen kaum bewegt hatte, konnte dieses fiepende Wehklagen nur von ihr stammen.
»Ihr habt was, Papa?«
»Wir sind stehengeblieben und zu ihr zurückgegangen, aber es war nichts mehr zu machen.«
»Es war nichts mehr zu machen?«
»Sie war tot, Luzie.«
»Tot, Papa?«
Ich wusste noch nicht, was ich damit angerichtet hatte, aber als sie fragte, wie ich mir da so sicher hätte sein können, und ich es ihr erklärte, und als sie sich dann vergewisserte, ob wir sie wirklich am Straßenrand hätten liegen lassen und niemanden gerufen hätten, weder Polizei noch Rettung, versuchte ich noch einmal nein zu sagen und konnte dann doch nur ja sagen. Seit damals hatte ich es nie jemandem erzählt, gleichzeitig aber so viele Jahre, vierzehn, nein, fünfzehn damit gelebt, dass es zu einem Teil von mir geworden war und ich die Erschütterung, die es auslöste, nicht einzuschätzen vermochte. Natürlich hatte ich immer gewusst, dass ich besser nicht darüber sprach, kein Mensch konnte so etwas billigen oder auch bloß Verständnis dafür aufbringen, wenn ich nur die Umstände erklärte, ich war ein- oder zweimal kurz davor gewesen, es zu tun, und hatte mir dann rechtzeitig die Folgen ausgemalt, nicht so sehr die rechtlichen Folgen, das erschien mir nach all der Zeit noch das Wenigste, sondern die Folgen zwischen mir und dem oder vielmehr der Eingeweihten, es waren beide Male Frauen gewesen, die Vorstellung, welchen Blick sie dann auf mich gehabt hätten. Ich war bei dem Unfall nicht gefahren, aber natürlich machte mich das nicht unschuldig, natürlich war ich beteiligt gewesen und natürlich hatte ich die Entscheidung mitzutragen, die Tote am Straßenrand liegen gelassen zu haben.
Für Luzie, anders lässt es sich nicht sagen, brach eine Welt zusammen, und es war unsere gemeinsame Welt. Wir hatten in der Zeit, in der sie bei mir wohnte, so viel auseinandersortiert, um ihr begreiflich zu machen, wie man seinen Weg durch das Leben fand, dass es bei so etwas nicht den geringsten Spielraum gab. Man fügte keinem anderen Schaden zu, und wenn doch, versuchte man, ihn wiedergutzumachen, und wenn er nicht wiedergutzumachen war, stand man dafür gerade und tat Buße. Es musste auf einer ihrer ewigen Listen stehen, die sie nach den beiden Jahren in England angelegt hatte, und ihr moralisches Empfinden war so stark, dass der kleinste schwarze Fleck auf der weißen Weste sich für immer auszubreiten drohte in ein verwaschenes Grau, wenn sie ihn nicht sofort zu reinigen versuchte. Sie konnte sich noch nach Wochen bei jemandem entschuldigen, wenn ihr plötzlich einfiel, sie habe ihm unrecht getan, und dann stand sie vor einem und bat einen, ihr etwas zu verzeihen, was in Wirklichkeit allein in ihrem Kopf existierte, und sei es auch, dass sie nur schlecht von einem gedacht hatte.
Jetzt hatte sie Tränen in den Augen, und es wurde wenig besser dadurch, dass ich noch einmal sagte, es sei nichts mehr zu machen gewesen, und wenn wir den Unfall gemeldet hätten, hätte das die Tote nicht wieder zum Leben erweckt und der jungen Kollegin nur die Zukunft zerstört. Luzie schüttelte den Kopf, als könnte sie nicht glauben, dass ich so daherredete. Sie hätte mir leicht meine eigenen Prinzipien gegen ein solches Scheinargument an den Kopf werfen können, aber sie gab sich nicht einmal die Mühe und stocherte in ihrem Essen herum, wie sie es lange nicht mehr getan hatte, bevor sie es auf ihre Art verzehrte, zuerst das Fleisch, dann die Beilagen, dann den Salat.
»Den Tod feststellen kann nur ein Arzt«, sagte sie schließlich. »Unabhängig von allem anderen bleibt da das Problem, dass ihr womöglich eine Sterbende am Straßenrand liegen lassen habt.«
In den Wochen darauf sprachen wir nicht mehr darüber. Wenn ich sie traf oder mit ihr telefonierte und etwas dazu anmerken wollte, erwiderte sie immer, was es da noch zu reden gebe, es sei alles gesagt. Schließlich erkundigte sie sich doch, ob ich wenigstens herauszufinden versucht hätte, wer die Tote gewesen sei und ob sie Angehörige gehabt habe, und ließ mir meine Unentschiedenheit nicht durchgehen, fragte, ob ich in den Jahren seither nicht auf den Gedanken gekommen sei, dass ich den Hinterbliebenen helfen könnte, und sei es nur mit Geld, wie es meine Art war, sei es anonym. Darauf sagte ich ja, aber für sie blieb dieses Ja ein folgenloses Ja, weil ich dann doch nichts getan hatte, und am Ende bestrafte sie mich dafür.
»Du musst allein nach Amerika fahren, Papa.«
»Aber doch nicht wegen dieser Geschichte!«
»Ich werde nicht mit dir kommen«, sagte sie. »Ich brauche Zeit, um nachzudenken. Mehr kann ich dir nicht sagen. Es ist besser, wenn wir uns eine Weile nicht sehen.«
ZWEITES KAPITEL
Begonnen hatte die Geschichte, die mit der Toten am Straßenrand irgendwo in der Wüste von New Mexico endete, bereits acht Monate eher auf Stephens Ranch in Montana, die er sich ein paar Jahre davor außerhalb von Helena gekauft hatte, weit genug weg von Missoula, dass er nicht von seiner Herkunft erstickt wurde, und doch so nah, dass es noch seine Gegend war. Dort verbrachte er gewöhnlich die Sommer, manchmal auch einige Wochen im Herbst oder im Winter. Er hatte mich schon ein paarmal eingeladen gehabt, ihn zu besuchen, aber es war immer etwas dazwischengekommen, immer hatte es anderes zu tun gegeben, und seit Luzie auf der Welt war, hatte sie als Grund genügt, dass ich nicht konnte. Anders war dieses Mal gewesen, dass er mich nicht nur wieder aufgefordert hatte, endlich über meinen Schatten zu springen, sondern dass das Ganze mit einem Film verbunden war, für den die Dreharbeiten im Frühjahr darauf beginnen sollten, also weniger Privatvergnügen als Arbeit.
Ich hatte seit meinen ersten amerikanischen Erfahrungen mit dem Film und nach einer Ausbildung in Graz vor allem Theater gespielt, auf Bühnen dort, in Wien und in München, aber nicht nur zu Hause immer wieder Angebote bekommen, daneben für das Kino zu arbeiten, sondern auch aus Amerika. Manches, wahrscheinlich das meiste, hatte ich Stephen zu verdanken, selbst wenn er das leugnete. Er war immer so freundlich zu behaupten, es liege ausschließlich an meinen Qualitäten als Schauspieler, und wenn ich nicht aufhörte, es müsse doch unter den Tausenden von Berufenen oder sich berufen Fühlenden wenigstens einen geben, der meinen Part jeweils übernehmen könne, meinte er lachend, die Leute hätten nun einmal gern einen Österreicher, wenn es darum gehe, die Rolle eines Knochenbrechers zu besetzen, das wirke authentisch. Wenn mir das nicht reichte, sagte er, vielleicht sei der Grund für meinen Erfolg auch mein Englisch mit seinem alpinen Akzent, oder er neckte mich, dass ich in den Spiegel schauen und ihm verraten solle, ob ich sonst noch eine solche Schönheit kennen würde, mit einem solchen Kinn, einer solchen Nase, solchen Augen und einem solchen unwiderstehlichen Spalt zwischen den Schneidezähnen, und spätestens da war es sinnlos weiterzureden.
Wie auch immer es sonst sein mochte, diesmal gab es auf jeden Fall keinen Zweifel, dass er seine Finger im Spiel gehabt hatte. Denn er war mit dem Regisseur befreundet und hatte mich vorgeschlagen, angeblich mit dem etwas peinlichen Hinweis, dass ich jederzeit den harten Kerl hervorkehren, aber dennoch nicht verleugnen könne, dass ich eine Seele von Mensch sei, was mich zur Idealbesetzung für die Rolle mache, und jetzt sollte ein erstes Treffen stattfinden, zu dem er außer mich noch einen weiteren Kollegen und die beiden Hauptdarstellerinnen gebeten hatte, sowie einen Berater, der uns mit den Hintergründen des Films vertraut machen würde. Situiert war dieser im Milieu der amerikanischen Grenzbeamten in Texas, genauer in El Paso und in der Umgebung von El Paso, am Rio Grande, wo auch der größte Teil gedreht werden sollte. Der Regisseur wollte für einen oder zwei Tage zu uns stoßen, und wir würden uns in der fremden Welt zu orientieren versuchen. Wir könnten erste Ideen entwickeln und schauen, ob die Figuren in einem glaubwürdigen Verhältnis zueinander standen und ob es uns gelang, daraus etwas Lebendiges zu schaffen, würden uns näherkommen und die richtige Distanz zueinander suchen, die wir zum Spielen brauchten, und ansonsten einfach ein paar entspannte Tage auf Stephens Ranch verbringen.
Bereits am zweiten oder spätestens am dritten Tag hätte ich sagen können, dass etwas nicht stimmte. Da tasteten sich alle noch ab, aber mir blieb nicht verborgen, dass Stephen mit der ersten Hauptdarstellerin aus dem kleinsten Anlass in Konflikt geraten konnte, wie mir schon bei der Ankunft nicht entgangen war, dass sie ein Paar sein mussten. Er hatte es mir vorher nicht verraten, er hatte mich nur gefragt, ob mir Xenia James ein Begriff sei, und das keineswegs zweideutig, das entsprach ihm nicht, aber allein die Blicke, die sie am Begrüßungsabend quer über den Tisch wechselten, an dem die Bediensteten auf der Veranda groß aufgedeckt hatten, waren nicht zu übersehen, und an den folgenden Tagen prallten sie nicht nur mehrmals zusammen und war ich nicht nur zweimal Zeuge ihrer Umarmungen, sondern geriet ich immer wieder in eine Situation, in der ich dachte, sie hätten gerade entweder Sex oder Streit gehabt oder beides. Schließlich gaben sie jede Zurückhaltung auf, und alles wurde offensichtlich, die Liebe, ja, und nein, nicht der Hass, der Wahn vielleicht, die Verzweiflung, die schiere Energie, wie man heutzutage sagen würde.
Ich hatte mir vor dem Treffen zwei Filme von Xenia angesehen und in beiden ihr Spiel gemocht, das offensichtliche Risiko, das sie darin suchte, nicht mit allen Mitteln gefallen zu wollen. An die Beschwörungen mancher Kollegen glaubte ich nicht, man müsse einen Pakt mit den Zuschauern eingehen, als würden sie insgeheim jedem einzelnen zuzwinkern und ihm damit das Gefühl geben, nur er sei gemeint und habe Anspruch auf Entschädigung, wenn er nicht zufrieden wäre. Bei der Klarheit von Xenias Darstellung konnte keine Rede von so etwas sein. Eher schien sie sich in einem fort umblicken zu wollen, wie um rundum alle zu fragen, ob jemand wirklich glaube, sie sei für konventionellen Unsinn empfänglich, und die Größe, die sie dadurch bekam, strahlte nicht nur auf ihre Figuren aus, sondern auch auf sie als Person. Ich will nicht sagen, dass Xenia eine Diva war, die Zeit der Diven ist ein für alle Mal vorbei, aber wenigstens konnte man vor gar nicht so vielen Jahren noch nicht jeden oder jede selbstverständlich googeln und fand dann etwas, das es einem schwermachte, an das fragile Konzept von Göttlichkeit zu glauben, und seien es nur ein paar Aktfotos, vor Ewigkeiten aufgenommen, leichtfertig aus der Hand gegeben und von einem sogenannten Freund ins Netz gestellt oder überhaupt von einem elenden Spanner gefälscht, der jeden Kopf auf einen fremden Torso mit gespreizten Beinen und nackten Brüsten setzen konnte und sich so seine eigenen Bilder machte.
Solange alle anderen noch da waren, nahm ich an den gemeinsamen Freizeitunternehmungen nicht teil. Wenn sie ausritten, blieb ich in meinem Zimmer, und auch bei den Schießübungen, ohne die ein Aufenthalt auf einer Ranch in Montana nicht komplett gewesen wäre, ließ ich mich entschuldigen, weil mir seit meiner Zeit beim Bundesheer Leute, die mit geladenen Waffen in der Landschaft herumstanden, unheimlich waren. Außerdem hatte ich zum ersten Mal die kindische Idee, einen Roman zu schreiben, die mich seither alle paar Jahre einholte, und auch wenn das nirgendwohin führte, war ich tagsüber beschäftigt. Ich hatte über die Schreibversuche und mehr noch Schreibergebnisse meiner Schauspielkollegen immer gelästert, hatte sie abwechslnd narzisstische oder neurotische Peinlichkeiten genannt, aber ich musste meine eigenen Patzereien ja niemandem zeigen, und mehrere tausend Kilometer von zu Hause entfernt hatte ich ohnhin Narrenfreiheit. Also saß ich da, vor mir das weiße Blatt, und hörte das Geballere aus dem kleinen Wäldchen in der Nähe des Haupthauses und der beiden Gästegebäude und hatte kaum zwei oder drei Sätze vorzuweisen, wenn die anderen zurückkamen. Dafür waren sie aufgedreht, als hätten sie es mit der Anzahl ihrer Drinks nicht so genau genommen oder sich hinter den Büschen die Nasen gepudert, und rechneten sich gegenseitig unaufhörlich vor, wer von wie vielen Schüssen wie viele ins Schwarze getroffen habe.
Bei den Drehbuchlesungen aber war ich natürlich dabei, die wir, in unsere Korbsessel gefläzt, nur halb ernst und mit nachlässiger Ironie auf der Veranda betrieben, weil die Dialoge noch ziemlich hölzern klangen, und ich war auch an dem Nachmittag dabei, an dem der Berater am Zug war und über seine Zeit als Grenzer erzählte. Er war ein gar nicht so kräftig gebauter Mann mit absurden Kringellocken und einem nervös zuckenden Lid, der vorher an Supermarktkassen und in Warenlagern gearbeitet hatte und sich rechtfertigte, er sei überhaupt nur wegen des Geldes bei der Sache gelandet, überall sonst hätte er mit seinen Qualifikationen nicht einmal die Hälfte, kaum ein Drittel verdient. Angeblich hatte er erst vor einem knappen Jahr aus freien Stücken seinen Dienst quittiert, doch Stephen behauptete, er sei in Wirklichkeit suspendiert worden, weil er ein Alkoholproblem habe und bei der Verfolgung von Verdächtigen zweimal ohne Not seine Waffe gezogen und entweder nur in die Luft oder, wahrscheinlicher, wirklich hinter ihnen hergeschossen habe.
Seine Einstellung zu zeigen hütete er sich, aber wenn er schilderte, wie es war, wenn man in der Wüste auf der Lauer lag, wie es sich anfühlte, wenn ein Bewegungsmelder anschlug oder eine Zielperson in das Sichtfeld einer Kamera trat und man den Befehl bekam einzuschreiten, konnte er nicht verbergen, dass er sich immer noch damit identifizierte, und die folgende Distanzierung klang jedesmal lau. Er meinte, die meisten ließen sich widerstandslos festnehmen, sowie man sie eingeholt habe, und dann trete eine Resignation in ihre Gesichter, die man kaum aushalte, sie würden einen bitten, sie laufen zu lassen, während man ihnen Handschellen anlege und sie nach Waffen und Drogen durchsuche, und nicht wenige würden anfangen zu weinen, wenn sich ihre Träume zerschlügen. Zwischendurch machte er lange Pausen, und immer wieder einmal passierte es ihm, dass er in den Slang verfiel, den er offensichtlich mit seinen Kameraden gebraucht hatte, und sich gleich darauf betreten korrigierte. So sagte er statt »Grenze« in der Regel zuerst »Linie«, als würde dadurch der Spielraum enger, auf zwei Dimensionen beschränkt, und als wäre klarer, dass man eine Linie, wenn sie erst einmal gezogen war, nicht ohne Folgen überschreiten konnte, und er sagte »Körper«, als wären es nicht Lebende, sondern Tote, und meinte die Fliehenden, die er im Ödland gejagt hatte.
Wir hörten ihm zu und stellten am Ende brav ein paar Fragen, und Stephen wollte die Versammlung schon auflösen, damit wir vor dem Abendessen noch eine Stunde für uns hätten, als Xenia sagte, sie könne nicht glauben, was da vor sich gehe. Sie hatte sich aus ihrem Sessel erhoben und stand noch in ihrer Reitkleidung da, resolut mit ihrer etwas stämmigen Figur, die Haare zusammengebunden und ihren Blick auf den Berater gerichtet, der einen Teleskopstift aus seiner Brusttasche gezogen hatte und ihn ausfuhr und wieder zusammenschob, als wäre er ein verkümmertes Überbleibsel eines Schlagstocks. Xenia hatte ihn schon zwei- oder dreimal unterbrochen gehabt, jedesmal noch ungeduldiger, hatte sich erkundigt, ob er sicher sei, jeweils das Richtige getan zu haben, hatte wissen wollen, ob er nicht wenigstens mit den Kindern Mitleid verspürt habe, und attackierte ihn jetzt unverblümt.
»Ich will Sie nicht beleidigen, aber für mich hört es sich an wie die schlimmste Drecksarbeit«, sagte sie. »Wenn wir wirklich einen Film darüber machen wollen, müssen wir eine Haltung entwickeln, und das beginnt mit den richtigen Worten.«
Dabei senkte sie ihren Blick und sah den Berater nicht mehr an, sondern auf seine Füße, auf die Stiefel, die er trug. Man hätte es als plötzliche Verlegenheit interpretieren können, aber das war es nicht. Eher schien sie Maß zu nehmen und ihm zeigen zu wollen, wie klein ihn das alles für sie machte, oder sie visierte den Punkt an, wo sie in einer übertriebenen Filmszene vielleicht hingespuckt hätte.
»Ich habe mitgezählt, wie oft Sie in Ihrem Vortrag Körper gesagt haben. Verfluchte vierzehn Mal! Ich habe jedesmal gedacht, wenn Sie es noch einmal tun, erlaube ich mir, Sie einen Idioten zu nennen, und ich habe es vierzehn Mal nicht getan. Dafür sollten Sie mir danken.«
Der Berater war zusammengezuckt, sein nervöses Lid ein einziges Flattern, hatte gleichzeitig Stephens Blick gesucht und begann jetzt, sich mit dem Teleskopstift rhythmisch auf den Oberschenkel zu schlagen, während er sagte, es sei nur ein Wort, und sie ihm sofort widersprach.
»Glauben Sie das im Ernst?«
Sie zischte vor Ablehnung.
»Wollen Sie so genannt werden? Denken Sie einmal nach! Was würden Sie sagen, wenn es jemandem einfiele, Sie als Körper zu bezeichnen?«
Auf seine hilflose Antwort, es habe sich niemand viel dabei gedacht, lachte sie laut auf und sagte, dann sei es aber höchste Zeit, damit anzufangen, und als Stephen einschritt und sie bat, sich zu beruhigen, hatten sie zum ersten Mal offenen Streit, der damit endete, dass Xenia drohte, noch am selben Tag abzureisen.
»Ich soll mich beruhigen, wenn einer von lebenden Menschen spricht und sie Körper nennt, und ihr sitzt alle auf euren Ohren und lächelt ihn an wie den Weihnachtsmann?«
Währenddessen stand der Berater untätig da und wusste nicht, wohin mit seinen Händen. Er hatte den Teleskopstift eingesteckt und hätte sie in Ermangelung anderer Möglichkeiten allem Anschein nach am liebsten an die Hosennaht gelegt oder mit ihnen Bewegungen wie ein Hampelmann vollführt. Dabei strahlte er ein körperliches Unbehagen aus, das sich eigentlich nur in einem Gewaltakt Abhilfe schaffen konnte, und als ich ihn später am Pool sah, wirkte er immer noch so, als suchte er etwas, das er verbiegen, zerbrechen oder zerschlagen könnte.