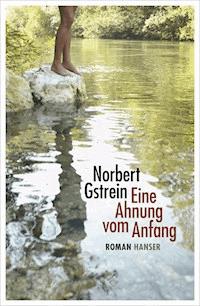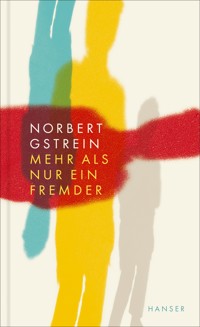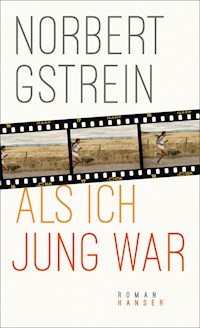Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
John, amerikanischer Jude und ehemaliger Freiwilliger der israelischen Armee, wird in San Francisco auf offener Straße niedergestochen wird. Wer war John? Diese Frage stellt sich dem österreichischen Autor Hugo, der um seinen Freund trauert. Auf den Spuren Johns reist er nach Kalifornien, wo sich die beiden vor einem halben Leben kennengelernt haben, und dann nach Israel. Dort findet er sich im jüngsten Gaza-Krieg auf beiden Seiten des Konflikts wieder. "In der freien Welt“ wagt nun die Frage nach unserem heutigen Blick auf jüdische Identität, auf das Fortwirken deutscher Geschichte und die Politik Israels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
John ist tot: Niedergestochen mitten in San Francisco. Er war ein amerikanischer Jude, ein hinreißender Draufgänger mit der Devise »Leben wie in den Romanen, sterben wie in den Romanen«. Und der Österreicher Hugo der seltsamste Lebensfreund, den er nur haben konnte. Auf den Spuren Johns reist Hugo nach Kalifornien, wo sich die beiden vor einem halben Leben kennengelernt haben, und dann nach Israel. Dort findet er sich in der Zeit des jüngsten Gazakrieges auf beiden Seiten des Konflikts wieder. Norbert Gstrein öffnet die Fenster zur ganzen Welt. Zwischen Kalifornien, Israel und Palästina, zwischen den ersten Lieben zweier junger Männer, ihrem Älterwerden und der großen Politik stellt dieser mitreißend erzählte Roman eine aufrüttelnde Frage: Wie können wir »in der freien Welt« gemeinsam leben, ohne einander Schmerz zuzufügen?
Hanser E-Book
NORBERT GSTREIN
In derfreien Welt
Roman
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-25197-7
© Carl Hanser Verlag München 2016
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Manches von dem Folgenden
ist wirklich geschehen,
aber ich bin nicht ich,
er ist nicht er,
sie ist nicht sie,
die alte Geschichte
Für Alan Kaufman
You said: »Had the earth not been round,I would have continued to walk.«
Mahmud Darwisch, In the Presence of Absence
Erster Teil
BEOBACHTER,ZEUGE UNDBEWUNDERER
I
Der Tod meines Freundes John in San Francisco ist mir mit wochenlanger Verspätung bekannt geworden, aber die genauen Umstände liegen immer noch im dunkeln. Es war wenige Tage nach seinem einundsechzigsten Geburtstag, ein Zufall wahrscheinlich, und die ersten Berichte in den Online-Ausgaben des San Francisco Chronicle und des Examiner gleichen sich fast aufs Wort, sind hier überschrieben mit »Poet dies in knife attack«, dort mit »Poet knifed to death«, ohne weiter darauf einzugehen, dass er Schriftsteller war. Kaum überraschend lautet die offizielle Version, dass er von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und, obwohl er sich nicht zur Wehr gesetzt habe, auf offener Straße niedergestochen worden sei. Er war auf dem Heimweg von einer Abendeinladung im Mission District unterwegs, kurz vor Mitternacht, es gab keine Zeugen, und in der amerikanischen Kriminalstatistik ist er sicher nur ein Toter mehr, insbesondere wenn man bedenkt, dass Oakland auf der anderen Seite der Bucht jahrelang eine sogenannte Hochburg des Verbrechens war und vielleicht immer noch ist. Dabei sticht in seinem Fall eine Besonderheit ins Auge, die der Polizei unmöglich entgangen sein kann. Er trug sein Smartphone und angeblich einen Betrag von exakt 157 Dollar 40 bei sich, ohne Zweifel mehr als zu den meisten Zeiten seines Lebens, und ist nicht ausgeraubt worden. Damit fällt das naheliegendste Motiv weg, und bei der Frage, warum sonst er umgebracht worden ist oder wer Interesse gehabt haben könnte, ihn aus der Welt zu schaffen, sehe ich sofort zwei Ermittlungsbeamte aus dem Fernsehen vor mir, die an eine Tür klopfen und sich treuherzig erkundigen, ob er Feinde gehabt habe. Dazu habe ich Johns Stimme im Ohr, die mich in ihrer Anschmiegsamkeit immer an die Stimme eines Synchronsprechers erinnerte, obwohl es original Englisch war, und wie er sagt, Feinde, um nach einer langen Pause eine dieser einfachen Wahrheiten loszuwerden, vor denen er trotz seiner scharfen Intelligenz keine Scheu hatte, ein Mann, der keine Feinde habe, sei kein Mann.
Ich hatte die Nachricht von Elaine, und das war natürlich kein Zufall. Mit ihr war John zusammen gewesen, als ich Anfang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zum zweiten Mal ein paar Monate in Kalifornien lebte, und wir telefonierten immer noch von Zeit zu Zeit. Ich hatte sie angerufen, weil ich in der Zeitung auf einen unfreundlichen Artikel über San Francisco gestoßen war und mit ihr darüber sprechen wollte, und als ich mich nichtsahnend erkundigte, wie es unserem gemeinsamen Freund gehe, fragte sie, ob ich es denn nicht gehört hätte.
»Nein«, sagte ich. »Was?«
Ich hielt mich zurück, während sie erzählte, was passiert war. Dabei vermochte ich mich nicht gegen den Andrang der Bilder zu wehren, die ich plötzlich vor Augen hatte, ein weichgezeichneter Film im sanften Licht am äußersten Rand des amerikanischen Kontinents, und alles ein halbes Leben und gleichzeitig erst so erschreckend kurz her. Wir hatten viel Zeit gemeinsam verbracht, und vielleicht waren es meine glücklichsten Monate überhaupt gewesen, die Monate mit John und Elaine in jenem Frühjahr, aber das behielt ich für mich. Ich stand in meinem Arbeitszimmer, schaute in den leeren Schulhof gegenüber und rechnete noch einmal nach, wie spät es in Kalifornien war und ob ich nicht zu früh angerufen hatte, als Elaine sagte, es sei in der Gegend des Mission Dolores Park geschehen.
»Sagt dir die Clarion Alley etwas, Hugo?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Ich glaube nicht.«
»Sie verbindet die Mission Street mit der Valencia Street. Es ist nur ein schmaler Durchgang. Nach Einbruch der Dunkelheit dürfte dort kaum jemand unterwegs gewesen sein.«
»Klingt nicht unbedingt nach einem Ort, den man sich zum Sterben aussuchen würde«, sagte ich, um irgend etwas zu sagen. »Andererseits hat der Name ja etwas Poetisches. Das macht es nicht weniger wahrscheinlich, dass es sich um ein elendes Rattenloch handelt. Was heißt ›clarion‹ denn auf deutsch?«
»Das fragst du mich?«
»Trompete oder Posaune?«
»Wenn du es sagst.«
»Fanfare?«
»Die Gegend ist sicher nicht mehr so schlimm wie damals«, sagte sie. »Da war es eine finstere Ecke. Jetzt treiben sich tagsüber in der Gasse sogar Touristen herum, die sich die Wandgemälde anschauen. Nicht, dass das etwas bedeuten würde.«
»Haben wir uns nicht immer ganz in der Nähe getroffen?«
»Doch«, sagte sie. »Vor dem alten Missionsgebäude oder direkt am oberen Rand des Parks an der 20th Street. Der Blick von dort über die Stadt hatte es John angetan. Es war einer seiner Lieblingsorte.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Er hat sogar ein Gedicht darüber geschrieben. Ich kann es noch auswendig. Ein einziger Gefühlsausbruch.«
»Was für ein Gedicht?«
»Er hat es uns im Park vorgelesen. Eine Beschwörung des Westens, aber mehr noch eine Elegie auf dich. Er hat sich erhoben und ist mit wehenden Haaren im Wind gestanden.«
»Zumindest hast du das davon in Erinnerung behalten«, sagte sie halb abwehrend, halb voller Zustimmung. »Mir ist erst im nachhinein klargeworden, dass wir immer zu dritt zusammengesteckt sind. Aber so war es doch, oder? Jeden Tag.«
»Jeden Tag«, sagte ich. »So war es.«
Meine Wehmut war nicht zu überhören.
»Ich weiß nur nicht mehr, warum ich immer dabeigewesen bin.«
»Na, na, Hugo«, sagte sie. »Das kann ich dir gern verraten. Versteh mich bitte nicht falsch, aber du warst sein Beobachter, Zeuge und Bewunderer. Ohne dich hätte ihm die ganze Geschichte mit mir nur halb soviel Spaß gemacht.«
Wahrscheinlich hatte sie recht. Elaine stammte aus einer Kleinstadt in Nebraska, und sie war der Typ Mädchen, die John um sich scharte oder die auf ihn flogen und mit denen er sich vorstellen konnte, unter freiem Himmel und buchstäblich von nichts als von Luft und Liebe zu leben. Wenigstens hatte er das einmal zu mir gesagt, als ich ihn fragte, ob ihm nicht schwindlig werde bei der Häufigkeit, mit der er seine Freundinnen wechsle, und ob es nicht anstrengend sei, dem Bild des Draufgängers zu entsprechen, mit dem er spielte. Wir hatten ein paar Monate lang zusammengewohnt, in einem mehr als nur renovierungsbedürftigen viktorianischen Haus in Lower Haight, und dort hatte ich auch Elaine kennengelernt, als sie mir eines Nachts, aus Johns Zimmer kommend, auf dem Weg zur Toilette im Gang begegnete. Sie hatte nichts an, hob lächelnd eine Hand und schob sich, groß und jungenhaft schlank, wie sie war, mit ihrem rotblonden Haar, eine Hüfte vorgereckt, die Schultern zurückgenommen, an mir vorbei. Mit den Lippen formte sie ein lautloses »Hi«, und daran musste ich jetzt wieder denken, als ich ihre Worte wiederholte.
»Beobachter, Zeuge und Bewunderer.«
Ich hörte sie schlucken, als sie sagte, am Ende sei John trotzdem allein gewesen und zu bewundern und zu bezeugen habe es so viel auch nicht mehr gegeben, und ich wusste nicht, ob sie den Augenblick des Todes meinte oder die letzte Zeit seines Lebens, die letzten Monate oder vielleicht sogar Jahre.
»Er hat sich im übrigen auch immer ausgemalt, dass er so enden würde«, sagte sie, als ich nichts erwiderte. »Erinnerst du dich nicht mehr, Hugo?«
»Allein, meinst du?«
»Nicht nur das«, sagte sie. »Auch die Art und Weise.«
»Dass er auf offener Straße niedergestochen würde?«
»Vielleicht nicht niedergestochen, aber über den Haufen geschossen«, sagte sie mit einem resignierten Ausdruck in der Stimme und als legte sie Wert auf genau diese Formulierung. »Ich weiß allerdings nicht, ob der Unterschied so groß ist.«
Er hatte damit kokettiert und am Anfang womöglich nicht einmal kokettiert, sondern wirklich Angst gehabt. Auch in seinen frühen Schreibversuchen war es ein wiederkehrendes Thema gewesen und das Thema seiner ersten publizierten Erzählung Who I am, dass er so zu Tode kommen würde, selbst wenn da die meisten noch dachten, was er sich ausmale, sei bloße Fiktion. Er hatte den wenigsten erzählt, dass er während des ersten Libanonkriegs in der israelischen Armee Dienst getan hatte und im Gazastreifen im Einsatz gewesen war, und so dachten viele, die Kampfszenen, die er beschrieb, mit den penibel dargestellten Grausamkeiten, seien genauso reine Erfindung wie der Verfolgungswahn seit seiner Rückkehr und das jahrelang anhaltende Gefühl der Bedrohung.
»Dahinter steckt seine alte Geschichte«, sagte ich. »Er war damals schwer traumatisiert, aber das ist eine Ewigkeit her. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um zu begreifen, warum er keinen Tropfen mehr trinkt? Ich habe geglaubt, er macht das freiwillig.«
»Aber das hat doch jeder gewusst, Hugo.«
»Ich nicht.«
»Du hast nicht gewusst, dass er oft zweimal am Tag zu seinen Anonymen Alkoholikern gegangen ist? Er war da noch gar nicht lange trocken. Wie kann dir das entgangen sein?«
»Ich habe gedacht, es ist seine freie Entscheidung, sich von allem fernzuhalten«, sagte ich. »Kennengelernt habe ich ihn anders. Da hat er nicht mehr aufhören können, wenn er einmal angefangen hat. Aber im Grunde hat es immer schon zu seinen asketischen Vorstellungen gepasst.«
Ich hätte Elaine gern gesehen, als ich ihr Lachen hörte. Es klang noch mädchenhaft, aber dazwischen brach ein dunklerer Unterton durch. Ich wusste nicht, ob Sarkasmus darin mitschwang, aber etwas sagte mir, dass sie viel über die Geschichte nachgedacht hatte und nicht noch einmal damit anfangen wollte.
»Der Krieg hat ihn auf jeden Fall weiter beschäftigt«, sagte sie trotzdem. »Manchmal ist es mir erschienen, als würde er es als gerechte Strafe empfinden, wenn sich seine schlimmsten Alpträume erfüllten. Über seine Erlebnisse als Soldat ist er nie hinweggekommen. Auch nach mehr als dreißig Jahren nicht.«
»Als gerechte Strafe?« sagte ich. »Es kann doch nicht sein, dass wir in einem Telefongespräch über zwei Kontinente und einen Ozean hinweg über ihn zu Gericht sitzen.«
»Davon ist keine Rede«, sagte sie. »Wir unterhalten uns über ihn. Außerdem war er selber nicht gerade zurückhaltend, wenn es um seine Heldentaten ging. Er hat doch ungefragt jedem alles erzählt, ob der ein Ohr dafür hatte oder nicht.«
Sie setzte an, noch etwas zu sagen, und es war deutlich zu hören, dass sie es sich verbiss und stattdessen wiederholte, sie rede nur von seinem Gefühl auch nach dreißig Jahren, dass er so enden würde. Dann schwieg sie, und ich legte ihr nahe, daraus keine große Geschichte zu machen, es gebe wahrscheinlich gar nicht so wenige Menschen, die sich zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens ausgemalt hätten, wie sie sterben würden, und die dann auch genauso gestorben seien. Ich weiß nicht, warum ich das sagte, aber es hörte sich falsch an und wurde nicht besser dadurch, dass ich es ins Anekdotische zog und damit verharmloste.
»Einmal hat er doch auch gesagt, am liebsten würde er sterben wie ein Revolverheld in einem Western. Erinnerst du dich nicht? Es müsste nur schnell gehen, ein Schusswechsel auf einer staubigen Straße, und entweder er wäre dran oder der andere.«
Ich hatte ihr noch nichts von unserem letzten Treffen erzählt, bei dem er das Thema auch angeschnitten hatte, aber als ich das jetzt tat, war mir im selben Augenblick klar, dass ich mit dem Ende anfangen müsste, wenn ich seine Geschichte in den Griff bekommen wollte, weil die Eindrücke von dieser Begegnung so frisch waren.
»Wir haben uns im Frühjahr noch in Israel gesehen.«
Es war Anfang Juni gewesen, keine drei Wochen vor seinem Tod, und sie reagierte irritiert.
»Das erwähnst du erst jetzt?«
»Tut mir leid«, sagte ich. »Keine böse Absicht.«
»Aber was habt ihr in Israel gemacht?«
In ihre Stimme war etwas Gereiztes getreten. Sie hatte selbst immer mit John dorthin gewollt, aber das konnte nach so vielen Jahren nicht mehr der Grund sein. Damals war kein Tag vergangen, ohne dass sie mit ihm über das Land gesprochen hatte. Es war die Zeit der Kuwait-Krise gewesen, und als die Amerikaner im Irak einmarschierten und als Vergeltung die ersten Raketen in Tel Aviv einschlugen, war es ihr nicht mehr gelungen, ihn vom Fernseher wegzubringen. Wie gebannt sah er die immer gleichen Bilder, sich vor Sicherheitsbunkern verängstigt drängende Menschen, futuristische Gasmaskengesichter und grelle Explosionsblitze über der nächtlichen Stadtsilhouette, und rief schließlich im israelischen Konsulat an, er melde sich erneut zum Einsatz, man könne jederzeit über ihn verfügen, er sei bereit zu kämpfen, wohin auch immer man ihn schicke. In seinen späten Dreißigern und mit etlichen Kilo zuviel, wurde er nicht ernst genommen, aber so erfuhr ich auch, dass er eine kleine Tochter in Tel Aviv hatte, deren Mutter ihm jeden Kontakt zu ihr verwehrte, was ihn rasend machte bei der Vorstellung, dem Mädchen könne etwas passieren. Es waren entsetzliche Wochen für ihn gewesen, und gerade die Erinnerung daran ließ mich jetzt aus irgendeinem Grund abwiegeln.
»Was sollen wir in Israel schon gemacht haben«, sagte ich. »Nichts Besonderes. Wir haben dort Zeit verbracht und es uns gutgehen lassen. Das ist alles.«
Vielleicht war das ein bisschen zu nachlässig, aber ich wunderte mich dennoch, in welcher Erregtheit Elaine sofort über mich herzog.
»Ihr habt euch in Israel getroffen, um dort nichts Besonderes zu machen?« sagte sie. »Da habt ihr euch aber einen schönen Ort ausgesucht. Was erzählst du mir da? Hast du vergessen, dass John Jude war? Ein gemeinsamer Badeurlaub von zwei unbedarften älteren Herren an einem Mittelmeerstrand, willst du das sagen? Den hättet ihr auch woanders haben können.«
»Aber Elaine.«
»John ist hinterrücks ermordet worden, und du erzählst mir, ihr habt euch drei Wochen davor in Israel getroffen«, fing sie noch einmal an. »Ist das nicht etwas Besonderes? Seine Freunde sitzen hier ratlos herum und suchen nach einem Grund. Kannst du dir nicht vorstellen, dass das auch für die Polizei von Interesse wäre?«
»Ich habe doch gerade erst erfahren, dass er tot ist.«
»Aber dass ihr euch in Israel getroffen habt, erzählst du mir trotzdem so, als würde damit nicht alles unter einem anderen Stern stehen. Verstehst du denn nicht? Wenn ein Jude drei Wochen nach einem Aufenthalt in Israel ermordet wird, ist das doch etwas anderes, als wäre er vorher nur zum Wassertreten auf Hawaii gewesen.«
Ich stimmte zu und versuchte gleichzeitig, ihr zu widersprechen, aber sie unterbrach mich, sie habe keine Zeit mehr, ihr Sohn warte schon, dass sie ihn zur Schule bringe.
»Können wir später noch einmal reden?«
»Natürlich«, sagte ich. »Wann immer du willst.«
»Du musst mir alles erzählen, Hugo. Tag für Tag, wo genau ihr wart, was ihr getan habt, eure Gespräche. Dann kann ich mir ein Bild machen.«
»Sag einfach, wann.«
»Am besten heute abend. Wie groß ist der Zeitunterschied? Acht oder neun Stunden? Du kannst mich auch mitten in der Nacht anrufen.«
Das war ihre alte Quirligkeit, und ich hatte schon aufgelegt, als ich merkte, dass ich gar nicht auf den misslaunigen Artikel über San Francisco zu sprechen gekommen war, wegen dem ich mich bei ihr gemeldet hatte. Wir waren uns damals vor über zwanzig Jahren auf eine Weise vertraut gewesen, die etwas von der Vertrautheit von Geschwistern hatte, aber während ich das hinschreibe, weiß ich, es stimmt nicht, oder es stimmt nur, wenn man alle Möglichkeiten und die eine Unmöglichkeit mit dazudenkt. Ich hatte mich am Abend immer im letzten Sonnenlicht zum Lesen auf die Holzstufen vor dem Haus gesetzt, und wenn sie herauskam und sich eine Zigarette anzündete oder sich nur wortlos zu mir gesellte und wartete, dass ich das Buch weglegte, war ich glücklich. Diese Stunde vor dem Dunkelwerden liebte ich über alles, die Geräusche aus der Stadt hatten etwas anheimelnd Fremdes, der Lärm trat zurück, auf einmal drang eine Vielzahl von Stimmen aus der Nachbarschaft, aus offenen Fenstern, aus den Gärten, manchmal eine Polizeisirene, manchmal etwas, das sich wie Schüsse anhörte, und Elaine saß, die Arme um die Knie geschlungen, in einem ihrer verspäteten Blümchenkleider da und sagte, was ich gerade selbst gedacht hatte, jetzt könnte die Zeit stehenbleiben, oder sinnierte einfach nur, wie verrückt das auch sei, es habe etwas Beruhigendes, sich vorzustellen, dass wahrscheinlich schon vor uns ein Mann und eine Frau auf diesen Stufen gesessen seien und die gleichen Gespräche geführt hätten und dass auch nach uns welche so dasitzen würden. Ich fing ihretwegen an zu rauchen und blieb meistens noch eine Weile rauchend draußen, wenn sie zu John hineinging, immer mit einer Geste, als würde sie in der kühleren Abendluft frösteln, aber wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Um Geld zu sparen, hatte er mir sein Zimmer vermietet und war selbst in die fensterlose Abstellkammer gezogen, drei mal zwei Meter, wo es außer seinem Schlafsack auf dem Boden, einer Kiste mit Kleidung und ein paar Büchern nichts gab, und ich wollte die Laute nicht hören, die wenig später aus dem finsteren Loch drangen.
Als ich selbst einmal eine Frau mit nach Hause brachte, kam Elaine ein paar Tage lang nicht mehr zu mir auf die Treppe hinaus. Es war eine Zufallsbekanntschaft aus dem Kino, eine Nachmittagsvorstellung im Castro, und obwohl überall Platz genug blieb, setzte die Fremde sich direkt neben mich. Die Worte, die ich mit ihr wechselte, hätte ich gern gezählt, weniger ging fast nicht, und auch mit ihr zu schlafen war eine lautlose, grimmige Sache, ihr bleiches Gesicht im Dämmerlicht wie ausgeschnitten, die weit aufgerissenen Augen, und vor dem offenen Fenster die Gelassenheit der Palmen, durch die ein Schauer ging, wenn der Wind in sie hineinfuhr. Sie war nicht mehr jung und sagte, ihr Mann sei vor zwei Wochen gestorben, als sie aufstand und sich anzog, im Spiegel über dem Kaminsims ihr Mascara prüfte und sich verabschiedete, ohne Namen oder sonst irgend etwas. Ich überlegte, ob ich das Elaine überhaupt erzählen sollte, als sie endlich wieder draußen vor dem Haus auftauchte, aber ein »Und?« von ihr genügte, und ich kannte kein Halten.
»Na dann, gute Nacht«, sagte sie, als ich geendet hatte. »Muss wohl eine europäische Finesse sein. Die ganze Stadt ist voller Mädchen, und du schleppst ausgerechnet diesen Todesengel an. Ist hoffentlich nicht ansteckend.«
Sie hatte sich nicht hingesetzt und hampelte vor mir hin und her. Kaum war sie ein paar Stufen die Treppe hinuntergehüpft, stieg sie von neuem herauf. Sie wusste nicht wohin mit ihren Händen, vergrub sie im Stoff ihres Kleides, um sie gleich wieder hervorzuholen. Dabei sah sie mich nicht an, sondern starrte abwechselnd vor sich auf den Boden und im nächsten Augenblick haarscharf an mir vorbei.
»Die Erotik des Morbiden, uh?«
»Was soll das heißen, Elaine?«
»Der kleine Tod und der große Tod, uh?«
Ich erwähne das auch, weil sie dann ansatzlos von Johns Mutter redete, die im Krieg als Vierzehn- oder Fünfzehnjährige vor der drohenden Deportation aus Paris geflohen sei und bei italienischen Partisanen in den Bergen überlebt habe. Es war eine irritierende Verbindung, die sie da herstellte, ob zufällig oder bewusst, und ich konnte groteskerweise auch später nicht an diese Flucht denken, ohne mich gleichzeitig an die Frau aus dem Kino zu erinnern, mit der ich geschlafen hatte. John selbst hatte mir gegenüber bis dahin nie von seiner Mutter gesprochen, und Elaine erzählte jetzt, er sei als Kind manchmal mitten in der Nacht von ihrem Schluchzen wach geworden und habe sie dann über ihren Koffer gebeugt auf dem Boden kniend vorgefunden, mit den paar Erinnerungsstücken aus ihrem ersten Leben, den Fotos der Toten, ihrer ermordeten Eltern und Freunde, die sie unter ihrem Bett aufbewahrt und Nacht für Nacht angeschaut habe.
»Das musst du wissen«, sagte sie, nachdem sie eine Weile geschwiegen hatte. »Sonst weißt du gar nichts von ihm.«
So ernst hatte ich sie davor nie erlebt. War es gerade noch, als würde sie nur witzeln, hatte sie von einem Augenblick auf den anderen den Ton gewechselt, und hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich es als gezielten Angriff auf mich empfunden. In dieser Sache schien sie keinen Zweifel zu dulden.
»Ein kleiner Junge, der seiner Mutter dabei zuschaut, wie sie mitten in der Nacht die Fotos ihrer ermordeten Eltern und ihrer ermordeten Onkel und Tanten aus einem Pappkoffer hervorholt. Das war in der Bronx, wo er aufgewachsen ist. Er dürfte noch keine fünf Jahre alt gewesen sein, als er es zum ersten Mal gesehen hat. Das ist seine Geschichte, und genau davor ist er geflohen.«
Ich war so überrumpelt, dass ich nichts sagte, aber wenn ich heute darüber nachdenke, ist mir klar, dass das der Anfang war und dass ich genausogut damit beginnen könnte und nicht mit dem Ende, als wir uns zum letzten Mal trafen. Mir war es immer so selbstverständlich erschienen, John als stark zu sehen, dass ich lange keinen Blick für alles andere hatte, und noch immer legt sich über das Bild des kleinen Jungen, der seine weinende Mutter beobachtet, wie sie sich über den Koffer mit den Bildern ihrer Toten beugt, die imposante Erscheinung, die er als Mann abgegeben hat. Dann höre ich auch jedesmal seine Stimme und wie er sich selbst anpreist, als müsste er gegen die ganze Welt in den Ring steigen.
»Ein Meter fünfundneunzig vom Scheitel bis zur Sohle. Wenn du willst, kannst du gern nachmessen. Hundert bis hundertzehn Kilo Kampfgewicht, je nachdem.«
Ich hatte ihn nach seiner Größe gefragt und brauchte nicht weiterzufragen, weil er nur darauf gewartet hatte, einmal richtig loslegen zu können.
»Im College habe ich Football gespielt«, sagte er. »Alle Positionen, aber hauptsächlich Quarterback. Willst du wissen, wie mein Spitzname war? Knochenbrecher.«
Es folgte eine Aufzählung der Verletzungen, die er sich zugezogen hatte, und so wie er seinen Stolz zelebrierte, tat er es nicht das erste Mal.
»Mehrere angeknackste Rippen, ein ausgeschlagener Schneidezahn, eine Gehirnerschütterung, um von den Prellungen und Quetschungen erst gar nicht zu reden.«
Trotzdem kam ich nicht auf die naheliegende Idee, dass dieses Bramarbasieren für John eine Schwäche weniger verbergen als ihn dagegen immun machen sollte, und ich sehe erst jetzt, was im Grunde schon damals offen zutage lag. Er ließ keine Gelegenheit aus, sich als Kämpfer darzustellen, und seine Art, einen Streit eher zu suchen, als ihm aus dem Weg zu gehen, hat mich an seiner Seite oft genug in Schwierigkeiten gebracht. Ich erinnere mich an Wortgefechte in Bars und auf der Straße, nicht nur einmal war es soweit, dass er sagte: »Ich nehme den Großen, du den Kleinen« oder: »Ich nehme den Linken, du den Rechten«, und es lag wahrscheinlich nur an seinem einschüchternden Äußeren, weshalb ich nie beweisen musste, dass ich für ihn einstehen und nicht davonlaufen würde. Ob es mit dem Koffer seiner Muter zu tun hatte oder nicht, er durchquerte den halben Kontinent als blinder Passagier auf Zügen, kaum dass er New York hinter sich gelassen hatte, er verschrieb sich immer neuen Sportarten, hatte eine Zeitlang ein schweres Motorrad und suchte beim Wellenreiten an der kalifornischen Küste oder beim Klettern in den Rocky Mountains die Gefahr, als müsste er sich stets von neuem bestätigen, dass er entkommen war und, wie sehr er das Schicksal auch herausforderte, seinen Kopf immer aus der Schlinge ziehen würde. Er brach sich nicht das Genick, er stürzte nicht ab, und die Züge waren zwar Güterzüge und führten manchmal auch Viehwaggons mit, aber sie fuhren nicht nach Osten, sie fuhren nicht nach Polen, sie fuhren nach Westen, und er saß mit baumelnden Beinen in der offenen Schiebetür und schaute zu, wie die endlose Prärie an ihm vorbeizog, ein kleiner Junge mit der Statur eines Riesen, der mit seinem markanten Gesicht und dem schulterlangen Haar den perfekten Krieger in einem Sandalenfilm abgegeben hätte, einen Söldner in der Armee König Davids, der mit Schwert und Schild durch die judäische Wüste zog.
II
Ich habe John kaum je so entspannt gesehen wie bei unserem letzten Treffen in Israel, nicht lange vor seinem Tod. Als junger Mann hatte er in einem Kibbuz gearbeitet, und als reichte ihm die Erinnerung daran, schien jetzt alles Posieren und Den-harten-Kerl-hervorkehren-Müssen, ob selbstironisch oder nicht, weitgehend von ihm abgefallen. Er war eine andere Person, und das begann schon mit dem Namen. Seine Freunde dort nannten ihn Jonathan, was er sich in Amerika immer verbeten hatte, wo er sogar auf dem »h« in der geschriebenen Kurzform bestand, und das gab ihm trotz seines Alters etwas Knabenhaftes. Er war von San Francisco hingeflogen, ich von Wien aus, und wir hatten fast fünfundzwanzig Jahre nach unserer gemeinsamen kalifornischen Zeit ein letztes Mal Tage zusammen verbracht, die in mir das Glück von damals heraufbeschworen. Dazu brauchte es nicht mehr, als dass wir uns viele Stunden im Freien aufhielten, dass immer Leute um uns waren, Freunde und Bekannte von ihm, und dass wir bis tief in die Nacht hinein diskutierten, mit einer ganz anderen Leidenschaft als zu Hause. Ich hatte meine paar intakten Verbindungen in die österreichische Kulturwelt genützt, um ihn im Sommer davor nach Gmunden zu einem Festival einladen zu lassen, wo er seine Gedichte vorlas und auf einem Podium über den israelisch-palästinensischen Konflikt sprach, und wir hatten uns dort nicht nur für nächstes Jahr, sondern möglichst für irgendwann in den nächsten paar Monaten in Jerusalem verabredet. Wie als Beweis unserer Entschlossenheit gab es dieses Foto von uns, aufgenommen am Strand von Tel Aviv, auf dem John einen Arm um meine Schultern gelegt und seinen Kopf mir zugeneigt hat, das Haar schwarzgefärbt und lang, wie er es immer noch trug, die Augen von einer Sonnenbrille verborgen, aber dahinter ohne Zweifel mit dem weichen und gleichzeitig brennenden Ausdruck, mit dem allein schon er stets alle um sich eingenommen hat. Er hatte sich breitbeinig in den Sand gestellt und der Freundin, die den Schnappschuss machte, Anweisungen gegeben, als hinge unsere Zukunft davon ab. Ich erinnere mich, wie er zu mir sagte, ich solle mich anstrengen, eine gute Figur abzugeben, das sei unser Bild für die Nachwelt.
Ich könnte von diesen Tagen erzählen, als wüsste ich immer noch nichts von seinem Tod oder als strahlten sie in meiner Erinnerung trotz der Missverständnisse, die wir auch hatten, eine besondere Helligkeit aus, weil ich jetzt weiß, dass er danach nur noch so kurz lebte. John hatte mich immer gedrängt, endlich einmal nach Israel zu fahren, und als ich es dann eines Tages ohne ihn tat und ihm davon berichtete, reagierte er eifersüchtig. Zuerst verstand ich das nicht, aber dann begriff ich, es hatte weniger damit zu tun, dass ich dort gewesen war, als mit meinem Sprechen darüber. Ich könnte herumreisen, wo immer ich wollte, dürfte mir aber bloß nicht einbilden, ich wäre dadurch in der Lage, ihm auch nur irgend etwas von Bedeutung über das Land zu sagen, in dem er mehrere Jahre verbracht hatte und für das er bereit gewesen war und immer noch bereit wäre, sein Leben zu geben.
Wir hatten Streit, als ich ihm sagte, ich hätte vor, auch in die Westbank zu fahren. Es war am dritten Tag unseres Aufenthalts, und wir hatten bis dahin das Thema umgangen, was eine ziemlich lange Zeit dafür war. Ich gab mich möglichst beiläufig, und er tat zuerst, als hätte er nicht gehört, sprach über etwas anderes und fragte dann plötzlich, was ich dort wolle.
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Schauen.«
Er wiederholte das Wort und lächelte irritiert.
»Was meinst du mit ›schauen‹? Du willst dir einen Eindruck verschaffen, wo ich im Krieg war, stimmt’s? Ein bisschen Sensationstourismus, ein bisschen Gruseln, ein bisschen Kokettieren mit der Gefahr, die es für dich gar nicht gibt, wenn du dich nicht verhältst wie ein Narr. Am liebsten würdest du auch in den Gazastreifen fahren, aber dort lassen sie dich zum Glück nicht hinein. Was erwartest du? Du glaubst doch nicht, dass du dann klüger bist als jetzt?«
Er hatte sich in eine Erregung hineingeredet, die er nicht mehr zu kontrollieren vermochte, und ich beging den Fehler zu sagen, er könne ja mitkommen, was ihn nur noch mehr aufbrachte.
»Kann ich nicht.«
»Natürlich kannst du, John.«
»Kann ich nicht.«
Es klang jetzt so bestimmt, dass ich fast nicht wagte, noch einmal zu widersprechen, und als ich sagte, er habe einen amerikanischen Pass und könne sich frei im Land bewegen, war er voll Hohn.
»Als ob es nur darum ginge. Ich kann nicht dorthin. Das weißt du genau. Außerdem würden die sofort erkennen, dass ich Jude bin.«
»Die Diskussion haben wir schon gehabt. Wie du weißt, siehst du für mich eher aus wie ein römischer Legionär, den es in die falsche Zeit verschlagen hat. Wir sollten nicht noch einmal damit anfangen, wenn wir nicht bei deiner Nase landen wollen.«
»Ich will nur sagen, dass ich auf meinen amerikanischen Pass im Zweifelsfall pfeifen kann«, sagte er. »Ich weiß nicht, welche Sensoren die dafür haben, aber manchmal rede ich mir ein, die Bastarde riechen es.«
»Jetzt riechen Juden also schon«, sagte ich. »Wonach denn bitte? Nach Kamelmist? Nach einer muffigen Gelehrtenstube aus einem anderen Jahrhundert?«
»Nach den Zedern des Libanon«, sagte er. »Wonach sonst?«
»Warum nicht gleich nach Weihrauch und Myrrhe? Nach den sinnbetäubenden Düften des Orients? Nach dem Atem Gottes?«
Ich sah ihn an, und er lachte.
»Vielleicht auch nur nach der Wüste«, sagte er. »Das ist von allen Gerüchen der reinste. Hast du nie T.E. Lawrence gelesen? Dort steht es.«
Es war ein Geplänkel, wie ich es nur mit John haben konnte, weil bei ihm jedes Missverständnis ausgeschlossen war, aber von den drei Tagen meiner Abwesenheit wollte er dann trotzdem nichts wissen. Er tat so, als wären meine Fahrten nach Bethlehem und Hebron, nach Ramallah und Nablus gar nicht geschehen, und fiel mir ins Wort, wenn ich darauf zu sprechen kam. Dabei hätte ich ihm so viel zu sagen, hätte ihn so viel zu fragen gehabt, aber nach den ersten Abfuhren unterließ ich es, und wenn mir doch einmal etwas herausrutschte, biss ich mir auf die Zunge und entschuldigte mich.
Ich erfuhr erst später, dass er in meiner Abwesenheit vergeblich versucht hatte, seine Tochter zu treffen. Auch das trug zu seiner schlechten Laune bei. Er hatte sich schon von Amerika aus mit ihr verabredet, aber jetzt klappte es nicht, und er reagierte nicht wie ein Vater, sondern wie ein zurückgewiesener Liebhaber.
Am Tag nach meiner Rückkehr mietete er ein Auto und brachte mich wie als Gegenprogramm zu meinen Verirrungen in den Negev, als wollte er mir zeigen, dass es neben der Herrlichkeit von Tel Aviv mit seinen Stränden, Cafés und dem in allen Reiseführern angepriesenen mediterranen Flair nicht nur Jerusalem, sondern noch eine ganz andere Wirklichkeit des Landes gab. Wir besuchten das Wüstenhaus von Ben Gurion, und ich merkte, wie John mich die ganze Zeit im Auge behielt, während wir durch die Ausstellungsräume des Museums gingen und die karge Wohnung und das rumdum mit Büchern vollgestellte Arbeitszimmer des ersten Premierministers anschauten. So dargeboten, war es wenig, was selbst von einem großen Leben blieb, und in Erinnerung behielt ich vor allem die getrennten Schlafstätten des Ehepaars mit ihren jeweils an die Wand gerückten, schmalen Betten, nicht gerade Feldbetten, aber viel mehr dann auch wieder nicht. Wir waren gemeinsam mit einer Schulklasse da, und wie es seine Art war, hatte John längst Kontakt zu der Lehrerin aufgenommen. Er sprach hebräisch mit ihr, und ich verstand kein Wort, aber er erklärte mir, was sie zu den Schülern sagte.
»Sie hat es mit der Wüste. Du solltest verstehen, mit welcher Inbrunst sie darüber spricht. Sie will von den Kindern wissen, warum die Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten, vierzig Jahre durch die Wüste geirrt sind, bevor sie das Gelobte Land betreten haben.«
»Wahrscheinlich, weil es der Wille Gottes war.«
»Natürlich«, sagte er. »Aber der lässt sich erklären.«
»Es steckt nicht reine Willkür dahinter?«
»Ausnahmsweise nicht«, sagte er. »Die Generation der in der ägyptischen Sklaverei Aufgewachsenen musste zuerst sterben, bevor Gott die anderen ins Gelobte Land führte. Die in der Wüste Geborenen sollten nach seinem Willen Kämpfer sein. Für die Eroberung des Gelobten Landes konnte er keine Sklaven gebrauchen.«
Da war es wieder, sein Lieblingsmotiv, aber ich hielt mich zurück. Gerade in diesen Tagen waren die israelischen Zeitungen voll mit Berichten, dass die Österreicher ihr UN-Kontigent vom Golan abziehen wollten, weil sich die Kämpfe im syrischen Bürgerkrieg bis zur Grenze ausweiteten und die dort stationierten internationalen Truppen Gefahr liefen, in Gefechte verwickelt zu werden, und ich fürchtete schon, John würde noch einmal darauf zu sprechen kommen. Er hatte mehrfach gesagt, es sei eine einzige Erbärmlichkeit, sich im Augenblick der höchsten Not davonzumachen, aber jetzt deutete er nur auf die Schüler.
»Schau sie dir an. Alles kleine Kämpfer. Ich kann mir vorstellen, wovon sie heute nacht träumen. Alles in der Wüste Geborene. Sie werden sich von niemandem wie Lämmer zur Schlachtbank führen lassen.«
Er konnte die martialische Attitüde doch nicht ganz ablegen, die mit seiner Fürsorglichkeit einherging und manchmal nicht von ihr zu unterscheiden war. Das erinnerte mich an viele Gespräche, die wir über die Jahre gehabt hatten. Ich wusste, was alles für ihn mitschwang, aber es war nicht der Augenblick, damit anzufangen. Wie zur Bebilderung des Gesagten stand die Lehrerin vor einer Vitrine, in der die Pistole von Ben Gurion ausgestellt war, und während die Schüler sie umringten, blickte sie John über die Köpfe hinweg an. Ich sah, wie er ihr zulächelte, und wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich schwören können, dass sie sich schon lange kennen mussten. Es war eine seiner stillen Eroberungen, und als ich ihn im Gehen fragte, wie er es geschafft habe, sie für sich einzunehmen, sagte er, ich würde es nie lernen, es sei an seinen Schuhen gelegen, sie habe daran erkannt, dass er gekämpft habe, und ich starrte auf seine ausgelatschten, sandfarbenen Schnürstiefel, die Desert Boots, ohne die ich ihn selten gesehen hatte, und konnte nicht einschätzen, ob er es ernst meinte oder ob er mich nur auf den Arm nehmen wollte.
Am folgenden Tag wanderten wir im Makhtesh Ramon, und lange waren einmal drei, einmal fünf Kampfjets in der Luft, die über dem riesigen Erosionskessel mitten in der Wüste ihre Übungsflüge absolvierten. John bestand darauf, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und dann noch bis in die Dunkelheit hinein draußen zu bleiben, anders würde ich keinen wirklichen Eindruck von Raum und Zeit der Gegend bekommen, und wir marschierten jeder mit sechs Litern Wasser im Rucksack, aber ohne weiteren Proviant, auch das eine seiner Bedingungen, in der Morgendämmerung los. Gehen, sonst nichts, war die Devise, so weit und solange wir konnten, reden nur das Notwendigste, und in der Nacht wollten wir uns unter freiem Himmel auf den nackten Wüstenboden legen und in die Sterne schauen. Die Flugzeuge tauchten zum ersten Mal mitten am Vormittag auf, und wir hatten uns schon in eine richtige Trance hineingetrottet, als sie in der Ferne, wie getragen vom Schall, über den Kraterrand hinwegzogen. Wir standen auf einer Erhöhung, und sie schienen unter uns zu fliegen, gerade noch als winzige, schwarze Punkte ins Blau des Himmels getupft, wurden sie rasch größer, spuckten grell leuchtende Hitzekugeln hinter sich aus, die einen Raketenangriff von ihnen ablenken sollten, und verschwanden in einem langen Bogen ins Nichts. Es war nicht nur die Landschaft, wie vor aller Zeit, es war das plötzliche Erscheinen der Flieger, wie nach aller Zeit, das mir von einer Sekunde auf die andere das Gefühl gab, mich in einer Welt ohne Menschen zu bewegen. Ich vergaß fast zu atmen, aber John tat, als achtete er gar nicht darauf, und ging ungerührt weiter. Das Schauspiel wiederholte sich im Viertel- oder Halbstundenabstand, einmal waren sie weiter weg, einmal näher, und schließlich, als wir in einem engen Canyon ein Stück bergab stiegen, war ein Jet plötzlich direkt über uns, schwer zu sagen, ob hundert oder zweihundert Meter, aber sicher nicht mehr. Es geschah fast ohne Ankündigung, ein sanftes Rauschen, dann ein überwältigender Krach, der mir in die Glieder fuhr und das pochende Herz gegen die Brust presste, das Gefühl, gleichzeitig niedergedrückt und emporgehoben zu werden, ein riesiger Schatten, der über uns hinwegging, und schon war es vorbei.
Ich sah John an, der diesmal auch erschüttert wirkte und sich mit beiden Händen gegen die Ohren schlug, als wäre er nicht sicher, ob er noch richtig hören würde.
»Eigentlich ein schöner Tod«, sagte er, kaum dass er sich wieder gefangen hatte. »Ein Augenblick der Euphorie, mehr ist es nicht, ohne dass man wirklich begreift, was passiert.«
Genau das gleiche hatte ich gedacht. Ein Verdächtiger in Gaza oder wo auch immer auf der Welt könnte nicht einmal ein Gebet sprechen, bevor ihn eine Rakete treffen würde. Es war einer der Gedanken, die einem eher gedacht wurden, als dass man sie selbst dachte, und es schauderte mich bei der Vorstellung.
»Besser, als im Bett zu sterben.«
»Alles besser«, sagte John. »Mitten in einer Tätigkeit. In einer Runde mit Freunden. Am besten im Augenblick der Liebe.«
»Was meinst du damit?« fragte ich. »Wenn du mit einer Frau zusammen bist? Ist das nicht ein bisschen pathetisch? Wenn du mit ihr schläfst?«
»Im Augenblick der Liebe«, sagte er. »Und wenn das nicht zu haben ist, noch besser überraschend und ohne das geringste Bewusstsein davon.«
Es wäre unsinnig, daraus gleich ein Omen zu machen, aber das Gespräch blieb mir in Erinnerung, und wahrscheinlich leuchtete Tel Aviv am nächsten Abend so, weil wir aus dieser Mondlandschaft der Wüste und aus dieser Ausgesetztheit kamen. Jedenfalls erschien mir die Stadt wie das Zentrum der Welt, als wir wieder dort anlangten. Wir waren am Tag nach unserer Wanderung, einem Sabbat, noch bis in den Nachmittag in dem kleinen Ort am Kraterrand geblieben, wo das Leben fast vollständig zum Erliegen kam und der einsetzende Wind die Hitze kaum milderte, und ich erinnere mich an Johns Müdigkeit, seine Nostalgie, als er sagte, hier habe er mit seiner ersten Frau gleich nach ihrer Hochzeit ein paar Tage verbracht und wie wenig er es in seinem Alter aushalte, irgendwohin zurückzukehren, wo es ihm gutgegangen sei, wie sehr ihn das schmerze. Er war viermal verheiratet gewesen und auch viermal wieder geschieden, aber von seiner ersten Frau sprach er immer mit einer Sanftheit, die sie heraushob, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass er sie in Israel kennengelernt hatte. Sie war im Land geblieben, als er wieder nach Amerika ging, und er tat jetzt so, als wäre er aus dem Paradies vertrieben worden oder hätte den Fehler begangen, es freiwillig zu verlassen, und das wäre schon die ganze Geschichte. Dabei verfiel er von einer Vereinfachung in die andere, schwärmte im einen Augenblick, sie seien wie Kinder gewesen, und winkte im nächsten ab, was für ein Unsinn, er rede wie ein alter Mann, dem niemand mehr zuhöre.
Ich wartete auf eine Fortsetzung, aber er sagte nichts weiter, zumindest nichts Konkretes, und drängte dann gleich zum Aufbruch. Für die Rückfahrt wählte er eine andere Route, was ich erst merkte, als links und rechts von der Straße Verbotsschilder mit dem Hinweis FIRING AREA und schließlich ein ganzes eingezäuntes Feld mit nur notdürftig unter Planen verborgenen Panzern auftauchten. Er hatte die Strecke genommen, die an der Grenze zum Gazastreifen entlangführte, und antwortete nicht, als ich ihn fragte, was er damit bezwecke. Es begegnete uns kaum ein Auto, und er holte alles aus dem kleinen Mietwagen heraus, saß tief über das Lenkrad gebeugt und war von meinen Bitten, langsamer zu fahren, nicht zu erreichen. Der Schweiß lief ihm über das Gesicht, und erst als er am Nordende des eingeschlossenen Gebietes nach Westen abbog, Richtung Meer, und dann bald schon die ersten Wohnblocks von Aschkelon zu sehen waren, entspannte er sich. Er wollte an den Strand und schwamm so weit hinaus, dass ich ihn aus den Augen verlor und mir Sorgen machte, bis er wieder zurückkam und sich, schwer atmend und ohne sich abzutrocknen, neben mir in den Sand fallen ließ.
Ich erinnere mich an seine Ausgelassenheit an diesem Abend in Tel Aviv. Wir waren mit dem Schriftsteller Roy Isacowitz zusammen, der damals noch nicht bekannt war, zwei Freundinnen aus ihrer gemeinsamen Zeit im Kibbuz kamen später dazu und verschwanden dann wieder, Kirsten und Alina, und John erzählte eine Anekdote nach der anderen. Ich wünschte, ich hätte sie aufgeschrieben, weil alles durcheinanderging, sein Aufwachsen in der Bronx, die Jahre in Israel, die Zeit als Soldat und sein Leben danach. Wir saßen zuerst in einem Café am Rabin-Platz und gingen dann zu dritt vor an den Strand, und er redete und redete, als wäre es die letzte Gelegenheit für ihn. Das Ende war ein Streit, als Roy ihm von dem Buch erzählte, an dem er gerade schrieb, und John kein gutes Haar daran ließ. Es sollte den Titel The Ingathering of the Exiles tragen und in einzelnen Episoden von berühmten Juden handeln, lauter historischen Figuren, die das heutige Israel besuchten und dort allesamt entweder missliche Erlebnisse hatten oder sich durch ihr eigenes Verhalten disqualifizierten.
»Was zum Teufel willst du damit beweisen, Roy?« sagte John, als er glaubte, genug gehört zu haben. »Es ist deine übliche antizionistische Scheiße. Warum kannst du das nicht endlich sein lassen? Das mag kein Mensch hören.«
»Aber ist es nicht lustig?«
»Lustig, Roy?«
John brach in ein wildes Lachen aus.
»Anne Frank, die sich beim Besuch von Yad Vashem vollkommen fehl am Platz fühlt. Baruch Spinoza, der vor orthodoxen Rabbis den philosophischen Beweis erbringt, dass die Siedler kein Recht auf ihr biblisches Judäa und Samaria haben. Sigmund Freud, der in einem Jugendcamp in Galiläa an nichts als an das eine denkt und mit seinem Psychogebabbel ein minderjähriges Mädchen herumzukriegen versucht.«
Er war laut geworden.
»Alles Kronzeugen, die am Ende das Existenzrecht des Staates unterminieren«, sagte er. »Ich bitte dich, Roy. Wer sind die anderen? Das ist doch Wahnsinn.«
»Franz Kafka.«
»Natürlich.«
»Bugsy Siegel, Meyer Lansky.«
»Da hast du dir ja ehrenwerte Herren ausgesucht.«
»Alfred Dreyfus. Vielleicht Moses, vielleicht Jesus, vielleicht Gott selbst, falls der Jude ist oder Jude war, wenn man ihn für tot hält. Kandidaten gibt es genug.«
»Findest du das wirklich lustig?«
John drehte sich ganz zu Roy um und fixierte ihn.
»Findest du die Bilder von Anne Frank mit einem Palästinensertuch lustig, mit denen irgendwelche Idioten angeblich auf Übergriffe der israelischen Armee in der Westbank aufmerksam machen wollen?«
»Aber das ist doch etwas anderes.«
»Das ist nichts anderes. Provokation um der Provokation willen. Anne Frank, die weiß, dass von ihr erwartet wird, dass sie in Yad Vashem an der Hand des Jerusalemer Bürgermeisters weint, um die richtigen Bilder fürs Fernsehen zu liefern, und keine Träne hervorbringt. Das ist erbärmlich. Du musst doch wissen, wo die Grenzen liegen.«
»Aber dass sie mit israelischen Schriftstellern auf einem Podium über Holocaust-Literatur diskutiert, ist das nicht lustig?«
»Sie diskutiert mit israelischen Schriftstellern?«
»Ja, und die sagen ihr einhellig, dass man so, wie sie über den Holocaust geschrieben hat, nicht über den Holocaust schreiben kann.«
»Das soll lustig sein?«
Ich sehe noch ganz genau vor mir, wie John aufsprang und über den Strand davonlief, weil es mein letztes Bild von ihm ist. Danach habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Zuerst dachte ich, er würde umkehren, wenn er sich beruhigt hätte, aber Roy sagte, er kenne das schon, ihre Treffen kulminierten immer, entweder er selbst suche von einem Augenblick auf den anderen das Weite oder John, und es dauere meistens eine Zeit, bis sie wieder eine Annäherung wagten. Sie könnten über alles reden, über Frauen, über die Liebe, über das Leben und den Tod, nur eben über Politik nicht, weil da ihre Meinungen so weit auseinanderlägen, und es wundere ihn, dass ihre Freundschaft das all die Jahre unbeschadet überstanden habe. Ich dachte da noch, ich würde John wenigstens am Abend sehen oder am nächsten oder übernächsten Tag, bevor ich zurückflog, aber er hatte das Handy ausgeschaltet und tauchte auch in seiner Unterkunft in Jerusalem nicht auf, und so blieb es bei diesem seltsam offenen und unbefriedigenden Ende zwischen uns, das mit seinem Tod besiegelt wurde.
Ich bin ihm nicht gefolgt und habe weiter mit Roy über sein Buch gesprochen, aber dessen Eifer war auf einmal verflogen. Er schien einen Schuldigen für Johns abrupten Aufbruch zu suchen, und ich bot mich dafür an, als ich sagte, er könne in seine illustre Runde von Juden, die Israel bereisten, auch Canetti aufnehmen. Jedenfalls schlug seine Stimmung plötzlich um, kaum dass ich das ausgesprochen hatte.
»Warum sollte ich das tun?«
»Er würde in deinen Zyklus passen.«
»Canetti? Glaube ich nicht. Wie kommst du darauf?«
»Er ließe sich mit ein paar Strichen karikieren.«
»Canetti?«
»Du kennst doch die Anekdoten über ihn? Seine Weibergeschichten. Hast du nicht gehört, dass er ein Frauenheld und Schwerenöter allererster Güte war?«
»So einfach ist das nicht«, sagte er. »Erstens schätze ich Canetti. Das solltest du wissen, bevor du etwas von dir gibst, das du nachher bereust. Zweitens ist es ein kleiner Unterschied, ob die Idee von dir oder von mir stammt.«
Das war auch schon das Ende unseres Gesprächs. Er erhob sich und sagte, es sei ihm eine Freude gewesen, aber er müsse jetzt los. Als er mir blinzelnd die Hand reichte, fühlte ich mich düpiert und blieb sitzen. Ich hatte mir bei meinem Vorschlag nicht viel gedacht, hatte nur umgänglich sein wollen und war zu weit gegangen und fand nicht mehr zurück. Vor meiner Einreise in Israel hatte ich gefürchtet, beim kleinsten Missverständnis als Deutscher oder Österreicher gebrandmarkt zu werden, aber nichts davon, die schiere Freundlichkeit im Flugzeug, die schiere Freundlichkeit bei der Passkontrolle, die schiere Freundlichkeit auch seither, und diese Zurückweisung jetzt hatte ich mir nur selber zuzuschreiben. Am liebsten hätte ich mich bei Roy entschuldigt, aber er hatte längst die Esplanade überquert, die den Strand von der Stadt trennt, und war nicht mehr zu sehen. Es war windstill und immer noch heiß, draußen über dem Meer ein irritierendes Flimmern. Die Sonne war untergegangen, und ich überlegte, was ich mit dem Rest des Abends anfangen sollte. Abgesehen von den Tagen, die ich in der Westbank verbracht hatte, war ich zum ersten Mal, seit ich im Land war, allein, und dieses Alleinsein, das ich sonst überall aushielt, war an diesem Ort etwas anderes, fühlte sich kalt und schneidend an. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit und war gleichzeitig froh, als es dunkel wurde, und wartete, bis die ersten Sterne erschienen, bevor ich aufstand und ging.
III
Ich sprach nur nebenbei von dem Treffen mit Roy und erwähnte das Buch nicht, an dem er schrieb, als ich Elaine gleich am Morgen nach unserem ersten Gespräch wieder anrief. Roy hatte nichts mit Johns Tod zu tun, und es wäre mir zu kompliziert gewesen, ihr zu erklären, warum ich die Idee so aufregend fand, berühmte Juden aus der Geschichte einen kritischen Blick auf das moderne Israel werfen zu lassen. Bei dem Vorhaben hatte ich sofort an einen meiner Lieblingsautoren gedacht, an Danilo Kiš und sein Buch , sowie an von Roberto Bolaño, und was für ungeheure Effekte die beiden durch freien Umgang mit Fakten und Fiktionen erzielten. Natürlich hatte ich auch Angst, missverstanden zu werden. Sich als Österreicher für ein antizionistisches Projekt zu ereifern bringt einen schnell in Erklärungsnot. Ich konnte mir die üblichen Vorwürfe und Verdächtigungen ersparen, die üblichen Diskussionen, warum ich mich ausgerechnet für die Missstände in Israel interessierte und nicht für die in Tschetschenien, in Afghanistan oder irgendwo sonst auf der Welt, wo Dinge passierten, an denen gemessen für die meisten Palästinenser das Leben in den besetzten Gebieten vielleicht nicht gerade ein Leben im Paradies sei, aber immerhin ein Leben, eine Existenz und nicht der sichere Tod.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!