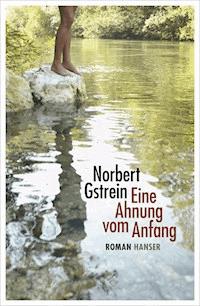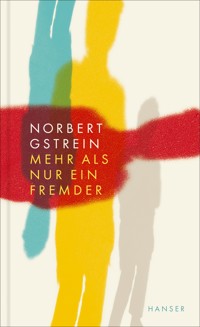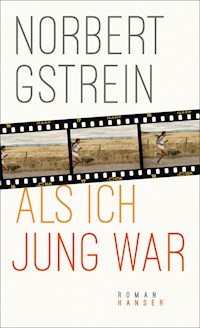9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heinrich Glück, Verleger in Wien, lernt die junge, exzentrische Dagmar kennen und lässt sich scheiden, um seine letzten Jahre mit ihr zu verbringen. Immer ausschließlicher ergreift sie Besitz von seiner Existenz. Als er stirbt, soll er endgültig ihr Eigentum werden: Sie schreibt ein Buch über seinen Tod. Kann eine Frau behaupten, die ganze Wahrheit über ihren Mann zu wissen? Der langjährige Verlagslektor jedenfalls weigert sich, Dagmars Buch zu publizieren. In einem ironischen, brillanten Vexierspiel zeichnet der aus Österreich stammende Norbert Gstrein das Porträt einer Frau, die nur an eine Wahrheit glauben will: ihre eigene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Norbert Gstrein
Die ganze Wahrheit
Roman
Carl Hanser Verlag
eBook ISBN 978-3-446-23624-0
© 2010 Carl Hanser Verlag München
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Inhalt
Erster Teil
Das Judenmädel
7
Zweiter Teil
Die ganze Wahrheit
105
Dritter Teil
Der Jenseitsrabe
195
Wer Verstand hat, berechne die Zahl des Tieres!
Denn es ist eines Menschen Zahl;
und seine Zahl ist 666.
Offenbarung 13, 18–19
Erster Teil
Das Judenmädel
1.
Man hat mir abgeraten, darüber zu schreiben, und natürlich kenne ich Dagmar lange genug, um zu wissen, was mich erwartet, wenn nur etwas von dem, was ich über sie in die Welt setze, anfechtbar ist. Ich habe oft genug erlebt, mit welchen Lappalien sie ihren Anwalt betraut hat, den beflissenen Dr. Mrak, um Leute, die sie für ihre Feinde hielt, mundtot zu machen, und gebe mich nicht den geringsten Illusionen hin. Meine Darstellung, da bin ich sicher, wird noch am Tag der Veröffentlichung auf seinem Schreibtisch landen und auf Punkt und Komma überprüft werden, ob sich darin etwas Justitiables findet. Da würde es auch wenig helfen, die Tatsachen zu verdrehen, welche Mühe auch immer ich mir geben mochte, die Spuren zu verwischen, ob den Ort des Geschehens von Wien nach Berlin zu verlegen, ob Dagmar anders zu nennen, ob ihr eine andere Herkunft zuzuschreiben und sie statt aus Kärnten vielleicht aus einem Dorf an der Ostsee stammen zu lassen, ganz vom anderen Rand des Sprachraums, um nicht überhaupt so weit zu gehen, aus der Frau, die sie immerhin ist, einen Mann zu machen.
Am Ende sind das Kindereien, und ich würde mir den Vorwurf einer plumpen Täuschung einhandeln, würde mir anhören müssen, ich spräche von einer Kindheit am Meer, spräche von den Nachmittagen am Strand, der Weite und dem Licht des Nordens, und meinte in Wirklichkeit die Beengtheit der Berge, meinte ein abgeschiedenes Karawankental und die schneereichen Winter in den fünfziger Jahren, von denen Dagmar endlos schwärmen konnte. Es wäre eine schwere Entscheidung, ob ich die Lehrerfamilie beibehalten würde, in der sie aufgewachsen ist, ob den strengen Vater, oder ob ich aus ihm einen kinderliebenden, freundlichen Mann machen würde, aus der früh verstorbenen Mutter eine langlebige Dame, die sie immer noch regelmäßig im Altersheim besucht. Ich könnte aus der Schulausreißerin, die mit sechzehn auf eigene Faust nach Klagenfurt ging und sich dort jahrelang als Kellnerin und Aushilfe in allen möglichen Restaurants durchschlug, bevor ihr ein Stammgast eine Buchhändlerlehre ermöglichte und die Liebe zum Lesen in ihr weckte, eine Internatsschülerin machen, ein Mädchen, das sich in der katholischen Jugend engagierte und dann brav Germanistik studierte, könnte von ersten Schreibversuchen sprechen oder auch nicht, es liefe auf ein und dasselbe hinaus. Denn sobald ich ihren späteren Mann auch nur erwähnte, wäre zumindest für die Leser der Klatschspalten »zwischen Bodensee und Neusiedler See«, wie das österreichische »from coast to coast« heißt, alles klar, gäbe es für sie keinen Zweifel, die Rede war von Heinrich Glück, dem Verleger, den das immer ein wenig zum Windigen neigende Wiener Feuilleton weniger ehrerbietig als verächtlich mit den Größten seiner Zunft verglichen hat, und ich könnte mir alle weiteren Ausschmückungen sparen. Dagmar hat selbst wieder und wieder erzählt, wie sie ihn kennengelernt hat, und die Anekdote gehört zu der Folklore, die sie aus ihrem Leben macht, ist für die Freunde des Hauses Gemeingut, eine richtige Schnurre, wie er sie bei der Präsentation eines Buches aus seinem Verlag angesprochen hat, auf einem Wörther-See-Schiff, und sie trotz des Altersunterschieds sofort dem Charme dieses Kavaliers der alten Schule verfallen ist.
Die ganze Beziehung von Anfang bis Ende hatte dann auch etwas Schmierenkomödiantisches, das in dieser Form vielleicht tatsächlich nur in Wien möglich ist, die sozusagen auf einer Bühne geführte Ehe eines Verlegers schöner und nicht ganz so schöner Literatur, wie er selbst gern gesagt hat, der nicht mit seinen Büchern, sondern durch seine erste Heirat mit einer geborenen Thurn-Milesi zu einem Millionenvermögen gekommen war und sich jetzt von seinem »Kärntner Dirndl« den Lebensabend versüßen ließ. So konnte man es, o du, mein Österreich, allen Ernstes lesen, und so wurden die beiden auch in der Öffentlichkeit gesehen, der trotz aller Feingeisterei linkisch gebliebene alte Herr und die immer mehr ihren Hang zum Mondänen entdeckende Madame, die nebenbei auch noch als Schriftstellerin dilettierte und bald in seinem Verlag ihr Debüt gab. Die beiden gehörten schnell zu den Adabeis einer ebenso feinen wie halbseidenen Gesellschaft, und in ihrer besten Zeit verging kaum eine Woche, in der sich nicht etwas über sie in den bunten Blättern fand, ob einer der spektakulären Abwerbeversuche, mit denen Heinrich Glück von sich reden machte, einer seiner grandiosen geschäftlichen Misserfolge, die er mit einem Achselzucken und dem Lächeln des ewigen Kindes wegsteckte, oder ihre gemeinsamen Auftritte bei einer Theaterpremiere, beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel oder bei einem Empfang in ihrer Hietzinger Villa. Er glich dabei immer mehr einem Seebären, als wären seine buschigen Koteletten und Augenbrauen, seine Schiebermützen und Zweireiher ein Zugeständnis an einen Vorfahren in der Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft, während sie eine Zeitlang immer jünger zu werden schien, immer blonder, wenn sie ihr Haar nicht gerade in diesem seelenvollen Rot der Selbsterfahrung färbte, und für die Fotografen auch dann noch ein beliebtes Objekt war oder wenigstens in Abendgarderobe oder in ihrem weißen Pelzmantel und den Biberfellstiefeln im Schnee weiterposierte, als ihr Gesicht über Nacht ins frühe Alter umkippte und sie plötzlich etwas Vergrämtes ausstrahlte.
Es gab schon lange Gerüchte, aber das ist natürlich geschenkt, alter Mann mit Geld und jüngere Frau. Die Leute zerreißen sich das Maul, und die Spannbreite der üblen Nachrede ist wohl immer die gleiche, alles, was sich gegen ein solches Glück auffahren lässt, wird aufgefahren, damit der Neid seine Genugtuung hat. Selbst die Stimmen, Dagmar könnte ihren Mann vergiftet haben, die unmittelbar nach seinem Tod aufkamen, gehören wohl nur zu den Klischees einer derartigen Konstellation und werden nicht besser, wenn man sie mit mehr oder weniger berühmten Beispielen aus den Kriminalarchiven garniert. Ich sage lieber gleich, dass ich nichts davon halte, nicht aus Angst vor dem ehrenwerten Dr. Mrak und seiner Paragraphenreiterei, sondern weil die Sache komplizierter ist und man mit dem Schielen auf eine billige Sensation nur den Blick auf das Wesentliche verstellt. Zudem hieße es Dagmar unterschätzen, und die Verschwörungstheoretiker, die partout eine Hexe in ihr sehen wollen, wissen nicht, wovon sie sprechen, die Damen und Herren, die schon früh Voodoo-Geschichten über sie verbreiteten, undurchdachte Aufgeregtheiten, in denen von einem Medium die Rede war, das sie beschäftigt habe, von einer Spiritistin und Schwarzkünstlerin oder gar einer haitianischen Magierin, die in ihrem Auftrag mit einer Strohpuppe und Stecknadeln hantiert haben soll, und was nicht sonst noch alles.
Daran ist Heinrich Glück nicht gestorben, und wenn die Behauptung, sie sei an seinem Tod nicht unschuldig gewesen, überhaupt eine Bedeutung hat, dann im übertragenen Sinn. Das aber ist ein weites Feld, die beste Voraussetzung dafür, dass Dr. Mrak seinen Bleistift spitzt und sich Notizen macht, und wenn ich mich trotzdem darauf einlasse, muss ich mich fragen, wo anfangen und wo enden, und sehe wieder die Trauergesellschaft auf dem Hietzinger Friedhof vor mir, die sich eingefunden hatte, um den Verstorbenen zu verabschieden, und Dagmar diese feindselige, versteinerte Haltung entgegenbrachte. Es war ein eiskalter Tag im Dezember gewesen, vor mittlerweile mehr als fünf Jahren, leichtes Schneetreiben, und obwohl es im engsten Familienkreis hätte sein sollen, hatte sich am Ende doch eine Schar um das offene Grab versammelt und beobachtete sie auf Schritt und Tritt. Der Grund war, dass ich herumtelefoniert hatte, damit wenigstens seine paar verbliebenen Freunde Bescheid wussten, aber ich habe auch Dagmar in Verdacht, dass sie die von ihr selbst ausgegebene Geheimhaltung unterlaufen hat und für die Kamera verantwortlich war, die ein paar Gräber weiter stand und den Schmerz der Hinterbliebenen für die wöchentliche Klatschsendung im Fernsehen dokumentierte.
Über das Grelle ihres Auftritts ist viel gesagt worden, und ich will nicht beurteilen, ob zu Recht oder zu Unrecht, aber ich erinnere mich noch genau an die vier Mitglieder der von Heinrich Glück gegründeten »Loge«, die den Sarg umstanden, als müssten sie ihn vor ihr beschützen. Sie waren die letzten Überlebenden seines längst nur mehr nominellen »Zirkels zur Förderung der österreichischen Kunst und Kultur und zur Hebung ihres Ansehens im Ausland« und standen wie ein Aufgebot von Knappen da, die ihren Ritter verloren hatten, fast achtzigjährige Herren, schon sehr wacklig auf den Beinen, während sie Dagmar anstarrten, die selbst am Arm eines älteren Mannes gekommen war, ihres Onkels Erich aus Villach. Sie hatte ihren Schleier gelüftet, und ich kann nur mutmaßen, was sie in dem wachsbleich geschminkten Gesicht sahen, welchen Schrecken es für sie verbreitete. Mit seinem totenähnlichen Ausdruck erinnerte es mich an eine dieser gespenstischen Diven aus der Stummfilmzeit, und ich konnte zumindest nachempfinden, dass sie danach ihre Zurückhaltung vergaßen und von einer furchterregenden Maske sprachen.
Es war auch einer von ihnen gewesen, Professor Andermaier, ein Karl-Kraus-Spezialist und nach wie vor hoch angesehener Emeritus der hiesigen Universität, der noch auf dem Friedhof deutlicher wurde. Dass er sich an mich wandte, mochte Zufall sein, oder er hatte es getan, weil er sich erinnerte, wie Heinrich Glück mich der Runde nicht nur einmal als seinen zukünftigen Nachlassverwalter und Biographen vorgestellt hatte, wenn er mit den vieren länger im Imperial zusammengesessen war und mich bat, ihn abzuholen. Wie es seine Art war, hatte er es immer spöttisch gesagt, weil ihm jeder Gedanke an die eigene Bedeutung oder gar an die Nachwelt sofort peinlich war, und ich versuchte jetzt, im Gesicht des mir gegenüberstehenden Mannes etwas von dieser Ironie wiederzuentdecken. Er hatte mir auf die Schulter getippt und, kaum dass ich mich zu ihm umgewandt hatte, angefangen zu sprechen, aber statt einer Erinnerung daran sah ich die gleiche absurde Mischung aus Hingabe und Auflehnung, die ich auch an den drei anderen zu sehen geglaubt hatte, solange sie um den Sarg gestanden waren.
Deshalb hatte ich es zuerst nur für eine Redensart gehalten, als er mit seiner Ungeheuerlichkeit herausrückte, vielleicht ein bisschen unelegant an diesem Ort und zu dieser Zeit, aber nicht weiter außergewöhnlich, bis sich der Satz in mir festfraß.
»Sie hat ihn umgebracht.«
Wir standen ein wenig abseits, und er sprach leise, aber während ich noch überlegte, wie ich reagieren sollte, lachte er schon. Es war das kalt meckernde, fast lachsackhafte Lachen eines Greises, das er allem Anschein nach beliebig an- und wieder abstellen konnte. Dabei richtete er seinen Blick auf die anderen drei, die ihm sofort zuzunicken schienen, und ein weiterer Kommentar erübrigte sich. Denn nur der Ministerialrat Walther stand allein da, Witwer seit einem Vierteljahrhundert, mit seinen ebenso nachlässig wie verzweifelt von einem Ohr zum anderen gekämmten Haarsträhnen, während die beiden Trattinger-Brüder lodenbemäntelt, der eine mit einem angeberhaft breitkrempigen Hut, der andere mit Baskenmütze, am Arm ihrer zweiten oder vielleicht auch schon dritten Frauen hingen.
»Sehen Sie sich die zwei Herren bitte an«, sagte der Professor, und es war klar, dass er den Ministerialrat Walther als unerheblich ausgeklammert hatte. »Sie sind beide jünger als ich.«
Er sagte nicht, dass sie dem Tod trotzdem näher standen, aber ich war sicher, dass er das meinte, und als danach von neuem sein Lachen einsetzte, gab es keinen Zweifel, er lachte auch wegen der Frauen an ihrer Seite. Die eine war eine blondierte Fünfzigjährige, mit dem hochgefönten Haar ihrer Jugend, die andere ein wenig ältlich, aber gleichzeitig fast noch mädchenhaft mit ihren asiatischen Gesichtszügen, und ich erinnerte mich wieder, wie Heinrich Glück immer gesagt hatte, Alfons Trattinger, der jüngere der beiden Brüder, habe seine Frau aus der Zeitung, Franz, der ältere, habe sie direkt von der Stange aus einer Nachtbar geholt, was aus seinem Mund so klang, als wäre es ein und dasselbe. Er hatte sich gern lustig darüber gemacht, wenn sich wieder einmal einer seiner Jahrgangskollegen von einem jungen oder nicht mehr ganz so jungen Ding vor den Traualtar führen ließ, hatte ihn einen alten Esel genannt und sich auch dann noch mit den Sprüchen eines Haudegens aus der Affäre zu ziehen versucht, als er selbst längst schon Dagmar verfallen war und das Aufgebot bestellt hatte.
»Das sind Kindereien, die man irgendwann hinter sich lassen sollte«, hatte er in meiner Gegenwart nicht nur einmal gesagt. »Man kann doch warten, bis sich das erste Feuer gelegt hat, und so lange alles mit ein paar Klunkern und einer kleinen Apanage regeln.«
Es war ein rüder Umgangston gewesen, den auch die anderen bei ihren Treffen anschlugen, ausgenommen der Ministerialrat Walther, der immer schweigsamer wurde, je mehr das Gespräch zum Zotigen neigte, und es hatte schon eine besondere Ironie, die Trattinger-Brüder von ihren Gattinnen auf den Friedhof geführt zu sehen, während Professor Andermaier, ein überzeugter Junggeselle, sich in seiner Häme erging. Von den Sprüchen, mit denen sie sich bei ihren Runden im Imperial manchmal gegenseitig zu übertrumpfen versucht hatten, war nichts mehr übrig, den Derbheiten, die besser zu Pferdeknechten aus einer anderen Zeit gepasst hätten, viel jüngeren Burschen gewiss auch, als zu den kultivierten Herren, als die sie sich sonst gaben, und ihre Fügsamkeit erschütterte mich. Kleinlaut, wie sie jetzt waren, erinnerte nichts daran, wie sie sich immer mit besonderen Grüßen an die Gnädige von Heinrich Glück verabschiedet hatten und was für eine Bosheit darin gelegen war, und ich dachte wieder einmal, dass sich das Alter, wie es in Romanen dargestellt wird, gegen die Realität als Kinderspiel ausnimmt.
Das war die Geschichte, wie ich sie seither vielen Leuten erzählt habe, und es ging allen gleich, sie warteten auf eine Fortsetzung, die es nicht gab, wenn ich sagte, dass ich eine Weile nur dastand und mich dann von Professor Andermaier entfernte, ohne etwas auf seine Anschuldigung zu erwidern.
»Hast du ihn nicht gefragt, wie er das meint?«
Ich schüttelte wortlos den Kopf.
»Er sagt, sie hat ihn umgebracht, und du schweigst?«
Tatsächlich kommt es mir selbst unglaublich vor, dass ich nichts gesagt habe, aber statt mir Rechenschaft darüber abzulegen, wich ich immer mit der gleichen Ausflucht aus.
»Auf Friedhöfen wird viel geredet«, sagte ich und zog es so ins Ungefähre. »Da muss man nicht jedes Wort gleich auf die Goldwaage legen.«
Dennoch war das Thema damit angeschlagen, und wenn ich diese paar Seiten jetzt lese, die ich hingeschrieben habe, um einen Anfang zu machen, sehe ich selbst die aufdringliche Motivführung und kann für mich nur in Anspruch nehmen, dass es so war und dass ich keine literarischen Ambitionen habe, sondern den Wunsch, mich nach bestem Wissen an die Tatsachen zu halten, wenn der Einwand kommt, ich hätte zu dick aufgetragen.
»Müssen beide Trattinger-Brüder jüngere Frauen haben?«
Das war eine der immer gleichen Fragen, die ich immer gleich beantwortete, und wahrscheinlich kann mir nicht einmal Dr. Mrak einen Strick daraus drehen, wenn es stimmt.
»Sie müssen nicht, aber sie haben sie gehabt.«
In diesem Stil ging es in der Regel weiter.
»Müssen sie dann auch noch Lodenmäntel tragen?«
Ich gab mir nicht viel Mühe, mich zu verteidigen, und sagte nur, dass auch das keine Erfindung von mir war und dass ich damit nicht etwa versuchte, die Geschichte in eine andere Zeit oder in ein anderes Milieu zu verlegen.
»Man braucht sich nur am Samstagnachmittag oder sonntags in der Wiener Innenstadt umzusehen und wird dort ohne Zweifel auf Leute stoßen, die aussehen wie Jäger, die von einer Treibjagd kommen«, verlor ich mich jedesmal in der gleichen Erklärung. »Dass sie sich auf Nachfrage als Universitätsprofessoren herausstellen, die nicht die geringste Ahnung davon haben, wie man ein Gewehr bedient, darf einen nicht irritieren.«
»Und die Schweinereien der alten Herren?«
»Was soll damit gemeint sein?«
»Ihre drastische Art, über Frauen zu sprechen.«
Es waren natürlich alles Honoratioren, und wenn ich da schon Abstriche machen müsste, könnte ich gar nichts erzählen, könnte nicht sagen, wie kalt Dagmars Finger waren, als ich mich zu ihr stellte und sie mir die Hand in den Ärmel schob und ich augenblicklich daran dachte, wie man ihren Berührungen ausgeliefert war, wenn sie etwas von einem wollte. Sie hatte den Schleier wieder heruntergelassen, aber selbst durch das Spitzengewirk glaubte ich ihren Blick zu spüren, und obwohl ich das Wort bei einem Autor in all meinen Jahren als Lektor gestrichen hätte, schreibe ich es jetzt doch hin. Denn der Blick war eisig, und ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie alles mitgehört hätte, obwohl es ganz und gar unmöglich war, so weit weg stand sie. Halblaut betete sie vor sich hin, und wenn es nur um die Plausibilität oder Wahrscheinlichkeit einer guten Geschichte ginge, würde ich verschweigen, dass es die paar Brocken Hebräisch waren, die sie sich selber beigebracht hat, würde dieses Detail übergehen, das auf den ersten Blick fehl am Platz scheint, an diesem unwirklich anmutenden Nachmittag jedoch Wirklichkeit war.
Das Schneetreiben war dichter geworden, und ich weiß noch, wie ich dastand und hoffte, sie möge sich zurückhalten und sich nicht in eine ihrer Trancevorstellungen hineinsteigern. Sie hatte in den Wochen der Bettlägerigkeit ihres Mannes aus dem geringsten Anlass in dieses kehlige Krächzen verfallen können, zu dem sie auch jetzt wieder Anlauf zu nehmen schien und das die um sie Stehenden immer in eine betretene Sprachlosigkeit gestürzt hatte. Das wollte ich verhindern, und weil mir nichts Besseres einfiel, trat ich einen Schritt vor und begann, das Vaterunser zu beten, bevor sie lauter werden konnte. Ein paar Augenblicke lang war nur meine Stimme zu hören, aber dann fielen die ersten ein, und ihr Murmeln verdichtete sich in meinem Rücken zu einem Chor, von dem ich mich getragen fühlte wie in meinen glorreichsten Zeiten als Ministrant.
2.
Ich habe keinen Zweifel, dass Dagmar genau verstanden hat, was ich damit bezweckte. Ohne dass ich mir etwas überlegt hätte, war es doch ein erster Versuch gewesen, das Andenken von Heinrich Glück vor ihr in Schutz zu nehmen, und es will mir scheinen, alles, was seither passiert ist, von der endgültigen Entfremdung zwischen uns bis hin zu meiner Entlassung nach mehr als zwanzig Jahren, hat seinen Anlass in dieser Szene auf dem Friedhof. Jedenfalls kündigte Dagmar noch am selben Tag an, sie habe vor, etwas über das Sterben und den Tod ihres Mannes zu schreiben, und ich weiß, was sie mir damit aufhalsen wollte, wie ich es damals schon wusste, als sie es mit dem Zusatz würzte, für sein Leben und das Leben überhaupt sei ja ich zuständig. Dahinter steckte nicht weniger als ihre Überzeugung, dass ich keine Ahnung davon hatte, und auch wenn ich mir da noch kaum Gedanken darüber gemacht habe, sehe ich es jetzt als ihre Retourkutsche, ihre Art, mich sofort wissen zu lassen, dass mein kleiner Sieg am offenen Grab nicht das Ende der Geschichte war. Sie war mit keinem Wort auf den Zwischenfall zu sprechen gekommen, hatte mich nach der Trauerfeier zu sich in die Hietzinger Villa eingeladen, und nachdem ihr Onkel Erich sich ins Bett begeben hatte, war es noch ein langer Abend geworden, der mit ihrer Ankündigung endete. Die Grappaflasche stand wie immer, wenn ich bei ihr zu Besuch war, auf dem Tisch, und sie hatte die Fotoalben hervorgeholt, die ich bereits kannte und die sie in den vergangenen Monaten, aber wahrscheinlich auch schon davor und in Wirklichkeit wohl, seit sie im Haus war, um- und umarrangiert hatte, so dass ein Biograph sich ihrer nur bedienen müsste, und er hätte das Leben von Heinrich Glück fein säuberlich dokumentiert, zumindest sein Leben, wie Dagmar es sah oder wie sie es sehen wollte.
In seiner Ausstrahlung war er unverwechselbar, beginnend bereits mit dem Schulkind, das in einem zu kleinen Pullover in einer Wiese stand und den Betrachter fixierte, bis zum Ehrendoktor seiner Alma mater, zweieinhalb Jahre vor seinem Tod, von einer klaren Präsenz, aber mir fielen sofort die Leerstellen auf. Auf fast jeder Seite waren Bilder entfernt worden, und ich konnte mir zuerst keinen Reim darauf machen, aber je weiter ich blätterte, um so mehr wurde mir das System klar. Es war ebenso offensichtlich wie platt, so dass ich es zuerst nicht glauben wollte, denn tatsächlich fehlten die Frauen. Da und dort tauchte natürlich Edith auf, die sich nach fünfzehn Ehejahren kaum verleugnen ließ, aber von den anderen war so gut wie jede Spur getilgt, und die leeren Flächen wiesen gleichzeitig nur um so aufdringlicher auf sie hin.
Ich hatte Dagmars Drang zur Bereinigung ihrer eigenen Biographie und der ihres Mannes nie verstanden und war jetzt bestürzt zu sehen, was alles in seinem Leben sie mit ihrer Aussortierung ungeschehen machen wollte. Ich konnte nur staunen über diese Unverfrorenheit und dieses Vermögen oder wie man es nennen will, diese Skrupellosigkeit, sich die Welt nach den eigenen Wünschen zurechtzuinterpretieren, in der sie selbst natürlich keine Skrupellosigkeit sah, weil ihr dafür das Bewusstsein fehlte. Es war kein Geheimnis, dass Heinrich Glück sich auch mit anderen Frauen eingelassen hatte, nicht nur vor, während und nach seiner ersten Ehe, sondern auch während seiner zweiten, und die Ungehaltenheit, mit der sie reagierte, wenn jemand sich in ihrer Gegenwart verplapperte, war allenfalls skurril, aber dass sie so weit gehen würde, hätte ich nicht gedacht. Ich saß neben ihr und wagte die längste Zeit nichts zu sagen, hätte aber am liebsten die Litanei der Namen heruntergebetet, die mir in den Sinn kamen. Denn selbst die paar Aufnahmen von ihm, die immer wieder in den Zeitungen zu sehen waren, wirkten ohne die jeweiligen Begleiterinnen schal, geradeso, als wäre ihnen Glanz entzogen worden, und Dagmar schien sich von Fall zu Fall sogar die Mühe gemacht zu haben, ihr unliebsame Personen wegzuretuschieren oder wegretuschieren zu lassen, obwohl das kaum sein konnte und sie wohl einfach nur die Bilder ausgetauscht hatte. Jedenfalls fehlte beim Empfang des russischen Dissidenten Eduard K. Balintow am Flughafen in Schwechat die Dolmetscherin, an die ich mich erinnere, eine geradezu plakative Schönheit, mit der Heinrich Glück damals ein paar Wochen zusammengewesen war, und die Runde junger tschechoslowakischer Lyriker, die er nicht lange nach dem Prager Frühling in einer Kellerwohnung in Budweis getroffen hatte, bestand ausschließlich aus Männern, obwohl ich schwören könnte, dass auf der Lehne des zerschlissenen Sofas, in dem er sich breitmachte, ein Mädchen gesessen war, burschikos zwar, in einer derben Arbeitermontur und mit kurz geschnittenen Haaren, aber eben doch ein Mädchen, als ich das Foto das letzte Mal gesehen hatte.
Die Gründlichkeit ihres Vorgehens hatte etwas Unheimliches, um so mehr, als der Don Juan, als den sie ihren Mann offensichtlich sah und nicht sehen wollte, gerade erst gestorben war und auch die Mädchen aus den sechziger und siebziger Jahren, seiner großen Zeit, entweder selbst schon tot sein mussten oder längst alte Damen waren, mit Kindern und Enkeln oder wenigstens einem Leben, das mit Dagmar nicht das geringste zu tun hatte. Was auch immer gewesen sein mochte, es war nichts mehr da, was sie hätte auslöschen müssen, und trotzdem hatte sie nicht einmal vor seiner Jugendfreundin haltgemacht. Ihr Foto, das Bild eines Kindes fast noch, mit langen Zöpfen und einem verträumt abwesenden Blick, hatte seinen Platz immer neben der Aufnahme gehabt, die ihn als Achtzehnjährigen in Wehrmachtsuniform zeigt, und weil dieses Gegengewicht jetzt fehlte, wirkte er auf verheerende Weise allein gelassen auf seinem Bild, ein junger Soldat, dessen Strahlen ohne sie gleich in einem anderen Licht erschien.
Ich erinnerte mich an ihren Namen und wusste, dass sie nach dem Krieg mit ihren Eltern nach Amerika gegangen war, ein ätherisches, blasses Wesen mit blauen Lippen, weil sie es am Herzen hatte. Sie hieß Vera und hatte Heinrich Glück fast bis zuletzt ein- oder zweimal im Jahr geschrieben. Meistens war zu seinem Geburtstag eine Karte gekommen, und immer zu Weihnachten, und obwohl nicht mehr als die konventionellsten Grüße draufstanden, war er immer gerührt gewesen und hatte ihr Eintreffen nicht nur einmal zum Anlass genommen, darüber zu räsonieren, was für Zufälle doch ein Leben bestimmten, ja, er war eines Tages in mein Büro getreten, hatte den Atlas aus dem Regal geholt und mit mir den Ort gesucht, an dem sie zu der Zeit lebte. Es war irgendwo in Montana gewesen, und als er mich fragte, ob ich mir dazu etwas vorstellen könne, und ich die Schultern hob, sagte er, er brauche nur die Augen zu schließen und sehe einen rot gestrichenen Holzschuppen vor sich, ein gelbes Feld und eine junge Frau, die in der Mittagssonne sitzt und in die Ferne blickt.
Das hätte ein Kalendermotiv sein können und war es wohl auch, ein Idyll, hinter dem kaum merklich das Grauen lauerte, kam gleichzeitig aber dem sehr nahe, was er einmal als seine Vorstellung vom Paradies beschrieben hatte, und als die Karten schließlich ausblieben, gab es für ihn nur einen Grund.
»Sie muss gestorben sein«, sagte er, als ich ihn nicht lange nach seinem siebzigsten Geburtstag fragte, ob sie in diesem Jahr wieder habe von sich hören lassen. »Jetzt werde ich wohl nicht mehr zu ihr fahren.«
Nicht dass er das jemals vorgehabt hätte, aber es schien ihm doch etwas zu fehlen, ein Ort auf der Landkarte, den er von nun an woanders suchen müsste, und wohl nicht mehr in der bewohnten Welt. Ich neige nicht zu übernatürlichen Erklärungen, aber es war eine dieser unauflösbaren Paradoxien, wie er sie an und für sich mochte, nur dass er jetzt wie darin gefangen wirkte. Deshalb war die Wahrheit um so schlimmer, und ich hütete mich, ihm zu sagen, was wirklich dahintersteckte, die banale Tatsache, dass Dagmar sich mit der Bitte an die Frau in Amerika gewandt hatte, ihren Mann nicht weiter zu belästigen, er sei danach immer verwirrt und brauche Tage, bis er sich wieder in seinem Leben zurechtfinde.
Den Brief habe ich für sie getippt, wie ich gestehen muss, und obwohl sie ihn mir damals ohne die geringsten Bedenken, mich zum Mitwisser zu machen, diktiert hat, wollte sie jetzt nichts davon hören, als ich sie auf das fehlende Bild hinwies und sie an die Geschichte erinnerte.
»Wie soll sie geheißen haben?«
Ich sagte es ihr.
»Vera?«
Ich nickte.
»Vera?«
Sie tat, als wäre allein schon der Name ein Scherz.
»Nach Amerika soll ich ihr geschrieben haben«, sagte sie zweifelnd. »Geht da nicht deine Phantasie ein bisschen mit dir durch?«
Es wäre vielleicht interessanter gewesen, wenn es ein Geheimnis gegeben hätte, aber es gab kein Geheimnis, es gab nicht einmal eine richtige Geschichte, sie leugnete nur auf besonders trostlose Weise die Realität. Ich sagte ihr, dass ihr das Mädchen auf dem Foto gefallen habe und dass ich noch genau wisse, wie sie von ihm geschwärmt hatte, es scheine Charakter zu haben, aber darüber lachte sie nur, eine solche Wendung komme in ihrem Sprachgebrauch sicher nicht vor und es bestehe kein Zweifel, ich müsse mich täuschen. Sie sah mich abschätzig an, und als ich versuchte, ihr eine Beschreibung zu geben, winkte sie grob ab, sie brauche keine Bestandsaufnahme von Augen, Mund, Nase, Ohren, um sich etwas vorstellen zu können.
»Dass von einer Frau die Rede ist, habe ich verstanden.«
In ihrer Stimme lag mehr Unwillen als Spott.
»Es steht dir natürlich frei, von ihr zu sprechen wie von einem Fabelwesen«, sagte sie. »Wenn du dich wieder beruhigt hast, bleibt doch der kleine Schönheitsfehler, dass es sie nie gegeben hat.«
Dann blätterte sie schweigend weiter, und entweder ist es eine besondere Ironie, dass sie genau bei dem Bild innehielt, das wahrscheinlich mehr mit einer Frau zu tun hat als all die anderen, die es von Heinrich Glück gibt, oder sie tat es gezielt, um von mir etwas darüber zu erfahren. Aufgenommen im Frühjahr 1975, nur wenige Monate vor seiner ersten Hochzeit, war er allein darauf abgebildet und saß auf eine Weise in sich zusammengesunken da, wie es sonst nicht seine Art war, Rücken und Schultern gekrümmt, das Gesicht angespannt und die Wangenfarbe selbst auf dem Schwarzweißfoto von einem auffallenden Grau. So, wie sie darauf starrte, wirkte sie, als würde ihr etwas an ihm auffallen, das sie davor noch nie gesehen hatte. Er war barfuß, hatte nur ein Unterhemd über seiner Hose an, eine Zigarette im Mundwinkel, und das Lächeln, das er versuchte, wollte ihm nicht recht gelingen, verschwamm auf dem ohnehin schon verschwommenen Bild. Das Zimmer war ein Hotelzimmer, dem Licht nach früh am Morgen, mit dem ungemachten Bett, dem offenen Fenster, dem Balkon im Hintergrund und noch weiter hinten dem Meer, und obwohl es eine triste Atmosphäre war, hätte ich ihren Kommentar nicht erwartet.
»Es ist das einzige Foto, auf dem man seine Sterblichkeit erkennen kann«, sagte sie nach einer Weile. »Sieht er nicht so aus, als hätte er sich gerade erst mit dem Tod angesteckt?«
Ohne Zweifel war es seine Melancholie, die sie dazu brachte, die Müdigkeit seines Blicks, aber sie wäre vielleicht weniger elegisch damit umgegangen, wenn ich ihr verraten hätte, dass es das Bild eines Liebeskranken war, hätte sich wohl zumindest die Bemerkung gespart, er gleiche darauf einem französischen Filmstar, dessen Name ihr gerade nicht einfalle. Es stammte aus der Zeit, in der Ira Dilaver ihn verlassen hatte und er mit ihrer Zwillingssschwester Isa den ganzen Mai jenes Jahres in Positano versackt war, um seine Wunden zu lecken. Zumindest hatte er mir gegenüber in diesen Worten davon gesprochen, in dieser für ihn so ungewöhnlichen Formulierung, und ich erinnerte mich wieder, wie er dabei die Hände gehoben hatte, als schämte er sich für das Kolportagehafte der Geschichte und versuchte, es durch seine allzu saloppe Sprache ins Ironische zu ziehen.
Allein wie er Zwillingsschwestern sagte, als hätte das für sich schon etwas Anrüchiges, ist mir noch in den Ohren, oder wie er kopfschüttelnd meinte, er wisse nicht, warum er mir das überhaupt erzähle, um dann ein wenig übertrieben, wie er es in diesen Dingen liebte, nach meinem Arm zu fassen.
»Kann ich mich auf Ihre Diskretion verlassen?«
Er hatte Iras ersten Gedichtband veröffentlicht, in dem von einer raubtierhaften Art, das Glück an sich zu reißen, die Rede war, die ich immer auf ihn bezogen habe, und es belustigte mich, ihn flüstern zu hören, als würde er mir ein Geheimnis anvertrauen, das ihn den Kopf kosten könnte. Ich erinnere mich, wie er von einer richtigen Kälberliebe sprach, obwohl er damals nicht mehr jung gewesen sei, auch das ungewöhnlich für ihn, ungewöhnlich, weil er sonst nicht zur Sentimentalität neigte, und im Delirieren seiner letzten Tage glaubte ich mitunter, Bruchstücke der Geschichte zu erkennen, glaubte ich, in seinem Stöhnen den Namen zu hören, war es ein »i«, wenn er einatmete, ein »a«, wenn er ausatmete, und das Stocken dazwischen, die Sekunden manchmal, in denen ich schon dachte, es sei das Ende, der fehlende Konsonant, über den er kaum noch hinwegkam, als wäre ihm mit der Ordnung der Buchstaben tatsächlich längst auch schon die Ordnung seiner Welt zerfallen. Zugegeben, ich habe ihm den Namen selber manchmal vorgesprochen, habe mich über sein Bett gebeugt und ihm ins Ohr geflüstert, habe wieder und wieder »Ira« gesagt, als könnte ich seinen Atem damit in Gang halten, und vielleicht ist es Wunschdenken, aber mein Eindruck war, je weniger er Dagmar oder sonst jemanden erkannte, um so mehr waren gerade diejenigen um ihn, die sie im nachhinein aus seinem Leben zu entfernen versuchte.
Auch deshalb war es absurd, dass ich jetzt neben ihr saß und immer noch auf das Foto starrte. Ich weiß nicht, was sie von Ira wusste, aber trotz ihres Pathos hatte sie wohl etwas getroffen, wenn sie meinte, dass es damals einen Knacks in seinem Leben gegeben haben musste. Zwar kannte ich die genauen Umstände nicht, doch dass er schon im Sommer danach verheiratet war, war mir immer überhastet vorgekommen, immer so, als hätte er sich nach einem Blick in den Abgrund ein für alle Mal in Sicherheit gebracht, und etwas davon schien sie zu ahnen.
Das Wort »Sterblichkeit« ließ mich indessen nicht mehr los, und als mir wieder einfiel, wann ich es zum ersten Mal mit ihm in Zusammenhang gebracht hatte, schauderte es mich, und ich rückte von ihr ab. Das war an dem Abend gewesen, an dem ihr Stück im Burgtheater durchgefallen war. Ich hatte ihn beobachtet, als die ersten Buhrufe aufkamen und überall in den Rängen Leute aufstanden und gingen. Schon früh hatte sich ein Desaster angekündigt, aber er hatte in der Pause noch Konversation getrieben, als stünde es in seiner Macht, einen guten Ausgang zu erzwingen, und tat jetzt so, als würde er nichts merken, obwohl die Stimmen der Schauspieler in dem anschwellenden »aufhören, aufhören« schon unterzugehen drohten. Er war aufgesprungen, schien seinen Körper gegen die Menge in Stellung bringen zu wollen, und ich sah, dass sein Gesicht ganz weiß war, weiß auch die Knöchel der ineinandergekrallten Hände, und seine Anspannung die einer Statue, kurz bevor sie die ersten Risse bekam. Den Atem musste er schon die längste Zeit angehalten haben, und die Mär will, dass er dann lospolterte, mit wüstem Schimpfen gegen das Tohuwabohu anging, aber in Wirklichkeit stand er nur da und versuchte, alles von sich abprallen zu lassen.
Habe ich da schon gedacht, das bringt ihn um, oder sind es nur die Worte von Professor Andermaier, die sich jetzt in meine Erinnerung drängen? Ich weiß es nicht, ich weiß aber, ich würde viel dafür geben, wenn ich Heinrich Glück nie so hätte sehen müssen. Allein die Erinnerung daran versetzte mich wieder in diesen Zustand, dem ich damals tagelang ausgeliefert war, ein Katastrophengefühl, das mich in die tiefste Apathie stürzte und gegen das ich mich auch jetzt kaum zu wehren vermochte.
Ich hatte noch immer nichts gesagt, und je mehr ich merkte, wie sehr Dagmar darauf wartete, um so undenkbarer schien es mir. Ein Blick genügte, und sie musste wissen, dass eine Frau das Foto aufgenommen hatte, doch von mir würde sie das nicht zu hören bekommen. So unnötig es war, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, wenn sie mich drängte, würde ich spekulieren, dass ihr Mann sein Unglück damals wohl mit Selbstauslöser verewigt hatte. Ich fragte mich, warum er diesen flehentlichen Blick auf die Kamera richtete, geradeso, als handelte es sich um eine Pistole und er würde am liebsten um den Gnadenschuss bitten, aber ich hütete mich, ihr das in den Kopf zu setzen.
»Er ist damals erst fünfzig gewesen«, sagte ich schließlich, um die Situation aufzulösen. »Ist es da nicht ein bisschen zu früh, vom Sterben zu reden?«
Statt etwas zu erwidern, deutete sie nur auf die beiden Gegenstände, die neben ihm auf dem Bett lagen und auf die ich bislang nicht aufmerksam geworden war. Es schienen zwei Metallspiralen zu sein, am ehesten von einem Expander, mit dem er vielleicht gerade noch trainiert hatte. Ich sah nichts Außergewöhnliches darin, war er in seinen jüngeren Jahren doch ein sportlicher Mann gewesen, aber sie bestand darauf, dass ich genau hinschaute.
»Glaubst du, sie bilden zufällig ein Kreuz?«
Das war eine von Dagmars mystischen Anwandlungen, mit denen ich nie etwas hatte anfangen können. Ich hatte nicht beabsichtigt, sie aus der Reserve zu locken, und doch schien mir genau das gelungen zu sein. Auf ihre Ausflüge ins Übernatürliche hatte ich immer mit Schweigen reagiert, und die unausgesprochene Abmachung zwischen uns war, ich widersprach ihr nicht, und sie beließ es bei Andeutungen.
»Es sieht doch aus, als sei das absichtlich so arrangiert worden«, sagte sie und war damit nahe daran, unsere Spielregeln zu verletzen. »Ich bin sicher, es ist jemand bei ihm gewesen.«
Die Grenzen der Logik sprengte das nicht, sie konnte sich ihr Teil denken, ich dachte mir meines, aber es blieb ein ungutes Gefühl zurück, und ich war froh, dass sie wenigstens keine Mutmaßungen anstellte, wer es gewesen sein könnte, und die Sitzung gleich danach für beendet erklärte. Sie wollte, dass ich nicht ohne Erinnerung aus dem Haus ging, und obwohl es schon nach Mitternacht war, drängte sie mich, vor dem Spiegel im Schlafzimmer gleich mehrere von Heinrich Glücks alten Anzügen anzuprobieren. Ich wehrte mich vergeblich, und weil sie alle zu klein waren, fand ich mich später in einem roten Skipullover mit weißem Streifen und der blauen Aufschrift »Squaw Valley«, den ihr Mann angeblich von einer Amerikareise mitgebracht hatte, auf der Straße wieder. Dass er in Wirklichkeit nie dort war, wusste sie genauso gut wie ich, aber das war ganz einfach das Privileg, das sie sich herausnahm, ihre innere Wahrheit, wie sie sagen konnte, wenn jemand sie auf einen Widerspruch hinwies, und deshalb hatte natürlich auch der Silberbecher, den sie mir an der Tür noch in die Hand drückte und der mir Glück bringen sollte, seine eigene Geschichte.
Ich stand schon in der Kälte, als ich mir noch anhören musste, er stamme aus Mekka und ihr Mann habe ihn bei einem Heiligen auf der Djemaa el-Fna in Marrakesch für sie gekauft, obwohl sie ihn wahrscheinlich von einem Flohmarkt oder aus einem Versandhauskatalog hatte und ich später feststellen durfte, dass ich nicht der einzige war, dem sie einen geschenkt hatte. Tatsächlich gab es in ihrer Bekanntschaft bald niemanden mehr, der nicht einen gehabt hätte, oder es war sonst ein Andenken, mit dem sie ihn bedacht hatte, eine Füllfeder mit der Gravur »Heinrich Glück«, ein paar Schuhe aus seinem Besitz oder sonst etwas aus dem unerschöpflichen und allem Anschein nach immer größer werdenden Reservoir seines Erbes. Zusammen waren es wohl ein paar Dutzend Leute, von denen sich einige aus Aberglauben so schnell wie möglich von den Dingen trennten, aber soviel ich weiß, ist auch keinem von den anderen etwas geschehen, sie sind alle am Leben und erfreuen sich bester Gesundheit, wie man so sagt.
Das betone ich, damit keine Missverständnisse entstehen, und vielleicht kann Dr. Mrak schon einmal zu Protokoll nehmen, dass ich in meinem Zauberbecher Büroklammern aufbewahre und damit keine nachteiligen Erfahrungen gemacht habe. Gerade dieser Tage hat das Kind einer Freundin mit ihnen gespielt und sie in einer langen Reihe auf dem Teppich im Wohnzimmer ausgelegt, aber es ist nichts passiert. Sie liegen immer noch dort, einige von ihnen auf groteske Weise verbogen, andere abgeknickt, wieder andere in ihrer ursprünglichen, sicher nur um so verdächtigeren Form, und immerhin, manchmal, wenn ich nach Hause komme, bleibe ich davor stehen, frage mich, ob sich in meiner Abwesenheit etwas in ihrer Anordnung geändert hat, und lege dann selbst ein oder zwei um, bevor ich das Gefühl habe, es ist alles in Ordnung.
3.
Ich bin nicht sehr gut in der Beschreibung von Personen und beschränke mich hier deshalb im wesentlichen auf das, was in Dagmars Pass stand, Körpergröße 157 cm, Augenfarbe grün und als besonderes Merkmal eine Narbe von einem entfernten Muttermal unter dem rechten Nasenflügel. Tatsächlich verstellen mir in Romanen allzu detaillierte Angaben eher das Bild, das ich von einer Figur habe, als dass sie helfen, es zu konturieren, und ich kann mich kindisch freuen, wenn ich auf alte Stereotype stoße, ein »knabenhaftes Gesäß« etwa, »kleine Brüste« oder auch nur das Wort »makellos«, das immer noch rege Anwendung auf Frauenbeine findet, ohne Zweifel ein Überbleibsel aus der Zeit der ersten Nylonstrümpfe. Dagmars vielleicht auffallendste Äußerlichkeit war bei all ihrer Morbidität eine trotzige Natürlichkeit, ja, manchmal fast etwas Heimatfilmhaftes in ihrem Aussehen, wenn sie die Haare mit dem Glätteisen langgezogen hatte, eine Pausbäckigkeit über die Jahre hinaus, sowohl im metaphorischen als auch im wörtlichen Sinn, wie man sie so nur in der österreichischen Provinz findet, eine Mischung aus Naivität und Verschlagenheit.
Heute sage ich mir manchmal, ich hätte Heinrich Glück von Anfang an vor ihr warnen müssen, ich hätte ihm sagen sollen, was man über sie munkelte, aber ich weiß, wie illusorisch das ist, weiß, er hätte mich im besten Fall nur ausgelacht, sich aber viel wahrscheinlicher jedes Wort verbeten. Wie kam ein Angestellter dazu, seinen Chef über die vielleicht merkwürdigen Anschauungen seiner Frau zu unterrichten, die ihm selbst kaum entgangen sein dürften? Konnte er ihm sagen, dass sie eine notorische Lügnerin war, ohne sofort seine Stelle zu verlieren? Konnte er auch nur ernsthaft Zweifel an ihrer Begabung als Schriftstellerin äußern? Es waren alles in allem drei Gelegenheiten, bei denen er mich nach ihr gefragt hat, und ich hielt mich jedesmal zurück, auch noch beim letzten Mal, knapp drei Wochen vor seinem Tod, als er Dagmar nicht mehr erkannte und auf einmal wissen wollte, wer die Dame in Weiß eigentlich sei, die an seinem Bett ein solches Theater aufführe und sich anstelle, als wäre er schon gestorben, und ich einen Augenblick die Vorstellung hatte, ich könnte ihn retten, könnte ihn in letzter Sekunde noch aus ihren Fängen befreien und, welche Selbstüberschätzung, vielleicht sogar am Leben erhalten.
Statt dessen sagte ich ihm nur, sie sei seine Frau, und die Reaktion, die das auslöste, hatte es in sich.
»Meine Frau?«
Bevor ich es zu verhindern vermochte, hatte er sich im Bett aufgerichtet und starrte mich an. Dagmar war gerade aus dem Zimmer gegangen, um etwas zu holen, und er war kaum zu beruhigen, wollte aufstehen und sich selbst vergewissern, und ich erinnere mich, dass er Tränen in den Augen hatte, als ich ihn in die Kissen zurückdrückte. Ich hielt ihn fest, hörte, wie er stöhnte, und es war das letzte Mal, dass ich seine Kraft spürte, den erstaunlichen Druck, den er mir entgegensetzte, obwohl sich seine Oberarme in meinen Händen anfühlten wie Vogelknochen, von einer pergamentenen Haut überzogen.
»Sie glauben wohl, ich habe den Verstand verloren«, sagte er und war dabei so klar wie seit vielen Tagen nicht mehr. »Wollen Sie mir wirklich weismachen, dass diese Stute meine Frau ist?«
Es war genau die Ausdrucksweise, die sich auch bei den Runden im Imperial durchgesetzt hatte, Teil der Unflätigkeiten und zweideutigen Späße, die dort schon unangenehm auffielen und sich jetzt auf dem Sterbebett nur um so grotesker ausnehmen mussten. Allein von seiner Stimme, einem trockenen Krächzen, bekam ich eine Gänsehaut. Jeder Vitalität beraubt, klang das Großsprecherische wie aus der Hölle und schien erst so seinen ganzen Schrecken zu verbreiten, als er immer wieder anfing, seine Frau sei eine Dame, und dann regelrecht loszeterte.
»Was erlauben Sie sich?«
Obwohl es in diesen Tagen schon mehrmals vorgekommen war, dauerte es eine Weile, bis ich merkte, dass er nicht von Dagmar, sondern von seiner ersten Frau sprach.
»Sie verwechseln sie«, sagte ich. »Ich meine nicht Edith.«
Er hatte öfter nach ihr gefragt und, wenn ich ihm sagte, sie sei schon seit Jahren tot, es in der Regel sofort wieder vergessen. Manchmal waren dann nur ein paar Minuten verstrichen, und er hatte von neuem begonnen, und schließlich hatte er tatsächlich gemeint, tot, das interessiere ihn nicht, tot, sie solle kommen und ihn hier nicht allein lassen. Er war damals nicht zu ihrem Begräbnis gegangen, hatte mich mit einem Kranz hingeschickt, den er bei einer Gärtnerei am Semmering in Auftrag gegeben hatte, und es war herzzerreißend, wie er jetzt nach ihr verlangte.
»Warum versteckt man sie vor mir?«
Da konnte ich noch so sehr versuchen, den Sachverhalt aufzuklären, es blieb ohne Folgen, und was auch immer ich mir einfallen ließ, ich machte es nur schlimmer, bis er schließlich verfügte, er wolle nichts mehr davon hören, ja, er verbitte sich den Namen Dagmar ein für alle Mal, er kenne niemanden, der so heiße.
»Außerdem verstehe ich dieses Schachern nicht«, sagte er dann in der hellsichtigen Mischung aus Klarheit und Verwirrung, die manchmal über ihn kam, und wieder nicht gerade zimperlich in seiner Ausdrucksweise. »Ich habe doch keinen Harem.«
Das zweite Mal, dass er mich nach ihr fragte, war nach der Katastrophe im Burgtheater, auch wenn es da nicht unbedingt eine Frage war, vielleicht nicht einmal die Aufforderung, etwas zu ihr und ihrem Stück zu sagen, wie ich zuerst dachte, sondern nur Erleichterung, dass ich mich als einziger nicht an den Erklärungen beteiligt hatte, was schiefgegangen war. Er hatte zur Premierenfeier im Sacher reservieren lassen, aber nachdem jede Äußerung nur falsch sein konnte und in der Situation zu Missverständnissen führen musste, hatte die Runde sich schnell aufgelöst. Ich weiß nicht mehr, wer außer den Getreuen seines Stammtisches alles dabei war, doch als schließlich auch die beiden Trattinger-Brüder aufbrachen, saßen wir allein da.
»Das letzte Wort ist in dieser Sache längst nicht gesprochen«, kündigte der eine noch eine Ehrenrettung für den übernächsten Tag in seiner Zeitung an. »Ich werde selbstverständlich etwas schreiben.«
Der andere sagte, was er den ganzen Abend gesagt hatte.
»Ein Skandal, wenn man mich fragt.«
Im selben Augenblick schien ihm zum ersten Mal bewusst zu werden, wie zweideutig das war, und während er Dagmars Blick suchte, legte er sich nur um so mehr ins Zeug.
»Meiner Meinung nach hat die Uraufführung noch gar nicht stattgefunden«, sagte er, und es klang, als hätte er den Ausgang geahnt und es für alle Fälle vorbereitet. »Das Debakel geht ganz auf die Kappe des Herrn, den ich nicht im Traum Regisseur nennen würde.«
Dann war es plötzlich still, und in die Stille hinein wandte Heinrich Glück sich an mich, als hätte er in mir einen letzten Trumpf.
»Von Ihnen haben wir noch gar nichts gehört.«
Ich war so überrumpelt, dass ich nur stammelte und froh sein konnte, als Dagmar, die bis dahin selbst kein Wort gesagt hatte, mir zu Hilfe kam.
»Mein Gott«, fuhr sie ihn an. »Hast du nicht endlich genug?«
Sie war den ganzen Abend dagesessen wie unter einer Glasglocke, und ihr Ausbruch kam überraschend. Zugleich verschwand das Lächeln aus ihrem Gesicht, das ihr den Anschein gegeben hatte, nicht die einfachsten Zusammenhänge zu verstehen, aber in Wirklichkeit nur ihre Art gewesen war, sich zu wappnen. Sie war lauter geworden und senkte sofort wieder die Stimme.
»Was in aller Welt willst du noch hören?«
Das verschaffte mir Luft, und ich äußerte mich erst, als sie mich auf der Heimfahrt bat, einen Augenblick anzuhalten, ihr sei schlecht. Sie hatte ein Glas Champagner nach dem anderen getrunken, und als sie die Tür im Fond öffnete, nachdem ich gerade noch in eine Nebenstraße eingebogen war und einen dunklen Seitenweg gefunden hatte, dauerte es eine Weile, bis sie hervorgekrochen kam. Es war tatsächlich ein Kriechen, und ich schaute ihr im Rückspiegel zu, wie sie sich abmühte und einen Augenblick mehr auf allen vieren als aufrecht neben dem Auto verharrte.
»Bleib, wo du bist«, sagte sie zu ihrem Mann, der sich anschickte, ihr zu helfen. »Wenn du mich anfasst, fange ich an zu schreien.«
Dann wankte sie in den Scheinwerferkegel und setzte sich an den Straßenrand. Es war ihr erstes Lebenszeichen, seit wir losgefahren waren, und sie blieb zwei, vielleicht drei Minuten allein sitzen, ihr Gesicht zerknautscht und verbeult wie von richtigen Schlägen, ihr Haar auf genau die Weise feucht, wie es mir immer feucht erschienen war, kurz bevor sie zu weinen begann. Ich hatte das Fenster heruntergekurbelt und hörte nichts, weil ich den Motor laufen gelassen hatte, aber als ich sah, wie es sie würgte, beeilte ich mich, auszusteigen und zu ihr zu gehen.
Nachdem ich mich ihr Schritt für Schritt genähert hatte, ließ ich mich neben ihr nieder und legte einen Arm um ihre Schultern. Dabei spürte ich, wie sie unter der viel zu kurzen Jacke zitterte, und mein Gott, so genau musste man mit den Worten vielleicht doch nicht sein, auch nicht als der größte Lektor der Welt, jedenfalls nicht mitten in der Nacht, in der Dunkelheit und wenn es keine Zeugen gab, um nicht ein wenig Menschlichkeit und Wärme walten zu lassen. Zu der Zeit hatte ich schon mehrfach erlebt, wie mitleidslos sie mit Leuten umgehen konnte, wenn sie erst einmal in ihre interne Rubrik »böse« fielen, aber ich hätte ein Unmensch sein müssen, wenn sie mir in dem Augenblick nicht leid getan hätte.
Ich hörte sie wimmern und sprach auf sie ein, und natürlich war es genauso hilflos, wie es klang, als ich sagte, sie solle sich doch nicht wegen eines versnobten Spießerpublikums grämen, das in acht oder neun von zehn Fällen das wirklich Große verkenne. Ich wusste nicht, ob Heinrich Glück das mitbekam, kann nur sagen, wie sehr ich hoffte, nicht am Ende Zeuge einer Szene zwischen den beiden zu werden. Gegen das Scheinwerferlicht gelang es mir nicht, ihn zu sehen, nur die Ahnung eines Schemens hinter der Windschutzscheibe, aber er hatte den Motor inzwischen ausgeschaltet, und ich hörte den immer noch starken Verkehr von der Hauptstraße, will aber nicht glauben, dass auch schon die ersten Vögel zu lärmen begannen, wie es mir später die Erinnerung vorgaukelte.
Es roch nach Benzin, es roch nach Frühling, und als ich mich wieder zu Dagmar beugte, war ich sicher, einen Hauch von Urin zu riechen. Ich schaute ein wenig betreten an ihr hinunter und sah einen dunklen Fleck auf dem orange-rot-gelben Abendkleid. Darin hatte sie im Triumph die Bühne stürmen wollen, eine feurig am Himmel aufgehende Sonne, und das verlieh ihm jetzt um so mehr etwas von einem Narrenkostüm. Sie schien zu frösteln, und als wäre ihr mein Blick unangenehm, zog sie wieder und wieder vergeblich an der Jacke herum, die nur gerade ihre Schultern bedeckte.