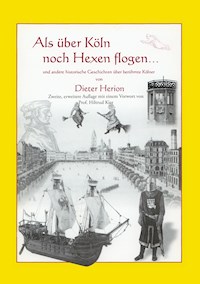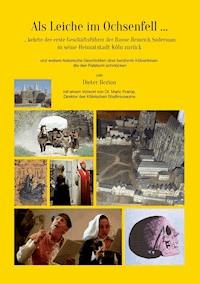
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Kölner Ratsturm finden sich herausragende Personen der Kölner Stadtgeschichte verewigt. Neben dem Hansesyndikus Heinrich Suderman begegnen Sie in diesem Buch dem Erzbischof Anno II., dem als Ketzer verbrannten Adolf Clarenbach, dem berühmten Maler Stephan Lochner und der Hauptseidmacherin Fygen Lutzenkirchen. Dieter Herion lässt die Figuren in fiktiven Gesprächen teilweise in ihrer Ursprache, nämlich Kölsch, aus ihrem Leben berichten, fügt aber den kölschen Äußerungen die hochdeutschen Fassungen unmittelbar hinzu. So erfahren die Leser nicht nur interessante Details der Kölner Geschichte aus weit zurück liegenden Jahrhunderten. Der Autor lässt dadurch ihre Protagonisten im Dialog auf ganz besondere Weise lebendig werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
V
ORWORT DES
A
UTORS
G
ESCHICHTEN UND
G
ESCHICHTE
A
LS
L
EICHE IM
O
CHSENFELL
…
… kehrte der erste Geschäftsführer der Hanse (Syndikus)
Heinrich Suderman
(1520–1591) in seine Heimatstadt Köln zurück
H
AT DER
K
ÖLNER
E
RZBISCHOF
A
NNO
II.
DIE
A
BTEI
B
RAUWEILER BESTOHLEN?
E
S SIND
K
ETZER IN
K
ÖLN
!
Kurze Geschichte der Nichtkatholiken in Köln (Katharer, Bettelorden, Beginen, Täufer/Wiedertäufer, Reformierte)
E
S IST NOCH KEIN
M
EISTER VOM
H
IMMEL GEFALLEN
Geschichte der Kölner Zünfte (Bruderschaften – Ämter – Gaffeln)
1288 S
CHLACHT BEI
W
ORRINGEN
Ein „Freiheitskampf“ und seine Folgen
H
ANSESTÄDTE ZWISCHEN
14.
UND
16. J
AHRHUNDERT
L
ITERATURVERZEICHNISSE
B
ILDNACHWEISE
VORWORT DES AUTORS
Mein zweites Buch1 über Kölner Ratsturmfiguren erzählt etwas von und über Heinrich Suderman, den ersten Geschäftsführer der mittelalterlichen Hanse, Erzbischof Anno II. und seine Auseinandersetzung um das Erbe Richezas, der Königin von Polen, Hauptseidmacherin Fygen Lutzenkirchen verteidigt die Freiheit der Stadt Köln, Adolf Clarenbach und die Kölner Ketzerbewegungen sowie Stephan Lochner und die Kölner Zünfte.
Ich habe die Texte – um sie noch anschaulicher zu gestalten – häufig mit kleinen orts-, situations- und zeitbezogenen Geschichten angereichert, vergleichbar mit den heute so beliebten Spielfilmszenen in Geschichtsdokumentationen mancher Fernsehproduktionen. Bei den Personen, die zwar den Ratsturm zieren dürfen, aber über die wenig bekannt ist, habe ich mir erlaubt, die zeitbezogenen Geschichten aus eigener Phantasie ein wenig zu erweitern.
Dieses Taschenbuch halte ich auch – ebenso wie mein erstes Buch „Als über Köln noch Hexen flogen …“ – gut für Stadtführer geeignet, die vor dem Ratsturm etwas über einzelne der dort aufgestellten Figuren erzählen möchten.
Eine deutsche Hochsprache entwickelte sich erst allmählich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, nachdem zunächst seit dem Ende des 17. – und erst recht im 18. Jahrhundert – an allen Höfen und im gehobenen Bürgertum Französisch gesprochen worden war.2Für die nicht der kölschen schen Sprache ausreichend mächtigen Leser habe ich jeweils unmittelbar an den mundartlichen Text eine hochdeutsche Übersetzung in Kursivschrift angefügt.
Danken möchte ich an dieser Stelle insbesondere meiner Frau Lieselotte für das Korrekturlesen, Herrn Peter Richerzhagen für die Beratung bei der Abfassung der kölschen Texte und Frau Dr. Sabine Doll für die Unterstützung bei meinen kirchenhistorischen Recherchen.
Köln, im November 2015
Dieter Herion
2 Karl-Heinz Göttert: Deutsch. Biographie einer Sprache. Ullstein, Berlin 2010.
GESCHICHTEN UND GESCHICHTE
Geschichtsschreibung beruht auf Fakten und Quellen, ausgewertet nach nachprüfbaren Methoden, dargebracht in nachvollziehbarer Form. Das ist der wissenschaftliche Anspruch.
Dabei geht Geschichte uns alle an: Geschichte kann jedem passieren, unabhängig davon, ob er oder sie nun ein Land regiert, jeden Morgen aufsteht, um die Bürgersteige der Stadt zu fegen, oder sich auf die große Reise zu einem Ort begibt, der ein besseres Leben verspricht. Geschichte ist immer auch individuell, weil sie aus unseren gebündelten persönlichen Erzählungen besteht, die gerade in ihrer Einzigartigkeit oft nicht überliefert werden und daher kaum in der „großen“ Geschichtsschreibung vorkommen.
Wie aber schaffen wir den Spagat zwischen Faktizität und Lebensnähe, wenn wir als Historiker ein breites Publikum auch abseits des akademischen Betriebs erreichen wollen? Wie können wir Geschichte schreiben und gleichzeitig Geschichten erzählen, die ein lebendiges Bild der Vergangenheit erschaffen?
Dieter Herion, der sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im Arbeitskreis des Kölnischen Stadtmuseums unermüdlich für die Vermittlung von Geschichte engagiert (unvergessen seine lebendigen Themenabende im historischen Kostüm!), gibt gelungene Antworten auf diese Fragen.
Historiographisch belegte Gegebenheiten werden hier vermengt mit Beschreibungen des Alltäglichen und Profanen. Die Grenzen zwischen Faktum und Fiktion verschwimmen zugunsten der Hör- und Lesefreude. Mögen besonders gewissenhafte Historiker das ein oder andere kritisch anmerken … So wissen wir etwa nicht, ob dem einflussreichen Syndikus der Hanse, Heinrich Suderman, 1565 in Köln tatsächlich ein quiekendes Schwein über den Weg gelaufen ist. Doch war dies bei den damaligen Verhältnissen in Köln sehr gut vorstellbar. Und: Es ist vor allem gut erzählt.
Dafür gebührt Dieter Herion mein herzlichster Dank – und seinem Buch unzählige Leserinnen und Leser, die viel Freude mit seinen Geschichten haben werden!
Mario Kramp
Direktor des Kölnischen Stadtmuseums
ALS LEICHE IM OCHSENFELL …
… kehrte der erste Geschäftsführer der Hanse (Syndikus) Heinrich Suderman (1520–1591) in seine Heimatstadt Köln zurück
Wer oder was war die „HANSE“?
Ein (fiktiver) Rückblick
Sudermans Lebensweg
Sudermans Persönlichkeit
„Hanse“ haben wir alle schon einmal gehört. Heute noch geläufig ist der Begriff nicht zuletzt von den Autokennzeichen für die Hansestädte Bremen, Hamburg, Lübeck, Rostock, Stralsund, Greifswald und Wismar.
Diese Namen haben die Städte von einer Handelsorganisation, der sie – neben Köln auch ca. 200 andere Städte3 – im Mittelalter angehört hatten. Die Hanse hatte sich im Laufe mehrerer Jahrhunderte auf der Basis einer „Gemeinschaft der Gotlandfahrer“ gebildet, etwa zu Beginn des 12. Jahrhunderts. Sie sollte Handelswege und -plätze sichern, denn fehlende Zentralgewalten mit entsprechender Sanktionsmacht in Europa hatten zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert Raubritter- und Strandräubersitten zur Folge. Außerdem waren Kaufleute aus fremden Städten und Ländern der Willkür der jeweiligen Herrschaften an allen Handelsplätzen ausgesetzt.
Deshalb sicherten sich die der Hanse angehörenden Städte gegenseitig Geleitschutz, Rechtsschutz und Handelsprivilegien (Steuerfreiheit, Zollfreiheit, eigene Rechtsprechung usw.) zu und gegenseitige Unterstützung bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Besonders bekannt ist für uns heute noch der Kampf der Hanse gegen Klaus Störtebeker und seine Vitalienbrüder.
Die Hanse war zeitweise so stark, dass sie selbst gegen Staaten Krieg führen oder durch Handelsblockaden zum Einlenken bewegen konnte. Selbst der deutsche Kaiser setzte sich zeitweise für die Hanse ein, weil er wusste, welche Bedeutung sie für sein Reich hatte.
Nachbau einer Hansekogge in Lübeck
Die Macht der Hanse war also groß, obwohl der Hanse eine ständige eigene Exekutivgewalt fehlte. Ebenso fehlten ihr übrigens eine eigene Verwaltung, Finanzhoheit, Heer und Siegel. Wohl aber verfügte sie über eigene feste Niederlassungen, Kontore oder Faktoreien genannt.
Die Hanse war immer auf die Solidarität ihrer Mitglieder angewiesen, die leider manchmal zu wünschen übrig ließ, weil diese hin und wieder lieber jeweils ihre eigenen Interessen verfolgten, die denen der Gesamtorganisation manchmal zuwiderliefen. Die Hanse versuchte dann die „Individualisten“ notfalls durch die Androhung der „Verhansung“ (Ausschluss) wieder in die Gemeinschaft zu zwingen. Mit diesem Schicksal musste sich z. B. auch einmal die Stadt Köln von 1471 bis 1476 abfinden.
Der Hanse gehörten in der Regel Städte an – vertreten durch ihre Stadträte oder Bürgermeister –, es konnten aber auch einzelne Kaufleute sein und das auch manchmal nur zeitweise. Diese unterschiedliche und für Fremde besonders undurchsichtige Organisationsform führte hin und wieder zu heftigen Auseinandersetzungen mit Ländern oder Städten bis zum Verlust von Handelsplätzen oder Privilegien. Das galt insbesondere für England, an dem die Stadt Köln als größte Handelsmetropole Europas im Mittelalter starkes Interesse hatte. Und in einer solchen privilegierten Position ließ sich Köln – als zudem freie Reichsstadt – auch nicht gerne von anderen Hansestädten in ihre Handelspolitik hineinreden.
Der letzte Hansetag, an dem auch Köln teilnahm, fand 1669 in Lübeck statt, aber der Niedergang der Hanse setzte schon Mitte des 16. Jahrhunderts ein mit
den großen Entdeckungen und dem beginnenden Überseehandel, denen die Verlagerung der Handelsströme folgte,
der Reformation und den damit verbundenen Religionskriegen
4
,
der Erstarkung der Territorialmächte, in denen sich schon im 15. Jahrhundert allmählich eine geordnete Verwaltung des weltlichen Gemeinwesens entwickelt hatte, die Polizei (Politie, Police) genannt wurde. Es bedurfte deshalb immer weniger der selbständigen Schutzfunktion der Hanse, noch ließ sich nun die jeweilige Territorialmacht in ihre eigenen Aufgaben hineinreden.
Das Archiv der Hanse wurde schon 1593 in Köln konzentriert, damit es im dortigen Stadtarchiv auf Dauer sicher aufbewahrt werde. Dass das Archiv am 03.03.2009 einstürzen würde, war damals nicht zu erwarten. In Deutschland nennen sich heute noch nach eigener Stadtsatzung 17 Städte Hansestadt, die aber nicht mehr alle ein „H“ in ihr Autokennzeichen eingefügt haben. Entweder weil sie einer größeren Gebietskörperschaft angehören, wie beispielsweise Anklam oder Demmin, oder weil sie diese „attraktive“ Zusatzkennzeichnung nicht nötig zu haben glauben, wie Köln oder Düsseldorf.
EIN (FIKTIVER) RÜCKBLICK
Und nun möchte ich mich dem ersten Syndikus der Hanse, Generalsekretär oder Geschäftsführer – so würde man heute sagen –, nämlich Heinrich Suderman persönlich nähern. Lassen Sie sich dazu 450 Jahre zurückversetzen:
Porträtgraphik Heinrich Suderman
An einem sonnigen Frühjahrsmorgen des Jahres 1565 schritt Heinrich Suderman durch die Botengasse nachdenklich auf das Rathaus zu.
Er kam von seinem Haus Unter Sporenmacher und hatte sich, weil der Tag noch recht kühl war, trotz des kurzen Weges seinen Mantel mit dem Pelzkragen übergeworfen. Er stand ihm gut und gab ihm ein vornehmes Aussehen. Er glaubte, das seiner Stellung und dem bevorstehenden Gespräch auch schuldig zu sein.
Die vielen Kot- und Unrathaufen auf der Straße vermied er fast wie im Schlaf. Ein quiekendes Schwein, das seinen Weg kreuzte, verlangte da schon mehr Aufmerksamkeit.
Sein schmales Gesicht trug wie immer einen leicht spöttischen Ausdruck. Er amüsierte sich oft über seine Gesprächspartner, wenn sie unsicher waren, ob sie im Gespräch lieber in sein linkes oder in sein rechtes Auge blicken sollten, denn sein linkes Auge folgte nicht immer der Richtung seines rechten. Mit andern Worten: Er schielte.
Suderman hatte sich mit Bürgermeister Konstantin von Lyskirchen verabredet, um mit ihm über seine Verhandlungen mit Prinz Wilhelm von Oranien zu sprechen, dem damaligen Stadthalter der spanischen Niederlande. Es ging um eine engere Beziehung zu den Niederlanden. Suderman wollte, dass die Hansestädte Druck auf England ausübten, um wieder die alten Privilegien im Stalhof von London, der Faktorei der Hanse, zu erreichen. Er hatte den Bürgermeister von Lyskirchen schon darauf vorbereitet.
Als er vor dem Ratssaal ankam, war die Sitzung noch nicht zu Ende. Also wartete er. Er übergab seinen Mantel einem Ratsdiener und begab sich in die Stube des Burggrafen. Burggraf Weinsberg5 war unterwegs. So setzte er sich auf eine Bank und nutzte die Muße, um einmal darüber nachzudenken, wie er eigentlich zu seinem Einsatz für die Hanse und die Handelsbeziehungen seiner Vaterstadt Köln – was nicht immer dasselbe war – kam.
Heinrich Suderman war am 31.08.1520 als Sohn des wohlhabenden Kaufmanns und Bürgermeisters Hermann Suderman in Köln geboren worden. Sein Vater hatte ihm erzählt, dass die Vorfahren der Familie aus Dortmund stammten, einer Stadt, mit der Köln seit Jahrhunderten vielfältige Handelsbeziehungen unterhielt und die ebenfalls der Hanse angehörte. Mit 18 Jahren – sein Vater hatte ihm als Kind viel Freiheit gelassen – begann er in Köln das Studium der sieben freien Künste6, eine Art Grundstudium, und wurde drei Jahre später zum Magister Artium promoviert. Er hatte von vornherein eine juristische Laufbahn angestrebt, darum setzte er anschließend seine Studien in den für Jura bekannten Universitätsstädten Orléans und dann in Bologna fort, wo er auch den Doktorgrad „beider Rechte“7 erwarb.
Nach Köln zurückgekehrt, war er für verschiedene Auftraggeber als juristischer Berater tätig. 1550 heiratete er Gude, die Tochter des Bürgermeisters Jakob von Rodenkirchen. Mit ihr bekam er sechs Kinder.
Er konnte sich noch gut erinnern, wie ihn sein Vater, Bürgermeister Hermann Suderman, vor nun gut zwölf Jahren eines Tages in sein Kontor gebeten hatte und ihm dort eröffnete:
„Hein, do häs met vill Erfolch en Kölle, Orléans un Bologna studeet un et hät jo janz jot jeklapp. Dat do och em Praktische jot drop bes, häs do am Reichskammerjereech en Speyer bewise un ne janze Püngel Lück us Kölle häs do jot berode. Wie ich deer em vörije Johr zom eeschte Mol hansische Krom an et Hätz jelaat hatt, es mer och opjejange, wat do all kanns! Ävver de Hanse selvs, dat jeit mer ald lang durch dr Kopp, möht ens öhndlich ömjekrempelt wäde. Ich han och ald en Idée, üvver die ich hück noch nit met der schwade well. Ävver ich well dich jän morje ens metnemme noh England, wo mer uns för de Hanse öm ahl Rächte en dr Reme läje möhte. Dobei kanns do och bei denne Kadette vun dä andere Hansestädt Endrock maache. Wammer dann met vill Erfolch zoröckkumme, well ich dr och verzälle, wat ich mit deer vörhan.“
„Heinrich, du hast mit viel Erfolg in Köln, Orléans und Bologna studiert. diert. Dass du das Gelernte auch in der Praxis gut anwenden kannst, hast du am Reichskammergericht in Speyer bewiesen, und viele Kölner Mitbürger hast du erfolgreich beraten. Als ich dir im vorigen Jahr zum ersten Mal Angelegenheiten der Hanse aufgetragen hatte, ist mir auch persönlich bewusst geworden, was du alles kannst! Aber die Hanse selbst – das geht mir schon lange durch den Kopf – müsste mal gründlich neu organisiert und effizienter gestaltet werden. Ich habe auch schon eine Idee, über die ich heute noch nicht mit dir sprechen möchte. Aber morgen will ich dich gerne mal mitnehmen nach England, wo wir uns für die Hanse um alte Handelsvorrechte einsetzen müssen. Dabei möchte ich dich auch den anderen Vertretern der Hansestädte vorstellen. Wenn wir dann erfolgreich zurückkommen, will ich dir auch erzählen, was ich mit dir vorhabe.“
Damit hatte er seinen Sohn Heinrich stolz und – neugierig gemacht. Sein Vater ließ sich aber nicht weiter bedrängen.
Die Gesandtschaft erreichte tatsächlich im November beim englischen König die erhoffte Bestätigung der Hanseprivilegien. Damit empfahl sich Heinrich als Vertreter der Hanse für weitere Verhandlungen in den nächsten zwei Jahren. Nach ihrer Rückkehr nach Köln eröffnete ihm sein Vater nun auch seinen Plan:
„De Hanse es zick ville Johr ärch lahm jewode. Wat fassjelaat wod, weed nit bei Zigge ömjesatz, un jeder mät wat hä well, janz ejal wat andre drüvver denke. Die Hanse bruch janz secher ne Syndikus, dä immer för se do es un sich öm dat janze Krömche öchelt: Afstemme un maache, wat fassjalat wood un immer widder dobei sin, wann se zesamme kumme.
Maach ens ne Schrieves, wo denne Häre klorjemaat weed, wie mer uns dat vörstelle. Dann wäden se dich om näkste Hansedach als Syndikus met enem jode Enkummes ensetze. Do bes jetz 33 Johr un do bruchs ene anständije Poste, domet du ding Famillich övver de Zick brenge kanns.“
„Die Hanse hat seit einigen Jahren viel ihres einstigen Durchsetzungsvermögens