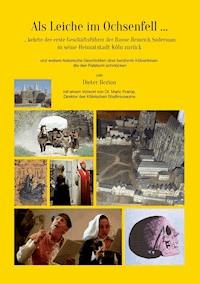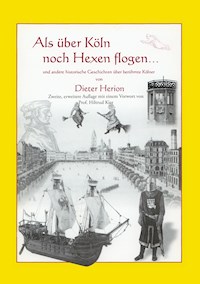
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der 1937 geborene Dieter Herion hatte neben seiner Sparkassentätigkeit sein Betriebswirtschaftsstudium an der VWA Köln erfolgreich abgeschlossen, sich aber schon früh - wie er sagt: „schon immer“ - für Geschichte interessiert. Obwohl er im Laufe seines Berufslebens als Bankkaufmann in der Betriebshierarchie einer großen deutschen Bank bis auf die Ebene des „niederen Adels“ aufstieg, holte ihn eines Tages seine alte Liebe zur Geschichte wieder ein. Er studierte einige Semester an der Kölner Volkshochschule und an der Kölner Universität und „praktiziert“ nun seit 25 bzw. 20 Jahren Geschichte in Form von Stadtführungen durch Köln bzw. Führungen und Vorträgen im Kölnischen Stadtmuseum. Und das verstärkt nach dem Ende seines Berufslebens. Dies ist die erste Veröffentlichung aus seiner Vortragstätigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Das große Interesse meines Freundes- und Bekanntenkreises an meinen geschichtsbezogenen Vorträgen im Kölnischen Stadtmuseum hat mich dazu bewogen, einen Teil davon einmal gesammelt zu veröffentlichen. Die Vorträge können damit leichter einem noch größeren Interessentenkreis zugänglich gemacht werden.
Da es sich um voneinander völlig unabhängige Geschichten handelt, kann jede einzelne bequem in der S-Bahn von Düren, Hennef oder Neuss nach Köln gelesen werden, selbstverständlich auch von Düsseldorf aus (oder umgekehrt).
In allen Geschichten habe ich mich bemüht, Bezüge zur heutigen Zeit herzustellen, wenn sie mir interessant erschienen (Rittersleut`, Nicasius Hackeney, Kölner Hexen). Soweit erforderlich und bekannt habe ich Legende und belegte Historie deutlich voneinander getrennt (der gute Gerhard, Agrippa von Nettesheim).
Ein den Geschichten angefügtes Literaturverzeichnis soll eine weitere Vertiefung in Personen, Umfeld und Materie ermöglichen.
Fast alle Hauptpersonen dieser Kölner Geschichten werden zukünftig wieder auf dem Kölner Ratsturm zu finden sein, nur nicht alle erwähnten „Rittersleut`“. Zu letzteren musste sich die seinerzeit auswählende Historikerkommission – bei 124 zur Verfügung stehenden Plätzen – auf einige wenige beschränken, um andere, bedeutendere Persönlichkeiten der über 2000-jährigen Kölner Geschichte nicht zu kurz kommen zu lassen. Das wird die „ritterbürtigen“ Kölner Familien (s. Vortrag „Rittersleut`“) damals möglicherweise etwas enttäuscht haben.
Vielleicht wird der/die eine oder andere Leser/ in zukünftig ein wenig länger vor dem Ratsturm verweilen, um dieser oder jener Figur nun vertraut zuzuwinken (wenn sie sich nach der Restaurierung noch an ihrem ursprünglichen Ort befinden). Zur Unterstützung ihrer Suche habe ich eine jeweilige grafische „Ortsbestimmung“ angefügt.
Danken möchte ich an dieser Stelle Frau Beatrix Alexander, der Bibliothekarin des Kölnischen Stadtmuseums, für das Heraussuchen der einschlägigen Literatur und manchen Hinweis und Rat, ebenfalls Frau Rite Wagner vom Kölnischen Stadtmuseum für die wissenschaftliche Begleitung. Für das Lektorat dieses Buches danke ich meiner Frau herzlich.
Köln im Mai 2007 Dieter Herion
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Als über Köln noch Hexen flogen
Hexenglaube und Hexenverfolgung in Köln
Warum Kaiser Heinrich IV. „nach Canossa“ ging und dennoch den Kölner Ratsturm zieren darf
Der gute Gerhard
Wie ein Kölner Kaufmann dem englischen König Richard Löwenherz zu „Herz“ und Krone verhalf
Lyskirchen, Overstolz und Co
.
ja, so war´n die Kölner Rittersleut´
Nicasius Hackeney
Ein Kölner Patrizier als Finanzminister Kaiser Maximilians I., des „letzten Ritters“
Agrippa von Nettesheim
Kam Goethes Faust aus Köln?
Nachwort
Literaturverzeichnisse, Abbildungsnachweis
Vorwort
Geschichte mit Geschichten zu erzählen macht immer Spaß, einerseits denjenigen, die sie erzählen und natürlich denen, die sie erzählt bekommen. Dabei kommt es sehr darauf an, wie Geschichten erzählt werden. Dieter Herion hat darin eine besondere Übung, ist er doch langjähriges Mitglied der Arbeitskreise des Kölnischen Stadtmuseums und gewann nicht zuletzt dabei ein dankbares Publikum, das seiner speziellen Interpretation der Kölner Geschichte lauschte. Nichts lag dabei näher, als dies in einem Büchlein zu veröffentlichen.
Es ist gerade die sehr subjektive Schilderung, die seine Darstellungen auszeichnet, in denen er Geschichte auch weiterdenkt. Jenseits der bekannten Fakten versucht Dieter Herion Verständnis für bestimmte Situationen durch die Schilderung möglicher Alltagsgeschichten zu schaffen, wie z.B. bei seinen einleitenden Worten zu dem so besonders traurigen Kapitel der Hexenverbrennungen. Da wird so manche Situation lebendig, wie sie gewesen sein könnte und wofür sich Dieter Herion einfach die Freiheit des Erzählens nimmt.
In diesem Sinne wünsche ich diesem Geschichts- und Geschichtenbüchlein möglichst viele Leser und Leserinnen, die sich nicht nur für die Geschichte der tapferen Katharina Henot, sondern auch für andere wichtige Kölner, wie die aus den Geschlechtern der Lyskirchen, Overstolz und Hackeney oder für den Guten Gerhard und Agrippa von Nettesheim interessieren. Sie alle werden dadurch eingestimmt auf das reichhaltige Angebot an Ausstellungen und Publikationen zur Geschichte von Köln.
Zülpich, im März 2007 Prof. Dr. Hiltrud Kier
Als über Köln noch Hexen flogen
Hexenglaube und Hexenverfolgung in Köln
Woher kommt die „böse Hexe“?
Einleitung und – kurze Geschichte der menschlichen Vorstellungen von Göttern, Hexen und Dämonen
Gründe für Hexenverfolgungen
Juristische Grundlagen
Geschichte der Kölner Hexenprozesse
Beispiele
Und wie sieht es heute aus?
Woher kommt die „böse Hexe“?
Einleitung und – kurze Geschichte der menschlichen Vorstellungen von Göttern, Hexen und Dämonen
Vor ca. 200 Jahren wurde in einem kleinen Dorf in der Schweiz die letzte Hexe verbrannt (von geschätzten 5 bis 9 Millionen in 300 Jahren). Und von Köln gingen wesentliche Impulse zur Hexenverfolgung in Deutschland aus. Wie war so etwas möglich?
Heute können wir mit Computersimulationen Klimakatastrophen vorhersagen. Wir wissen, dass übertriebene Flussregulierungen zu Überschwemmungen führen. Blitz und Donner und das Nordlicht können wir erklären. Vor der Tuberkulose haben wir keine Angst mehr; es gibt ja Antibiotika. Selbst den heute noch unerklärlichen Rinderwahnsinn schieben wir nicht mehr einer Hexe „in die Schuhe“.
Aber vor 500 Jahren? Wie dachten die Menschen damals?
War nicht gestern die schöne junge Magd im Stall, bevor die Kuh krank wurde?
Und vorige Woche, als der Blitzschlag Hermanns Hof traf, ist da nicht kurz vorher die alte Trin – wieder einmal unverständliches Zeug murmelnd – über den Dorfplatz geschlurft?
Und wer erinnerte sich nicht daran, wie im vorigen Jahr die rothaarige Tochter vom reichen Overstolz an Maria Lichtmess – ausgerechnet! – vom Bayenturm bis zum Kunibertsturm am Rhein entlang gelaufen ist? 14 Tage später trat der Fluss über die Ufer. Waren verdarben, Häuser stürzten ein und Menschen und Vieh ertranken! Wenn man die mal streng verhören würde, könnten wir wohl auch erfahren, wieso ihr Vater in so kurzer Zeit so reich geworden ist.
Das konnte doch alles nicht mir rechten Dingen zugegangen sein!
Wenn das Pferd krank wurde, konnte das nur durch den bösen Blick geschehen sein. Wenn eine verheiratete Frau kein Kind bekam, musste sie von einem Zauber getroffen worden sein. An einer Flutkatastrophe oder einer Dürreperiode konnte nur ein Hexenmeister schuld gewesen sein. –
Woher kamen diese merkwürdigen Vorstellungen?
Je weiter wir in die Geschichte zurückblicken, umso mehr nehmen Götter und Dämonen Raum ein in der Denk- und Handlungsweise der Menschen. Die Menschen stellten sich dabei diese nicht sinnlich wahrnehmbare Welt ähnlich vor wie ihre eigene reale: Auch dort gab es immer gut und böse, Götter und Dämonen mit oft sehr menschlichen Zügen.
So sind uns Zaubersprüche der Chaldäer aus dem Königspalast von Ninive und vom assyrischen König Assurbanipal aus dem 9. vorchristlichen Jh. überliefert. Im alten Babylon glaubte man selbstverständlich an die Toten, die als Vampire aus Gräbern steigen und Menschen anfallen. – Unter dem persischen König Xerxes (519 - 465 v. Chr.) wurde die Medische Priesterkaste der Magier mächtig, weil sie sich auf Sterndeutung verstanden. (Wir kennen einige aus der Bibel als die „Weisen aus dem Morgenland“.)
Das klassische Griechenland kannte die thessalischen Weiber, deren Salben die Menschen in Vögel, Esel oder Steine verwandeln konnten und die durch die Lüfte zu ihren Buhlschaften flogen. Diese Künste müssen sich überliefert haben, denn nach mittelalterlicher Vorstellung benötigten die Hexen auch Salben, um mit Hilfe von Besenstielen, Rechen oder – Galgenbäumen durch die Luft fliegen zu können, in der Regel auf Berggipfel, in Köln meist auf den Neumarkt, den Domhof, den Aposteln- und den Gereonsklosterhof.
Augustinus (354-430) warnte vor der Macht von Dämonen und Teufeln, an die er als „Geistwesen“ fest glaubte. Er hielt sie nicht für stofflich, aber sie waren es, die den Menschen böse Träume eingaben. Dennoch hielt im 10. Jh. der Kanon Episcopi1 die Bischöfe noch an, gegen den Glauben an solchen „heidnischen Unsinn“ Kirchenbußen zu verhängen.
Denn seit Beginn unserer Zeitrechnung glaubten die ersten Christen, mit Jesus sei die Welt vom Bösen erlöst worden, und der Satan habe keine Macht mehr über die Menschen.
Für die Kirchenlehrer der ersten drei Jahrhunderte stand demnach fest, dass nur die Götter Roms Dämonen waren (später selbstverständlich auch die germanischen, die keltischen, die afrikanischen usw.). Nur das Christentum brachte dem gläubigen Christen die Sicherheit vor solchen Dämonen!
Woher aber dann der allmähliche Wandel?
Nachdem Kaiser Konstantin die alten römischen Götter durch den Erlöser Jesus und den Gott der Christen ablösen ließ, damit überall das Gute auf die Welt käme, erkannten spätere gelehrte und einflussreiche Theologen, z. B. Augustinus, Albertus Magnus, Thomas von Aquin, dass es mit der Überwindung des Bösen auf der Erde doch nicht so weit her war. Sie suchten nach Erklärungen und fanden sie in alten vorchristlichen Schriften. Hier waren die bösen Mächte genau beschrieben. Als sie diese in ihre Zeit hinüberführten, merkten sie gar nicht, dass sie damit eigentlich zu Ketzern wurden, weil sie nämlich diesen bösen Mächten mehr Macht über einen getauften und damit ja eigentlich geschützten Christen einräumten als Gott (s. u. S. 148).
Das war die theologische Seite. Wir dürfen daneben aber nicht die scheinbare „Hexerei“ vergessen: Man kennt seit mindestens 2000 Jahren den Einfluss von Drogen auf die Psyche des Menschen, z.B. Bilsenkraut, Eisenhut, Tollkirsche. Die darin enthaltenen Alkaloide2 lösen Gefühle des Fliegens, erotische Phantasien, visionäre Begegnungen und Haut- oder Körperveränderungsgefühle aus. Nur: Drogenkonsumenten hielten bis ins 19. Jht. hinein ihre Halluzinationen für tatsächliche Erlebnisse. Und vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Hexenhysterie hatten sie also tatsächlich mit dem Teufel auf dem Neumarkt getanzt!
So etwas zu gestehen, bedurfte dann noch nicht einmal mehr der Folter.
In Köln erschien noch 1755 die letzte Auflage der „Disquisitiones magicae“, die „Magischen Untersuchungen“, die Hexentheorie des belgischen Jesuiten Martin Delrio. Sie war 150 Jahre vorher verfasst worden.
Aber – je mehr Gewissheit sich die Menschen über die Naturgesetze aneignen konnten, um so mehr nahm der Glaube an „übernatürliche“ Dinge ab.
Gründe für Hexenverfolgungen
Wir würden heute sagen: Sollen sich doch von mir aus irgendwelche Spinner als Hexen bezeichnen. Was stört es mich?
Aber vor 1000 Jahren war es interessierten Kreisen ja tatsächlich gelungen, die Menschen vom Schadenszauber durch Hexen zu überzeugen oder sie in diesem alten Aberglauben zu bestärken. Die Menschen hatten also wirklich Angst vor diesen unheimlichen Wesen, die deshalb ausgerottet werden müssten!
Nun, wer hatte ein Interesse daran, diese Furcht zu verbreiten und – warum?
Diktaturen und Oligarchien benutzten schon immer gerne Götter und Dämonen; Götter, um ihren Machtanspruch zu mystifizieren, Dämonen, um sich ihrer Gegner ebenso „glaub“-würdig entledigen zu können. Neben der theologischen Erklärung für das immer noch existierende Böse in der Welt ging es also um Machterhalt. Hier ein paar Beispiele aus älterer Zeit:
Die Pharaonen in Ägypten waren schon immer von göttlicher Abstammung. Wer sie nicht anbetete oder ihnen opferte war ein Gotteslästerer.
Dasselbe galt für die assyrischen und babylonischen Herrscher.
Im alten Israel änderte sich mit dem Aufkommen der Theokratie die Einstellung der Menschen zu ihren Herrschern, aber nicht zu anderen Religionen, deren Vertretern und deren Kultus. Für deren Anhänger kam nach dem Buch Moses
3
nur eine Strafe in Frage, nämlich die Steinigung, d.h. die Todesstrafe. Denn die Verehrung anderer Götter beeinträchtigte die Macht der Priesterkaste des einen, allzuständigen Gottes.
In der römischen Kaiserzeit wandelte sich das Ansehen der schon erwähnten Magier: Zunächst als Gaukler verspottet, wurden sie später als Gotteslästerer verfolgt und getötet, weil sie nicht an die umfassende Macht des
göttlichen
Kaisers glaubten.
Seit dem frühen Mittelalter fühlte sich die mächtige christliche Kirche oft bedroht durch aufkommende reformatorische bis revolutionäre Ideen, die schließlich im 15./16. Jht. zu der dauerhaftesten und bedeutsamsten Kirchenspaltung Mitteleuropas (evangelisch/ katholisch) führten. Sie erinnerte sich mit Schrecken an vorausgegangene Abspaltungen (Kopten, Orthodoxe, Katharer usw.). Die stärkste Bedrohung ging für die Macht und Reichtum gewohnten Kirchenfürsten von der Forderung der Häretiker4 aus, die Diener der Kirche hätten, wie seinerzeit Christus, arm und ohne weltliche Macht zu sein. Deshalb finden wir in den geistlichen Fürstentümern die erfolgreichsten Inquisitionen und die meisten „Hexen“: in Bamberg, Fulda, Salzburg, Trier und Würzburg.
Schon als im 12./13. Jh. Glaubensabweichler (Albigenser, Katharer, Waldenser usw.) besonders starken Widerhall in der Bevölkerung fanden, stellten Theologen fest, dass der alte Aberglaube von leibhaftigen Hexen, Dämonen und Teufeln im Volk immer noch lebendig war. Ihn galt es also zu nutzen. Dafür musste der Kanon Episkopi nur etwas „modernisiert“ werden. Besonders hervor tat sich damit der französische Dominikaner Nikolaus Jaquies Mitte des 15. Jht5. Man habe bis zum 10. Jht. die moderne Entwicklung des Hexenwesens noch nicht ahnen können, behauptete er, nämlich, dass sich Hexen und Hexenmeister inzwischen auch stofflich machen könnten. –
Später setzten die Inquisitoren Heinrich Institoris und Jakob Sprenger6 in ihrem Hexenhammer – auf den ich gleich noch ausführlicher eingehen werde – diese Interpretation fort. Sie stützten sich dabei gern auf Thomas von Aquin als den ältesten und berühmtesten Zeugen des Hexenwesens.
Kaiser Friedrich II. führte schon 1224 die Todesstrafe für Ketzer7 und – anfangs auch für Bettelmönche ein. Sie sollten auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Denn wer die Lehrsätze der offiziellen Kirche in Frage stellte, dem war auch alles andere zuzutrauen! Man musste sie/ihn vernichten! Zudem bot der Scheiterhaufen auch die Garantie für die ewige Beseitigung dieser teuflischen Personen, denn wer verbrannt war, konnte am Jüngsten Tag auch nicht wieder leibhaftig auferstehen.
Aber warum traf gerade Frauen – wie bekannt – der Bannfluch der Inquisition in besonderem Maße?
Zunächst lag es wohl daran, dass der schon erwähnte Hexenhammer die geschlechtliche Vereinigung mit dem Teufel in den Mittelpunkt der Hexenbeweise stellte und der Teufel traditionell männlich war.
Aber vielleicht irrten sich die Verfasser auch?
Immerhin vermuten moderne Wissenschaftler, die sich mit diesem mittelalterlichen Phänomen der fanatischen Hexenverfolgung beschäftigen, dass auch eine mysteriöse Ehr-“Furcht“ des Mannes vor der Frau eine Rolle gespielt haben kann als dem Lebewesen, das die für ihn unerreichbare Fähigkeit besitzt, Leben zu gebären.
Damit hing m. E. auch die Verfolgung von Hebammen zusammen. Darüber hinaus vermutet der Jurist Manfred Hammes in seinem Buch „Hexenwahn und Hexenprozesse“, weil Hebammen prädestiniert dafür gewesen seien, an eines der wichtigsten und am schwersten zu beschaffenden Bestandteile der Hexensalbe zu kommen, nämlich an ein „neugeborenes, möglichst ungetauftes Kind“.
Dazu möchte ich aus Shakespeares „Macbeth“ Zubereitung und Zutaten der Hexensalbe in Auszügen zitieren. Als Kind des 16. Jh. glaubte Shakespeare wahrscheinlich auch an das, was er so formulierte:
„Um den Kessel dreht euch rund, werft das Gift in seinen Schlund. Kröte, die im kalten Stein Tag und Nächte, drei mal neun, zähen Schleim im Schlaf gegoren, soll zuerst im Kessel schmoren....
.......
Eibenreis, vom Stamm gerissen in des Mondes Finsternissen Hand des neugebor`nen Knaben, den die Metz`8 erwürgt im Graben, abgekühlt mit Paviansblut, wird der Zauber stark und gut.“
Ebenfalls wäre eine patriarchalische Furcht der Männer vor den Frauen denkbar, die unabhängig leben konnten, also vor jenen Frauen, die nicht unter direkter Kontrolle eines Vaters oder Gatten standen. Diese Ansicht kann durch Untersuchungsergebnisse von Hexenprozessen belegt werden, die aber auch das Motiv zulassen, dass man von allein stehenden Frauen den geringsten Widerstand erwartete.
Die Furcht der Männer vor den Frauen beschränkte sich übrigens nicht nur auf Europa. Vor mehr als 2500 Jahren hatte schon Buddha seine Jünger gewarnt: „Unergründlich verborgen, wie im Wasser des Fisches Weg, ist das Wesen der Weiber, der vielgewitzten Räuberinnen, bei denen Wahrheit schwer zu finden ist, denen die Lüge ist wie die Wahrheit und die Wahrheit wie die Lüge.“
Unter Frauen spielten Neid und Hass auf die erfolgreichere, glücklichere, schönere eine große Rolle. Immerhin denunzierten Frauen überwiegend wiederum Frauen, sei es in erpressten Geständnissen, sei es von sich aus, um sich einer lästigen Rivalin zu entledigen.
„Hexensabbat“ oder „Die drei Wetterhexen“ Holzschnitt von Hans Baldung, gen Grien, 1510
Es gab aber noch weitere Gründe für den Hexenglauben:
Die Gier nach der Hinterlassenschaft der Verurteilten war eine ganz wesentliche Triebfeder. Schon Friedrich Spee von Langenfeld, der Verfasser der „Cautio criminalis“ und große Zweifler an den Hexenverfolgungen, schrieb einmal, dass „viele nach den Verurteilungen der Zauberer hungerten, davon sie fette Suppe essen wollten.“ Von Bedeutung war dabei auch, dass die Hexenrichter oft keine anderen Einnahmequellen hatten und deshalb nach der Verurteilung weiterer Hexen „lechzen“ mussten. Bald erhoben sich an vielen Orten Klagen über den persönlichen Aufwand, den manche Henker und Richter trieben. Trotzdem unterstützten viele Landesherren weiterhin dieses schreckliche Treiben, denn die Hälfte des Vermögens der verurteilten Person fiel häufig – dem Landesherrn zu.
Mediziner versteckten sich gerne hinter ihrem noch unzulänglichen Wissen (Anatomie war z. B. streng verboten), indem sie notfalls auf Dämonen und Hexen verwiesen, wenn sie mit ihrer Kunst nicht mehr weiterkamen. Medizinische Veröffentlichungen des 16. und 17. Jhts. gehen von der realen Existenz von Luftgeistern aus, die mit den Gestirnen in Gemeinschaft stehen und so für den Menschen Schaden erzeugen (Sebastian Wirdig, †1687). Andere führten die Entstehung von Krankheiten auf böse Dämonen zurück (Robert Fludd, †1637).
Nicht außer Acht lassen dürfen wir auch die scheinbare „Hexerei“, denn die Macht und der Einfluss von Drogen auf die Einbildungskraft des Menschen ist – wie schon erwähnt – erst eine Erkenntnis des 19. Jhts.. Hierin hatten Frauen, die sich traditionell mit der Heilkraft von Kräutern beschäftigten, die umfangreichsten Kenntnisse.
Schließlich sollten wir auch an den schon damals bei Männern und Frauen anzutreffenden Selbstdarstellungstrieb – sprich: Prahlerei – denken, auch wenn er in diesen Fällen meist tödlich endete.
Auf dem Höhepunkt des Hexenwahns war selbst ein angehender Kleriker nicht mehr vor Verfolgungen und Verhaftungen sicher. So berichtete ein Pfarrer aus Bonn einem befreundeten Adligen:
„Ihre fürstliche Gnaden (der Kölner Kurfürst und Erzbischof ) haben gestern 70 Zöglinge des Priesterseminars, die binnen kurzem Pfarrer hätten werden sollen, verhaften lassen.“
Der Heidelberger Mathematik- und Philosophieprofessor Lerchheimer konnte 1585 öffentlich vermuten, Papst Sylvester II. sei nur deshalb zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt worden, weil er sich vor seiner Wahl dem Teufel verschrieben habe.
Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz, die „schwarze Katze“ natürlich.
Juristische Grundlagen
Der Dominikaner Nikolaus Jacquier, Führer der Inquisition in Nordfrankreich, war der Erste, der die Brücke von der Ketzerei zur Hexerei schlug. In seiner allgemein beachteten Schrift „Ketzergeißel“ behauptete er nämlich, dass die Ketzer erst nach der Anbetung des Teufels während des Hexensabbats9 von ihm die Mittel erhielten, Schadenszauber zu bewirken.
Das strafwürdige Verbrechen bestand also in erster Linie in dem Delikt der Gotteslästerung. Die konnte sowohl darin bestehen, dass eine geweihte Hostie geschändet wurde, als auch darin, dass man durch die Luft flog. Denn das war eine Missachtung göttlicher Gesetze. Diese und ähnliche Formen von Gotteslästerung – ob tatsächlich verübt oder nur angedichtet oder eingebildet – reichten grundsätzlich schon für ein Todesurteil.
Die wirksamste und zugleich schrecklichste Waffe in der Verfolgung der sogenannte Hexen war der „Hexenhammer“ oder – wie er auf Latein hieß – „Maleus malificarum“, ein übles Machwerk, das die beiden Dominikaner Heinrich Institoris und Jakob Sprenger 1487 herausbrachten. Sie stützten sich dabei auf die Bulle Papst Innozenz VIII. „Summis desiderantes affectibus...“ aus dem Jahr 1484.
Der Historiker Joseph Hansen bezeichnete in seinem Buch „Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter“ den Hexenhammer als ein „... unglaubliches Monstrum voll geistiger Sumpfluft.“ und weiter „... aber zu der schonungslosen und unerbittlichen Brutalität dieser Vorgänger (des Hexenhammers), ihrer an Stumpfsinn grenzenden aber mit theologischer Eitelkeit durchsetzten Dummheit tritt hier noch kaltblütiger und geschwätziger Zynismus, ein erbärmlicher und nichtswürdiger Hang zur Menschenquälerei, der beim Leser immer wieder den Grimm und die äußerste Erbitterung über die Väter dieser eklen Ausgeburt religiösen Wahns wachruft.“
Aber zunächst einmal zurück zu den Autoren: Heinrich Institoris, vom Papst als Inquisitor für Oberdeutschland eingesetzt, brachte nur bedingt überzeugende Voraussetzungen mit, sich als Retter gestrauchelter Seelen aufzuführen: Er war einmal nur mit Mühe der Verhaftung und Bestrafung wegen Unterschlagung von Ablassgeldern entgangen.
Der Dominikaner Jakob Sprenger war von 1472 bis 1488 Prior seines Ordens in Köln und ab 1481 Inquisitor für die Erzbistümer Köln, Mainz und Trier. Er ist wahrscheinlich gegen seinen Willen als Mitautor des „Hexenhammers“ genannt worden10
Institoris wusste schon damals um die Zweifel der Menschen am leibhaftigen Teufel und an den Hexen. So schrieb beispielsweise der Kölner Kaufmann und Ratsherr Hermann Weinsberg keine 100 Jahre später in seinem berühmten Tagebuch unter dem 30. Juni 1589 unter anderem: „...Ich weiß wohl, dass es manche böse, argwöhnische, niedrige, aufsässige, unzüchtige, schädliche Weiber gibt, daraus folgt aber gar nicht, dass diese Zauberinnen seien. Niemals habe ich ein Weib gesehen, das imstande wäre, Hasen, Hunde, Katzen, Mäuse, Schlangen, Kröten zu machen, mit einem Bock durch den Schornstein zu fliegen oder mit dem Teufel zu tanzen; und derjenige, der da sagt, er habe es gesehen, kann lügen.“
Wegen dieser Zweifel bediente sich Institoris, um seinem Hexenhammer das von ihm gewünschte Gewicht zu geben, der Kölner Universität. Sie stand damals im Ruf, die Autorität auf dem Gebiet der Kirchenlehre und Bibelauslegung zu sein, zumal sie auch vom Papst als Zensurbehörde ausdrücklich anerkannt worden war. Institoris reichte also sein Manuskript dieser gewichtigen Institution ein und erhielte – eine sehr reservierte Beurteilung. Die theoretischen Grundlagen seien zwar nicht falsch, hieß es darin, den strafrechtlichen Ausführungen könne man aber nur insoweit folgen, als sie den kirchlichen Vorschriften nicht widersprächen.
Diese Bestätigung ging dem Autor nicht weit genug! Also fälschte er kurzerhand ein für sein Werk vorteilhafteres Gutachten, fügte noch vier gefälschte Unterschriften von Kölner Professoren hinzu und heftete es der ersten Veröffentlichung des Hexenhammers vor. Das tat er auch mit der päpstlichen Bulle. Ja, er scheute noch nicht einmal davor zurück, auch diese in seinem Sinne zu „ergänzen“. Aus der päpstlichen Bulle hatte Innozenz den im ersten Entwurf enthaltenen Geschlechtsverkehr zwischen Teufel und Mensch gestrichen. In der Version des Hexenhammers ist er wieder drin. Innozenz war auch nicht davon überzeugt, dass Hexen fliegen könnten. Der Hexenhammer lässt daran keine Zweifel aufkommen. Nach geltendem kanonischem Recht, nochmals bekräftigt in der „Hexenbulle“ Papst Innozenz` VIII, sollten bußfertige, nicht rückfällige Ketzer in lebenslanger Kerkerhaft büßen. Darüber setzt sich der Hexenhammer hinweg und hält selbst für abschwörende Hexen ihrer besonderen Boshaftigkeit wegen den Scheiterhaufen für die einzig angemessene Strafe.
Ursprünglich galt für den Einsatz der Folter auch die Karolina, das erste allgemeine deutsche Strafgesetzbuch Karls V.. Nach ihr durfte eine verdächtige Person nur einmal gefoltert werden. (Sogar die Dauer der Folter war vorgeschrieben.) Auch darüber setzte sich die Praxis der Inquisition im Laufe der Zeit hinweg. Hatte eine der Hexerei angeklagte Person nach der ersten Folter nicht gestanden, galten weitere Folterungen einfach als – „Fortsetzung“. Hexenwesen wurde als Sonderverbrechen betrachtet, das auch eine besondere Behandlung der Delinquenten erforderlich machte.
Die erste Ausgabe des Hexenhammers erschien – wohlüberlegt– nicht im Kölner Raum, sondern in Straßburg, damit die Fälschung nicht zu früh entdeckt wurde. Institoris spekulierte: War der Hexenhammer mit diesen theologischen Autorisierungen einmal zum Selbstläufer geworden, konnte seinen Siegeszug kein Dementi mehr aufhalten. Er sollte Recht behalten.
Zwar war der Hexenhammer eigentlich nur der Kommentar zu der erwähnten päpstlichen Bulle, aber ohne das Werk von Institoris (und Sprenger) blieb natürlich eine päpstliche Bulle etwas „blutleer“. Trotzdem ist festzuhalten, dass mit dieser Bulle der größte und grausamste Menschheitswahn eingeleitet wurde, vielleicht nur noch mit den Judenverfolgungen des Dritten Reichs vergleichbar.