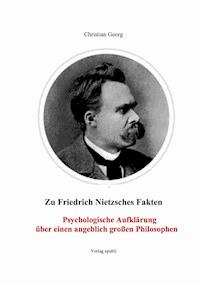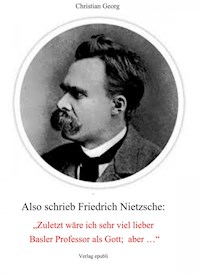
Also schrieb Friedrich Nietzsche: "Zuletzt wäre ich sehr viel lieber Basler Professor als Gott; aber ..." E-Book
Christian Georg
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zu seinen Lebzeiten war Friedrich Nietzsche - bis zu seiner Aufsehen erregenden Einweisung in die Irrenanstalt Basel Anfang 1889 - ein Denker ohne nennenswerte Bedeutung. Aufgrund der Einschätzung seiner Freunde und einiger weniger Leser und weil seine Schwester ab 1893 eine Einkommensquelle brauchte, propagierte sie ihren Bruder als geistigen Vordenker und Bodenbereiter einer neuen "Moral", die allerdings nur auf Maßlosigkeiten beruhte. Der damals im deutschen Kaiserreich großmannssüchtige Zeitgeist ließ die verheerenden Schwächen von dem, was Nietzsche im Laufe der Jahre als seine außerordentlich widersprüchlich gestaltete "Philosophie" angesehen hatte, weitgehend unbeachtet, förderte aber seine gedankenlosen Großmannstiraden, weil das damals von Nietzsche Veöffentlichte nicht seine tatsächlichen Absichten offenlegte. Die Meinung der Schwester und deren Mitläufer, die wie Nietzsche an sich selbst, an diesen als einen großen, seiner Zeit weit vorauseilenden Denker glauben wollten, haben alles unternommen, ihn als ein Ideal seiner und überhaupt aller Zeiten erscheinen zu lassen. Die Fakten-Grundlage aus Nietzsches vollständig veröffentlichten Schriften ergibt inzwischen, chronologisch nachvollzogen, das Bild eines bis zum Autistischen ausgeprägten Egozentrikers ohne Sinn und Empfindung für die ihn umgebende Wirklichkeit. Aufgrund seiner Veranlagung und Wesens(un)art mussten Nietzsches Ansichten in einem ihm eigenen Prozess der Enthemmung, zu dem aus seiner Sicht durchaus ehrlich getanen letzten Satz ausarten, dass er "zuletzt sehr viel lieber Basler Professor als Gott" gewesen wäre. Das vorliegende Buch zeigt für Nietzsches Lebensjahre von 1844 bis Anfang 1889 (dem Ausbruch seines nicht mehr zu leugenden Wahnsinns), an engmaschig ausgewählten Beispielen die seinen denkerischen Verfalls-Prozess dokumentierende "innere Logik" als durchaus spannende "geistige Biographie" in vielen Zusammenhängen unter vielen bisher nicht gesehenen Gesichtspunkten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 13683
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Georg
Also schrieb Friedrich Nietzsche:
„Zuletzt wäre ich sehr viel lieber
Basler Professor als Gott; aber …“
Verlag epubli
Impressum
Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright: © 2016 Christian Georg, 22889, Tangstedt, Zur Wälschenbek 4
Vertrieb: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Für die Unterscheidung der Sprechenden in diesem Buch wurden unterschiedliche Schriften angewendet:
Texte des Autors
Texte von Nietzsche
Zitate anderer Autoren
Also schrieb Friedrich Nietzsche:
„Zuletzt wäre ich sehr viel lieber
Basler Professor als Gott; aber …“
Eine chronologische Darstellung seiner als Philosophie
erachteten Wahnideen in Gegenüberstellung zu den
Gegebenheiten seiner tatsächlichen Existenz.
Zusammengestellt und kommentiert von
Christian Georg
Verlag epubli
Inhaltverzeichnis
Vorwort, „Gebrauchsanweisung“ und Einleitung.5
Was man über N von Anfang an wissen sollte.28
Ns Kindheit u. Schuljahre in Naumburg, 1844 bis 1857.35
1858: „Geistiges Erwachen“, Selbstbespiegelung u. Herrscheramt64
1859: Internatsjahre in Schulpforta (bis 1864)85
1860: Die Zeit der „Germania“.102
1861: Der erlebte Lebenssinn durch Ralph Waldo Emerson.111
Die Emerson-Infektion.132
Der Hintergrund gewisser „Momente“.167
Die Nachwehen der Emerson-Infektion.231
Wieder angekommen in der Alltagswelt, in Schulpforta.239
1862: Symptome einer unzuverlässigen „Gesundheit“.260
1863: Erste Ansätze zu elementarem Widerspruch.
Vorwort, „Gebrauchsanweisung“ und Einleitung
(Folgen Sie Ihrem gesunden Menschenverstand, aber fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker)
Der Gebrauch des eigenen Denkvermögens offenbart einem jeden, wie schön und logisch doch alles zusammenpasst, was unter strenger Berücksichtigung dessen, was realiter, d.h. im Rahmen der uns derzeit bekannten und zuverlässig zur Verfügung stehenden Kenntnisse über die uns umgebende Wirklichkeit sich als immerhin möglich vorstellen lässt. Alles, was unter diesen Voraussetzungen als eher unwahrscheinlich erscheint, sollte nur mit äußerstem Vorbehalt als Faktum betrachtet werden und als solches gelten. Auf dieser Basis können viele abenteuerliche Ansichten und philosophische Wahrheiten getrost als irrtümlich zustande gekommen auf Seiten des Ungültigen abgelegt werden. Die im Zuge der Aufklärung zu einer wirkungsvollen Kraft gelangte Wissenschaft stellte den verlässlichen Unterschied fest zwischen bloß Denkbarem und dem, was Wirklichkeit genannt zu werden verdient, - auch zwischen empfundenem und erlebtem philosophischen Denken und wahrer Erkenntnis, sowie zwischen dem, was einer aus der Welt seiner Ursachen und Wirkungen heraus für richtig hielt und dem, was für die Gesamtheit der Menschen als gemeinsame Wahrheit gelten darf.
Die erste lexikographische Erwähnung Nietzsches erfolgte noch zu seinen Lebzeiten, allerdings erst gut 2 Jahre nach dem Aufsehen erregenden endgültigen, ungeheuer bekanntheitsfördernden und nicht mehr zu widerlegenden Ausbruch seines Wahnsinns, in der Siebenten Auflage des heute kaum mehr bekannten „Pierers Konversations-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit oder neuestes enzyklopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe“, das im deutschen Sprachraum als „erstes voll ausgeformtes modernes allgemeines Lexikon“ gilt, in Band 9 von insgesamt 12 Bänden, Lübeck-Ostinato, 1891, auf Spalte 1212 unten rechts und lautet, noch sehr kurz und damit Ns damaliger Bekanntheit entsprechend:
Nietzsche Friedrich Wilhelm, deutscher Schriftsteller, geb. 15/10 1844 Röcken bei Lützen; geistvoller philosophischer Denker, in Schopenhauers Werken geschult[eher bewandert, denn a) galt Schopenhauer zu der Zeit nicht als anerkannter Philosoph und b) hielt N sich in seinen Schopenhauer-Kenntnissen für seiner Zeit weit voraus], früher bedeutender Anhänger Richard Wagners, von dessen Sache er sich nachmals abwandte; Professor in Basel 1869-79; führte dann, durch seinen Gesundheitszustand gezwungen, sein Amt niederzulegen, ein Wanderleben, bis er im Frühjahr 1889[unmittelbar zum Jahresbeginn]in der Landesirrenanstalt[u.a. schließlich in]Jena[vergeblich]Heilung suchen musste. Er verfasste….. [darauf folgt eine Aufstellung der von ihm bis dahin veröffentlichten Werke.]
6 Jahre nach Nietzsches festgestellter und inzwischen als endgültig anzusehender geistiger Unzurechnungsfähigkeit sowie 5 Jahre vor seinem Tod erschienen 1895,als zweitältestem lexikographischen Eintrag, imauch heute noch bekannten „Brockhaus‘ Konversations-Lexikon“, 14. vollständig neubearbeitete Auflage, im 12. von insgesamt 16 Bänden,Angaben über Friedrich Nietzsche. Diese stammten weitgehend aus dem von Friedrich Nietzsches Schwester ins Leben gerufenen und von ihr rigoros, d.h. streng, unerbittlich und rücksichtslos überwachten, alle Urteile über ihn kontrollieren wollenden „Nietzsche-Archiv“ und standen unter dem Diktat, dass es sich bei ihm - wie er selber es immer von sich behauptet hatte und er unter einem derartigen Superlativ auch besser zu vermarkten war! - um den angeblich größten Denker aller Zeiten handeln würde und um aller Weisheit letzten Schluss, was ohnehin nicht angehen konnte.
Zur Einführung in das auf den ersten Blick als „philosophisch“ erscheinende Phänomen Friedrich Nietzsche, - so wie dieses fast ein Jahrhundert lang - allerdings nach und nach immer angefochtener - gegolten hat und worauf das allgemeine Ansehen Nietzsches und seine Bedeutung letztlich noch heute beruht - soll dieser eine ganze Spalte lange, das heißt „eine halbe Seite“ füllende, lexikographische Eintrag als erster Eindruck dienen. Zugleich wird mit dem Zitat dieses Artikels für die weitere Darstellung Nietzsches für ihn das dort benutzte Kürzel „N“ ohne Geringschätzung, allein der zu praktizierenden Kürze wegen, übernommen.
Der erstmals in größerem Umfang gegebene Lexikon-Eintrag lautet - einschließlich inzwischen notwendig gewordener, die Fakten herausstreichender und zurechtrückender Kommentare:
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, Philosoph, geb. 15. Oktober 1844 zu[in]Röcken bei Lützen[zur geschichtsträchtig bedeutsamen Erwähnung des gut 2½ km von dem winzigen Dörfchen Röcken entfernten Ortes war der „Begriff“ Lützen schon Nietzsche selber wichtig geworden, weil dort - nicht in dem belanglosen Röcken! - einst, 1632, eine der Hauptschlachten des von 1618 bis 1648 währenden Dreißigjährigen Religions- also Ansichten-Krieges, d.h., dass es vor allem um Raub und Besitzstände ging, stattfand, bei welcher der Schwedenkönig Gustaf II, Adolf fiel. Zudem fand auf den Ebenen bei Lützen - genauer eigentlich bei dem von beiden Orten etwa gleichweit (je 6 km) entfernten Großgörschen! - am 2. Mai 1813, geschichtlich also Nietzsche „viel näher“! - die erste Schlacht der Befreiungskriege gegen den 1812 durch seinen verheerend verlaufenen Russlandfeldzug 1812-1813 geschwächten französischen Kaiser und „modernen Raubritter“ Napoleon statt. Die Entscheidungsschlacht der Befreiungskriege ereignete sich dann ein halbes Jahr später, vom 16. bis 19. Oktober 1813 - nochmals ca. 18 km weiter nordöstlich - bei Leipzig, in der bis dahin wahrscheinlich größten Schlacht der Weltgeschichte mit 92.000 Toten und Verwundeten. Durch die Verbindung des Namens Lützen mit der Geburtsstätte Ns sollte seine Geburt mittels der nahebei über die Bühne gegangenen blutigen historischen Superlative mit besonderer Bedeutung aufgeladen werden! - Er, der Sohn eines im Alter von 36 Jahren, 1849, an einer Hirnerkrankung verstorbenen Dorf-Pfarrers, der einmal Prinzessinnen-Erzieher gewesen war], studierte 1864-67 in Bonn[1 Jahr]und Leipzig[einschließlich Militärdienst und Krankheit 4½ Jahre]klassische Philologie, wurde 1869[auf Empfehlung seines Professors kurz vor Abschluss seines Studiums!]als außerordentlicher Professor der klassischen Philologie nach Basel berufen und[dort]1870 zum ord. Professor ernannt. Am Krieg 1870[gegen Frankreich]nahm er[für die Dauer von etwas mehr als 2 Wochen!]als freiwilliger Krankenpfleger teil. 1879 nötigt ihn ein[bereits seit Schulzeiten auftretendes]mit häufigen Kopfschmerzen verbundenes Augenleiden, sich pensionieren zu lassen[eigentlich sein Amt niederzulegen. Der großzügige Entschluss der Universität machte daraus ein zuerst auf 6 Jahre begrenztes, dann mehrfach verlängertes Pensionsangebot]. Anfang 1889 wurde er infolge von geistiger Überanstrengung und im Übermaß gebrauchter Schlafmittel[was von der Schwester steif und fest und entgegen den wahren Zusammenhängen so behauptet und von ihr als offizielle Begründung vorgeschrieben war]unheilbar geisteskrank. N. lebt seit 1897 in Weimar[nach dem Tod der Mutter im Besitz seiner Schwester im inzwischen dort angesiedelten N-Archiv in dem er vielfach als „konsekrierte“, noch lebende Hostie, zu Anbetungszwecken herzuhalten hatte]. In den Werken der ersten Zeit, der «Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik» (Lpz.1872; 4. Aufl. 1895) und den «Unzeitgemäßen Betrachtungen» (1873-76; 3. Aufl. 1895) versucht[e]er den Begriff einer deutschen Kultur im höchsten Sinne[als einen Superlativ, aber ohne erkennbare praktische Konturen!]zu bauen, als deren hoffnungsvollste Ansätze ihm die Philosophie Schopenhauers und die Kunst Wagners erschienen. Die Gedankenwelt einer zweiten, in Aphorismus-Büchern sich äußernden Periode («Menschliches, Allzumenschliches», 2 Bde, 1878-79; 4. Aufl. 1895; «Morgenröte», 1881; 3. Aufl.1897; «Die fröhliche Wissenschaft», 1882; 3. Auflage 1897) wird[wurde]eingeleitet durch eine Abkehr[eher eigentlich durch einen Widerruf]von der pessimistischen Philosophie Schopenhauers und der im «Parsifal» christlich-asketisch gewordenen Kunst Wagners und ist[aufgrund einer elementaren, illusionsumnebelten Realitätsfremdheit!]radikal skeptisch in philosophischen, entschieden atheistisch in religiösen und übernational in Dingen der Politik, Kultur und Kunst[die weltweit entsprechend seinen Vorurteilen betrachtet werden sollten!]. Es beginnt eine einschneidende Kritik der Entstehung und des Wertes der heutigen Moral, die[N meinte neu nach eigenen Maßen feststellen zu dürfen, was]ihn dazu[ver-]führt[e], die heute herrschenden Werturteile als Werte des absteigenden[zu verachtenden zeitgenössischen]Lebens (der nihilistisch-christlich-skeptischen, demokratischen Dekadenz) zu verwerfen und ihnen seine neuen aristokratischen, lebenbejahenden[aber vollkommen irrealen, nämlich „die Anderen“ nicht auf der Rechnung habenden!]Zukunftsideale entgegenzustellen. Dies geschieht zuerst in poetisch-symbolischer[legendenhaft „biblisch tönender“]Form im ersten Werk seiner dritten Periode: «Also sprach Zarathustra» (1883-85; 6. Aufl. 1897)[was als 1895 „erlassener“ Angabe keinen Tatsachen entsprechen konnte, denn auch in den vorangegangenen „Werken“ fand N - bei strikter Verneinung der erlebten Welt in allerdings anderem, aphoristischem Tonfall! - Bejahung nur für seine allem widersprechenden Illusionen!]; die folgenden (der zusammenhängenden Gedankenentwicklung sich wieder nähernden[oder nur den Inhalt nicht mehr poetisch vernebelnden!]) Werke; «Jenseits von Gut und Böse» (1886; 6. Aufl. 1896), «Zur Genealogie der Moral» (1887; 6. Aufl. 1896), «Der Fall Wagner» (1888; 5. Aufl. 1896, «Götzendämmerung» (1888; 5. Aufl. 1896) führen die immer radikaler[immer enthemmter]werdende Kritik der[von N in keinem Punkt tiefer verstandenen]Modernität und Moral weiter; sein unvollendet gebliebenes[nie existiert habendes, weil von der Schwester aus Nachlass-Notizen zusammengeschustertes und zurechtgefälschtes]Hauptwerk: «Die Umwertung aller Werte», sollte die Zarathustra-Lehren in philos[ophischer]Darstellung entwickeln[was ihm selber und auch diesem „Fälscherprodukt“ nie gelungen war!]. N. ist[d.h. sollte gelten als]ein Psychologe ersten Ranges und[das allerdings unwidersprochen! - als]ein Stilist, der die deutsche Sprache um neue Stilformen und Ausdrucksmöglichkeiten bereichert hat[was als seine wesentliche Leistung anzuerkennen wäre!], als Dichter der Schöpfer eines neuen Dithyrambenstils[ein in der Antike, vor 500 v. C. gepflegter, stürmisch leidenschaftlich erregter ekstatischer Wechselgesang zwischen Chor und Vorsinger in freiem Versmaß, ursprünglich hymnisch auf den Gott Dionysos zielend, woraus sich die griechische Tragödie entwickelt hätte; ein berühmter Dithyramben-Dichter war der bei N in hohen Ansehen stehende Pindar, 522-446 v. C., aufgrund seiner Hymnen auf Vornehme und sonstige sich solches leisten könnende Auftraggeber, die Wert darauf legten, sich besingen zu lassen, - das gehörte in der Antike zum guten Ton]; er verbindet das feinste künstlerische Formgefühl[welches - wie hier der Eindruck erweckt werden sollte! - tatsächlich kein Superlativ, sondern nur eine von vielen möglichen dichterischen Ausdrucksformen war]mit großer Leidenschaft des Denkens[ohne aber je etwas von dem, was er schrieb, über den Moment hinaus konsequent durchdacht zu haben!]. Eine Gesamtausgabe seiner Werke (Bd. 1-10, Lpz. 1895-96) ist im Erscheinen begriffen; eine Biographie gibt seine Schwester, Elisabeth Förster-Nietzsche, heraus (Bd. 1, Lpz. 1895). - Zur ersten Einführung in Ns neue Gedankenwelt ist der Essay von Peter Gast in der 2. und 3. Auflage des «Zarathustra» am geeignetsten. - Vgl. Kaatz, Die Weltanschauung F.N.s (2 Tle., Dresd. u. Lpz. 1892-93); Lou-Andreas-Salomé, F. N. in seinen Werken (Wien 1894); E.Kretzer, F.N. (Frankf.a.M. 1895).
So fand es sich 1895 bei Brockhaus gedruckt und gehörte zum Anfang einer unübersehbaren Flut von Aussagen über den angeblich großen Denker N, der alles Bisherige im Bereich der Philosophie - wie von dem amerikanischen Schriftsteller Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, vorhergesagt? - in jeder Beziehung und auch endgültig gemeint in den Schatten stellen sollte. Bemerkenswert sind die genau wirkenden, aber betrügerisch zustande gekommenen Angaben zu den jeweils angeblich erreichten oder zu erreichenden Auflagenzahlen, mit denen es N bis zu seiner geistigen Umnachtung, Anfang 1889, allesamt und ausnahmslos nicht über die 1., jeweils zum größten Teil unverkauft gebliebene Auflagenzahl von 1000 Stück je Titel nicht hinausgebracht hatte, aber jetzt, bei Brockhaus wohl auf Betreiben des geschäftstüchtigen und auflagensüchtigen Wirkens der Schwester so demonstrativ überhöht gerechnet herausgestellt wurden. Das Interesse an Ns „Philosophie“ war seinerzeit vor allem durch den Anfang 1889 offen ausgebrochenen Wahnsinn und ab 1893 erst durch die massive Propaganda der Schwester wachgerufen und in Szene gesetzt.
Abzüglich der letzten gut 11 Jahre, während denen Ns Wahnsinn nicht mehr zu verleugnen und es ihm unmöglich war - ihm vielleicht aber auch nur nicht mehr nötig schien? - seine „Bücher-Produktion“ - die inhaltlich zum wesentlichen Teil aus Selbstrechtfertigungen bestand! - fortzusetzen, währte seine „geistig zurechnungsfähig“ zu nennende Lebenszeit bis in die ersten Tage des Jahres 1889 hinein gut 44 Jahre, - während denen er viel Geschriebenes - als „Faktenlage“ für das, was ihm bedeutsam schien! - entstehen ließ. -
BevorN mit der Produktion seiner Schriften - die als philosophisch angesehen werden können! - begann ereignete sich in seinem Leben etwas, das zwar für Fälle wie dem Seinen typischerweise im Alter von ungefähr 17 Jahren zu geschehen pflegt, aber deshalb durchaus nicht als etwas „Normales“ anzusehen ist! - Wenn die ersten 17 Jahre aus der zeitlichen Rechnung zu seiner Schaffenszeit abgezogen werden, so verblieben N 27 Lebensjahre für seine - wie man voraussetzte! - „denkerische Tätigkeit“.
Als N fast 17 Jahre alt war, widerfuhr, ereilte, passierte ihm offenbarungsähnlich ein umfassender, grundlegender und anschließend durch keinerlei Kritik mehr anfechtbarer - somit irreparabler! - „Kenntnisgewinn“, welcher bei ohnehin schwierigen und wegen etlicher auf komplizierte Weise tollkühn übertriebenen underklärungsbedürftigen Eigenheiten, schwerwiegende Folgen für das „Welterlebnis“ des jeweils Betroffenen zeitigen kann und bei N auch gezeitigt hat! In einem unvorbereiteten und nicht jedermann mit dermaßener Wucht treffenden „Erklärt-finden“ von zuvor dunkel und geheimnisvoll gebliebenen Eigenheiten seiner Existenz stieß N in einer Buchhandlung in Nürnberg zufällig auf die „Essays“ des amerikanischen Schriftstellers - und unverantwortlich großspurigen Schwätzers! - Ralph Waldo Emerson, 1803-1882. Dessen ausschweifende Behauptungen und Formulierungen traten N im Sommer 1861 a) aus rein persönlichen Gründen, b) auf überwältigend neueWeise als für ihn zutreffend erlebt - und deshalb c) für sich selbst in ungeahntem Ausmaß als gültig anzusehen entgegen, weil ihm in diesen - scheinbar sehr speziell auf seine Existenz zugeschnitten! - und ihm überdies außerordentlich zusagend! - in nicht unerheblichem Umfang eine Fülle von ihn bevorzugenden „Wertungen“ zugänglich wurde!
Im weiteren Verlauf und bei zunehmend verstärktem Bedürfnis, sich aufgrund seines vorbildhaften Lebensgefühls philosophisch weltbelehrend zu betätigen - und zu bestätigen! - vollzog sich bei N - parallel zur geschehenen Prägung durch die Auslassungen Emersons! - der Prozess eines schleichend fortlaufenden „Verfalls“, einer „Enthemmung“, einer Abnahme und Auflösung seiner Fähigkeit, sicher unterscheidenzu können zwischen a) seinen Wünschen und Idealvorstellungen und b) dem Maß seines eigenen Ich! - gegenüber andererseits der - von ihm aus gesehen! - c) weit außerhalb seines übermäßig fest geprägten Selbstverständnisses liegenden - und ihm deshalb zutiefst fremden und ihm fremd bleibenden! - ihn aber genauso wie jeden anderen umgebenden „Wirklichkeit“ als die Welt um ihn her - zu deren Bewältigung er auf selbstgefährdende, weil hilflose Weise insofern mangelhaft gerüstet war, als es ihm - im Gegensatz zu den meisten „normalen“ Anderen! - nicht gelingen wollte, in dem nun einmal für jeden unabweislich bestehenden Spannungsfeld zwischen innen - seinem Ich! - und dem Außen, der Welt mit „den Anderen“! - verstanden als Lebenstüchtigkeit! - sich „vernünftig“, d.h. vorteilhaft und lebenserleichternd mit der Realität auseinanderzusetzen, sich zu orientieren und durchzusetzen - in dem und mit dem, was das Leben so bringt, - ohne dauerhaft ein großes, philosophisch anmutendes Spektakel darum machen zu müssen!
N war bis zu Beginn seiner geistigen „Umnachtung“, Anfang 1889, für sehr wenige - wurde aber nach dem deutlich gewordenen Ausbruch seines Wahns für sehr viele! - ein Interesse weckendes Phänomen! - Es ist viel über ihn geschrieben worden und hat sich deshalb um ihn eine uferlose Sekundärliteratur gehäuft. Man hat ihn interpretiert, rauf und runter, hin und her - je nach vorgefasster Meinung und mehr oder weniger weit gehender Bewunderung! Das waren und sind Meinungen über ihn.
Was aber sind bei und zu N die Fakten? - Als Fakten zu N kann nur das gelten, was von ihm selber stammt, also das, was er geschrieben hat und sich aus seinem Lebenslauf als unzweifelhaft geschehen ergibt: Das sind a) sein „Werk“, b) seine „Briefe“ sowie c) seine „Notizen“, die er sich in Hülle und Fülle, heute über 4.700 Druckseiten hinweg, machte: Dies a) um die vielen Einfälle nicht zu vergessen, die er sich „über sich selbst gegenüber dieser Welt“ leistete - und b) wie es mit dieser Welt - seiner Vorstellung nach! - bestellt sein müsste! - damit Er und die Dinge des Lebens überhaupt als ihn zufriedenstellend betrachten konnte! - Das allein sind Ns Fakten! - Was andere, die N nicht persönlich gekannt haben, über ihn geschrieben haben, gehört nicht dazu. Alles andere - wie übrigens auch jede Wahrnehmung dieser Fakten! - ist zwangsläufig Interpretation - und als solche mit fremder Subjektivität belastet! -
Für eine auf das wirklich „Sachliche gerichtete“ Darstellung Ns erscheint es ratsam, sich in erster Linie streng an das zu halten, was in dargelegtem Sinn als Fakten zu N zu gelten hat. Ergänzend dazu kann bedeutsam sein, was und wie er zeitgenössisch, von Menschen, die ihn persönlich kannten, beurteilt wurde, - samt dem, was ihm von Vorgängern und Zeitgenossen - am ehesten zu fassen in gelesener Literatur und den Briefen an ihn! - nachweislich zugeflossen ist. Unter diesen Voraussetzungen geht es in dieser Darstellung nicht darum, N thematisch zu deuten und dies mit entsprechenden Zitaten zu unterlegen, sondern hier wird - anders herum! - ausgehend von dem, was er selber - zumeist über sich! - geschrieben hat - aufgezeigt, - so, wie er gesehen werden wollte - und wie er zu sehen war und ist! - In seinem Wahn und seiner Wirklichkeit.
Vom Prinzip her ließe sich eine Schrift über N in diesem Sinn - wenn man denn so etwas wie die Notwendigkeit einer „Beweisführung“ außer Acht lassen würde! - um mehrere Zehnerpotenzen kürzer fassen, als sie hier geraten ist - so kurz letztlich, dass beinahe ein Satz genügen würde, um zu erklären, dass es sich bei Ns Eigenheiten - und somit auch bei seiner Weltanschauung und deren „Gültigkeit für die Anderen“! - um einen in vielerlei Hinsicht weit außerhalb der Gauß‘schen „Glocke statistischer Normalverteilungen“ stehenden Charakter oder auch „Fall“ gehandelt hat und seine „Philosophie“ folglich eine entsprechend „verzerrte“ Weltsicht - allerdings als NsNormalität! - ausbilden musste und er somit weniger als ein philosophisches, sondern vielmehr als ein psychologisches Problem zu betrachten ist! - Mit dem fundamentalen Unterschied, N nicht als einen aufgrund von fundierten Erkenntnissen mächtig Entscheidenden, sondern infolge hilf- und haltloser Überforderung in unverstandenen Gegebenheiten und Zusammenhängen durch das Leben Getriebenen darstellen zu müssen, - um den vorliegenden Fakten gerecht zu werden.
N als Philosophen zu begreifen setzt voraus, dass sein Philosophieren entsprechend abendländischen Erwartungen und ungeschriebenen, aber allgemein nachvollziehbaren „Grundsätzen“, innerhalb der zu seiner Zeit geltenden „geistigen Infrastruktur“ auf durchgehend logisch vollzogenen Überlegungen beruhen würde. Dem ist, wie sich zeigen lässt, bei N absolut nicht so: Es gibt in seinen Aussagen und Stellungnahmen zu viele logische, ja geradezu schizophren anmutende, unaufgelöste und unauflösbare Brüche und Widersprüche zur ihn umgebenden Realität, denen mit einer „normal“ reagierenden Logik nicht beizukommen ist. Um solche Problemstellen aufzulösen ist N als psychologisches Problem in das Feld der Betrachtung zu stellen. So, wie die für N Begeisterten ohne viel nachzufragen von einer seit eh und je mit zweifelhaften Fehl-Interpretationen belasteten Deutung dessen ausgingen, was N geschrieben hatte - ihn also in seinem Sinn zum „Nennwert“ nahmen und dabei des Glaubens waren, dass es - wie einem deutschen Philosophie-Professor anlässlich seiner in seliger Ahnungslosigkeit z.B. über den wahren Einfluss von Emerson auf N, noch zum 100. Todestag von N, möglich schien, er hätte dem angeblich „großen, ungeheuer modernen Denker beim Denken zusehen können“! - so musste auch er aus Ns Texten das herauslesen, was er zuvor in sie hineininterpretiert hatte und folglich zu einer N-Version verleitet werden, welcher die nüchtern zu betrachtenden Fakten nicht entsprechen: Dies aus dem einfachen Grunde, dass es bei und von N ein durch-, über- oder auch ernsthaftes Bedenken seiner Ansichten gar nicht gegeben hat beziehungsweise nicht gegeben haben kann!
Auf bestimmte Themenkreise bezogen sind in Teilbereichen gegen N bereits etliche Vorbehalte vorgebracht worden. Hier aber soll es nicht darum gehen, eine weitere Meinung über Ns „Denken“ mit angeführten Zitaten zu stützen oder beanstandend zu widerlegen, sondern darum, möglichst „engmaschig“ an den von N im Verlauf seines Lebens festzustellenden Fakten - also entlang an der im Original chronologisch entstandenen Reihenfolge seiner Äußerungen! - die jeweiligen seelisch-geistigen Ist-Zustände seiner Entwicklung erläuternd zu protokollieren und auf diese Weise zu erklären, mit welcher Konsequenz N beim Übertritt in seine schließlich gut 11½ Jahre währende „geistige Umnachtung“ zu seiner letzten, auf seine Weise „bis dahin logisch“ zustande gekommenen, auch nachvollziehbaren und deshalb als sein „Ziel“ zu betrachtenden, abschließend sich bedauernden und entschuldigenden, und dabei letzte Fakten schaffenden Aussage kommen konnte, die da unter dem Datum vom 6. Januar 1889 lautet:
„Zuletzt wäre ich sehr viel lieber Basler Professor als Gott; aber ich habe es nicht gewagt, meinen Privat-Egoismus so weit zu treiben, um seinetwegen die Schaffung der Welt[einer von ihm - im Sinn einer „Verbesserung“! - neu erdachten Gegenwelt!]zu unterlassen“.
Allerdings hatte N bei dieser Aussage „des letzten Momentes“ übersehen, dass gerade sein „Gott“-Sein sein eigentlicher „Privat-Egoismus“ gewesen war! Und dieser „Privat-Egoismus“ hatte aus dem philosophisch erscheinenden Versuch bestanden, sich eine neue, ihm selber besser passende Welt auszudenken und diese begründen zu wollen! Mit dem von N selber gesetzten „aber“ lassen sich gut und gerne meine gut 3000 Seiten umfasenden Einwände gegen das bisherige N-Bild verstehen und begründen.
Die für ein solches Verfahren notwendigen „Beweisführungen“ ergeben sich in überzeugendem Ausmaß aus der Engmaschigkeit, mit der sie sich vorführen lassen. Das widerspricht jeglichem Bemühen, sich zu Ns Fall kurz zu fassen. Je häufiger die Umstände auf seinem Lebensweg sich gleichartig zeigen, umso eher ist davon auszugehen, dass sie sich in nennenswerter Bedeutsamkeit als zutreffend erweisen. Von der Faktenlage ausgehend, läuft die Betrachtung von N darauf hinaus, ihn nicht als ein philosophisches, sondern in erster Linie als ein psychologisches Phänomen und Problem zu behandeln. N war einerseits ein geistig durchaus begabter, zugleich in erheblichem Maße aber auch ein intellektuell schwer behinderter Mann, was über die hier bloß gemachte Aussage hinaus zu beweisen sein wird: - kontinuierlich durch sein gesamtes Schaffen hindurch! - um darzulegen, was an der darstellerisch überzeugenden Form der Abwegigkeit seiner Gedanken „dran ist“, - schließlich sind ihm Offenbarungen „gelungen“ und unterstellt worden, die für die Menschheit von grundsätzlicher Bedeutung sein sollten oder gar hätten sein müssen und auf barbarische Weise letztlich solche auch hatten, indem seine defekte „geistige“ Rücksichtslosigkeit auf den Flügeln seiner „Logik“ den ungeheuerlichsten Seiten im Menschen „moralisch vertretbare“ Tore öffnete! Die Aussage, dass N ein Fälscher, ein Betrüger, ja, ein Verrückter und als solcher auch ein Verbrecher war, ist an sich nicht neu: Nötig ist dazu nur, diese Tatsche in seiner leiblichen und vor allem „geistigen“ Biographie als durchgehend gültig nachzuzeichnen; schließlich bot N einen nicht unwesentlichen Anlass für das, wohin das Verhängnis, ihn als Philosophen und seine Auslassungen für Philosophie zu nehmen, zwangläufig führen musste: In eine unzivilisierte Barbarei, wie sie als bestimmender Zug des „Nationalsozialismus“ von Deutschland ausgehend auf die Welt angewandt worden ist: Entweder ist jemand ein Philosoph oder ein Verrückter, aber die Aussage „verrückter Philosoph“ umschreibt nichts als die Blindheit oder gar die Dummheit des Betrachters. Auch für N gilt, wie sorgsam Ideologen mit ihren wahren Antrieben hinter dem Berg zu halten haben, wie sehr sie beschönigen und wieviel sie verschweigen müssen, weil sie in ihrem eigenen Untergrund um die Unhaltbarkeit und die mannigfache humanitäre Mangelhaftigkeit ihrer Ziele für die Allgemeinheit wissen oder doch zumindest eine nicht vollends zu verdrängende Ahnung um diese haben; - was allerdings nichts vermag gegen die bedenkenlose Suchtstärke ihres Geltungsbedarfs.
In einem Magnetresonanztomographen - das ist ein umfangreiches bildgebendes Gerät vor allem zur medizinischen Diagnostik - werden aufgrund von starken Magnetfeldern im Radiofrequenzbereich in unterschiedlichen Gewebearten bestimmte Atomkerne angeregt, wodurch es - ohne den Patienten zu gefährden! - möglich wird, von ihm an jeder beliebigen Stelle, meist scheibchenweise, einen Querschnittseinblick in den Zustand der vorgefundenen Knochen und Organe seines durch das Verfahren unversehrten Körpers zu gewinnen. In übertragenem Sinn wird mit dem, was N geschrieben hat, in dieser Arbeit auf eine ähnliche Weise verfahren: Aus „in dünnen Scheiben“, d.h. hier in zeitlich nah beieinander liegenden überlieferten Texten werden - engmaschig! - signifikante Merkmale hervorgehoben und in diesen Ns „geistiger Zustand“ in allen Phasen seines Lebens erkennbar! Dazu kam bei ihm eine prinzipiell auffällige - von ihm stets unbewusst! - aber als absolut empfundene! - und von daher mit allen Konsequenzen maßlose - Überzeugtheit davon - als der überhaupt Einzige! - das einzig Richtige zu denken oder zu tun; - was einen grundlegenden und nicht behobenen Defekt in seiner geistig-seelischen Entwicklung offenlegt und anlagebedingt auch die Voraussetzung dafür war, dass es bei dem 17-jährigen zu seiner - nach ihrer lebenslangen Dauer als auch wegen ihrer unkritischen Intensität als unbedingt pathologisch einzustufenden „Infektion“ mit Emersons Thesen, vornehmlich aus dessen 1858 auf Deutsch erschienenen 20 „Essays“, überhaupt kommen konnte.
Ein solches Vorgehen ermöglicht zu jedem Satz von N relativ verlässliche Einblicke in die Art und Weise, wie seine Aussagen zustande kamen, d.h. wie er die Welt gesehen, wahrgenommen, empfunden, „verstanden“ und gedeutet hat - folglich auch hinsichtlich seiner „Ergebnisse“, in Abhängigkeit davon, welche - eigentlich allgemeinverbindlich zu verstehenden - Worte er wählte und diese zu „Objekten“ seiner „Philosophie“ geworden sind: - Dies zumeist mit ästhetizistischem Anstrich, d.h. bewertet nach „greif-“ oder gar „messbaren“ Eigenschaften, wie Seltenheit, geschmacksbedingte Schönheit, Wohlgefälligkeit, Vorbildlichkeit, Nutzen oder was auch immer; - alles danach, wie es sich ihm - emotional jedenfalls! - als mehr oder weniger ansprechend oder auch abstoßend erwies. Nicht, was er gemeint haben könnte zählt dabei, sondern welche Worte er benutzt hat, bestimmt den Gehalt seiner Aussagen. - Danach beurteilte er, was ihm Nutzen oder Nachteile verschaffte, - nicht nur für ihn selber! - sondern in Projektion auf die Welt, weil sich in diesem Maßstab seine eigene Bedeutung am zufriedenstellendsten empfinden und auskosten und jeweils zu superlativen Feststellungen kommen ließ: - Denn er liebte es, in größtem Stil Festsetzungen zu treffen - auch, um sich im Rahmen einer nicht unerheblichen Selbstherrlichkeit an diesen - und keinen anderen! - orientieren zu können! - Seine Äußerungen ergeben ein recht authentisches Erscheinungsbild dessen, was er in seiner bis zum Autistischen veranlagten Auf-sich-selbst-Bezogenheit darstellen wollte und konnte. In seiner extremen Bezogenheit auf sich selbst war ihm anlagebedingt eine angemessene Wahrnehmung „der Anderen“ erschwert bis sogar unmöglich gemacht, - obgleich „diese Anderen“ - allerdings außerhalb seines übertriebenen Icherlebens und deshalb für ihn so gut wie nicht erkennbar oder nachvollziehbar! - nach allgemeiner Logik so realistisch existierten wie er selbst und zwar in absolut gleichwertiger Stellung zu ihm - was er nie begriffen hat und auch nicht wahrhaben wollte!
In dieser für N selbst nicht durchschaubaren Konstellation seines Empfindens und Welterlebens - von reflektierender Durchdringung dieser Zusammenhänge konnte keine Rede sein! - hat Ns durchaus pathologisch zu nennende, aus vielen seiner Aussagen herausleuchtende übertriebene Auf-sich-selbst-Bezogenheit dazu geführt, sich absolut unausgewogen und überbetont als in jeder Beziehung einzigartig zu erleben: In einem Gefühl, von dem sein gesamtes Denken und Handeln getragen war - einschließlich sein Bedarf und Zwang zur und sein Leiden an der Einsamkeit und der Vereinsamung! - obgleich er realiter von „den Anderen“ - und dies in ebenfalls übermäßiger Weise! - von ihnen innerlich abhängig war! Dieses ihm letztlich schicksalhaft aufgezwungene Empfinden hatte er in Einklang zu bringen mit einem ihm ebenfalls aufgezwungenen Bedürfnis nach Vorbildlichkeit, - und für all das bedurfte es zu seinem „intellektuellen“ Wohlbefinden berechtigter Begründungen, dass er sich „des Ganzen“ - zumindest aber doch in der Form seiner eigenen „Philosophie“! - sicher war! Die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Fakten zeigen den gesamten und damit annähernd „wahren“ N - einfach aufgrund der Tatsache, dass sich über das Vorgelegte hinausgehend kaum etwas dem Widersprechendes bei ihm in gleicher Gewichtung findet! -
Besonders deutlich wird dies - in oft überzeugender Ausführlichkeit sogar! - an den - sich am ehesten offen und frei zeigenden, nicht von ihm selber veröffentlichen Nachlass-Notizen, in und mit denen er sich in seiner überschäumenden Bezogenheit auf sich selbst - gewissermaßen in Selbstgespräche vertiefte! - von niemandem gestört, „vertraulich unter sich“ und dies in vielen Fällen oft Jahre vor der veröffentlichten Preisgabe seiner „Einsichten“, welche ihn lange in Berücksichtigung altüberkommener Hemmungen veranlassten, schon Worte zu finden für Einfälle, die er sonst - sehr auf sein Ansehen bedacht! - sich mit Resten von Realitätssinn doch lange zu verkneifen verstand. Es fehlte N an kreativen Zweifeln an sich selbst und der Fähigkeit Neues zu denken. Deshalb blieb er zumeist in rabiat betriebenen Umwertungen von uralt Bekanntem stecken.
Weil N das im Laufe der vorüberziehenden Jahre fließend und fortlaufend sich enthemmende Geschehen seiner „geistigen Verfassung“ und seine Beschäftigungen - vor allem mit sich selbst! - als seine Selbstverständlichkeit erlebte und sein Werk sich nicht auf überzeugende Weise nach abgrenzbar schwerpunktbestimmenden Themenkreisen strukturieren lässt, bietet bei ihm vor allem der zeitliche Ablauf auf anschauliche Weise die bestmöglich erhellende Struktur für das Verständnis von Ns Leben, in dem es ihm - lebenslangeben! - darum gegangen war, sich als einen großen philosophischen Denker und Kenner von allem und jedem in unterschiedlichsten Zusammenhängen, Deutungen, Sinngebungen und Erfüllungen darzustellen und zu profilieren.
Die Fakten zu allem, was einmal Ns tatsächliches Leben als eine mehr oder weniger harmonisch von ihm erlebteEinheitausmachte, stecken heute - soweit sich davon etwas Geschriebenes zuverlässig und verbürgt erhalten hat! - in konzentrierter Form und damit insgesamt auf wenig übersichtliche Weise! - in den in sich geschlossenen Bücherfolgen a) seines „Philosophierens“, d.h. in dem, was er als seine Werke veröffentlicht hat; b) in seinen Notizen, die er sich zu dem, was ihm so im Kopf herumging und ihm wichtig schien, machte; und c) in den von ihm geschriebenen Briefen; sowie - nicht zuletzt - d) in den Briefen, welche er erhielt; - dazu noch in dem, was e) andere irgendwo in seiner auch entfernteren zeitgenössischen und persönlichen Umgebung ausreichend begründet über ihn dachten und notierten. - All das ist enthalten in 5 völlig voneinander getrennten, jeweils von Anfang bis Ende parallel nebeneinanderstehenden vielbändigen Buchreihen und ist für einen „normalen“ Leser nur mit unvertretbarem Aufwand wieder in einen chronologischen Zusammenhang zu bringen! -
Um einen Überblick über das Fakten-Material zu geben zeigen die folgenden Zusammenstellungen den Umfang, um den es sich jeweils handelt:
1.Die von N selbst veröffentlichten bzw. dazu vorgesehenen Werke
in der von Giorgio Colli und Mazzino Montinari im Verlag de Gruyter herausgegebenen
„Kritischen Studienausgabe“ (KSA):
2.Die von N gemachten, nicht veröffentlichten Notizen, die sogenannten
„nachgelassenen Fragmente“ im Rahmen der KSA:
3.Kommentare dazu:
4.Dazu das, was aus Ns Kindheit und Studienzeit schriftlich erhalten blieb, in der
nach während der NS-Zeit, 1940 mit Band 5 abgebrochenen
„Historisch-kritischen Gesamtausgabe“ der Werke und Briefe Ns
beim Verlag C. H. Beck, BAW1 bis BAW5 genannt:
5.Ns Briefe der Jahre 1850 bis 1889 in der Kritischen Studienausgabe KGB
im Verlag Walter de Gruyter:
6.Dazu die Briefe an N:
7.Kommentare zu den Briefen:
Daneben gibt es zusätzlich eine Flut von diversen Einzelveröffentlichungen, um nur die N zeitlich und dieser Arbeit inhaltlich nahestehendsten und umfangreichsten zu nennen:
Carl Albrecht Bernoulli: „Franz Overbeck und Friedrich N, eine Freundschaft“, 2 Bände; Erich F. Podach: „Gestalten um N“; Sander L. Gilman: „Begegnungen mit N“; Lou von Salomé: „Lebensrückblick“ und „Friedrich N in seinen Werken“; Paul Deussen: „Mein Leben“ und „Erinnerungen an Friedrich N“; Franz Overbeck: „Erinnerungen an Friedrich N“; Meta von Salis: „Philosoph und Edelmensch, ein Beitrag zur Charakteristik Friedrich Ns“; Resa von Schirnhofer: „Vom Menschen N“; und darüber hinaus wichtig: Pia Daniela Volz: „N im Labyrinth seiner Krankheit“; sowie viele Zeitungsartikel, mehrere Bände Emerson und so fort. - Die für die vorliegende Betrachtung herangezogenen sind in der Bibliographie aufgeführt.
Für die hier vorgelegte Arbeit über N waren die Mosaik-Splitter der zeitlich zusammengehörenden „Fakten“, welche in den von a) bis e) aufgeführten, insgesamt 7 „Informationsblöcken“ enthalten sind, herauszulösen, um den von N einmal durchlebten chronologischenZusammenhangwiederherzustellen, damit über seine Befindlichkeiten zu jedem Zeitpunkt seiner Existenz - alsEinheit aus allen Quellen! - ein umfassendes und zugleich neuartig zurückblickendes Bild gegeben werden kann: Nicht nach Problemkreisen geordnet, sondern so, wie es in seinem Lebens-Verlauf zustande gekommen war! - Es geht hier nicht um eine interpretierende Meinung über den möglichen oder unmöglichen Philosophen N, sondern er soll sich in wesentlichen Aussagen aus erster Hand selber beschreiben, erzählen und dokumentieren, „wie es damals war“! - Erklärungen zu den Details und den Gesamtzusammenhängen der jeweils vorliegenden „geistigen Positionen“ werden, wie schon im Zitat der frühen Brockhaus-Information über N, innerhalb von eckigen Klammern [in diesem Schrifttyp!] angeführt.
Dabei war es - zumeist aufgrund psychologischer Gesichtspunkte! - notwendig, zum Teil sehr weitgehend auf Details einzugehen. Das hat den Umfang der gesamten Betrachtung des Phänomens N in den nicht so ohne weiteres zumutbaren Umfang von über 3000 Seiten getrieben. Die von vornherein nicht gegebene Einsicht, was für den „Normalverbraucher“ zu viel sein möchte und ohne dass irgendwo festgeschrieben sein kann, wo welcher Leser seinen Schwerpunkt des Interesses gesetzt sehen möchte, legten es nahe, das Gesamt-Angebot organisatorisch so zu präsentieren, dass sich die aufdrängenden Aussagen zum Thema N für jeden - zumindest streckenweise! - je nach individuellem Belieben auch „diagonal überfliegen“ lassen und doch immer wieder problemlos in die gelieferten Details eingestiegen werden kann, ohne das Verständnis für den Gesamtzusammenhang zu verlieren.
Die oben aufgeführten, jeweils für sich stehenden Textblöcke enthalten die unumstößlichen Fakten zu dem, was N - jeweilszu einer bestimmten Zeit! - als seine Ansicht und „Wahrheit“ aufgeschrieben beziehungsweise veröffentlicht hat! Schlüsse aus diesen Fakten - welche aus der Zeit ihrer Entstehung heraus sinngemäß, weil N seine immer auf Ewigkeiten angelegten Ansichten gelegentlich wechselte, nicht ohne weiteres auf eine andere Zeit im Leben Ns übertragbar sind! - erlauben - im Gegensatz zu meistens sehr genau messbaren naturwissenschaftlichen Fakten! - nicht ohne weiteres eine Beurteilung auf richtig oder falsch. Im Zusammenhang mit geisteswissenschaftlichen Fragestellungen liefern Aussagen - die zwangsläufig und dies sogar oftmals mehrfach! - auf subjektiv beeinflusstenInterpretationen und nicht aufmessbaren „Wertungen“ beruhen - allenfalls über statistisch gehäufte Übereinstimmungen beweisähnliche Ergebnisse zur wahrscheinlichen „Richtigkeit“ der gezogenen Schlüsse. - Zumeist zählt, wirkt, gilt und liefert bei geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzungen die bessere, geschicktere „Argumentation“ - auch im Zurechtbiegen von Argumenten - worin N ein Meister war! - die Akzeptanz tragfähiger allgemeingültig sein könnender Wahrheiten; - welche solches letztlich gar nicht zu sein brauchen! - um als allgemeingültige Ansichten zu wirken. Für solche Art „Akzeptanz“ stellt N selbst ein beredtes Beispiel dar.
Bekanntlich bedeutet der Begriff „Philosophie“ - von den Griechen zusammengesetzt aus „philos“, dem Freund und „sophia“ dem Wissen - so viel wie „Weisheitsfreund“: „Liebe zur Weisheit“, - zum Verständnis und zur geistigen Durchdringung von Erleben - nicht nur des einen, eigenen Selbst! - also dem, was das Leben in seiner Vielfältigkeit ausmacht! - N hat viel davon gesprochen, dass Er seine „Philosophie“ leben würde, aber er sprach nicht von geistiger Durchdringung sondern zumeist von den weit instinktiveren, das Ganze auch ohne gedankliche Leistung ausmachenden Gefühlen, weil er aus diesen „Philosophie“ zu machen versuchte und von daher dem Eindruck unterlag, dass er seine philosophischen Einsichten in ein philosophisch geprägtes Leben übersetzen würde, obgleich genau dies umgekehrt den Tatsachen entsprach: Wahrheit und damit „Philosophie“ war für N immer das, was seine Gefühlslagen und Fähigkeiten ausmachte, denn „sophia“ bezeichnete ursprünglich jede Art Fertigkeit oder Sachkunde, durchaus nicht nur geistiger, sondern auch handwerklicher sowie technischer Art, sofern aus deren Aufwand ein „Produkt“ entstand, das „zu überzeugen“ vermochte, - sonst dürfte der Begriff schwerlich von der Beschreibung einer bestimmten Art des Tuns „aufgestiegen“ sein zur Bezeichnung von Weisheit und Können schlechthin, - die ja auf vielerlei Weisen bis zur Frage nach der grundlegenden Beschaffenheit der Welt und des menschlichen Daseins dringt, aber vom Tun herkommend den wichtigen Anteil am Tatsächlichen, Praktischen, Realistischen und also eng mit „der Orientierung an der uns umgebenden Realität“, den aktuellen, gekonnten, beherrschendenBezugzurWirklichkeit, verbunden ist! - Das ist schließlich von nicht zu vernachlässigender Wichtigkeit, - speziell bei der „Philosophie“ Ns, die gerade in Bezug auf ihre Beziehung zu Wirklichkeit viel, wenn nicht so gut wie alles, zu wünschen übrig lässt! - Zumindest dies hatte N nicht bedacht, sondern sich der „Richtigkeit“ seiner ihn die Wahrheit „fühlen“ lassenden Vorstellungen von dem, was ihn jeweils erfüllte, überlassen.
In einem Fall wie N ihn darstellt - als psychologisches Problem betrachtet! - besitzt der - so weit wie möglich „engmaschig“ geführte! - Nachweis aufgezeigter „Schwachstellen“ von Ns gedanklichen, als „philosophisch“ gelten sollenden Leistungen und Produktionen im Sinn von „statistischen Häufungen“ eine besondere Bedeutung; - nämlich als Argument dagegen, dass sich die ergebende Darstellung nur a) durch geschickte Argumentation und b) auf gelegentlich Vorkommendes stützen würde! - Natürlich ist die hier gebotene Auswahl an Beispielen aus Ns Fakten auf unvermeidliche Weise subjektiv, aber sie wurde - rein mengenmäßig! - in Hinsicht auf das Ganze so ausgewogen und gewissenhaft betrieben, dass als sichergestellt gelten kann, dass durch eine andereAuswahl aus dem Vorhandenen, kein grundlegend anderes - und schon gar kein dem hier gebotenen widersprechendes! - Ergebnis hervorgebracht werden kann!
Um das Thema N zu einem vernünftigen und vor allem überzeugenden Abschluss zu bringen, genügt es nicht, zu sagen, dass N ein Verrückter war - was sich letztlich nicht von der Hand weisen lässt! - sondern es ist in seinem Schaffen kontinuierlich an möglichst vielen deutlich zweifelhaften Stellen seiner Ausführungen im Detail zu erklären, a) was es damit auf sich hat, b) wie es dazu kam und c) was sie in ihrem Gesamtzusammenhang und ihrem gesamten Erscheinen zu bedeuten haben.
Je „engmaschiger“ sich die „geistige Verfassung“ Ns aus seinen Gestimmtheiten und Ansichten nachweisen und erläutern lässt, umso mehr erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass es mit den dazu gemachten Angaben „etwas auf sich“ und somit wohl auch seine Richtigkeit hat. Diese Grundeinstellung N gegenüber hat dazu geführt, Ns Auslassungen möglichst umfassend kritisch zu überprüfen, vorzuführen und zu kommentieren! Das Verfahren hatte zur Folge, dem Umfang der vorliegenden Arbeit bedenkliche Ausmaße zu verpassen, so dass von Anfang an die Empfehlung ratsam erschien, die Betrachtung des Phänomens N so anzulegen, dass es dem Leser überlassen werden muss, wie „engmaschig“ er die Fülle des vorgelegten Angebots zu den Hintergründen von Ns Äußerungen aufnehmen, oder lieber teilweise überschlagen oder eben doch - je nach punktuellem Interesse! - bis in alle Einzelheiten hinein zur Kenntnis zu nehmen wünscht; - ganz nach des Lesers Belieben! Diese Arbeit ist darauf angelegt, dass je nach zu wählendem Schwerpunkt innerhalb des chronologisch gebotenen Ablaufs von Ns „geistiger und philosophischer Entwicklung“ - die übrigens kaum eine gewesen ist! - die kommentierten Fakten problemlos auch „diagonal“ durchgegangen oder sogar übergangen werden können, um an Punkten vertieften Interesses ohne wesentliche Verluste im Verständnis des Ganzen an beliebiger Stelle gleichsam wieder einsteigen zu können. So dürfte der jeweils eigenen Interessenlage des Lesers am gewinnbringendsten entgegengekommen sein, zu dem Preis allerdings, dass es notwendig wurde, einige Kommentare mehrfach anzuführen. Das möge in Hinsicht auf die Gesamt-Absicht als entschuldbar gelten.
Die erläuternden Hinweise auf Zusammenhänge, die bei dieser Zusammenstellung sichtbar werden, gewähren neue Einblicke und Einsichten, welche den „Philosophen“, sein Werk - mitsamt seinen bei weitem nicht immer ehrlich und frei geäußerten Absichten! - zwangsläufig in einem völlig veränderten Licht erscheinen lassen. Dies besonders bei einer Figur wie N, welcher dem gelebtenMoment stets übermäßig verhaftet, wenn nicht gar diesem jeweils ausgeliefert war - bei dringender Berücksichtigung seiner teilweise steil schwankenden spannungsreichen bipolaren Unausgeglichenheit zwischen Manie und Depression in wechselnden Stimmungen, die ihn schließlich in so elitäre Höhen trieben, dass er zu erwägen meinte, doch „sehr viel lieber Basler Professor als Gott“ 6.1.89 zu sein! - denn das war seineWirklichkeit, sonst hätte er sich nicht auf diese Weise geäußert oder sogar überhaupt so äußern können! -
Die - wie hier gezeigt - in deutlich abgesetzter Schriftform und jeweils zwischen eckigen Klammern unmittelbar in vor allem Ns Texte eingeschobenen Kommentare sind darauf angelegt, dem Leser Hinweise auf die überall unsichtbar im Hintergrund wirkenden Zusammenhänge, eigentlichen Bedeutungen, Beziehungen zu anderen Textstellen, sowie zu Erinnerndes in möglichst kurz gefassten, im Text mitfließenden und dabei umständliche Fußnoten oder außerhalb angebrachte Ausführungen vermeidende Orientierungshilfen zu geben und ihn nicht vor persönlich bedingten, oft nur zeitbedingt hingeworfenen Fachbegriffen, Namen, Sprichworten und Zitaten einfach ahnungslos sitzen zu lassen und ihn stets bei zeitlichen Einordnungen mit Jahresangaben jeweils von-bis zu unterstützen.Insgesamt wurde keine Mühe gescheut, zu vermeiden, dass der Leser vor Fremdworten, Namen oder und undurchsichtigen Angaben ohne Hinweise hilflos sitzen gelassen wird.
An N lässt sich - wie anderweitig selten so gut! - sehen, erleben, erkennen, wieso Philosophie immer auch - mehr oder weniger vordringlich! - wie denn auch sonst, da sie immer unweigerlich an ein Individuum gebunden sein muss, um in Erscheinung treten zu können! - jeweils also höchst individuell und subjektiv gefärbt angelegt und geprägt ist - und damit zwangsläufig auch persönliche Interessen vertritt! - Das gilt, je mehr jemand sich ausschließlich aus sich selbst heraus, - bei so gering wie möglich von außen kommenden Einflüssen wie bei N! - im chaotisch wirkenden Weltgetümmel um ihn her zu orientieren sucht! - Überdies galt es gründlich zu überdenken, inwieweit es sinnvoll ist, die angeführten Originalstellten im direkten - und dabei am intensivsten wirkenden! - Wortlaut vorzustellen: Mit dem Schluss, dass nur die möglichst wenig beschnittenen Originaltexte Ns die verlässlich grundlegende Ausgangsbasis abgeben kann, um zu einem möglichst „wahrheitsgemäßen“ Portrait von N gelangen zu können. In diesem Bestreben musste die Arbeit - wie bereits angedeutet! - unvermeidlicherweise weit umfangreicher ausfallen als vorgesehen war und vielleicht auch nötig wäre, - was aber dadurch ausgeglichen wird, dass es dem Leser freisteht, in welchem Umfang er das Gebotene bei voller Aufmerksamkeit zur Kenntnis nehmen möchte. - Zu vermeiden war, dass zum Thema N die Meinung des Autors in den Vordergrund tritt, wo es doch immer darum gehen musste, den Kern von Ns Absichten in ein ausgewogenes, d.h. mit ausführlichen Hinweisen versehenes Bewusstsein des Lesers zu rücken.
Es ist also bis zur Unhandlichkeit umfangreich geworden; - das ist immer wieder einzugestehen, aber für jedes vorgebrachte Zitat gab es eindrückliche Gründe, - insgesamt vor allem den, dass keine Zusammenfassung, kein Bericht, keine Beschreibung, dass N dies oder jenes vorgebracht hätte, so eindringlich und überzeugend wirken kann, wie die Originalaussage! Als „Gegengabe“ sei entlastend versichert, dass eine unglaubliche Masse aussortierter, nichtgebrachter, gestrichener und als nicht so wichtig zu erachtender Aussagen Ns dem Leser in dieser Übersicht über Ns Wahrheit erspartund vom Halse gehalten wurden und er auf diese Weise von der auf eigene Faust hin gar nicht so leicht zu erbringenden Mühe der Auswahl und Ausdeutung verschont bleiben kann. - Das hat für den Leser immerhin als eine enorme Erleichterung beim Zur-Kenntnis-Nehmen der Bedeutung Ns als eine erhebliche Zusammenfassung und Kürzung des zum gesamten Themenkreis gehörenden Materials zu gelten!
Viele unterschiedliche Gründe gaben Veranlassung aus den zum Thema N vorliegenden Textbergen auszuwählen, was für das heutige Interesse an N und das Verständnis für N von Bedeutung sein könnte und müsste: Mal waren es nicht unbedingt zwingend erscheinende aber auffällige Wiederholungen, die bei ihm auf vorliegende bedenkliche Zwänge verwiesen; - mal waren es psychologisch verdächtige Formulierungen; - mal die bloße Wortwahl, hinter der sich Ungereimtes oder zu Verbergendes, unbedingt jedoch Aufzudeckendes verbirgt; - mal war es das für N Typische der Zusammenhänge mit Verweisen auf seltsam aufgenommene, fragwürdig scheinende Außenbezüge und mal - dies besonders oft, fast regelmäßig sogar! - waren es Hinweise darauf, dass es N statt um Gedankliches vielmehr eindeutig um den Ausdruck und die Schilderung von erlebt Gefühltem ging und oft war es einfach nur das Was und Wie N seinen nicht durchdachten Umgang mit Selbstverständlichkeiten, die absolut keine sein mussten, auf erschreckende Weise zu erkennen gab! - Zu dem also, was sich unter diesen Gesichtspunkten - nicht ohne zwangsläufig eine gewisse Subjektivität ins Spiel zu bringen! - zum aufmerksam gewordenen Heranziehen empfahl, gab es immer wichtige und für N typische Anlässe, das Ausgewählte zwecks eindeutiger Demonstration des „eigentlichen N“vorzuführen! So schwollen die meisten - für gewöhnlich jeweils ein Jahr seines erwachsenen Lebens umfassenden - Kapitel auf die dem einen oder anderen ungebührlich erscheinen mögende Länge. Bei der Auswahl von Briefen an N wurde aus der Fülle des Vorhandenen ausgewählt und zitiert, was N nachvollziehbar beeinflusst haben dürfte beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Zusammenhänge dienlich schien.
In seiner durchgehend unreflektierten Distanzlosigkeit zu sich selbst war N ein extrem typischer Vertreter des nun einmal in seiner Existenz - mittels Individuen! - von Grund auf selbstmittelpunktlich organisierten „Lebens“. Wo Er war, war nicht nur für ihn, sondern seiner Meinung nach überhaupt „oben“. N strotzte nur so von im Grunde ungebildeter, eben undistanzierter, intellektuell rücksichtsloser „Selbstmittelpunktlichkeit“, die ihn immer wieder dazu verführte, sich zum „Maß aller Dinge“ nicht nur zu nehmen, sondern zu machen und er hatte dabei - in seinem Weltenplan! - immer Recht:Er war das Recht! Und „alle Anderen“ waren weit entfernt von diesem! Daran gab es für ihn nur in sehr seltenen Ausnahmen einen meist auch nicht lange anhaltenden Zweifel! Aus diesem Grund konnte er mit und in allem, was er als letztgültige Wahr- und Weisheit von sich gab, dies immer nur für den Augenblick seiner eigenen Existenz in der jeweils zugehörigen Stimmung erlassen und akzeptieren! - Nichts außer diesen Grundsätzen war an N dauerhaft. Man darf deshalb Aussagen von ihm aus der einen Zeit nicht pauschal und bedingungslos auf ihn selbst zu einer anderen Zeit „als noch gültig“ anwenden! - denn „da galt es - zumeist schon! - nicht mehr“. Bei ihm war alles „im Fluss“! Von daher waren der „Halbwertszeit“ all seiner im Moment immer auf „Ewigkeiten“ erpichten Gültigkeiten außerordentlich enge Grenzen gesetzt. Was scherte ihn - nach relativ kurzer Zeit schon! - sein „Gewäsch von gestern“, da er doch stets - und das intensiv! - in dem und für den Augenblick lebte - der allerdings schnell und allzu oft inzwischen ein anderer geworden war.
Dass N in dem, was er als Philosophie produziert sehen wollte, voller Widersprüche stecken würde, ist ein Mythos und als solcher auch ein gern angenommenes Mittel gewesen, ihn geheimnisvoll und damit „interessant“, vielseitig, gar umfassend, sprich „über eine einfache Erklärbarkeit erhaben“ zu erhalten. - Diese Ansicht bildet sich schließlich erst im Auge des Betrachters. N war, trotz allen Absonderlichkeiten, ein Mensch und an diesem kann im Vergleich mit „den anderen Menschen“ nichts dermaßen anders und unerklärlich sein, als dass es sich bei der Wahl einer angemessenen „Perspektive“ nicht als „in sich schlüssig“ erklären ließe! Der diesen Eindruck veranlassende Fehler beruht vornehmlich darauf, N philosophisch zu nehmen, da bei ihm - in Bezug auf die ihn umgebende Wirklichkeit! - nichts wirklich logisch ab- oder weitergeleitet ist. Was N geboten hat war von ihm Gefühltes, - psychologische Momente, die nicht über einen logischen Leisten geschlagen gehören. Die in diesem Sinn problemlösende Perspektive auf N - und nichts anderes wird hier bei einer Führung durch das psychologische Labyrinth der Fakten, die in Ns Texten stecken, in aller Ausführlichkeit unternommen! - ist es, die beiden wichtigsten Elemente für Ns „geistige Entwicklung“ herauszustellen: Das ist 1. die Bedeutung Emersons für Ns Werte-Vorstellungen nachzuweisen und 2. Ns Aussagen nicht als Philosophie sondern als Dauerversuche einer Selbstdarstellungen zu nehmen, weil seine wichtigsten beiden „philosophisch“ gedachten Grundlagen - die „Ewige Wiederkehr“ und der „Übermensch“ mit allem, was er daran gehängt hatte! - wegen ihres irrealen „Daherkommens“! - zur Bildung von philosophischen Kategorien heillos unzulänglich und ungeeignet sind, - was N zu seiner Zeit erschwerender Weise nicht bemerkt hatte! Dass es bei der Betrachtung von Ns Problematiken immer wieder auf das Gleiche hinausläuft, liegt am durchaus eng und kurzgeschlossen begrenzten Wesen Ns, das, einmal erkannt, sich unvermeidlicherweise als nicht sonderlich vielschichtig und abwechslungsreich erweist.
Die größte und auffälligste der in dieser Arbeit benutzten SchrifttypenzeigtOriginal-Texte von N,denn um diese und ihn geht es; - und es geht darum, dem Leser anhand dergroßen Schrifttypen, die manchmal auch hinderlich erscheinen könnenden kleiner gedruckten Kommentare,auf einfache Weise mit den Augen zusammenfassend überfliegen zu können, um Ns Auslassungen auch in einem[durch Kommentare ungestörten Zusammenhang]auf sich wirken lassen zu können.
Auf die Nachweise zur Herkunft der zitierten Texte wurde viel Wert gelegt, um dem Leser im gewünschten - evtl. auch nur kontrollieren wollenden - Fall den Nachvollzug des Vorgetragenen so leicht wie möglich zu machen. Seit den Erstauflagen von Ns Texten gibt es dermaßen viele weitere, anders gestaltete Auflagen des von ihm Verfassten, dass zu beachten war, die kleingedruckt angefügten Herkunftsangaben so allgemeingültig wie möglich zu gestallten. Bei den meisten von N verfassten Schriften, die vielfach aus durchnummerierten Aphorismen bestehen, genügt dazu „Werk-Kürzel.Aphorismusnr.“ anzugeben, - zum Beispiel FW.341, für die N so wichtige und unübertroffen gelungene Darstellung der Bedeutung seiner „Ewigen-Wiederkehr“ im 341. Aphorismus der „Fröhlichen Wissenschaft“.
Wo dieses Verfahren nichteindeutig wäre, weil N nicht durchnummerierte sondern nach Kapitel-Überschriften neue Zählungen benutzte, wurde mit „Bandnummer.Seitenzahl“ auf die heutzutage letztgültige, mit gleichlaufender Seitennummer auch im Deutschen Taschenbuch-Verlag erschienene und von jedermann zu günstigem Preis erhältliche 15-bändige „Kritische Studienausgabe, herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari“ im Verlag de Gruyter verwiesen. Bei den Briefen von und an N wurde als Kennzeichnung das Datum gewählt, unter Angabe von „Tag.Monat.Jahr“, so kurz wie möglich. Für ungenaue Angaben, wie z.B. Anfang des Monats steht 1, für Mitte 15 und Ende 30 oder 31. Für die zitierten Briefe von N wurden zudem (in Klammern) die jeweiligen Briefnummern angegeben, um anhand dieser den Leser erkennen zu lassen, wie viele Briefe zwischen den zitierten übergangen wurden. Zitierte Texte anderer Herkunft als von N werden „in diesem Schriftsatz“ geboten. Alles vom Verfasser Stammende findet sich durchgehend im Schriftsatz von „Times New Roman“. Zum problemlos leichten Verständnis dieser Abhandlung über N ist es deshalb wichtig, dass die technischen Voraussetzungen für die Darstellung von 3 deutlich voneinander unterscheidbaren Schriftarten auf dem verwendeten Lesegerät gegeben sind, damit der Leser, bei allem, was er zur Kenntnis nimmt, sofort erkennen kann, mit welchem Text-Urheber er sich jeweils auseinanderzusetzen hat, d.h., wer zu ihm „spricht“!
Bei der unvermeidlich subjektiven Auswahl von Zitaten wurde darauf geachtet, dass keines durch das Herausnehmen aus seinem ursprünglichen Zusammenhang eine Verfälschung erfuhr oder gar uminterpretiert wurde. Die Zitate sind deshalb stets mit ausreichend fairer Umgebung und auch wieder nicht „Text-vermeidend“ angeführt. Würde man selbst solche Art Subjektivität als unzulässig betrachten, bliebe dem geschätzten Leser kaum etwas anderes übrig, als den gesamten „Komplex N“ auf eigene Faust und eigene Kritikfähigkeit hin selbst durchzuarbeiten und auf die Inanspruchnahme der jahrelangen Vorarbeit, die für die Vorlage dieser Sicht auf N nötig und wichtig war - und sie hiermit, gleichsam als ein „Fertiggericht“ serviert zu bekommen - zu verzichten.
Fünf aufeinanderfolgende Punkte ….. bezeichnen in jedem zitierten Text - bei Wahrung der Fairness aber ohne Angabe von Gründen! - dass für den darzustellenden Zusammenhang als unwichtig betrachtete Worte, Sätze oder ganze Textteile übersprungen und beiseitegelassen wurden.Weniger aufeinanderfolgende Punkte sind für Ns Texte typisch, weil er sie, als „Satzzeichen“ gewissermaßen, benutzte, um den Leser zur Weiterführung seines „Gedankens“, d.h. dem, was er zur Kenntnis geben wollte, oder zur aufmerksameren Wahrnehmung von dessen besonderer Bedeutung aufzufordern, anzuregen oder auch nur dessen „Offenbleiben“ anzudeuten. Jede Art Wortbetonung drückt sich in kursiver Darstellung aus. Betonungen in Zitaten entsprechen, wenn nicht anders angegeben, grundsätzlich dem Original. Hervorhebungen im Text, egal wie sie in den Originalzeilen der einzelnen Zitate vorgenommen wurden, erscheinen kursivgesetzt. Hervorhebende Eingriffe in Zitate wurden grundsätzlich unterlassen. Es gibt textlich einfühlsamere und auch wirksamere Möglichkeiten, den Leser auf Wichtiges aufmerksam zu machen. Anpassungen an heutige Schreibweisen wurden vorgenommen, sofern sich dabei keine unerwünschten Bedeutungsveränderungen ergaben. Etliche nach damaligem Sprachgebrauch und Bildungsstand bevorzugte Fremdwörter wurden so gleichbedeutend aber auch der jeweils erkenntlichen oder auch nur vermuteten ursprünglichen Absicht entsprechend durch heute dafür geläufige und mögliche Ausdrücke ergänzt oder auch ersetzt. Lateinische Angaben wurden mit ihrer Bedeutung im Deutschen ergänzt, griechisch angegebene Worte nur übersetzt. Sollten Leser, die der jeweiligen Sprachen mächtig sind, dies stören, so seien diese gebeten, mit Rücksicht auf die nicht so sprachmächtigen Leser freundlicherweise das Vorgehen mit Nachsicht zu tolerieren. Es soll in dieser Arbeit niemand mit ihm unzugänglichen und ihm fremd bleiben müssenden Informationen behelligt werden. Orthographische und auch grammatikalische „Korrekturen“ und Anpassungen erfolgten nebenher, sofern sie nicht zu Veränderungen der sinngemäßen Textstruktur führten. Zur angenehmeren Lesbarkeit im Fluss der jeweils dargelegten Probleme wurden allerdings durchaus eigenmächtige Absatz-Gliederungen vorgenommen.
Mit Ns Briefen hat es eine auffallende, aber doch erwähnenswerte Bewandtnis: Sie sind alles andere als kommunikativ. N kam - beispielsweise nur! - in seltensten Fällen auf das zurück, was ihm brieflich mitgeteilt worden war: Es gab für ihn und mit ihm so gut wie keine brieflich geführten Dialoge. Er erkundigte sich in seltensten Fällen nach dem Ergehen und Befinden des Adressaten und sprach in aller Ausschließlichkeit fast nur von sich. In jedem Brief geriet er in einen neu ansetzenden Monolog, besonders in ein Sich-Ausbreiten über seine Leiden und kam dann erst dazu, von sich mitzuteilen, wie er - entsprechend der ihn gerade erfüllenden Stimmung! - gesehen werden wollte, - was nicht immer identisch sein musste mit dem, wie er sich selber sah! Vieles dabei war auf Effekte erpicht, was seine Briefe sehr intensiv, leidenschaftsvoll und engagiert erscheinen lässt. Er nahm alles sehr persönlich, sehr unmittelbar, sehr undistanziert - auch aus dem Grund, weil er über kaum etwas, das er mitteilte, auf abwägende Weise wirklich nachgedacht hatte: Vor allem galt alles Geschriebene im jeweiligen Moment für die Ewigkeit. Er teilte mit, was für ihn selbstverständlich war und woneben es nichts anderes gab und - seiner fortwährend ausschließenden Natur nach! - auch nichts geben sollte.
Er liebte es, brieflich ins Vertrauen zu ziehen, „unter uns“ etwas mitzuteilen, in Kumpanei, - besonders wenn er etwas ihn Bewegendes früh, lange bevor es im „Werk“ auftauchen würde, in einhellig vorausgesetztem Einverständnis verriet und Seelentiefen öffnete, - auch wenn er mit dem jeweiligen Adressaten sonst nicht viel „gemein“ hatte. In den Briefen ging sein Ich viel leichter und auch viel früher „mit ihm durch“ als er das Gleiche in seinen „Werken“ zu zeigen wagte, da er doch immer in Sorge um sein überschätztes „öffentliches Ansehen“ war und folglich offiziell die Zügel seines Wünschens straffer hielt, - was im Hintergrund auf ein - allerding immer ohnmächtigeres! - immerhin aber noch funktionsfähiges „schlechtes Gewissen“ verwies. Dieser Umstand lässt Zitate aus seinen Briefen besondere Bedeutung gewinnen, auch wenn N Veröffentlichungen aus seinen Briefen sehr übel genommen hätte, obgleich er selber erhaltene Briefe bedenkenlos weiterreichte, - was durch sein Zweierleimaß-Verständnis entschuldigt war, - auch wenn er schrieb:Aus meinen Briefen etwas abdrucken[also „den Anderen“ zur Kenntnis zu geben, was ja immer außerhalb der von ihm gesetzten und beabsichtigten Effekte geschehen musste!]rechne ich zu den großen Vergehungen. Das tut mir so weh, wie wenig Anderes - es ist der gröbste Vertrauens-Missbrauch.14.3.79 -
Doch wieso? Was wäre ein ausreichender Grund für diese empört schamhafte Empfindlichkeit? Von Einem just, der sich je nach Bedarf ansonsten doch in allerlei schriftlichen Ungeniertheiten gefiel und suhlte? Was beabsichtigte N mit diesem Tabu und „Verbot“? - In erster Linie war es seine Angst vor Kritik an seinem mühsam zurechtgelegten und vor sich selbst sorgsam „begründeten“ und als notwendig gerechtfertigt erscheinendemSein - und aller Wahrscheinlichkeit nach! - dürfte der Grund zumeist auch in Ns ausgeprägtem Verlangennach immer exklusiv ausfallender Vertraulichkeit und Verborgenheit seiner unüberschätzbaren Unvergleichlichkeit gelegen haben: Seinem „nicht gestört werden wollenden Bedürfnis“ nach einem ihm gefällig scheinenden Bild von sich selbst - gegenüber der Welt! - das er gewahrt und respektiert wissen und dieses mittels Zensur - dem Veröffentlichungsverbot nämlich! - auch durchsetzen wollte! - Zusätzlich war damit natürlich die Angst verbunden, dass ein kritischer Kopf ihm „auf die Schliche“ und hinter seine Masken, hinter die Täuschungen und Manipulationen, die Effekte und Zurechtbiegungen kam, die er in der Praxis nicht scheute!
Die von dem Extrem-Egomanen N immerhin doch empfundene, nicht unerhebliche Spannung zwischen dem, was er mit berechnender und berechneter Wirkung zur Kenntnis seiner zumeist eigentlich gar nicht akzeptierten Leser als Wahrheit über sich dargestellt sehen wollte, brauchte gegenüber dem, was er daneben aus peinlichen Gründen verborgen hielt, aber doch als für sich wesentlich erachtete, ab und an ein Ventil: Nämlich aus dem - auch seinem Herzen ab und an unvermeidbaren - Bedürfnis heraus in seiner nicht sonderlich glücklich erscheinenden Lebenspraxis und dieser nachgeben zu können, einfach mal unverstellt, „vertraulich“, verständnisvoll, Zuwendung und Nähe erwartend, Gelegenheit zu haben, sich ehrlich - eben „unter uns“, wie er das oft und als Auszeichnung gemeint, nannte - aussprechen zu können. Was aber in tieferem Sinn nicht unbedingt der Rolle entsprechen musste, die er darstellen wollte und deren Legende das gewidmet war, was er seine „Philosophie“ nannte.
Um das Schicksal, „unter dem er angetreten“ und um das „Gesetz“, welches das seine war und für gewöhnlich von ihm als unüberbietbar große Auszeichnung, als seine „Aufgabe“, - mit der Folge „für diese erwählt zu sein“ - empfunden wurde, war N, so, wie er veranlagt war, gewiss nicht zu beneiden!Niemand kann als Denker geltenwollen, bloß weil er sich danach sehnt einer zu sein! „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ Matth.7.16, so heißt es von uralt geschätzten Weisheiten her, welche - weil es solche waren! - Aufnahme in die Bibel gefunden haben! - und speziell diese daraus dürfte N nicht unbekannt geblieben sein! - selbstverständlich mit dem unmittelbar davor enthaltenen „Seht euch vor, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, innwendig aber sind sie reißende Wölfe“ Matth.7.15, - wie N selbst einer war! - denn sein