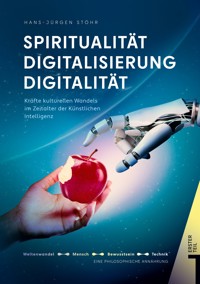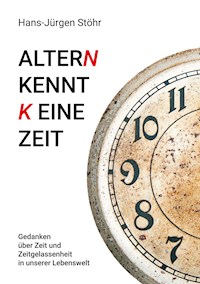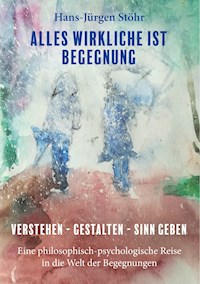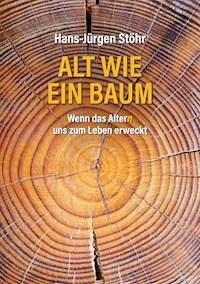
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alle wollen alt werden, keiner will es sein. Wir können dem Altern nicht entrinnen, und dennoch tun wir alles dafür, um ihm auszuweichen. Wird der Mensch das Wissen erlangen, seine Lebenszeit zu verlängern, das Altern aufzuhalten oder gar zurückzusetzen? Das Buch wirft einen Blick auf das menschlich Unverfügbare, das sich immer mehr zum Verfügbaren wandelt: das Altern. Die philosophische Annäherung ist auf Dialektik und Ethik begründet. Begriffsdiskurs, Lebenszeit und Resonanz sowie das Gute und der Sinn des Alterns bilden Teil 1 des Buches. Jungsein und Lebensreife, Egoismus und Fürsorge, Gewöhnung und Gewohnheit, Erinnern und Vergessen, Einsamkeit, Demenz und Scheitern spiegeln im 2. Teil das Alltägliche im Altern. Der Epilog greift aktuelle Frage der Altersforschung auf. Im Mittelpunkt steht die These: Altern ist eine Krankheit und setzt ich mit dem aktuellen Generationskonflikt zwischen Alt und Jung auseinander. Der langlebige philosophische Diskurs über Toleranz gibt den Lesenden einen neuen dialektisch begründeten Denkimpuls.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Enkelkinder Lea, Friedrich, Anne Lasse und Ole
Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden…
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Hermann Hesse (1877 – 1962) ∙ aus: Das Glasperlenspiel1
1 Vgl. u. a. H. Hesse: Mit der Reife wird man immer jünger. Betrachtungen und Gedichte über das Alter. Hrsg. v. Volker Michels, Insel Verlag, Taschenbuch 2311, Frankfurt a. M. und Leipzig, 1990, S. 87
INHALT
Vorwort
Einleitung ∙
Alter
n
sbegegnungen
Alter und Altern ∙ Eine philosophische Annäherung
Alter
n
∙ Was macht es philosophisch?
Alter
n
∙ Warum braucht es dafür
k
eine Zeit?
Alter
n
∙ Wie viel Resonanz steckt in ihm?
Alter
n
∙ Was ist das Gute daran?
Alter
n
∙ Was ist es uns wert?
Alter
n
∙ Begegnungen mit uns selbst
Alt werden – jung bleiben
∙ Macht das Altern immer jünger?
Älterwerden als Reisezeit
∙ Ist es egal, wie alt wir werden?
Altern in der Welt der Märchen
∙ Was sind ihre Botschaften?
Alter
n
ssorge
∙ Balance zwischen Egoismus und Selbstfürsorge?
Gewöhnung und Gewohnheit
∙ Macht Gewohnheit alt?
Allein∙und einsam
∙ Ist es eine Frage des Alter
n
s?
Erinnern und Vergessen
∙ Was ist, wenn wir beides (nicht) dürfen?
Demenz
∙ Geißel oder ein Geschenk des Lebens?
Im Leben gealtert
∙ Droht mit ihm auch ein Scheitern?
Epilog
Altwerden ∙ Geschenk der Natur oder gesellschaftlicher Luxus?
Alt werden war gestern
∙ Steht die Alter
n
sforschung vor einem Paradigmenwechsel?
Rebellion der Jungen
∙ Erwarten wir einen neuen Konflikt der Generationen?
Alt vs. Jung
∙ Was heißt tolerant sein?
Literatur und Empfehlungen
1000jährige Eichen ∙ Der Naturpark von Ivenack
Über den Autor
VORWORT
Jüngst gehörte ich zu jenen Baby-Boomern, die ihren 70. Geburtstag hatten. Richtig Lust auf dieses Jubiläum hatte ich nicht. Offensichtlich spürte ich, dass es jetzt anders werden würde. Dieser Geburtstag war das Tor ins achte Lebensjahrzehnt. Statistisch gesehen ist das für die Männer in Deutschland gegenwärtig das letzte Lebensjahrzehnt.
Vierzig, fünfzig und auch sechzig Jahre alt zu werden – diese Zeit habe ich souverän gelebt. Vom Altwerden war nichts zu spüren. So blieb diese Zeit meiner Geburtstage in guter Erinnerung.
Die Umstände brachten es mit sich, dass ich doch zur Geburtstagsfeier einlud. Bewegung auf der Bowlingbahn und gutes mediterranes Essen sollten diesem Tag das Besondere geben. Die Geburtstagsgeschenke nahm ich mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie vermittelten mir Botschaft, dass ich nicht mehr zu der mittleren, tatkräftigen Generation gehöre und vor einem „neuen Leben“ stehe.
Wilhelm Schmids „Gelassenheit. Was wir gewinnen, wenn wir älter werden“ (Insel Verlag, 2015); Rüdiger Dahlkes „Das Alter als Geschenk“ (Arkana, 2018) oder das Büchlein vom Verlag Coppenrath, 2008 „Das beste ALTER IST JETZT!“ waren Indiz dafür, dass ich in der Wahrnehmung meiner Gäste bei den Älteren angekommen bin.
Neben diesen zu Papier gebrachten geistig-kognitiven Alternsempfehlungen wurde auch an meine Neuroathletik gedacht, um mit ihr meine sportlichen Leistungen im Alter zu sichern oder gar zu verbessern (vgl. Lars Lienhard, Training beginnt im Gehirn, Riva Verlag, 2019). Die Einladung zur Paddeltour in die schöne Seen Flusslandschaft Mecklenburg-Vorpommerns war durchaus ein Willkommensgeschenk, denn Kanufahrten sind ja zu jeder Alterszeit gewinnbringend.
Das vorliegende Buch hat also sehr viel mit meiner neuen, altersbedingten Lebenssituation zu tun. Ich gehöre weder zu den Jungen noch zu den ganz Alten, auch wenn der Weg ins alternde Alter nicht mehr zu leugnen und aufzuhalten ist.
Das ist durchaus mit einer Katharsis vergleichbar, die den Weg vom Widerstand mit einer inneren, im Unterbewusstsein angelegten Annahme eines unumgänglichen Altwerdens hin zu dessen Bewusstwerdung zeichnet. Keiner kommt an diesem Sinneswandel vorbei, das eigene Leben mit zunehmendem Alter als ein am Ende stehendes Altgewordensein zu betrachten und anzunehmen.
Insofern steht dieses Buch für ein Aufarbeiten eines selbst ins Altern gekommenen Lebens. Es geht nicht nur um das bewusste Anerkennen eines vorauseilenden und bereitstehenden Lebensendes, sondern darum, was Zukunft eines Lebens im Alter bedeutet.
Es sind vor allem zwei Fragen, die mich derzeit in meinem Leben begleiten und zum Verfassen dieses Buches beitrugen: Was ist uns das Altern wert? Was steckt in ihm, das uns, der Jugendlichkeit lange entwachsen, noch lebendig hält und uns tagtäglich immer wieder neu zum Leben erweckt?
Mut macht, dass das Leben immer in der Gegenwart stattfindet; und diese Gegenwart ist menschlich gefühlt immer gleich, unabhängig davon, ob man sich jung oder alt wahrnimmt.
Ein weiterer Grund für dieses Buch waren die für April 2020 zum Thema „Alt werden – Jung bleiben ∙ Was ist uns das Altern wert?“ geplanten Philosophischen Tage. Sie sollten nicht sein. Der sich weltweit verbreitende Coronavirus stellt alles auf den Kopf. Das Buchmanuskript sollte den Philosophischen Tagen folgen. Stattdessen führte mich der Lockdown dazu, das Schreiben vorzuziehen.
Ich bin mir sicher: Das Jahr 2020 wird uns allen, selbst bis ins hohe Alter, in Erinnerung bleiben. Die um den Jahreswechsel 2019/2020 in China begonnene Corona-Epidemie, die in den Folgemonaten die ganze Welt durchzog, brachte in kurzer Zeit das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen. Sie wurde zu einem historischen Lehrstück einer verletzlichen globalisierten und digitalisierten Welt. Wirtschaft und menschliche Seelen gerieten an ihre Grenzen, wie sie in den letzten 75 Jahren, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wohl kaum erlebt wurden. Diese Lektion der Natur an den Menschen der Moderne machte deren philosophische Evidenz und Essenz deutlich.
Ich bin mir sicher, dass das, was in den vergangenen Monaten an sozialen, politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Entscheidungen getroffen wurde und wie sich die Menschen in der Alltäglichkeit unter den Bedingungen der Pandemie verhielten, noch so manchen philosophischen Nachtrag hervorbringen wird.
Ich bin mir auch sicher, dass die nachzuholenden 3. Philosophischen Tage die Aufarbeitung dieser Geschehnisse nicht unberührt lassen werden. Dieses Buch wandelte sich zu deren philosophischem Vorspann.
Das Thema der Philosophischen Tage 2021 steht in konzeptioneller Linie der vorausgegangenen. Begonnen mit der Frage „Was ist ein gutes Leben? ∙ Wie bitte geht das? (2016) und in Fortsetzung „Gesundheit erleben ∙ Was heißt gesund?“ (2018) kann nur das Alternsthema folgen. Es braucht nicht viel an Begründung und Überlegung, den Zusammenhang zwischen Leben, Gesundheit und Altern herzustellen. Die inhaltlichen Verbindungen sind unübersehbar und in vielen Seiten des Buches erlesbar.
Die vorliegenden Texte entstanden aus überarbeiteten Vorträgen und Werkstattgesprächen im Rahmen der Philosophischen Praxis und in Vorbereitung auf die Philosophischen Tage.
Mit ihnen verfolge ich ein grundlegendes und durchgehendes Ziel: Es ist mein Anliegen, das Philosophieren aus dem Hörsaal der Universität auf die Straße zu holen, um so vielen Interessierten, die Freude am Philosophieren haben, eine diskursive, bürgeroffene Plattform zu bieten. Mein Philosophieren verstehe ich i. S. von Immanuel Kant als Aufklärung
Die Formate wie das „Philosophische Café“ (Praktische Philosophie), der „Philosophische Salon“ (Politische Philosophie) oder „HUGENDUBEL lädt ein! Philosophie und Wissenschaften im Gespräch“ sind Brücken, die mich mit der Hansestadt Rostock zu jenem „Philosophischen Flaggschiff“ hinführten, das sich als „Rostocker Philosophische Tage“ etablierte und immer mehr den Charakter eines Festivals annimmt.
Dieses Buch ist in Schriftform gewordenes Altern. Mag es Anregung zum philosophischen Denken und praktischen Handeln sein, mit sich, dem eigenen Altern behutsam und wohlgefällig umzugehen.
Ich verbinde mit diesem Buch den Dank an all jene, die zur inhaltlichen und organisatorisch-technischen Vorbereitung der 3. Philosophischen Tage beitrugen und den Willen zum Ausdruck brachten, dieses philosophische Event mit neuem Anlauf für 2021 auf den Weg zu bringen.
Meine Wertschätzung gilt meinen kritisch-korrigierenden „Vorablesern“ Anne-Christin Schwirblath, Astrid Gipp und Dr. Friedrich Groth. Ihnen gilt mein besonderer Dank für die beratende Begleitung auf dem Weg zur Fertigstellung des Buchprojektes.
Hans-Jürgen Stöhr
Rostock, im Frühjahr 2021
Wer gut und lange leben will, der lebe langsam.
Marcus T. Cicero (106 – 43 v. Chr.)
EINLEITUNG ∙ Alternsbegegnungen
Altern2 ist immer auch eine Begegnung mit sich selbst. Wir sehen es. Wir spüren es. Das Altern lebt in uns. Es vermittelt uns ein Gefühl von Zerrissenheit, Ambivalenz und innerer Widersprüchlichkeit. Es macht erhaben und nachdenklich. Es will sich verorten. Wir sind stolz auf die gelebten Jahre, wollen sie zugleich wieder vergessen und sagen uns tröstend: „Ich bin so alt, wie ich mich fühle!“
Altern ist Eigenschaft und Qualitätsmerkmal unseres Lebens. Das Leben altert, und im Altern leben wir. Es lässt sich auch sagen: Mit dem Leben verleben wir es durch Altern, das wir, soweit wir es takten, in Jahrzehnten, Jahren, Monaten oder auch nur in Tagen messen.
Altern ist die Symptomatik des Lebens. Es ist Lebensbild und maß von besonderer Eigenart, das wir für selbstverständlich halten, weil wir unsere Lebenszeit nach ihm ausgerichtet haben.
Fragen wir nach deren Verfügbarkeit, werden wir nachdenklich und auf unser All-Ursprüngliches zurückgeworfen: Was ist Leben? Was ist bzw. was heißt Altern? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Müssen beide – Leben und Altern – so untrennbar miteinander verbunden sein oder hat der Mensch die Möglichkeit, diesen Zusammenhang aufzulösen?
Haben wir diese Fragen halbwegs in unserem Denken verinnerlicht, folgen bereits vertiefend die nächsten: Wie lässt sich etwas mit dem Leben Unverfügbares erklären? Oder müssten wir nicht angesichts gestiegener Lebenserwartungen an der Unverfügbarkeit des Alterns zweifeln? Hat das Altern einen Wert? Macht es Sinn?
Das Buch unternimmt den Versuch, sich dem Altern philosophisch auf verschiedene Weise zu nähern. Dem eigenen Altern zu begegnen ist von besonderer Art. Wir wissen inzwischen sehr viel über das Altern und doch fällt es uns schwer, dieses Phänomen in seiner Totalität und für sich selbst in der Gänze persönlich zu erfassen. Spätestens dann, wenn uns das Altgeworden- und das Greissein bewusst geworden sind, wir uns dem Sterben und Tod nähern, erfahren wir unsere Begrenztheit und eigene Lebensunverfügbarkeit.
Auf dem unvermeidlichen Weg dorthin folgen wir der Katharsis (Läuterung). Es ist ein Gang, mit allem, was mit dem Altwerden und Altsein, dem Sterben und dem Tod verbunden ist, eins zu sein.
Wer ein Buch über das Altern sucht, wird mehr als fündig. Es gibt Literatur an Überfluss: Über das Altern pro und contra, als diverse Ratgeber für ein Anti-Aging – körperlich, geistig, seelisch, medizinisch, psychologisch, philosophisch usw.
Mein Ansinnen ist eine philosophische Betrachtung des Alterns. Derartige Bücher sind mir nur in geringem Umfang bekannt: zufällig, geschenkt, gekauft, soweit es mir für meine Skripte und zur Vorbereitung auf die Philosophischen Tage sinnvoll erschien.
Dieses Buch ist ein Beitrag, das Leben im Alter – bei aller Metaphysik – annähernd zu verstehen, es bewusst zu gestalten und ihm einen gebotenen Sinn zu geben.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist unmittelbar verbunden mit dem Wert und Sinn des Alterns unseres Lebens. Sie stellt sich von selbst, wenn wir mit unserer Lebenspraxis konfrontiert werden und von Angesicht zu Angesicht vor dem Spiegel stehen. Spätestens dann, wenn wir eine Altenpflegeeinrichtung betreten, uns Sterben und Tod im Alltag begegnen, spüren wir das Altern an uns selbst.
Der Titel dieses Buches gibt viel Raum, dem Altern mit Achtung und Respekt, Demut und Ehrfurcht vor dem Älterwerden und Altgewordensein zu begegnen. Bäume3 sind Sinnbilder für das Altern. In Ivenack4 stehen die bestaunten sogenannten 1000jährigen Eichen – auch wenn noch nicht alle an das Methusalem-Alter heranreichen. Sie würden Geschichten erzählen von der Gründung Mecklenburgs5 bis in unsere heutige Zeit. Ihr Altern ist noch nicht zu Ende, auch wenn die eine oder andere Eiche nur noch im Torso als Naturdenkmal vor uns steht und mahnend die unvermeidliche Lebenszeitbegrenzung vermittelt.
Der Untertitel des Buches ist ein Weckruf, dem Altern ein gutes Leben zu schenken. Er ist mit der Botschaft verbunden, sich seines Lebens bei aller Alterung bewusst zu sein und das alternde Leben trotz seiner Verletzlichkeit und Begrenztheit bis ans Lebensende zu leben – besser zu erleben.
Das Einzige, was der Mensch selbst besitzt, ist sein ihm geschenktes Leben, über das er zu Lebzeiten verfügen kann. Die menschliche Verfügbarkeit über das Leben besteht erstens in der mit ihm gemachten Lebens-, Selbst- und Welterfahrung, zweitens in Eigen- bzw. Wirkungsmacht der Lebensgestaltung, was heißt, das Leben selbstgestaltend in die Hand zu nehmen, und drittens diesem eigenen Leben einen Wert bzw. Sinn zu geben. Darüber sie erhalten wir den unmittelbaren, wenn auch nicht tagtäglich wahrnehmbaren Zugang zum Altern.
Die reflektierten Alternsbegegnungen verfolgen keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stehen für inspirierende Denkstücke, die uns helfen, unser eigenes Altern (besser!) zu verstehen.
Die Zugänge in diesem Buch sind sehr unterschiedlich, so dass die Chance besteht, einen breiten Leserkreis mit philosophischethischen Denkambitionen über das Altern zu erreichen.
Die Vermessung des Alterns erfolgt in drei Teilen. Im ersten Teil wird vordergründig das Philosophische an ihm genährt. Dabei geht es nicht darum, eine Philosophie des Alterns zu kreieren. Es besteht auch nicht die Absicht, mit diesem Buch einen philosophiebzw. ideengeschichtlichen Vorspann zu konfigurieren. Hierzu steht den Leser*innen eine Reihe von Literatur zu Verfügung. (vgl. u.a. Thomas Rentsch und Morris Vollmann; Hrsg.: Das gute Leben im Alter. Die philosophischen Grundlagen, Reclam, Stuttgart, 2017; Otfried Höffe, Die hohe Kunst des Alterns. Kleine Philosophie des guten Lebens, C. H. Beck, München 2018).
Das hier vorliegende Buch möge sich in bisherige Publikationen einreihen und einen ergänzenden Beitrag zu einer Philosophie des Alterns leisten.
Die fünf Kapitel des ersten Teils betrachte ich als einen Diskurs über das Altern, der philosophisch vordergründig über Dialektik und Ethik erschlossen wird. Sie bilden den Zugang zu nachfolgenden alltagsbezogenen Alternsbetrachtungen. Die Alltagsrelevanz von Alter und Altern ist in diesem Teil zurückgesetzt.
Die Philosophie als Theorie und Denkmethode bildet die Grundlage für den folgenden Alterns-Diskurs im zweiten und dritten Teil des Buches.
Im ersten Teil des Buches werden in den Alternsüberlegungen Dialektik und Ethik miteinander verknüpft.
Dialektik steht für eine philosophische Wirklichkeitsbetrachtung, die davon ausgeht, dass es inner- und außerhalb unseres Lebens dialektisch zugeht. Das bedeutet, unsere Welt ist deterministisch, was wiederum heißt, dass in, mit und außerhalb unseres Lebens Wirkzusammenhänge bestehen. Alles ist direkt oder vermittelt miteinander verbunden. Unsere Weltendinge stehen zu- und miteinander in Wechselbeziehung, beeinflussen sich gegenseitig und zeigen sich in einer aufeinander bezogenen Bedingtheit und Abhängigkeit.
Der andere Teil des Dialektischen ist der Bezug zur Bewegung, Veränderung und Entwicklung. Alles ist im Fluss. Nichts ist heute so, wie es früher war. Das Gegenwärtige ist das Resultat des Vergangenen. In dem Heutigen steckt das Morgen, der uns den Blick auf das Zukünftige öffnet. Bewegung und Zeit scheinen aufeinander abgestimmt und unzertrennlich zu sein, und aus ihnen entspringen Veränderung und Entwicklung.
Wir sprechen heute mehr denn je von Wandlungen. Der Klimaund demografischer Wandel sind uns allgegenwärtig. Wir erfahren, dass wir uns in und mit der eigenen Lebensgeschichte verändern, wandeln: Wir waren jung, sind älter und letztlich alt geworden. Wir haben uns mit unserem Leben verändert, entwickelt, gewandelt – im Charakter, in der Persönlichkeit, im Geiste wie im Körperlichen.
Mit der objektiven Dialektik unterstellen wir die Existenz von Dialektischem – unabhängig von unserem menschlichen Willen und Bewusstsein. Wir gehen davon aus, dass es in unserer Welt dialektisch zugeht. Das heißt, sie ist eine Welt von Zusammenhängen und Bedingtheiten, von Bewegung, Veränderung, Entwicklung und Geschichte bestimmt.
Dieses Objektive erhält mit der subjektiven Dialektik sein geistigkognitives, strukturiertes Abbild. Sie steht für Theorie und Methode, Modell und These, Wissen und Erfahrung über das Objektiv Dialektische. Als solche sind diese in die Betrachtung des Alterns integriert.
Das Buch folgt im Rahmen des Alterns-Diskurses der objektiven und subjektiven Dialektik. Alter und Altern philosophisch erklärt, als Status und Prozess, in Bewegung, Zeit und Resonanz sind die hier gewählten Diskurszugänge.
Die Ethik des Alterns spiegelt sich insbesondere in der Frage nach dem Guten, Wert und Sinn von Altern wider. So stehen u. a. Fragen im Zentrum der Betrachtung: Was ist das Gute daran, alt zu werden und es schließlich zu sein? Hat das Altern einen Wert – wenn ja, welchen? Können wir mit dem Leben einen Alternssinn ergründen? Welcher praktischen Gestaltungskraft können wir dem Altern verleihen?
Der zweite Teil des Buches ist den alltäglichen Begegnungen mit dem Altern gewidmet. Neun Essays führen uns in das Altern ein. Jung und Alt, Leben und Zeit, Altern in Märchen, Fürsorge und Egoismus, Gewohnheit und Gewöhnung, Einsamkeit und Vereinsamung, Erinnerung und Vergessen, Demenz und Scheitern im fortgeschrittenen Alter sind Themen, die in dieses Buch aufgenommen wurden.
Hermann Hesse fasziniert mit seinen Gedanken über die Reife des Lebens. Es ist sein Aphorismus „Mit der Reife wird man immer jünger“, der zu einer vertiefenden Interpretation und Deutung einlädt, den lebenszeitlichen Gegensatz aufzuklären, aufzulösen und zu fragen, was dieser Leitgedanke für unser Leben und Altern bedeuten kann.
Der philosophische Diskurs über die Zeit hat gegenwärtig Hochkonjunktur (vgl. u.a. Rüdiger Safranski; Zeit, Was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen, Carl Hanser Verlag, München, 2015).
Altern ist Lebenszeitveränderung. Das führt uns zu den Fragen: Was bedeutet, das Altern als Reisezeit zu betrachten? Ist ein Altern ohne Lebenszeitbetrachtung vorstellbar? Können wir das Altern aufhalten und mit ihm die Zeit des Lebens verändern?
Märchen sind gewandelte Lebensgeschichten. Sie verdienen eine gebührende Aufmerksamkeit, weil in ihnen auch das Altern gespiegelt wird. Sie vermitteln uns interessante Botschaften aus vergangener Zeit darüber, wie Menschen in ihrem Alltag mit dem Altwerden umgingen und wie sie über das Altern dachten.
Viel näher mit unserem Alternserleben sind Fürsorge und Egoismus verbunden. Zwischen ihnen besteht ein äußerst differenziertes inneres (innermenschliches) und äußeres (zwischenmenschliches) Spannungsfeld. Dem stehen Gewohnheit und Einsamkeit im Alter keineswegs nach. Es sind Lebenseigenschaften (Verhaltensweisen), die nicht zwingend altersgebunden sind, aber im Alter eine besondere Präsenz zeigen. Wir brauchen Gewohnheiten, mehr noch mit zunehmendem Alter, weil sie uns Sicherheit geben. Doch sind wir uns auch immer der anderen gefahrenvollen Seite des Altgewordenseins bewusst? Worin bestehen die Chancen und Risiken eines in Gewohnheit lebenden Lebens im Alter?
Die Verbindung zur Einsamkeit ist hergestellt, sobald Gewohnheit einsam macht. Die Gefahr des Einsamwerdens und in Folge dessen die Vereinsamung sind besonders im höheren Alter sehr groß, auch wenn sie altersunabhängig zunehmend Raum in unserem Leben gewinnen. Wie stehen Alleinsein, Einsamkeit und Vereinsamung zueinander? Was verbindet und unterscheidet sie? Tragen sie in sich auch Chancen für ein zu veränderndes Leben im Alter?
Ein über Jahrzehnte lang gelebtes Leben hat die meiste (Lebens-) Zeit in Form von Erinnerungen und Erfahrungen festgehalten. Sie sind geistig verinnerlichte Vergangenheiten des Lebens. Wir haben sie stets in der Gegenwart bei uns. Im gealterten Leben nehmen das Erinnern (Erinnerung) und Vergessen (Vergessenheit) eine besondere Stellung ein. Sie sind viel tiefer als je in den vorangegangenen Lebensabschnitten mit uns und dem Altern verbunden.
Wir wollen uns an Vergangenes erinnern, weil es uns zum gelebten Leben hinführt. Das Erinnern sorgt für innere Lebendigkeit. Manches soll aber auch vergessen sein und für immer bleiben. Wird Vergessenes Erinnerung, offenbaren sich nicht selten Lebensschmerzen, die die Frage nach dem Sinn für das Leben im Alter in besonderer Art und Weise aufkommen lässt.
Damit ist die Brücke zur Demenz gebaut. De-menz – weg vom Geist – ist der Sammelbegriff für alle kognitiven Erkrankungen. Die Demenz vom Alzheimer-Typ (A.-Demenz) nimmt unter den Demenzen im Ausmaß eine bestimmende Stellung ein. Sie tritt am häufigsten auf.6 Für viele Menschen ist der Umgang mit A.-Demenz aus den unterschiedlichsten Gründen allgegenwärtig. Ebenso viele Menschen stehen dieser Erkrankung unsicher gegenüber. Es gibt Berührungsängste. Dieser Essay stellt sich den Fragen: Ist Demenz eine gesellschaftliche und persönliche Geißel oder gar ein Geschenk des Leben? Lässt sich die Demenz vom Alzheimer-Typ auch als sinnstiftend mit einer positiven Deutung beschreiben? Was würde das für unser Denken und Handeln bedeuten?
Alt- und Kranksein liegen gar nicht so weit auseinander. Das Altern lässt insbesondere die klassischen Alterserkrankungen ansteigen. Neben Demenz gibt es viele alternsbedingte Erkrankungen wie Krebs und Diabetes. In unseren letzten zwei Lebensjahren sind die Kosten unserer Alternserkrankungen vergleichsweise etwa gleich hoch wie die aller Lebensjahre zuvor.
Altern und Krankheit sind eng miteinander verbunden.7 Worum es hier geht, ist die erforderliche Betreuung und Pflege. Im Zentrum der Betrachtung dieses Essays stehen Fürsorge und Egoismus. Die philosophische Betrachtung von Fürsorge und Egoismus ist zugleich tiefenpsychologisch eingebunden.
Dass wir im Leben an so manchen Vorhaben und Zielen scheitern können, ist erfahrungsgemäß nachvollziehbar. Doch wie sieht es mit dem Altern aus? Das letzte Essay des zweiten Teils des Buches greift die Frage auf: Können wir am Altern scheitern? Diese Fragestellung scheint absurd und lebensfremd. Sie macht aber auch nachdenklich, wenn wir das Altern als eine dynamische, konstitutive Seite des Lebens betrachten und die Frage nach dem Scheitern auf das Leben selbst projizieren. Wir werden in besonderer Weise mit der Verfügbarkeit bzw. Unverfügbarkeit unseres Lebens am Lebensende konfrontiert.
Die Selbstbestimmtheit, gepaart mit der Unantastbarkeit der Würde des Menschen, bleibt auch bis ins hohe Alter ein wertvolles Gut.
Der dritte als Epilog beschriebene Teil greift zwei aktuelle, sich im philosophischen Diskurs befindende Themen in drei Kapiteln auf. Das erste Kapitel greift den gegenwärtigen Stand und zukünftigen Weg der Alternsforschung auf. Das Ende vergangenen Jahres erschienene Buch von David A. Sinclair „Das Ende des Alterns. Die revolutionäre Medizin von morgen“ (DuMont, Köln 2019) und viele weitere in den Medien erschienenen Beiträge über die Forschung sind darauf ausgerichtet, das sogenannte Methusalem-Gen zu finden. Die inzwischen weit vorangetriebene biologische Alternsforschung lässt den menschlichen Traum von der Unsterblichkeit immer mehr Realität werden. Sie ist inzwischen so faszinierend und abenteuerlich, dass es aus philosophischer Sicht hinreichend Anstoß gibt, sich der Problematik aus wissenschaftsethischer und moralischer Sicht anzunehmen.
Es stellen sich Fragen, die die Ethik der Humangenetik berühren und den Zusammenhang von Altern, Gesundheit und Krankheit in ein grundsätzlich neues, paradigmatisches Licht setzen.
Die These „Altern ist eine Krankheit“ fordert zu einem philosophischen Diskurs heraus. Die Logik ist: Wenn Altern eine Krankheit ist und Krankheiten einer Heilung bedürfen, dann kann die menschliche Mission nur darin bestehen, auch das Altern zu „therapieren“.
Die Medizin steht offensichtlich vor dem Ideenwechsel, dass das Altern heilbar sei, dass man zukünftig in der Lage sein werde, das Altern zu verlangsamen, aufzuhalten bzw. umzukehren.
Das zweite Kapitel wendet sich der Kontroverse und Frage zu: Befinden sich Jung und Alt derzeitig in einem neuartigen auszutragenden Generationskonflikt? Die Medien haben das Thema aufgenommen. Es findet seine demografische, sozialökonomische, psychologische und ökologische Aufmerksamkeit im breiten Diskurs.
Die aktuelle Corona-Krise, die seit dem Jahreswechsel das gesamte gesellschaftliche Leben im Würgegriff hat, fordert dieses Thema hinsichtlich einer signifikanten Altersmortalität zusätzlich heraus. Bedürfen die älteren, als Risikogruppe eingestuften Menschen im Vergleich zu den jüngeren einen besonderen Gesundheitsschutz? Wodurch ist das gerechtfertigt? Lassen sich die eher von Corona gefährdeten älteren Menschen so ohne Weiteres von den jungen, die Wirtschaft tragenden Menschen isolieren?
Medizinisch-therapeutisch ist bekannt, dass jene alten, an Corona erkrankten Menschen nicht in jedem Fall ursächlich an Covid-19 sterben, sondern maßgeblich aufgrund von Vorerkrankungen. Es ist auch bekannt, dass nicht wenige alte Menschen mit schwerem Erkrankungsverlauf eine intensivtherapeutische Beatmung nur mit viel Anstrengung verkraften und in Folge der Intensivbehandlung sterben. Wem ist damit geholfen?
Die Fragen zum Generationenkonflikt mehren sich: Treibt die Fridays-For-Future-Bewegung die Alten vor sich her, endlich Verantwortung für den Natur- und Klimaschutz zu übernehmen, nachdem sie über Generationen hinweg Raubbau an der Zukunft der Heranwachsenden betrieben hat? Geht die zunehmende Altersarmut der in Rente gehenden Baby-Boomer zu Lasten der jungen X- und Z-Generation? Reiben sich Jung und Alt und mit ihnen die Gesellschaft im politischen Entscheidungskonflikt zwischen Wirtschaft und Gesundheit auf? Steht uns ein Machtkampf ins Haus, und was würde er für unser gegenwärtiges und zukünftiges Leben bedeuten?
Das dritte Kapitel des Epilogs ist der Toleranz gewidmet. Philosophiegeschichtlich und in der Kritik menschlicher Gesellschaften ist er nicht wegzudenken. Immer wieder loderten neuerliche Diskurse auf – bis in unsere heutige Zeit hinein. Insofern ist verständlich, dass der Toleranzbegriff mit den sich verändernden aktuellen gesellschaftlichen Ereignissen wiederholter Analyse und Kritik unterzogen wird.
Hier nimmt der Toleranz- Diskurs den aktuellen Generationskonflikt zwischen Jung und Alt auf und geht darüber hinaus. In dezidierter Weise werden in diesem Epilog-Kapitel die Begriffe Toleranz und Akzeptanz, Intoleranz und Inakzeptanz insbesondere einer dialektischen Betrachtung unterzogen und ethisch unterfüttert. Lesende mögen kritisch nachsehen, dass der Blick auf das Alter und Altern hier eine eher nachgeordnete Rolle spielt.
Es ist immer wieder neu und zugleich keine Überraschung in unserer Erkenntnis: Wir begegnen uns letztendlich immer wieder selbst. Wir treffen uns im Alter und Altern. Es ist und bleibt stets ein Rückwurf auf unser Sein.
Alter und Altern
Eine philosophische Annäherung
Altern
Was macht es philosophisch?
Altern
Warum braucht es dafür keine Zeit?
Altern
Wie viel Resonanz steckt in ihm?
Altern
Was ist das Gute daran?
Altern
Was ist es uns wert?
2 Den Lesenden wird bereits im Untertitel des Buches aufgefallen sein, dass das „Altern“ in den meisten Fällen mit einem kursiv gedruckten „n“ geschrieben wurde. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass inhaltlich sowohl vom Alter (als Lebenszeitstatus) als auch vom Altern (als prozessierendes Leben in Veränderung) die Rede ist. Das Altern ohne ein kursiv gedrucktes „n“ drückt das Älterwerden als Prozess eines Jahr für Jahr fortschreitenden Alters aus.
3 Die im Buch verwendeten Fotos zeigen Eichen aus dem Ivenacker Naturpark. Näheres kann am Ende erlesen werden.
4 Ivenack ist eine kleine Gemeinde mit knapp 1000 Einwohnern im Landkreis Mecklenburger Seeplatte, in der Nähe der Kleinstadt Stavenhagen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
5 Urkundlich erstmalig 995 als slawische Burg Wiligrad erwähnt, dem heutigen Dorf Mecklenburg, das sich unweit der Hansestadt Wismar befindet.
6 Zwei Drittel aller demenzieller Erkrankungen sind vom Alzheimer-Typ. Zu den Demenzen gehört auch die vaskuläre Demenz, im Volksmund auch als Schlaganfall bekannt. Weitere sind das Korsakow-Syndrom oder Morbus Parkinson.
7 Im ersten Kapitel des Epilogs „Alt werden war gestern“ wird vertieft auf diesen Zusammenhang eingegangen.
Denn gar sehr ist dies der Zustand eines Philosophen, Verwunderung; ja es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als diesen.
Sokrates (469 – 399 v. Chr.)
ALTERN ∙ EINE PHILOSOPHISCHE ANNÄHERUNG
ALTERN ∙ Was macht es philosophisch?
Mit der Erfahrung Mensch zu sein, begeben wir uns auf ein ganz individuelles und zugleich gesellschaftliches Abenteuer. Sobald wir uns des Menschseins bewusst geworden sind, machen wir uns auf die Suche nach uns selbst: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin geht mein Lebensweg? Wo sind mein Platz und Wert in der menschlichen Gemeinschaft bzw. Gesellschaft? Diese Fragen bündeln sich in der Frage nach dem Sinn des Lebens, die sich mit den zunehmenden Lebensjahren in die Frage nach dem Wert und Sinn des Alterns wandelt. Es sind sein Entstehen, Werden und Vergehen, das den Menschen als Mensch begleitet.
Dabei ist sein Altern keineswegs nur biologisch, individuell und im Wesen von seiner Persönlichkeit geprägt. Als Teil einer sozialen Gruppe und Gesellschaft wird sein Altern auch durch sie beeinflusst und umgekehrt.
Sobald wir uns unserer Existenz bewusst geworden sind, bleibt es nicht nur dabei, unser Dasein zu reflektieren. Wir nehmen sehr schnell wahr, dass das eigene Sein eine Geschichte hat. Dieses Narrativ heißt Leben.
Wir lernen, dass dieses Leben in Jahren gezählt werden kann. Jedes Jahr werden wir mit unserem Geburtstag darauf aufmerksam (gemacht), dass sich unser Leben von Jahr zu Jahr verlebt. Wir werden älter. Als Kinder und Jugendliche wächst mit den Jahren der Stolz, wieder ein Jahr älter geworden zu sein. Anerkennung und Wertschätzung, Lebensträume und -ziele beflügeln uns, älter werden zu wollen.
Sehr schnell wachsen zudem auch das Wissen und die Erfahrung, dass das eigene Leben zeitlich begrenzt, mit Sterben und Tod verbunden ist. Sie werden zur Lebensweisheit, die so profund ist, wie das Leben und der Alltag selbst.
Mit den Lebensjahren gewinnt das Nachdenken über das mit ihnen verbundene Altern an Dominanz. Wir erfahren uns in unserem Werden und Vergehen von Jahr zu Jahr bewusster. Das Altern drängt sich förmlich auf und setzt sich immer mehr in unserem Denken und Handeln fest.
Wir beginnen zu fragen: Was ist unter Alter und Altern zu verstehen? Was ist und was bedeutet es, älter zu werden und schließlich alt zu sein? Lässt sich das Altern beeinflussen oder umgehen? Hat das alles einen Sinn? Können wir das Altern aufhalten oder uns gar auf irgendeine Weise jünger machen?
Antworten auf die Fragen zu finden wird zu einer ganz persönlichen Herausforderung. Stellen wir uns einmal vor, wir wenden ab dem 41. Lebensjahr für unser Lebensverlängerungs- und Anti Aging-Programm über die Lebenszeit von 40 Jahren insgesamt zwei Jahre auf, die uns eine höhere Lebenserwartung von zwei Jahren bringt. Was haben wir gewonnen? Ist uns auch etwas verloren gegangen? Die Antworten darauf werden persönlich unterschiedlich ausfallen.
Damit nicht genug: Das individuelle menschliche Werden, das sich in unserem Altern äußert, spiegelt sich auch in der Gesellschaft wider. Wir sprechen heute mehr denn je von einer schnelllebigen und alternden Gesellschaft.
Menschlich-individuelles wie gesellschaftliches Altern sind dieHerausforderungen unserer Gegenwart. Sie werden es auch für die nähere Zukunft bleiben. Dieser individuelle wie sozialgesellschaftliche Lebenswandel wird uns zu neuen Denkperspektiven bewegen.
Umbrüche – welcher Art auch immer – in Wissenschaft und Technik, Wirtschaft und Gesellschaft rufen die Philosophie auf den Plan. Das heißt, ein zutiefst „altes“, über mehr als zweieinhalbtausend Jahre diskutiertes Thema steht erneut im Fokus eines philosophischen Diskurses. Er folgt den realen Gegebenheiten und Entwicklungen unserer Zeit.
Mit dem vor etwa zehn Jahren begonnenen neuerlichen und bis heute nicht abgeebbten philosophischen Diskurs über die Frage „Was ist ein gutes Leben?“ erhält das Thema über das Altern neuen Grund und Boden.
Jeder Mensch wird früher oder später eine Antwort auf das eigene Leben, dessen Selbstgestaltung und Lebensende finden müssen. Das ist er sich selbst schuldig.
Er ist auch auf der Suche nach gesellschaftlich tragfähigen Antworten. Dabei geht es sowohl um die Frage nach dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben, nach der Wahl im Umgang mit den sterblichen Überresten als auch um die gesellschaftlichen Bedingungen für ein gelingendes Altern. Wir fragen nach den gesellschaftlichen und sozial-ökonomischen Folgen einer älter werdenden Gesellschaft.
Der „demografische Wandel“, der alle Bereiche unserer Gesellschaft betrifft, der Wissenschaft und Politik, Ökonomie und Gesundheit kreativ herausfordert, lässt philosophische Kritik nicht unberührt.
Doch wie kann eine gute, denk- und alltagsförderliche Kritik über das Altern aus der Sicht der Philosophie aussehen? Wie lässt sich eine Diskussion über das Alter und Altern menschlichen Lebens, noch dazu eingebettet in einen gesellschaftlichen Kontext, auf den Weg bringen?
Vorausschicken möchte ich, wie bereits in der Einleitung angesprochen, dass ich keinen ideengeschichtlichen Exkurs über das Altern erneuern möchte. Vielmehr wende ich mich an Philosophieinteressierte, um ihnen eine überschaubare Denkstruktur zu anzubieten, deren Teile zwar philosophisch miteinander in enger Verbindung stehen und dennoch teilbezogen für einen relativ eigenständigen Diskurs stehen.
Die Überlegung ist, sich dem Thema aus vier philosophischen Denkperspektiven anzunähern: Begriffsklärung, Wahrheitsfindung, dialektische Wirklichkeitsbetrachtung und werte- bzw. sinnstiftendendes Verhalten.8
Sprachphilosophisch, metaphysisch-analytisch
– Was ist darunter zu verstehen? Was heißt, was verbinden wir mit Alter und Altern – individuell wie gesellschaftlich? Es geht darum, ein Verständnis für das Alter
n
zu entwickeln, eine Begriffsklärung zu erreichen, um einen gemeinsamen Denkzugang zu ermöglich, der die Grundlage dafür bildet, in einen Diskurs einzusteigen.
Erkenntnistheoretisch
– Eine Denkperspektive, die die Quelle unseres Wissen im Focus hat: Wie wahrhaftig ist es, dass wir alt werden sind und alt sind? Woher nehme ich die Gewissheit, dass wir alt werden? Wir suchen nach verifizierbaren Erkenntnissen, die uns im Verständnis des Alters und Alterns voranbringen.
Dialektisch
– Ein Denkzugang, der uns zur Determiniertheit und Entwicklung von Alter und Altern führt: Von welchen Bedingungen bzw. Einflussfaktoren ist das Alter
n
abhängig? In welchem Zusammenhang steht das individuelle Altern mit den gesellschaftlichen, sozial-ökonomischen und/oder kulturellen Gegebenheiten? Was bringt das Altern hervor? Wie entwickelt sich Altern? Inwieweit ist der Mensch in der Lage, auf das Altern einzuwirken, d. h. zu verändern, zu verlangsamen oder zu beschleunigen? Wie stehen Altern und Krankheit im Zusammenhang?
Ethisch-moralisch
– Der Blick ist auf menschliches Entscheiden und Handeln gerichtet. Wir fragen nach deren Sinn und hinterfragen die Werte unseres Lebens. Wir wenden uns Fragen zu wie: Hat das Alter
n
einen Sinn und Wert? Welche Werte sollen mein älter werdendes Leben tragen? Inwieweit darf ich selbst entscheiden, wie alt ich werden will? Ist Alternsforschung gesellschaftlich und menschlich sinnstiftend und sind deren Anwendungen moralisch vertretbar?
Alle vier Zugänge sind philosophischer Natur. Sie ermöglichen uns, je nach Frage-, Aufgaben- bzw. Zielstellung den bzw. die jeweiligen Denkwege zu gehen. Es liegt auf der Hand, es selbst zu tun. Sie zu nutzen, wenn auch nicht voll ausgeschöpft, auf das Alter und Altern angewandt, ist der Versuch, sich diesen Lebenseigenschaften philosophisch zu nähern.
Über alledem steht der Sinn des Philosophierens. Die Einsicht, dass das Philosophieren gleichsam eine wissenschaftlich begründete Form des Denkens in Theorie und Methode darstellt, ist nicht selbstverständlich. Das Wissen darüber, dass das Philosophieren schon mit dem Aufstehen und dem Blick in den Spiegel beginnt, mit dem, was auf dem Frühstücktisch steht und etwas mit der Entscheidung zu hat, ob das Auto, die Straßenbahn oder das Fahrrad zur Arbeit benutzt wird, gilt zwar als alltäglich, jedoch weniger philosophisch betrachtet. Das ist es insofern nicht, weil es alltägliche Gegebenheiten und Entscheidungen sind, die unser Leben ausmachen. Das Philosophische ist aus ihnen mit einer besonderen Art des Fragens und des Nachdenkens herauszukitzeln. Es geht um jene Fragen, die wir den vier Zugangsebenen einer philosophischen Wirklichkeits- bzw. Lebensbetrachtung zuordnen können.
Was ist, was kann Philosophieren? Es ist eine wissenschaftlich begründete Denkweise, die uns einen Blick auf unsere Lebenswirklichkeit aus einer anderen Perspektive ermöglicht. Es verschafft uns neue Denk- und Handlungszugänge. Philosophieren ist ein Denken Anstoßen und zugleich anstößiges Denken. Dabei sind verfügbares Alltagswissen, menschliche Neugierde und Denkkreativität für einen Perspektivwechsel und dessen Erweiterung hilfreich.
Philosophieren bedeutet fragen, hinterfragen, zweifeln an dem bisher Gedachten; es steht für Staunen und Denken über den Alltag unseres Lebens hinaus.
Philosophieren hilft, die Logik des Denkens zu schärfen; es unterstützt das Argumentieren bei gedanklicher Beweisführung und aufgestellter Behauptung.
Philosophieren schafft Denkmuster und Denkweisen, die für Gegenstände unterschiedlicher Art sich neuerlich anwenden lassen. Wir sprechen von einem Denkalgorithmus als wiederkehrender und nutzbarer Denkablauf, ohne dabei in Denk-Stereotype zu verfallen. Die Kant´schen Fragestellungen – Was kann ich wissen? ∙ Was soll ich tun? ∙ Was darf ich hoffen? ∙ Was ist der Mensch? – entsprechen diesem Muster. Das gilt auch für die oben formulierten vier Betrachtungsebenen eines philosophischen Gegenstandes.
Philosophieren ist ein Begegnen mit der Lebenswirklichkeit. Mit ihm schaffen wir Raum für Veränderungen, die wiederum unser Philosophieren beeinflussen. Das Philosophieren ist Ausgangspunkt und Ergebnis von Wirklichkeitsbewältigung.
Philosophieren schärft unseren Blick für das scheinbar Alltägliche, das uns beim Philosophieren gar nicht so alltäglich gegenübertritt. Es macht das Alltägliche zu einem persönlichen Denkmittelpunkt.
Philosophieren heißt fragen nach dem, was ist; was es heißt, ein Verständnis des Erfragten zu finden, Konsens oder Dissens auszuloten und herauszufinden, worüber im Weiteren gesprochen werden soll. Es befördert die Selbstreflexionsfähigkeit und festigt das persönliche Wertebild.
Diesbezüglich macht unser Denkgegenstand – das Altern – philosophisch betrachtet keine Ausnahme. Wir wenden uns klärend der Frage zu: Was ist Alter? Was wollen wir unter Altern verstehen?
Selbstredend ist die philosophische Annäherung an dieses Thema ein Diskursangebot, von denen bereits viele bestehen. Der ideengeschichtliche Blick kann uns den Zugang zu deren Klärung wesentlich erleichtern.9 Sich selbst auf den Weg zu machen, über das Alter und Altern nachzudenken und einen ganz persönlichen Zugang zu diesem Thema zu finden, erachte ich als ebenso hilfreich. Das macht Sinn, weil es den Blick auf das eigene Leben schärft und die philosophiekritische Sicht auf das Altern unterstützt.
Wikipedia lässt uns unter dem Stichwort „Alter“ wissen: „Unter dem Alter versteht man den Lebensabschnitt rund um die mittlereLebenserwartung des Menschen, also das Lebensalter zwischen dem mittleren Erwachsenenalter und dem Tod. Das Altern in diesem Lebensabschnitt ist meist mit einem Nachlassen der Aktivität und einem allgemeinen körperlichen Niedergang (Seneszenz) verbunden.“ Unsere Alltagssprache greift auf dieses Verständnis zurück. Alt und Alter schließen nicht die ganze Lebenszeit ein, sondern wie es heißt, einen Lebensausschnitt. Das Altern beginnt nach dieser Bestimmung in einer Lebensphase, in der die jugendliche Frische verloren gegangen und die biologische Fortpflanzung nicht mehr thematisiert ist. Dieses Alter führt uns zu einem Lebensabschnitt, in dem vergangenes Leben mit Wehmut betrachtet wird und man beginnt, sich zunehmend Gedanken über das zukünftige Alter zu machen.
Das erklärt, wenn man fragen würde, was ist oder wann ist jemand alt, dass die Antworten auf Lebensjahre zielen, die mit beginnenden körperlichen Einschränkungen in Verbindung gebracht werden.
Das Englische „alter“ folgt keineswegs dieser Bestimmung. Im Langenscheidt (vgl. Wörterbuch, Englisch, 1. Teil, Berlin, München 1990, S. 31) steht al∙ter I für (ver-, ab-, um-) ändern; II: sich (ver)ändern; al∙ter∙a∙ble veränderlich, al∙tera´tion Änderung, Ver-, Ab-, bzw. Umänderung. Von einer zeitlichen Begrenzung oder eines Zeitabschnittes ist hier nicht die Rede. Alter zielt auf „Änderung“. Alter wird weder auf einen zeitlichen Lebensabschnitt noch auf eine körperliche Immobilität reduziert. „Änderung“ heißt Wandel in und zu jeder Lebenszeit eines Menschen. Dieser beginnt spätestens mit dessen Geburt, wenn nicht auch schon davor, bis zu seinem Tod.10
Für Veränderung im Alter gebrauchen wir das Wort „Altern“. Es bringt das Prozesshafte, das Verändernde menschlichen Lebens zum Ausdruck. Hier zielt der Erklärungsansatz des Alters darauf, das „Alter“ nicht erst mit dem fünftem oder sechstem Lebensjahrzehnt anzusetzen, also wenn sich die ersten signifikanten Gebrechlichkeiten einstellen, sondern „Alter“ ist weit früher anzusetzen, beginnend mit dem Leben selbst.
Biologisch betrachtet ist diese Sicht per se gerechtfertigt. Das Leben zeigt sich in natürlicher Veränderung, im Entstehen und Werden, im Wandel und Tod. In unserer Alltagssprache scheuen wir uns auch nicht davor, Lebensjahre bei Kindern und Jugendlichen in Jahren zu zählen und deren Alter zu benennen. Wir feiern den wiederholten Geburtstag und nicht das neue Alter. Wir zählen die Jahre, fixieren das Alter und lassen auf dieser Art und Weise kleine Erdenbürger alternd groß und stolz werden.
Das englische „alter“, das nicht das Altsein, sondern viel mehr das Altwerden betont, lässt eine Alterserklärung zu, die den statischen Altersbegriff in einen dynamischen umwandelt. Anders formuliert: Es macht nur Sinn, das Alter über das Altern zu definieren. Aus diesem Blickwinkel ist Alter ein zeitlicher Knotenpunkt, ein Zählmaß im Altern. Das Alter zeigt sich als Zeitmarker des Lebens.
Das Alter ist auch aufgewickeltes Altern, mit dem ein über die Zeit gewordener Alternsfixpunkt beschrieben wird. Alter ist im Leben zeitlich geronnenes Altern. Insofern haben wir mit dem Altern das alljährlich gezählte Alter aufgespult. Das aufgerollte Lebensband kommt einer Perlenkette gleich von aufgereihten Zeitpunkten, von Meilen- bzw. Zeitsteinen des Lebens.
Das Alter steht für einen zwischenzeitlichen Entwicklungsstand einer Alterung bzw. eines Älterwerdens.
Wir finden mit der Bestimmung des Alters über das Altern einen objektiven, natürlichen Zugang zum Alter. Das bedeutet aber auch, dass sich die Erklärung, was Alter ist, im Alternsverständnis auflöst. Anders formuliert: Es gibt nur das Altern, weil Alter stets als Fixpunkt, als Negation daherkommt. Altern ist fortschreitendes Alter mit aufsummierten Alterspunkten.
Das Altern setzt dem bisherigen Alter ein Ende, hebt es auf. Es bewahrt es zugleich, weil das Altern das Alter fortschreibt. Das Altern setzt das Leben fort bzw. hebt es auf eine weitere Lebens(zeit)stufe. Es verfügt über eine Dynamik, das Alter zu wandeln. Altern ist das Schwinden und Erscheinen des Alters. Indem das Altern neues Alter erzeugt, löst es das alte auf. Jede Altersauflösung bringt im Altern neues Alter hervor. Es ist das Aufheben des Werdens (von Alter im Altern), von dem Gottfried W. F. Hegel (1770 – 1832) in seiner Wissenschaft der Logik spricht. (vgl. Teil 1, ersten Buch, erster Abschnitt, Qualität, 1. Kap. Sein, 3. Aufhebens des Werdens)
Die dialektische Auflösung des Alters in ein Altern, das uns zum Grund des Lebens führt. Altern ist Leben – Leben ist Altern.
Die erste These über das Alter ließe sich als Fazit wie folgt formulieren: Das Alter ist fixiertes Altern und löst sich in ihm in der Lebenszeit auf.
Die Schlussfolgerung ist, wenn das Alter lediglich ein im Altern gewordener, aufgehobener Fixpunkt ist und für die Alternsbetrachtung eher untergeordnet scheint, schenken wir in unserer Alltagsbetrachtung dem Alter mehr Beachtung als ihm gebührt. Aus welchem Grunde machen wir das? Ist es die tiefe Sehnsucht des Menschen, alt zu werden und nicht alt zu sein? Es mag paradox klingen und dem obigen Gedankenansatz widersprechen, dass sich das Altern letztlich im Altern aufhebt. Die menschliche Abwehr des Altseins führt aber zugleich zur Abwehr des Altwerdens. Es ist unmöglich, sich aus diesem Dilemma zu befreien. Die Alternsverstrickung bleibt.11
Die zweite These für einen Diskurs über das Alter heißt: Das Alter ist ein vom Menschen erzeugter, im Vergleich zu sich selbst und zu anderen Menschen gesetzter Fixpunkt in der Zeit. Das Altern bestimmt das Alter. Unser Blick ist vielmehr auf das Alter statt auf das Altern gerichtet. Dieser Blick verschließt uns die ungetrübte Sicht auf das Altern. Das Altern wird im Alter gesehen und nicht umgekehrt.
Diese Ansicht ist aus alltäglich-menschlicher Sicht nachvollziehbar. Der Mensch hat sich die Natur mit seinem Hinzutun zum Vorbild seiner Altersbetrachtung gemacht. Das heißt, wir können das Alter anhand eines von der Natur gebotenen und vom Menschen aufgegriffenen Bewegungsrhythmus bestimmen.
Wir zählen das Alter in Jahren. Das Jahr ist fixiert durch die einmalige Umkreisung der Erde um die Sonne. Wir summieren das Jahr zeitlich in zwölf Monate auf. Ein Monat entspricht in etwa der einmaligen Umrundung des Mondes um die Erde. Der Monat zerfällt in Tage. Ein Tag ist definiert als die einmalige Selbstbewegung der Erde um die eigene Achse.
Es ist ein vom Menschen beobachteter naturgebundener Bewegungsrhythmus, den er in seiner Lebenszeit verinnerlicht hat. Wir sagen, der Mensch ist nach der Geburt Stunden oder Tage alt. Seine Lebenszeit gewinnt an Monaten; und später sprechen wir von einem Alter in Jahren. Mit jeder weiteren Erdumkreisung schlagen wir mit der Wiederkehr des Geburtstages ein weiteres Jahr drauf. Das Alter wächst zahlenmäßig; und mit dem weiteren Aufzählen der Lebensjahre altern wir – jahrein und jahraus.
Die gezählten Altersjahre führen uns letztlich zu dem, was das Alter in der Zeit ist: zum Altern. Das Alter dokumentiert das Leben in Bewegung, in Veränderung. Altern ist werdendes, wandelndes Alter. Das Alter entwickelt12 sich. Es entsteht Altern. Altern ist die immer wiederkehrende Überwindung des Alters an einem zeitlich fixierten Knotenpunkt.
Das begriffliche Verständnis des Alters und Alterns wird mit dem Hegelschen Aufheben des Werdens in einer sprachlich formulierten Doppelsinnigkeit in Verbindung gebracht. (G. W. F. Hegel: Wissenschaft der Logik, 1. Teil, 1. Buch, 1. Abschnitt, Qualität, 1. Kapitel Sein, 3. Aufheben des Werdens)
Natürlich versuchen auch andere Wissenschaften bzw. Fachgebiete, die mit dem menschlichen Alter und Altern in Berührung kommen, ihre Sichtweisen und Erklärungen einzubringen, die Ausgangspunkt für weitere Überlegungen werden.
Die Psychologie spricht von einem subjektiven Alter. Das Alter wird gefühlt, und wir sagen: Ich bin so alt, wie ich mich fühle. Die Ökonomie macht das Alter von der Leistungskraft eines Arbeitsnehmers abhängig. Die Rentenversicherung schafft das Übrige: Alt ist der, der in Rente geht. Politik und Gesellschaft machen das Alter primär an der Zeit vor und nach dem Rentenbeginn fest. Die Biologie knüpft es an die Fortpflanzungsfähigkeit. Die Medizin knüpft das Alter an das menschliche Gesundheits-Krankheitspotenzial. Physik und Technik binden das Messen eines Alters an natürlichen Verschleiß und Gebrauch.
Das Alterskriterium folgt nicht dem Altern, dem jedes Alter zugrunde liegt, sondern dem vom Menschen selbst gesetzten Altersmaß.
Solange das Werden von Alter nicht außer Acht gelassen wird, ist dem nicht zu widersprechen. Die Reduktion des natürlichen Alterns auf ein fixiertes Alter hingegen nimmt uns die Möglichkeit, das Alter als einen historischen Moment, als einen Wimpernschlag des Alterns zu betrachten. Umgekehrt reicht es nicht aus, das Leben auf das Alter zu reduzieren, das als Zeitpunkt des Lebens erscheint.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist also nur über das Altern und nicht über das Alter zu beantworten. Altern ist der lebendige, natürliche Ausdruck des Lebens, der uns den späteren Zugang zur Frage nach dem Sinn des Alterns erschließt.
Als wenig hilfreich erscheint die Gegenüberstellung von Jung und Alt, die formal gegensätzlich die Ausschließlichkeit der beiden Altersmerkmale betont: Alt ist nicht jung – Jung ist nicht alt. Es werden lediglich Alterszeiten gegenübergestellt, wie wir sie aus unserem alltäglichen Sprachgebrauch kennen. Es ist ein Konstrukt, um den Altersunterschied an gelebten Jahren zu verdeutlichen. Alternsbezogen bleibt jung auch alt an aufgewickelten Lebensjahren.
Wollen wir das Altern dennoch in Jung und Alt festhalten, so ist das gleichsam ein von uns Menschen geschaffener Anhaltspunkt, das Altern zu „sortieren“. Sind die „Twenties“ verlebt, wendet sich das Altern in ein Alter. Von Jungsein ist kaum noch die Rede, es sei denn, der, die, das Alte wird als Vergleich herangezogen.
Mit dem demografischen Wandel haben auch solche Begriffe Einzug gehalten wie Veralterung oder Entjüngung (in) der Gesellschaft. Hier wird das gesellschaftspolitische Altern philosophisch aufgeschlossen.
Seit Jahren pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Unsere Gesellschaft, genauer gesagt, die Menschen in der Gesellschaft werden älter. Die Lebenserwartung der heute Geborenen im Vergleich zu denen vor etwa 50 Jahren ist durchschnittlich um zehn Jahre gestiegen. Jeder neue Geburtsjahrgang hat etwa eine einmonatige höhere Lebenserwartung als der vorrangegangene Geburtsjahrgang.
Es werden immer mehr über 65jährige. Hundertjährige sind heute keine „Altersexoten“ mehr. Der Anteil jüngerer Menschen im erwerbsfähigen und -tätigen Alter dagegen schrumpft.
Der Begriff der Alterung bzw. Veralterung der Gesellschaft macht seine Runde. Er beschreibt eine wachsende Zunahme des Anteils der Bevölkerung mit höherem Alter ab 65. Diese Veränderung wird vielfach auch als demografischer Wandel beschrieben – u. a. als eine Bevölkerungsentwicklung, mit der sich die Altersstruktur in Richtung Älterwerdender13 verschiebt.
Was ist zum gesellschaftlichen Alterswandel philosophisch anzumerken? Welche sozialphilosophischen Fragen resultieren aus dieser Entwicklung? Was heißt Wandel? Was heißt Veralterung?
Veralterung steht vielfach im Verständnis für eine Umverteilung der Alterskohorten zugunsten älterer Lebensjahrgänge. Doch der Begriff der Veralterung ist nicht allein auf einen rein formalen statistischen Kontext reduzierbar. Er scheint auch andere Dimensionen in sich zu tragen, die mit dem Biologischen, Politischen, Ökonomischen, Soziologischen, Psycho-Sozialen ausgestattet sind und zugleich einen philosophischen Kontext tragen.
Der Begriff des Wandels, um einen Unterschied zu den Begriffen Bewegung, Veränderung oder Entwicklung auszumachen, ließe sich eine Art von Veränderung bestimmen, die mit einer Gestalts- bzw. Strukturveränderung einhergeht. Insofern kann der demografische Wandel als eine strukturelle Veränderung der Alterskohorten angesehen werden, was eine quantitative Umschichtung der Altersjahrgänge zugunsten der Älteren bedeutet und Folgen für das gesamte gesellschaftliche Gefüge hat. Es ist nicht nur das Straßenbild, das sich optisch verändert. Es sind auch neuartige Lebensweisen und daraus entstehende Anforderungen an die Märkte, die die älteren Menschen als Zielgruppe für sich gewinnen wollen. Demografischer Wandel ist kultureller und sozial-ökonomische Lebenswandel, die auch die politische Landschaft verändern.
Vor diesem Hintergrund wird zugleich eine weitere begleitende demografische Veränderung ausgemacht. Weniger geläufig fällt in diesem Kontext der Begriff der Entjüngung. Steht Entjüngung für Veralterung? Ist es ein anderes Wort mit gleichem Bedeutungsinhalt? Dies macht wenig Sinn. Es lohnt also, sich um eine begriffliche Differenzierung zwischen Entjüngung und Veralterung zu bemühen. Sie beschreiben zwei Erscheinungsformen des demografischen Wandels mit eigenständiger, abgrenzender Bedeutung und funktionaler Ausrichtung. Beide führen uns zu einer Gesellschaft mit wachsenden Alterskohorten. Doch die Ursächlichkeiten des Altersstrukturwandels sind jeweils andere.
Die Veralterung ist das Ergebnis nicht ausreichender nachwachsender Geburtsjahrgänge. Der kindliche und jugendliche Nachwuchs ist zu klein. Die Alterspyramide in Gestalt einer klassischen Tanne wie noch vor gut einhundert Jahren verformt sich in einen Laubbaum. Die Kopflastigkeit der Alterspyramide ist unübersehbar. Der Geburteneinbruch Anfang der 70er („Pillenknick“) und der der 90er („Wendeknick“) sowie die Abschwächung der Geburtenraten in den Folgejahren ließen den Anteil älterer Menschen im Vergleich zu den jüngeren anwachsen.
Die Veralterung ist in einem veränderten sozial-ökonomischen Lebensumfeld primär biologisch-generativ begründet. Mehrkindfamilien, wie sie noch in den 60er Jahren zum Familienbild gehörten, verschwanden immer mehr und sind heute eher gering. Der geistigkulturelle und wirtschaftlich-technische Wohlstand hat die Familienstrukturen grundlegend verändert.
Die Entjüngung ist ein besonderes, bis heute nicht ganz aufgehobenes Phänomen des demografischen Wandels, das die Veralterung ergänzt. Unmittelbar nach der Wende 1989/90 wanderte viel Frauen im gebärfähigen Alter in die alten Bundesländer ab. Die Chance, bei der hohen einheimischen Arbeitslosigkeit im westlichen Teil Deutschlands wieder Arbeit zu finden, war wesentlicher größer. Die Abwanderung setzte sich in Gang. Aufgrund des nach wie vor bestehenden Gefälles in den Gehalts- bzw. Lohnzahlungen gleicher Berufe gehen bis heute junge Menschen aus dem „Osten“ in den „Westen“. Geld und Wohlstand, wenn auch im Vergleich vor dreißig Jahren abgeschwächt, sind nach wie vor die treibenden Kräfte für eine Entjüngung.
Entjüngung hat eine ausschließlich sozial-ökonomische Begründung in der Veralterung der Gesellschaft, die insbesondere die neuen Bundesländer betrifft. Dabei sei von der Tatsache abgesehen, dass aus den westlichen Landesteilen Deutschlands ältere, in Rente und Pension gegangene Menschen aufgrund von Klima, Natur und einer beschaulichen Infrastruktur ihren Lebensabend im Nordosten verbringen wollen, was zwar marginal, aber zusätzlich die Veralterung der Bevölkerung begünstigt.
Die Quintessenz: Ältere werden durch diese Bedingungen älter, ohne selbst (biologisch und zeitlich) älter zu werden.
Das ruft erneut die Ethik auf den Plan. Ist der demografische Wandel mit all seinen Erscheinungsbildern Ausdruck menschlichen und gesellschaftlichen Verschuldens? Wenn ja, wodurch ist es begründet?
Menschliche und gesellschaftliche Geschichte ist nicht geradlinig. Es hat schon immer ein Auf und Ab gegeben. Es sind Wellen des Auf -, Ab- bzw. Niedergangs, von denen der Mensch angepasst sich immer wieder erholen konnte. Vielleicht haben wir es auch mit einem ganz natürlichen Vorgang zu tun, dass im Laufe der menschlichen Geschichte demografische Wellen stattfinden. So erfahren wir eine Oszillation, ein Auspendeln von Verjüngung und Veralterung in der Gesellschaft.
Des Weiteren ist im Zuge des demografischen Wandels auch von einer Überalterung die Rede. Sie ist berechtigt besorgniserregend, weil mit ihn eine übergebührliche Veralterung zum Ausdruck gebracht wird, mit negativen Folgen für die Gesellschaft einhergeht. Die Regeneration ist nachhaltig geschwächt. Den Mangel an Regenerationsfähigkeit betrachte ich als eine politische und sozioökonomische Verfehlung, die die Zukunft einer Gesellschaft in Gefahr bringt.
Die Verantwortung für derartige Entwicklungen tragen wir alle, unabhängig des Altersunterschiedes, jeder auf seinem Platz im gesellschaftlichen Leben. Es macht keinen Sinn, einzig und allein der Politik oder der Wirtschaft den „Schwarzen Peter“ in die Schuhe zu schieben.
Die Verantwortung für ein gesundes Älterwerden beginnt bereits bei uns selbst.
8 In gebotener Ausführlichkeit sind sie in Alles Wirkliche ist Begegnung im Kapitel Philosophieren. Eine Begegnung mit der Wirklichkeit, S. 35 ff., erläutert. (vgl. Hans-Jürgen Stöhr, Books on Demand, Hamburg 2019)
9 Verwiesen sei u. a. auf Platon, Aristoteles, Cicero, Seneca, Musonius, Montaigne, Schopenhauer, Grimm, Bloch, Hesse oder Simone de Beauvoir. (vgl. Gutes Leben im Alter. Die philosophischen Grundlagen, hrsg. v. Thomas Rentsch, Morris Vollmann, Reclam, Stuttgart 2017)
10 Der Vollständigkeit sei erwähnt, dass für Alter bzw. Lebensalter das englische Wort „age“ zur Verfügung steht. (vgl. a.a.O., S. 27). Es drückt auch „Reife“, „alt werden“ und „altern“ aus. Letzteres führt uns wieder zu alter, was m. E. an den oben formulierten Aussagen wenig ändern würde.
11 Ungeachtet dessen hält der Mensch an dieser Lebenszeitverstrickung fest. Die Hoffnung, dass sie sich doch noch erfüllt, ist nicht ganz unbegründet. Die gegenwärtige und weiterhin zu erwartende Alternsforschung ist auf dem Wege, alles dafür zu tun, das Leben (Altern) zu verlängern, zu verzögern bzw. umzukehren. Im ersten Kapitel des Epilogs „Alt werden war gestern […]“ gehe ich näher darauf ein.
12 „Das Alter entwickelt sich“, ist sprachlich nicht ganz korrekt, wenn wir das Entwickeln als ein Abwickeln verstehen. Unser Leben in Jahren aufgezählt ist im Grunde nach ein Aufwickeln. Wir häufen mit unserem Leben aneinander gereiht Lebensjahre an.
13 Das Älterwerden hat in der Altersstruktur zwei Determinanten: Es ist erstens der Zuwachs an Älteren über 65 Jahre im Vergleich zu anderen Alterskohorten. Zweitens haben wir es mit einer höheren Lebenserwartung der Älteren zu tun, die den Anteil jener Altersgruppe größer werden lässt.
Es ist nicht wenig Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Lucius Annaeus Seneca (1 – 65 n. Chr.)
ALTERN ∙ Warum braucht es dafür k eine Zeit?
Jeder Mensch weiß es: Wir werden älter. Der jährliche Geburtstag erinnert uns daran, dass wir das Zählen der Lebensjahre nicht vergessen. Sie sind zeitliche Marker, an denen wir uns orientieren und miteinander vergleichen.
Mit zunehmendem Alter wächst der Stolz auf wachsende Lebensjahre. Er wandelt sich in Demut oder Wehklagen, wenn uns bewusst wird, dass uns nicht gelebtes Leben einholt.
Dieses Bedauern begleitet viele Menschen. Wodurch ist es begründet? Finden wir darauf eine Antwort?
Es ist keinesfalls ein neuzeitliches Phänomen. Darüber konnte schon Seneca jr. (1 – 65 n. Chr.) berichten und schreibt in „Von der Kürze des Lebens“ (De brevitate vitae): „1. Die meisten Menschen […] beklagen sich über die Missgunst der Natur: Nur für eine kurze Spanne Zeit werden wir geboren, und diese zugestandene Frist läuft so rasch, ja rasend schnell ab, dass das Leben die Menschen, mit nur wenigen Ausnahmen, verlässt, während sie sich gerade im Leben einrichten. […] Aber nein, wir haben keine zu geringe Zeitspanne, sondern wir haben viel davon vergeudet. Lang genug ist das Leben und reichlich bemessen auch für die allergrößten Unternehmungen – wenn es nur insgesamt gut angelegt würde. Doch sobald es in Verschwendung und Oberflächlichkeit zerrinnt, sobald es für keinen guten Zweck verwendet wird, dann spüren wir erst unter dem Druck der letzten Not: Das Leben, dessen Vergehen wir gar nicht merkten, ist vergangen. […] Wir haben keine kurze Zeit empfangen, sondern es kurz gemacht; keinen Mangel an Lebenszeit haben wir, sondern gehen verschwenderisch damit um.“ (Reclam, Nr. 11105, Stuttgart 2017, S. 9 f.)
Senecas Gedanken führen Altern und Zeit zusammen. Sie lassen zwei Wege des Überlegens zu: Der eine ist, dass der Mensch nicht in der Lage ist, Zeit als Lebenszeit bewusst für sein Leben nutzbringend und sinnvoll einzusetzen. Damit verpasst er, dem Leben seinen Wert zu geben, weil es mit seinem Dasein per se nicht wertlos ist, selbst dann nicht, wenn es als wertfrei zu betrachten ist.
Der andere Gedanke ist bestimmt durch Sorglosigkeit oder von derartiger Leichtigkeit des Lebens, die die Lebenszeit außer Acht lässt. Doch mit der Späte des Lebens dringt diese sogenannte Gedankenlosigkeit ins Bewusstsein und das Wehklagen nimmt seinen Lauf.
Senecas Zeitbetrachtung über das Leben wirft Fragen auf: Braucht das Altern ein Zeitverständnis? Lässt sich das Altern auch ohne Zeit denken?
Diesen Fragen nachzugehen, scheint absurd und absolut fehlschlüssig zu sein. In unserem Alternsverständnis war Zeit immer präsent und mitgedacht. Warum sollte das jetzt anders sein?
Es gibt keinen hinreichenden Grund, das Leben und das Altern ohne Zeit zu denken. Und dennoch käme es auf einen Versuch an. Den Grund dafür sehe ich im menschlichen Umgang mit Zeit. Beobachten wir den Alltag und das Arbeitsleben, erhalten wir nicht nur den Eindruck, sondern erfahren unmittelbar, wie Zeit unser Leben „auffrisst“. Alles wird der Zeit untergeordnet. Alter und Altern – stets stehen sie in einem zeitlichen Kontext. Deshalb die Fragen: Können wir das Altern auch ohne Zeit denken und erleben? Ist ein Altern möglich, ohne immer die Zeit im Nacken zu haben?
Zeit und Zeiterleben. Zeit hat in und mit uns eine unübersehbare Wirkungsmacht. (vgl. H.-J. Stöhr, Alles Wirkliche ist Begegnung, BoD, Hamburg 2019, S. 328 ff.) Sie in Frage zu stellen, wäre für unsere Alltagsbewältigung sträflich. Sie ist überall, gefühlt, im Denken und Handeln präsent. Und dennoch ist es nach wie vor ein Rätsel, sodass es uns nicht gelingt, auf Zeit eine befriedigende Antwort zu geben.
Klammern wir uns an ein Phänomen, das es objektiv gar nicht gibt und nur in unserer Lebensvorstellung existiert? Das zu bekräftigen und Zeit seiner Objektivität zu nehmen, würde dem Zeitverständnis in keiner Weise gerecht werden. Wir scheinen in einem Dilemma zu stecken. Wir sind unsicher, ob Zeit objektiv real, d. h. außerhalb des menschlichen Bewusstseins existiert, oder ob es ein reines Gedankenkonstrukt ist, umso besser mit den realen Lebenssituationen zielführend und mit Erfolg umzugehen.
Ist es nicht die eigentümliche Nichtigkeit, auf die Rüdiger Safranski (vgl. Zeit. Was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen, Carl Hanser Verlag, 2015, S. 135) mit Verweis auf den Heiligen Augustinus (354 – 430 n. Chr.) aufmerksam macht: Sie, die Zeit, ist und sie ist es auch wieder nicht. (vgl. Bekenntnisse, 11. Kapitel)
Treten wir aus uns selbst heraus und schauen uns die Zeit „von oben“ an. Wir begegnen der natürlichen bzw. organischen Zeit. Unsere Erfahrung von der Naturzeit rekrutieren wir aus der Tatsache von Regelmäßigkeiten (Wiederholungen, Wiederkehrungen) in Naturereignissen. Es gehört zu unseren Erkenntnissen, dass die Erde sich um die Sonne, um ihre eigene Achse dreht und der Mond sich um die Erde bewegt. Es ist ein milliardenfach sich wiederholendes Naturgeschehen. Wir haben diesem Geschehen eine Zeiteinheit gegeben. Wir nennen es Jahr, Tag und Monat.
Wir wissen, dass unsere Natur sich in wiederkehrenden Jahreszeiten zeigt. Wir kennen Ebbe und Flut. Diese natürlichen Bewegungen offenbaren ihren zyklischen Charakter. Wir geben ihnen eine Zeit.
Einer anderen, ebenso natürlichen Zeit begegnen wir, wenn wir uns eine Vorstellung vom Entstehen und Werden unseres Universums machen. Vor ca. 14 Milliarden Jahren hat uns der Big Bang die Entstehung eines Universums beschert. Es breitet sich aus und die Astrophysiker sind in der Lage, in die Vergangenheit des Weltalls zu sehen. Bewegung der Himmelskörper, ein mit ihm entstandener Raum und die Bewegung des Lichtes (Lichtgeschwindigkeit) lassen Zeit aus ihrem Zyklus heraustreten. Haben wir es hier noch mit einem aus unserem Lebensalltag bewährten Zeitverständnis zu tun? Zeit ist im Universum eine andere, nicht mit unserer Alltagszeit, gemessen mit unserer Uhr, vergleichbar.
Natürliche Zeit erfährt mit der Wiederholbarkeit natürlicher Erscheinungen nicht nur etwas Bewegendes, sondern zudem auch zeitlich Verschiedenes. Das sich Wiederholende ist Gegenwärtiges, Vergangenes und Zukünftiges zugleich. Wir bilden mit der Zeit Historie ab. Das betrifft unser Universum ebenso wie die Erdgeschichte und die Evolution von Fauna und Flora.
Zeit ist in Geschichte gegossenes Sein. Sie zeigt sich als Gewordenes aus Vergangenem, als Gegenwärtiges im von uns unmittelbar Wahrgenommenen; sie ist Werdendes und für den Menschen zu Erwartendes. Die Zeit tritt aus ihrer Zyklizität heraus und uns als eine natürlich-historische Zeit gegenüber.
Der Mensch wird geboren und findet im Tod sein Lebensende. Technische Geräte werden gebaut, verschleißen mit ihrem Gebrauch und werden zu Schrott. Wir nennen es Lebenszeit; die eine ist von menschlicher, die andere von technischer Natur – ganz ohne Zyklus. Es sind verlebte und verbrauchte Zeiten.
Wir erfahren den Zeitenwandel unmittelbar in und mit unserem Leben, auf den selbst und mit dem Altern noch einzugehen ist. Es ist menschliche Zeit. Als solche ist sie reale und wirkende, von Menschen hervorgebrachte Zeit.
Die menschliche Zeit äußert sich in verschiedenen Zeitbildern. Damit sind Zeiten gemeint, die der Mensch durch sein Denken und Handeln „geschaffen“ hat. Es sind seine Erfahrungen und denkbaren Zeitperspektiven, die Wirklichkeiten in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zu denken, auch wenn wir sie in ihrer Unmittelbarkeit nur im Gegenwärtigen wahrnehmen und das Vergangene und Zukünftige für uns nur vermittelt existiert. Wir verknüpfen das Gewesene mit Erinnerung, Erfahrung bzw. Wissen; das Vorausschauende verbinden wir mit Vorwegnahmen, Antizipation oder Zukunftsdenken.
Es gibt eine ökonomische Zeit, die im Zusammenhang mit Effektivität und Effizienz menschlichen Handelns und Produzierens steht.
Wir kennen eine künstliche, mittels Technik geschaffene Zeit. Sie hat ihre Quelle in der natürlichen, zyklisch angelegten Zeit. Der Mensch hat dieser Zeit ein menschliches Gesicht gegeben. Mit seiner Sonnen-, Sand, Wasser-, Wand-, Armband- Kirchturm- oder Atomzeituhr hat sich der Mensch im Laufe der Geschichte seine Zeit mittels einer Uhr geschaffen.