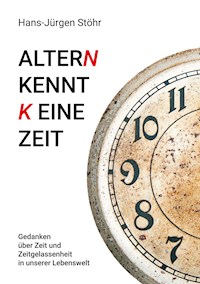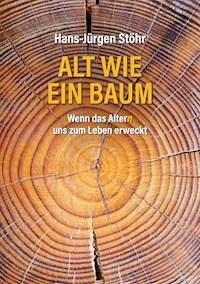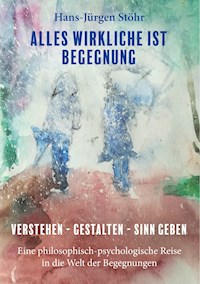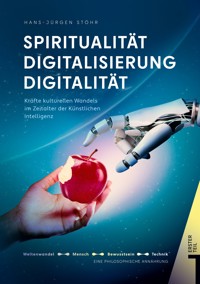
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was passiert, wenn sich Spirituelles und Digitales begegnen, die auf den ersten Blick eher miteinander fremdeln? Beide haben ihre eigene Quelle und Geschichte. Zwischen ihnen liegen ca. 70.000 Jahre. Vor knapp einhundert Jahren hat nun auch das Digitale die Bühne der Moderne betreten. Mit dem 21. Jahrhundert wurde aus dem Neben- ein Miteinander von Spirituellem und Digitalem. Spirituelle Digitalität und digitale Spiri-tualität gewinnen neue Lebensräume. Sie stehen für eine Kultur und erweisen sich als treibende Kräfte des gesellschaftlichen Lebens. Wie wurde ein derartiges Zusammengehen möglich? Was bedeutet das Aufeinandertreffen von Spiritualität und Digitalität für Mensch, Technik und Gesellschaft? Welche neuerlichen Kräfte werden freige-setzt? Die zentrale These des Buches ist: Spirituelles und Digitales sind für den Menschen essenziell. Die Entwicklung der Künstlichen Intelli-genz bedarf des Gebotes einer bewusst zu gestaltenden Kultur des Spirituellen. Das sozialkritische und zugleich mutmachende Buch beschreibt im ersten Teil den Weltenwandel, erzählt die Erfolgsgeschichte erwa-chenden Denkens und beschreibt die Qualitäten und Entwicklungen des Bewusstsein und der Intelligenz des Menschen. Es wird die Technikentwicklung in der Geschichte der Gesellschaft bis zur Digi-talisierung nachgezeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Jubiläumsjahr 2024
zu Ehren eines deutschen Philosophen
anlässlich seines 300. Geburtstages
IMMANUEL KANT (1724–1804)
Was ist Aufklärung?
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“
Berlinische Monatszeitschrift Dezemberheft 1784, S. 481-494
Brauchen wir ein neues Verständnis über unser modernes Leben?
Was passiert, wenn Spirituelles und Digitales aufeinandertreffen?
Was macht zwischen Spirituellem und Digitalem das Verbindende und Trennende aus?
Wie viel Künstliche Intelligenz tut dem Menschen gut?
Wohin geht der Mensch?
Brauchen wir eine neue, auf Spiritualität und Digitalität ausgerichtete Lebenskultur?
Ist die Zeit reif für eine Ethik des spirituellen und digitalen Humanismus?
„Nach einer Zeit des Verfalls kommt die Wendezeit. Das starke Licht, das zuvor vertrieben war, tritt wieder ein. Es gibt Bewegung. Diese Bewegung ist aber nicht erzwungen […] Es ist eine natürliche Bewegung, die sich von selbst ergibt. Darum ist die Umgestaltung des Alten auch ganz leicht. Altes wird abgeschafft, Neues wird eingeführt, Beides entspricht der Zeit und bringt daher keinen Schaden.“
Aus dem Buch der Wandlungen I Ging zitiert von Fritjof Capra in Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild S. VII, Scherz Verlag 1990
INHALT
Vorwort
Beginn einer
ver
rückten Idee
Einleitung
Einladung zu einer außergewöhnlichen Begegnung
Erster Teil
Weltenwandel ∙ Mensch ∙ Bewusstsein ∙ Technik
Eine philosophische Annäherung
I. Welt der Moderne im Wandel ∙ Sprachphilosophische Miniaturen
Welten menschlichen Lebens und menschliche Lebenswelt
Weltenwandel und Wandlungen des Menschen
Menschenbild in der digitalisierten Lebenswelt
II. Bewusstsein und bewusstes Sein
Erwachendes Denken ∙ Eine Erfolgsgeschichte des menschlichen Geistes
Bewusstsein ∙ Geisteskraft mit Wirkung
Beobachtung, Wahrnehmung, Vorstellung ∙ Denkformen mit Folgen
Erfahren, Erkennen, Wissen ∙ Gewandeltes bewusstes Sein
Wissen, Meinen und Glauben ∙ Grenzgang zwischen den Wahrheiten
III. Technik und Digitalisierung
Technik ∙ Zweitnatur mit Wirkungskraft
Digitalisierung ∙ Technikentwicklung 4.0
Analoges und Digitales ∙ Grenzgang mit Passfähigkeit zum Spirituellen
Zweiter Teil
Spiritualität ∙ Digitalität ∙ Humanität ∙ Resonanz
Werte neuzeitlichen Lebens
IV. Spirit und Spiritualität
Diesseits und Jenseits ∙ Seiten und Grenzgang in einer Lebenswelt
Spirit ∙ Das andere Seinsbewusstsein
Wege zum Spirituellen ∙ Quellen und treibende Kräfte
Spiritualität ∙ Korrektiv in der digitalen Lebenswelt
V. Kulturwandel und Digitalität
Digitalisierte Lebensqualität ∙ Zeit und Schnelllebigkeit
Digitalität ∙ Kultur von gewandelter Drittnatur
Digitale Lebenskultur ∙ Über (Un-)Sinn und Kritik
VI. Spiritualität und Digitalität
Spirituelles und Digitales ∙ Von Dialektik beseelt
Digitale Spiritualität und spirituelle Digitalität ∙ Neue Lebenswirklichkeiten
Spiritualität und Digitalität ∙ Qualitäten des Lebens im Grenzgang
EPILOG
Spiritualität ∙ Digialität ∙Resonante Humanität
Digitaler und spiritueller Humanismus ∙ Wegbereiter zur resonanten Humanität
Ein Resümee ∙ Unsere Lebenswelt für einen resonanten Humanismus ∙ Vierzehn Thesen und ihre Botschaften
Literaturempfehlungen
Personen- und Sachregister
Autor
VORWORT
Beginn einer verrückten Idee
Es muss eine verrückte Eingebung gewesen sein, als ich zur Corona-Zeit intuitiv die Phänomene Spiritualität und Digitalisierung in Beziehung setzte. Was sollte sie miteinander verbinden? Beide haben ihren Platz in der Gesellschaft mit einer jeweils eigenen Geschichte. Mir fiel anfänglich nichts dazu ein. Ich war neugierig herauszufinden, welche Gedanken freigesetzt werden, wenn ich die Spiritualität und die Digitalisierung unserer Lebenswelt verknüpfen würde.
Es hatte sich bei mir die Idee festgesetzt, dass es zwischen dem Spirituellen und Digitalen eine reale Verbindung gegeben müsste und es sich philosophisch – dialektisch wie ethisch – lohnen würde, den Zusammenhang, eine Wechselwirkung ausfindig zu machen.
Je mehr ich mir Zeit nahm, eine Verbindung zwischen Digitalisierung und Spiritualität erkennen und beide Phänomene in den aktuellen gesellschafts-(gesundheits-)politischen Kontext stellen zu wollen, desto stärker wuchs die Gewissheit, dass sich zwischen ihnen eine Schnittmenge gegenseitiger Wirksamkeit aufdecken lassen würde.
Es war für mich eine herausfordernde Verlockung, durch Inspiration oder Intuition gespeist, durch die Corona-Pandemie angestoßen und durch die Politik aufgefordert, die Digitalisierung schneller auf den Weg zu bringen, mit dem Digitalen Spirituelles und umgekehrt erfahrbar zu machen.
Mir war bewusst, dass die Suche nach einer bestehenden Wechselbeziehung einem Abenteuer glich, ohne zu wissen, ob sich die Mühe des Nachforschens jemals lohnen würde. Ein positives Ergebnis analytischer, deskriptiv-philosophischer Arbeit konnte ich bei bestem Wohlwollen nicht antizipieren. Es war lediglich die Idee geboren. Sie hatte sich unwiderruflich in meinem Kopf festgesetzt, hierzu ein Manuskript zu verfassen und die vierten Rostocker Philosophischen Tage1 über den Wirkungszusammenhang zwischen Spiritualität und Digitalisierung durchzuführen zu wollen. Ich empfand die Herstellung eines derartigen Zusammenhangs als etwas Besonderes und war überzeugt, dass es viele geben würde, die ebenfalls neugierig waren, in einem öffentlichen Diskurs über die Spiritualität und Digitalisierung unserer Lebenswelt zu philosophieren.
So hatte ich mir Aufgabe gestellt, mich dem dialektischen Zusammenspiel von Spirituellem und Digitalem zu nähern – und das bei dem Wissen, dass der gegenseitige Einfluss vor etwa dreihundert oder gar erst vor einhundert Jahren seinen Anfang nahm.
Eine Verbindung zwischen ihnen gab es lange Zeit nicht, weil 70.000 Jahre menschliche Geschichte als eine Geschichte des Spirituellen ohne das Digitale verliefen. Die Digitalisierung unserer Lebenswelt, wie wir sie heute kennen, war schlicht und einfach in unserem Leben nicht präsent.
Die Kernthese, mit der ich schwanger ging, folgte der Überlegung, dass die Spiritualität sich als eine Geisteskraft zeigt und wie ein Katalysator wirken muss, um der Gefahr einer ausufernden, unbeherrschbaren Digitalisierung Einhalt zu gebieten. Ich hatte mir die Aufgabe gestellt, diese These zu verifizieren und der Idee nachzugehen, dass im gesunden, von Humanismus getragenen Spiritualismus die Kraft einer Neutralisierung digitaler Ungezügeltheit steckt und zur Wirkung zu bringen ist.
Dabei war es mir wichtig, nicht nur Spirituelles mit Digitalen zu knüpfen, zwischen ihnen Zusammenhänge und Wechselwirkungen aufzudecken, sondern aus der dialektischen Deskription auch die Frage aufzuwerfen: Brauchen wir angesichts eines wachsenden Zusammenspiels beider eine weiterzuführende Ethik, die einen spirituellen und digitalen Humanismus zum Inhalt hat?
Das vorliegende Manuskript verfolgt den Charakter eines philosophischen Sachbuches. Es ist primär für jene geschrieben, die Freude am Philosophieren haben und für jene, die an der beschriebenen Verknüpfung von Spirituellem und Digitalem Interesse zeigen. Es gibt drei Gründe für den teilweise etwas schwerfälligen Zugang zu den Texten:
Erstens. Es ist der Versuch einer philosophischen Annäherung zwischen Spiritualität und einer sich digitalisierenden Lebensgestaltung, der allein in der Sache schwer zu vermitteln ist, weil jeder, der damit konfrontiert wird, sich fragt, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Es braucht seine Zeit, den ersten Gedanken einer Verbindungslosigkeit zwischen dem Spirituellen und Digitalen aufzulösen und sich dieser Problematik nähern zu wollen. Zweitens. Im philosophischen Diskurs wird hinsichtlich der Logik und Tiefe der Abhandlungen deutlich, dass wir es mit einer dialektischen Beziehung zu tun haben, die in der Darstellung wie im Verstehen die Dialektik als Denkprinzip einfordert, um der realen (objektiven) Dialektik in und zwischen dem Spirituellen und Digitalen gerecht zu werden. Drittens. Sachverhalte, Gegebenheiten, Prozesse dialektisch zu beschreiben, d. h. in Bedingtheit und Bestimmtheit, in Kausalität, Veränderung und Entwicklung sowie in einer sich ein- wie ausschließende Gegensätzlichkeit abzubilden, ist an sich schon ein schwieriges Unterfangen. Das dialektische Denken und die bewusste Anwendung der Dialektik als Methode zur theoretischen Widerspiegelung unserer Lebenswirklichkeit ist uns Menschen nicht a priori in die Wiege gelegt. Es muss regelrecht erarbeitet werden. Das Alltagsdenken, das vielfach von linearen Kausalitäten lebt und uns nicht selten zu einem animistischen Denken verführt, zwingt uns nicht immer ein dialektisches Denken ab. Dennoch bleibt es mein Anspruch, dialektische Lebenswirklichkeiten mittels adäquater Theorie und Methode, d. h. dialektisch, zum Ausdruck zu bringen.
Dafür gab es nach meinem Dafürhalten zur Zeit der Corona-Pandemie, wie über ihren Ursprung, ihre Wirkungsweise und Umgang mit ihr gedacht wurde, allen Grund. Der Zeitgeist spirituellen Denkens und Handelns hat sich gewandelt; sein Wesen blieb bis heute unberührt. Die moderne Fassung drückt sich nach wie vor in Gestalt des Archaisch-Animistischen aus. Es äußert sich u. a. in menschlicher Urangst, Lebensverunsicherung und Gefahren des Verlustes an Kontrolle über das eigene Leben.
Die Komplexität unserer Lebenswirklichkeit, bestimmt durch den menschlichen Willen einer gleichzeitigen Beherrschung von Globalisierung und Digitalisierung, Weltgesundheit und Natur- bzw. Umweltschutz, führt bei einzelnen Menschen zur Überforderung praktischer Lebensüberschaubarkeit. Die heute verfügbare digitale Lebenshilfe, d. h. die Nutzung des kommunikativen Austausches in den sozialen Netzwerken und der Zugang zu den vielfältigsten You-Tube-Kanälen, wurde zu einer Plattform, auf denen sich archaisches und insbesondere animistischen Denken platzieren konnten. Die Vielzahl von Verschwörungsnarrativen zur Corona-Pandemie, darin eingebunden Weltwirtschaftsverschwörungen, offenbarten sich als ein modernes Format derartigen Denkens. Es wurden Scheinkausalitäten produziert. Ursache-Wirkungsbeziehungen waren auf den Kopf gestellt. Das Fehlen der gemachten Erfahrung erleichterte den Zugang zum spirituellen Denken.
Bei allem Bemühen, der Dialektik des Lebens so nah wie möglich heranzukommen, in der Darstellung uns der realen Lebenswirklichkeit weitestgehend zu nähern, bleibt das Spannungsfeld zwischen einer dialektischen Wirklichkeitsbeschreibung als Erklärung auf der einen und deren Verstehen auf der anderen Seite bestehen. Es mögen mir jene nachsehen, die die Mühe nicht scheuen, sich in die Texte einlesen zu wollen.
In einigen Kapiteln werden Redundanzen vermittelt. Die im ersten Teil des Buches entwickelten Gedanken werden im zweiten Teil erneut aufgenommen, um sie in einen neuerlichen Kontext zu stellen und weiterzuführen. Das macht die gedanklichen Zusammenhänge zwischen dem vorerst Allgemeinen und späteren Einzelnen transparenter. Dabei sind manche Wiederholungen nicht ausgeschlossen, um den Lesenden das Zurückblättern zu ersparen.
Das vorliegende Buch mag Zeugnis sein, sich jenen kraftvollen Wirkungsmächten wie Spiritualität und Digitalisierung anzunähern und sie philosophisch und ethisch zu durchdringen. Philosophisch interessant ist die Verknüpfung zwischen ihnen allemal. Es ist und bleibt die verrückte Vorstellung, dass Spirituelles und Digitales – so zusammenhangslos sie beim ersten, spontanen Vordenken erschienen – das menschliche Leben und die Gesellschaft wirkungskräftig beeinflussen. Jedes Phänomen ist für sich in den Gedanken nachvollziehbar. Eine Brücke zwischen ihnen herzustellen, ihre Wirkungsmächte wechselseitig auszuloten, das ist zweifelsohne philosophisches Neuland. Wir tun gut daran, ihnen Raum für weiterführende Diskurse zu geben.
Ich möchte die Leserinnen und Leser, die Interesse an der Dialektik zwischen Spirituellem und Digitalem zeigen, zum folgenden deskriptiven Wechselspiel einladen, der mit menschlicher Verantwortung in einen resonanten Humanismus mündet.
Hans-Jürgen Stöhr Rostock im Frühjahr 2024
1 Seit 2016 finden in Rostock die Philosophischen Tage statt. Die ersten Rostocker Tage waren der Frage nach dem guten Leben gewidmet. Die Philosophischen Tage 2018 stellten die Gesundheit in das Zentrum des Diskurses. Für 2020 – aufgrund der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben – stand das Altern und Jungbleiben im Mittelpunkt des Philosophierens.
EINLEITUNG
Einladung zu einer außergewöhnlichen Begegnung
Stein des Anstoßes. Die Idee, Spiritualität und Digitalisierung2 in einem wechselwirkenden Zusammenhang zu beschreiben, scheint absurd und wenig nachvollziehbar zu sein. Bei einer ersten Betrachtung könnten beide kaum unterschiedlicher sein. Der Versuch, zwischen ihnen eine einträgliche Verbindung zu erkennen oder gar eine Wechselwirkung auszumachen, lässt ihn eher zu einem rein gedanklich herbeigeführten Konstrukt werden.
Ein derartiges Urteil, zwischen Spiritualität und Digitalisierung ließe sich nur Sinnloses, Unüberbrückbares ausmachen, kann angesichts der Tatsache, dass sich vieles mit vielem in einer wechselseitigen Bestimmtheit und Bedingtheit befindet, und beide Realitäten zu unserer unmittelbaren, erfahrbaren Lebenswelt gehören, nicht unkritisch hingenommen werden.
Das Philosophieren käme leichtfüßig daher, wenn es diese Lebenswirklichkeiten unberührt ließe und die These nicht aufnehmen würde: Zwischen Spiritualität und Digitalisierung besteht Verbindendes und Wirkendes. Durch sie werden Kräfte frei gesetzt, die unser Leben maßgeblich beeinflussen.
Jedes der beiden Phänomene spiegelt sich vielfach in den Publikationen wider. Philosophische Betrachtungen sind mit eingeschlossen. Der Diskurs hat erst seinen Anfang.
Seit einigen Jahren sind insbesondere seit der Corona-Pandemie Spirituelles und Digitales näher zusammengerückt. Die Begegnung zwischen ihnen zeigt sich darin, dass mit Nutzung von digitaler Technik die Vermittlung von spirituellen und religiösen Botschaften stärker als je zuvor auf virtuellem bzw. digitalisiertem Weg erfolgt. Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung derartiger spiritueller Botschaften beschleunigt und manifestiert. Das führte zur Erweiterung und Vertiefung unserer digitalen Lebenswelt. Die Pandemie wirkte wie Hefe in einem aufgehenden Teig. Sie wurde zu einem zusätzlichen Anschub, zur ergänzenden treibenden Kraft für die digitale Weltennutzung.
Da die Spiritualität schon vor der Digitalisierung die Lebenswelt des Menschen eroberte, ist davon auszugehen, dass sie mit der gesellschaftlichen Entwicklung selbst eine Transformation durchlief.
Interessant wird der Blick darauf, wenn nach dem Einfluss des Spirituellen auf das Digitale gefragt wird. In diese Richtung gedacht, liegt der wissenschaftlich-philosophische Diskurs noch brach. Es reicht in die Welt des Zukünftigen hinein, die uns dazu auffordert, Spirituelles und Digitales neu in einem zusammengefügten Kontext zu denken.
Fragen drängen sich auf: Was bedeutet es, wenn die Grenze zwischen Mensch und Technik immer mehr miteinander verschmelzen? Wo führt es hin, wenn humanoide Roboter nicht nur zu denken anfangen, das Lernen lernen und in der Lage sind, nicht nur Gefühle zu äußern, sondern eine eigene spirituelle Daseinsweise hervorbringen? Die Technik 4.0, die das Zusammenwachsen von Mensch und Technik offenlegt, ist nur der Anfang einer weiter fortschreitenden Angleichung zwischen ihnen.
Wir sind gut beraten, diese Fragen bei aller wissenschaftlichen und philosophisch-ethischen Betrachtung nicht zu vergessen. Dabei geht es keineswegs darum, Spiritualität und Digitalisierung nebeneinander zu verorten und für sich zu beschreiben, was als Voraussetzung für eine Betrachtung wechselwirkender Zusammenhänge gilt. Vielmehr geht es darum, einen philosophischen Blick darauf zu werfen, was sie miteinander verbindet, wie sie zueinander in Beziehung stehen und in welcher Verhältnismäßigkeit sie miteinander agieren.
Was kann herausfordernder sein, sich der Spiritualität zuzuwenden, die den Menschen Zeit seines Lebens und in seiner Entwicklung begleitete und dieser über viele Jahrtausende sein natürliches, existenzielles Eigen nennen kann.
Spiritualität ist bis zum heutigen Tag konstitutiver Teil menschlichen Seins und Werdens. Sie ist eine Eigenschaft menschlichen Denkens und Verhaltens, des menschlichen Seins schlechthin. Sie bestimmt sein Wesen. Sie ist eine der den Menschen ausmachenden Essenzen.
Wir können in der Gesamtschau davon ausgehen, dass das Spirituelle nicht nur ihn in seiner Lebensqualität bestimmt, sondern es selbst mit den Entwicklungen von Mensch, Technik und Gesellschaft einen Kulturwandel vollzog, was ihm seine eigene Geschichtlichkeit verleiht.
Das Buch wird von der Idee getragen, die Spiritualität als menschliche Lebenseigenschaft mit Blick auf die Digitalisierung einer philosophischen Betrachtung zu unterziehen. Doch worin besteht der Sinn, wenn zwischen ihnen „Welten“ liegen? Zeitlich wie historisch ist das Spirituelle und Digitale unterschiedlich entstanden. Sie sind von unterschiedlicher Qualität. Das Spirituelle ist mit der Physis geistig-ideell im und das Digitale technisch am Menschen zu verorten. Beide sind sie gleichermaßen Produkte menschlichen Seins und Werdens und dennoch grundverschieden. Das Spirituelle entspringt dem natürlichen Werden des menschlichen Geistes – aus sich selbst; das Digitale ist der kreative Ent- und Auswurf des Menschen mit Hilfe und Nutzung außerhalb von ihm bestehenden Stofflichkeiten.
In dieser Außer- und Ungewöhnlichkeit, im Spirituellen und Digitalen Verbindendes zu entdecken, es zu beschreiben und dessen Wert für das praktische Leben auszumachen, liegt die Herausforderung. Wir tun gut daran, diese beiden scheinbar weit voneinander agierenden und dennoch mit der Historie und Entwicklung des Menschen verbundenen Phänomene nicht für sich zu betrachten, sondern sie in einem philosophischdialektischen und fortführend in einem ethischen Kontext zu diskutieren.
Zur Grundidee. Überall dort, wo sich Entwicklung und Geschichtlichkeit auftun, wo sich Wirkungen und Kausalitäten offenbaren, sich Triebkräfte für Veränderungen zeigen, ist eine dialektische Sicht als philosophische Denkmethode und Betrachtungsweise angebracht. Es geht darum, beide Phänomene, Spiritualität und Digitalisierung, einer philosophischen Kritik zu unterziehen, die davon ausgeht, dass zwischen ihnen ein Wirkungszusammenhang besteht. Die Dialektik als Denkprinzip (subjektive Dialektik) ist das theoretisch-philosophische Konstrukt einer bestehenden realen Dialektik (objektive Dialektik) in unserer Lebenswelt. Sie ist deren angemessenes Abbild.
Der vorliegende Diskurs wird nicht in allen Punkten für die Lesenden zufriedenstellend sein. So manches ist fragwürdig, streitbar und von Wert, diese Gedanken mit einer voranschreitenden Entwicklung weiter zu verfolgen. Das gewisse Ungewisse und zwangsläufig Ungeklärte sind auch dem realen Fortschreiten des Zusammenwirkens von Spirituellem und Digitalem geschuldet.
Was schon jetzt in unsere Betrachtung Eingang findet ist, dass mit dem Diskurs über den zu erörternden Zusammenhang von Spiritualität und Digitalisierung sich Gedanken entwickeln werden, die Möglichkeiten aufzeigen, beide Seiten in einem völlig anderen Kontext zu sehen. Das lässt sich allein dadurch begründen, dass wir davon ausgehen können, dass mit der fortschreitenden Digitalisierung des gesellschaftlichen Lebens ein Wandel einsetzte, der ihm den Titel „Kultur der Digitalität“ einbrachte.
Mit dem Begriff der Kultur der Digitalität3, der erstmalig 2016 in dem gleichnamigen Buchtitel von Felix Stalder seine Öffentlichkeit fand, wird m. E. der Rahmen der Zwei-Elemente-Beziehung, wie sie zwischen Spiritualität und Digitalisierung besteht, gesprengt. Die Überlegung, die Wirkungsmächte Spiritualität und Digitalisierung in einen gemeinsamen Kontext zu konfigurieren, wird dadurch nicht einfacher. Der Zutritt der Digitalität als Auftritt und Kernbild neuerlicher Kulturentwicklung in der heutigen Gesellschaft lässt erahnen, dass dieser nicht ohne Wirkung auf die Spiritualität und Digitalisierung des gesellschaftlichen Lebens bleibt. Es zeigt sich das Dreiergespann Spiritualität, Digitalisierung und Digitalität, das zur Erweiterung des Diskurses beiträgt.
Mit F. Stalders Beschreibung einer Kultur der Digitalität ist der Gedanke angelegt, dass die Digitalisierung nicht nur die Technik oder gar das Spirituelle transformiert, sondern selbst einer Veränderung unterliegt. Durch was es begründet ist, wie und unter welchen Gegebenheiten das geschieht, wird im Buch beschrieben.
Der Einlass der Digitalität als gesellschaftlich tragendes Kulturphänomen in die zu erörternde Beziehung von Spiritualität und Digitalisierung führt uns zur Bestimmung, Spiritualität und Digitalität als Eigenschaften auszumachen, die im und mit dem Menschsein begründet und verbunden sind. Es wird aufzuzeigen sein, dass trotz gemeinsamer Klammer des mit dem Menschen Verbundenen sie miteinander fremdeln – das Spirituelle mehr zum einzelnen Menschen und das Digitale mehr zur Gesellschaft gehörig – enger in Beziehung zueinanderstehen, als wir es vermuten.
Die Digitalisierung der Technik und deren Eindringen in alle Bereiche menschlichen Lebens, aufgetan wie ein über die Lebenswirklichkeit geworfenes Netz, wirken wie ein Schleier, der den Alltag des Menschen und die Gesellschaft umgibt. Das führt uns zur These, dass die Digitalisierung wie ein Kraftquell für eine neuartige Spiritualität und Kulturentwicklung wirkt und dabei selbst eine Wandlung vollzieht. Das lässt sich durch folgende Gedanken ergänzen:
Erstens. Spiritualität und Digitalisierung sind Phänomene menschlichen Lebens und gesellschaftlicher Entwicklung mit einer ungleich begründeten Innen- und Außenwirkung. Jedes für sich fordert den Menschen auf neuerliche Weise heraus. Sie setzen Marken für ein gesellschaftliches Miteinander und verändern dabei das menschliche Leben.
Zweitens. Mit dem Eintritt der Digitalisierung in die von Spiritualität getragene Lebenswelt entsteht eine wechselseitige wirkungsbestimmende Beziehung. Die Wirkungsmacht beider führt zu einer kontextlichen Aufmerksamkeit, die über eine jeweils separate philosophische Betrachtung von Spiritualität und Digitalisierung hinausgeht.
Drittens. Das Fortschreiten der Digitalisierung in der Gesellschaft, deren allseitig durchdringender Einfluss auf alle Lebensbereiche des Menschen, zeugt nicht nur von einem Technikwandel des Analogen hin zum Digitalen, sondern offenbart einen durchgreifenden Kulturwandel, der als „Kultur der Digitalität“ beschrieben wird. Diese ist Ausdruck von Lebensqualität, deren Umfang (Lebensbereiche) und Tiefe (Wirkungsintensität) von der Digitalisierung gesellschaftlichen Lebens bestimmt ist.
Viertens. Spiritualität und Digitalisierung verfügen jeweils über einen Bereich eigener Selbstwirksamkeit. Sie sind in ihrem Wesen selbstbestimmt, originär im Charakter, Entstehen und Wirken. Zugleich sind sie durch menschliches Hinzutun in der Lage, Macht auf deren Existenzweisen auszuüben. Ihre Eigendynamik besteht genauso aus einer unausweichlichen und erkennbaren Dialektik wie das wechselseitige Wirken zu- und aufeinander. Widerspruch, Wirkkraft und Geschichtlichkeit sind ihre dialektischen Kernmerkmale.
Fünftens. Mit der Konstituierung einer Kultur des Digitalität werden Spiritualität und Digitalisierung in einen gesamtgesellschaftlichen, soziokulturellen Kontext hinein- und in diesem aufgehoben. Die Digitalität zeigt sich als Charakterzug gesellschaftlicher Entwicklung unserer Zeit, in der Digitales und Spirituelles zusammenfließen. Insofern ist das Entstehen einer (Kultur der) Digitalität mit der Digitalisierung einer komplexen Lebenswirklichkeit begründet, aber keineswegs das alleinige Ergebnis des technischen Wandels vom Analogen hin zum Digitalen. In der Kultur des Digitalen steht das Spirituelle nicht passiv und unvermittelt daneben, sondern wird selbst zum Akteur und Markenbotschafter einer soziokulturell bestimmten Digitalität.
Sechstens. Die Identität und das Selbstverständnis für das Menschsein werden sich mit der Kultur der Digitalität verändern. Jene Kultur steht für Gewordenes in der gesellschaftlichen Entwicklung und wird zum Ausgangspunkt für neuerlich Weiterführendes. Dabei zeigen sich die Zukunftsaussichten für den Menschen prekär und hoffnungsvoll zugleich. Prekär insofern, wenn der Mensch die Digitalisierung des gesellschaftlichen Lebens derart vorantreibt, dass (Welt-)Räume für das Analoge und Spirituelle eingeengt werden, der analoge Mensch sich immer mehr fortschreitend digitalisiert und seine eigene Bedeutungslosigkeit vorantreibt. Wiederum hoffnungsvoll stimmt eine Raumentwicklung, wenn der Mensch über ein Potenzial verfügt, sich dessen bewusst zu sein, dass das in ihm immanente Spirituelle Kräfte freigibt, sich einer dem Menschen umklammernden und damit schadenden Digitalisierung entgegenzustellen. Es macht Sinn, in der Kultur der Digitalität Spirituelles (Spiritualität) zu entdecken bzw. einzuführen.
Siebtens. Mit der digitalen Welterweiterung droht die analoge Welt zu schrumpfen oder gar zu verkümmern. Sie entzieht dem Menschen seine innere und äußere Natürlichkeit – das, was menschliches Leben existenziell ausmacht. Diversität und Vielfalt, Unterschiede und Gegensätzlichkeiten gehen in den Komplexitäten natürlichen wie soziokulturellen Lebens verloren. Die Weltensimplifizierung vollzieht sich ungebremst, wenn nicht der Wille des Menschen dieser Entwicklung Einhalt gebietet. Die innere Kraft des Willens ist der im Menschen tief verwurzelte Humanismus.
Achtens. Der Humanismus des Menschen verfügt über das Potenzial, das Spirituelle (Spiritualität) und das Digitale (Digitalität) in sich aufzunehmen. Es ist seine Toleranz, aus sich heraus einen spirituellen und digitalen Humanismus zu kreieren. In beider Verbundenheit kann ein neuzeitlicher Humanismus entstehen, der der Spiritualität und Digitalität menschlichen Lebens gerecht wird. Eine verstärkende Wirkung lässt sich erreichen, wenn aus dem spirituellen und digitalen Humanismus ein von Resonanz geprägter Humanismus erwächst. Sie sprechen jeweils mit eigener Stimme und sind dennoch aufeinander, sich gegenseitig fördernd, eingestimmt.
Philosophieren auf vier Denksäulen. Die philosophische Annäherung an die Spiritualität, Digitalisierung und Digitalität verfolgt vier Zugänge. Erstens: Selbstverständnis, Klärung und Zuordnung von Begrifflichkeiten; zweitens: Blick auf den dialektischen Charakter der jeweiligen Sachverhalte; drittens: Erfahrung und Erkenntnis über jene Phänomene des gesellschaftlichen Lebens sowie die Frage nach deren Wahrhaftigkeit und viertens: Werte menschlichen Denkens und normativen Handelns sowie die Frage nach dem Sinn des Lebens im Zeitalter der Digitalisierung und wachsender Künstlicher Intelligenz.
Der Anfang ist gemacht, wenn wir unserem Verständnis von Spiritualität, Digitalisierung und Digitalität auf den Grund gehen, eine begriffliche Klärung im Inhalt (Intension) und in der Umfänglichkeit (Extension) herbeiführen, um so einen begrifflichen Marker für den Dialog zu setzen. Damit wird der Boden für ein zu entwickelndes Verständnis vorbereitet. Es ist zu fragen: Was ist (soll) unter Spiritualität, Digitalisierung und Digitalität zu verstehen (verstanden werden)? In welchem Lebenskontext lassen sich diese Begriffe konfigurieren? Was sind ihre Essenzen?
Darüber hinaus gelten Überlegungen, die nicht nur auf Begriffsklärungen und Beschreibungen gesetzter Beziehungen (hier: Spiritualität, Digitalisierung und Digitalität) beruhen, sondern auch darauf aus sind, reale wechselseitige und gestaltbare Wirkungszusammenhänge zu decken. Wir öffnen die Tür für eine dialektische Betrachtungsweise, die die Bedingtheit und Bestimmtheit, Ursache und Wirkung, Veränderung und Entwicklung zur Grundlage hat. Das setzt voraus, dass wir diese Eigenschaften als Eigenschaften des objektiv Realen (das Objektiv-Dialektische) und deren Beschreibungen (das Subjektiv-Dialektische) zu dem jeweiligen Sachverhalt als gedankliches Abbild anerkennen. Es wird zu klären sein: Was macht deren Historie aus? Gibt es zwischen ihnen eine beeinflusste wechselseitige Bedingtheit? Wie tritt sie in Erscheinung? Wie sind ihre Wirkungsfaktoren, die im Menschen selbst und gesellschaftlichen Werden begründet sind, ausgestattet, so dass sie in der Lage sind, Zukunft zu gestalten?
Wir fragen weiter, wenn wir uns auf den erkenntnistheoretischen Kontext dieser Problematik einlassen: Können wir unseren Beobachtungen, Wahrnehmungen und Erkenntnissen, die in Wissen oder Theorien münden, trauen, sind sie sicher und wahrhaftig, dann stoßen wir den erkenntnistheoretischen und Wahrheitsaspekt beim Philosophieren an. Wir stehen stets vor der Herausforderung, unser Wissen zu begründen, dessen Wahrheitsgehalt zu überprüfen und mit ihm einen praktischen Zugang zu unserer objektiven Wirklichkeit herzustellen. Ist das, was wir denken, wahr? Haben unsere Gedanken einen Inhalt, der der Außenwelt entspricht?
Keiner wird auf die Idee kommen, die Existenz der Erde oder der Sonne in Frage zu stellen. Doch wie ordnen wir jene Gedanken ein, die Bilder von Göttern und Engeln, Feen und Trollen zum Inhalt haben und deren Existenz beschworen wird? Die Frage nach deren Existenz oder Nicht-Existenz ist mehr als berechtigt. Der Wert und der praktische Nutzen unserer Erkenntnisse und des gewonnenen Wissens werden dadurch bestimmt, ob die Inhalte unseres Denkens einer (objektiven) Wirklichkeit entspringen, ob sie ausschließlich als eigenständige, gedanklich-geistige Kreationen unseres Denkens einzuordnen sind, oder ob wir zu akzeptieren haben, dass unsere Gedanken, Erfahrungen, unser Wissen ein Mix aus beidem sind.
Die Digitalisierung unseres Lebens wird kaum jemand in Zweifel ziehen. Sie ist für jedermann gegenständlich, erfahrbar und hautnah erlebbar. Die Spiritualität, die im Alltagsgebrauch mit Transzendenz, dem Göttlichen, der Existenz von Immateriellem außerhalb des menschlichen Geistes oder mit dem menschlichen Geist selbst in Zusammenhang gebracht wird, gibt die Antwort auf die Frage nach deren Wahrhaftigkeit nicht so ohne Weiteres frei.4 Sie wird je nach Ausgangspunkt der Betrachtung unterschiedlich ausfallen.
Diese Art zu denken und nach Wahrheiten zu suchen, ist in unserem Alltag nicht fremd. Die Corona-Pandemie hat mit kollektiver Erkenntnis deutlich gemacht, wie fragil Wahrheiten in unserem Leben sind und Fakten (Tatsachen) und Gewissheiten in Frage gestellt werden. Die Wahrheit unter den Menschen reichte von der Anerkennung des COVID-19-Virus bis dessen Leugnung über eine Verharmlosung als einen gewöhnlichen grippalen Infekt. Dabei wurden auch reale, undurchschaubare Mächte ins Spiel gebracht, die sich gegen die Menschheit verbünden würden, um die Weltherrschaft an sich zu reißen.
Nie waren zur Zeit der Digitalisierung unserer Lebenswelt Wissen und Glauben so eng miteinander verschlungen. Die Wissensverunsicherung ist in komplexen, schwer nachvollziehbaren Lebenssituationen groß. Es stellt sich dann zu Recht der Mensch die Frage: Was ist Wissen? Was sind Unwahrheiten? Wem kann ich Glauben schenken?
Während die mediale Öffentlichkeit in Sachen Politik und Wissenschaft um Aufklärung, Sachverstand bemüht war, die Administrative bei der Bevölkerung um Akzeptanz getroffener Entscheidungen, die die Grundrechte einschränkten, rang, mehrten sich gleichsam in privaten Kanälen und auf der Straße Stimmen, die das politische Handeln in Frage stellten. Die menschliche Machtlosigkeit regte und wehrte sich. Widerstände, begleitet von Verschwörungserzählungen, wurden offenkundig. Die Breite des Zweifels an begründeter, nicht anerkannter Richtigkeit und die Verängstigung der Menschen in der Zeit der Corona-Krise waren unübersehbar.
Die Folgen dieser Krise sind beileibe noch nicht aufgearbeitet und werden uns noch verschiedentlich beschäftigen.
Die Globalisierung erhielt ein neues, pathologisches Gesicht. Die Digitalisierung, die unser Leben in allen Bereichen eroberte, zuvor frei von Covid-19, mischte nun erstmalig global mit der Kraft des Menschlich-Spirituellen mit. Sie erhielt einen neuen Marker, soweit das Spirituelle mit der Digitalisierung versetzt wurde.
Mit Gewissheit lässt sich im Nachhinein sagen: Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung vorangetrieben – das Spirituelle aber auch. Die Corona-Krise gab der Spiritualität des Menschen einen qualitativ neuen Nährboden. Das spirituelle Erwachen des Menschen – angefangen von wiedergeborener Verschwörungsgläubigkeit bis hin zu erfahrenen Verunsicherungen, Nöten und Ängsten der Menschen in unserem vermeintlich aufgeklärten und digitalen Zeitalter – ist wert, ihm eine gebührende Beachtung zu schenken. Die Verbindung zwischen beiden ist kaum deutlicher hergestellt wie zu jener Zeit der Pandemie.
Ist der Wert von Erfahrung und Erkenntnis, Wissen und Meinungsbildung für eine einhergehende Wahrheitsfindung ausgemacht, öffnet sich die Tür von Ethik und Moral menschlichen Verhaltens. Für viele Menschen, die ihr Leben spirituell begleiten, wird sich die Frage nach dem Wert und Sinn von Spiritualität weniger oder gar nicht stellen. Sie haben ihre Antwort gefunden. Das Spirituelle wird per se anerkannt, hat im Leben derer seinen Platz gefunden. Das Denken und Handeln hat in Form von Beten, Meditationen oder anderen Ritualen ihre Praxis. Diese Menschen ziehen aus dem Spirituellen Kraft und Energie für das alltägliche Leben.
Dennoch sei die Frage erlaubt, wenn Spiritualität und Digitalisierung – einschließlich Digitalität – in einem gemeinsamen Kontext gedacht und diskutiert werden: Macht es Sinn und ggf. welchen, Spiritualität und Digitalisierung als zwei Seiten (Phänomene) ein und desselben menschlichen Lebens (Gesellschaft) zu verstehen? Ist es nicht richtiger, beide Seiten voneinander getrennt zu denken und ihnen eigenständige Werte und Normative zuzuordnen? Wirkt Spiritualität moralisierend auf das Fortschreiten der Digitalisierung, insbesondere auf die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI)? Die Suche nach Antwort auf die Fragen, ob Digitales in Gestalt hochentwickelter KI mit normativer Ethik ausgestattet sein müsste, ob eine derartige Technik mit zutiefst menschlichen Zügen moralisch vertretbar ist, entlässt gleichermaßen menschliche Neugier und Befürchtungen von nicht mehr Beherrschbarem. Wer wird letztlich über wen bestimmen: der Mensch über die KI oder die KI über den Menschen? Wer macht wen zum Instrument seines Daseins?
Werte wie Freiheit, Selbstbestimmtheit und Verantwortung, die einen hohen Stellenwert in der Werteethik einnehmen, bleiben im Verständnis von Spiritualität, Digitalisierung und Digitalität nicht außen vor. Im Gegenteil. Die moderne Ethik wird sich im Zuge zunehmender Digitalisierung und wachsender Qualifizierung Künstlicher Intelligenzen neu positionieren und in den Inhalten weiterentwickeln müssen.
Zum Inhalt des Buches. Das Buch hat zwei Teile mit jeweils drei Kapiteln. Im ersten Teil wird der Versuch einer philosophischen Annäherung zwischen Weltenwandel, erwachendem Denken und Technikentwicklung unternommen. Veränderungs- und Entwicklungsprozesse von Mensch, Technik und Gesellschaft stehen im Vordergrund des Diskurses und führen uns auf den Weg vom Analogen zum Digitalen.
Das Kapitel IWelt der Moderne im Wandel ∙ Sprachphilosophische Miniaturen ist der einführende Einstieg, sich den Welten des Lebens, den Realitäten und menschlichen Lebenswirklichkeiten zuzuwenden. Dabei nimmt hier der Begriff des Wandels eine zentrale Stellung ein. Er wird in Bezug auf Bewegung, Veränderung, Entwicklung einerseits, Prozess, Fortschritt und Evolution andererseits philosophisch vermessen und sein Alleinstellungsmerkmal zur Diskussion gestellt. Die Frage nach der Bestimmung von Klimawandel und Klimaschutz nimmt dabei einen beispielgebenden Platz ein und macht die Verantwortung des Menschen deutlich.
In diesem Kontext versteht sich die Beschreibung von Menschenbildern in der Historie gesellschaftlicher und technischer Entwicklungen.
Das Kapitel IIBewusstsein und bewusstes Sein gibt den naturwissenschaftlichen und philosophischen Zugang für die Herausbildung, das Wesen und Werden sowie die Vielfalt von Ausdrucksformen des Menschlich-Bewussten frei. Mit ihnen wird der Boden für weitere Überlegungen bestellt, der uns zum Spirituellen, zur Spiritualität, Digitalisierung und Digitalität führt. Die entwickelten Gedanken sind hilfreich, das Verständnis von Bewusstsein, dessen Realitäten und Wirklichkeiten, Entwicklungen, Abbilder und Formen zu vertiefen und auf diesem Wege einen nachvollziehbaren Zugang zur Spiritualität, Technik und Lebenskultur zu finden.
Im Zentrum dieses Kapitels stehen u. a. die Fragen: Was ist unter Sein, Realität, Wirklichkeit, Bewusstsein und Seinsbewusstsein zu verstehen? Was unterscheidet Ideelles vom Bewusstsein? Macht das Bewusstsein den Menschen zum Menschen? Ist das Bewusstsein ein mechanistisches Abbild (Spiegelbild) seiner Außenwelt oder zeugt es von Eigenkreationen, losgelöst von dieser? Was bedeutet es, dass das Bewusstsein die Fähigkeit besitzt, sich von seiner Außenwelt abzukoppeln und ein Eigenleben besitzt? Wie lassen sich diese Fragen im Verständnis des Spirituellen und Digitalen einordnen?
Kapitel IIITechnik und Digitalisierung. Mit der eigens über Jahrtausende, von Generation zu Generation kreierten Technik hat der Mensch seine Geschichte und Sozialisation vorangetrieben, was ihm einen herausstellenden Platz in der Naturentwicklung einbrachte. Der gesellschaftliche Fortschritt ist ohne Technikentwicklung nicht denkbar und mit der Natur des Menschen konstitutiv verbunden: ohne vom Menschen entwickelte Technik kein gesellschaftlicher Wandel, ohne Transformation der menschlichen Gesellschaft auch keine neuerlichen Ideen und Entwicklungen für die Technik. Dabei dürfen die zwar nicht hinreichenden, so doch notwendigen Bedingungen nicht außen vor bleiben. Gemeint sind die Existenz und kreativen Nutzungsmöglichkeiten verfügbarer Naturressourcen wie Feuer und Holz, Erz und Kohle, Erdöl und Erdgas. Mit ihnen wurde vor ca. tausend Jahren das Anthropozän5 erstmalig signifikant markiert, das mit der Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert einen neuerlichen, und zwar den Qualitätsschub erreichte, der die Nachhaltigkeit menschlichen Lebens zunehmend in Frage stellt.
Die Quelle allen Fortschritts ist in letzter Instanz der Mensch mit seinen Fähigkeiten zu Kreation, Intuition und Inspiration. Sein handwerkliches und geistiges Geschick, die in ihm innewohnenden individuellen und gesellschaftlichen Antriebe versetzten ihn in die Lage, die Natur in eine von ihm geschaffene Zweitnatur (Technik als Instrument und Verfahren) umzuwandeln, mit jener Zweitnatur erstere einzuverleiben und nach seinen Bedürfnissen beherrschbar zu machen.
Zu der aktuellen Transformationen technischer Entwicklung zählt die Digitalisierung. Sie steht für Prozess, Verfahren, Instrument und zeugt von einem Wandel des Analogen in das Digitale. Sie revolutioniert die Technik grundlegend. Dieser Wandel lässt die Gesellschaftsentwicklung zunehmend unter einem neuen Label auftreten. Der Mensch vom Typ Homo sapiens ist selbst im Begriff des Wandels – hin zum Homo digitalis.
Die Digitalisierung der Technik, verbunden mit weiterführenden, qualitativ neuen Entwicklungsschüben, hat mit der Technik 4.0 die Kreation der Künstlichen Intelligenz eingeläutet. Der Mensch ist in allem wie eine Spinne mitten im Netz, der ohne seine Selbstdigitalisierung6 nicht mehr auszukommen vermag. Fragen stellen sich: Wird der Mensch sein eigener Gefangener? Was bedeutet eine digitale Durchdringung alles Menschlichen und Gesellschaftlichen? Wie passfähig sind Analoges und Digitales zueinander? Wie wird die Digitalisierung die Lebensqualität des Menschen beeinflussen? Die Suche nach einer Antwort auf diese Fragen und nach den Folgen für das Spirituelle im und mit dem Menschen darf dabei nicht unberücksichtigt bleiben.
Der zweite Teil des Buches, der den Titel hat Spiritualität, Digitalität, Humanismus – Wachstumskräfte und Werte neuzeitlichen Lebens, stellt den wechselseitigen Zusammenhang, die Dialektik zwischen dem Spirituelle und Digitalen unserer Zeit ins Zentrum des weiteren Diskurses. Das, was im Teil 1 des Buches an philosophischem Vordenken geleistet wurde, findet jetzt Zugang in das gegenwärtige und zukünftige Weltgeschehen, für das es nur eine humanistische Perspektive geben kann.
Kapitel IVSpirit und Spiritualität. Es ist die Idee, von einem Geist geboren und getragen, von innen oder von außen hervorgebracht oder angestoßen – wodurch oder durch was auch immer – die das menschliche Sein, Werden und Vergehen in unserem Bewusstsein formt. Es ist die Intuition – im Inneren des Menschen geboren und nach außen gekehrt – oder die Inspiration – im Außen angestoßen und im Menschen geistig gebildet, die wir nicht immer als nachvollziehbare Eingebung erfahren. Wir wundern uns über ihr Entstehen und können schwer nachvollziehen, wie Spirituelles Raum für nicht Erklärbares gewinnt. Realitäts- und Sinneserfahrungen werden im Geiste des Menschen, in der Transzendenz über- bzw. in der Immanenz unterschritten. Das Bewusstsein kreiert seine eigene Welt, die gegenüber dessen Außenwelt oft fremd, unstimmig, ohne Resonanz erscheint.
Die Spiritualität hat als Eigenschaft menschlich-kulturellen Lebens und Verhaltens einen zutiefst natürlichen und gesellschaftlich tragenden Grund. Nichts scheint ihr menschlicher als sein eigener Geist zu sein. Dieser Geist verleiht der digitalen Gesellschaft ein regulatives Korrektiv.
Das Spirituelle mit einer Transzendenz, mit einem Glauben an die Existenz innerer bzw. äußerer Kräfte, von Mächten des Göttlichen oder Universellen, die eine schützende Hand über den Menschen halten, gleichzustellen, sind Vorstellungen, die eine geistig-kulturelle Geschichte aufweisen und dessen Reduktion dennoch zu hinterfragen ist.
Inhalt dieses Kapitels ist, das Seinsbewusstsein näher zu bestimmen, deren Urquell zu ergründen, den Grenzgang zwischen Transzendenz und Immanenz auszuloten und die geistigen Wirkungskräfte auf Mensch, Technik und Gesellschaft auszumachen.
Das wirft u. a. die Fragen auf: Was ist die Essenz des Spirituellen und der Spiritualität? Welche Wirkungsmacht haben sie auf die Qualität und den Sinn menschlichen Lebens? Welche Wandlungen hat Spiritualität selbst erfahren? Die Frage nach dem Wert des Spirituellen und dem Sinn menschlicher, kulturbedingter Spiritualität nimmt im Diskurs einen wichtigen Platz ein, wenn es darum geht, den Einfluss des Spirituellen und der Spiritualität auf die Technikentwicklung und Digitalisierung zu ergründen.
Kapitel VKulturwandel und Digitalität haben sich in den letzten dreißig Jahren derart eng umschlungen, dass sie nicht mehr voneinander lassen können. Ein neues Paradigma wird die Bühne der Technik- und Gesellschaftsentwicklung betreten – vorausgesetzt, der Mensch hat weder seinen Verstand noch seine Intelligenz vollends dem Digitalen übereignet und somit sich selbst entmachtet und verfremdet.
Die Digitalität ist mit Felix Stalders „Kultur des Digitalen“ entweder der neue Kulturschock, der mit einer neuen, großen technischen Innovation in der Gesellschaft einhergeht oder sie ist das Resümee einer auf Digitalisierung aufgebauten Gesellschaft.7 Das Buch von F. Stalder bietet zwecks Klärung einen Einstieg und ist Grundlage für eine kritisch-philosophische Betrachtung, sich Spiritualisierung und Digitalisierung im Kontext einer soziokulturellen Entwicklung der Gesellschaft anzusehen. Die Digitalität als eine Größe zu betrachten, die uns auf die Qualität des Lebens, auf Zeit und Schnelllebigkeit verweist, führt uns zugleich zur Kultur von gewandelter Drittnatur und digitaler Lebenskultur, die gleichermaßen als Sinn und Unsinn verstanden wird.
Damit drängen sich u. a. Fragen auf, wie: Welche Wirkung zeigt eine Kultur der Digitalität auf das gesellschaftliche Leben? Welchen Einfluss hat sie auf das Spirituelle? Welche Rückkopplungen und Einflussnahmen kann es auf eine Kultur der Digitalität geben? Inwieweit lässt sich hierfür eine Referenzialität bzw. Resonanz ausmachen?
Die Frage nach dem Wert und Sinn dieser neuen auf Digitalisierung begründeten Lebenskultur steht im Raum und drängt ebenfalls auf eine Antwort.
Kapitel VISpirituelles und Digitales vereinen Kräfte, Bedingungen, Eigenschaften individuellen und gesellschaftlichen Lebens. Schnell lassen sich zwischen ihnen Parallelwelten ausmachen, was gemeinschaftliches Wirken eher in Frage stellt. Zwischen ihnen – so scheint es – liegen Welten, was jeden Wechselbezug an Selbst- und Außenwirksamkeit schwer erkennen lassen könnte. Das berechtigt zur Frage: Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ist die Herstellung eines dialektischen Zusammenhangs zwischen ihnen ein reines Gedankenkonstrukt oder sind sie Eigenschaften im Menschlichen und Gesellschaftlichen und damit als Objektivitäten auszumachen? Was bedeutet es, wenn zwischen ihnen tatsächlichWechselwirkungen stattfinden?
Sind Spiritualität und Digitalität von Geist und Dialektik bestimmt, so führen sie uns zu neuen Qualitäten gesellschaftlichen Lebens. Sie zeigen sich als digitalisierte bzw. digitale Spiritualität und spiritualisierte bzw. spirituelle Digitalität. Was bedeutet ein derartiger Zusammenfluss von Spiritualität und Digitalität? Finden sie ihre Anerkennung und durchdringen die Lebenswirklichkeit des Menschen, so werden sie einen Platz als Kraftquellen unserer Zeit einnehmen. In welchem ethisch-moralischen Kontext wäre dieser Platz zu verorten? Welche Botschaften wären an den Menschen hinauszutragen? Die philosophische Substanz dieses Kapitels wird daran zu messen sein, inwieweit in diesem Diskurs die Ethik Eingang findet.
Der Epilog zielt auf die ethisch-moralische Auflösung von digitaler Spiritualität und digitalisierter Spiritualität durch eine Einbindung in einen, für unsere Zeit gemäßen Humanismus. Die Zeit ist reif für einen neuzeitlichen Humanismus. Damit ist gemeint, den spirituellen und digitalen Humanismus zusammenzubringen und sie unter das Dach eines resonanten Humanismus zu stellen.
Einen derartigen Humanismus angesichts wachsender, vor allem starker Künstlicher Intelligenz anzuerkennen und wirksam werden zu lassen, wird eine Hausforderung zu sein, an die der Mensch nicht umhinkommt, sie anzunehmen, wenn er sich seines Seins bewusst sein und sich nicht von einer von ihm geschaffenen KI instrumentalisieren lassen will.
Der Abschluss wird durch eine Zusammenfassung in Gestalt von Thesen und Botschaften philosophisch-ethischer Anstöße gebildet. Sie sind der Schlussstein des Diskurses. Er ist die Aufforderung an den Menschen, unserer Lebenswelt einen Wandel hin zum resonanten Humanismus zu schenken.
Die kommenden Generationen erleben sich in einer weiter wachsenden digitalen Welt, in der das Spirituelle menschlichen Lebens und dessen Kultur sich zu behaupten hat.
Die zu vermittelnden Botschaften sind dringender denn je, die in die Lebenswelt der Menschen hineingetragen werden müssen. Wie schon zur Zeit Immanuel Kants können es nur Botschaften menschlichhumanistischer Aufklärung sein. Die über zweihundert Jahre alte Geschichte menschlichen Denkens und Verhaltens macht dringender denn je deutlich, dass wir Philosophen an Aufklärung nicht nachlassen dürfen und sie als einen zu leistenden generationsübergreifenden und zeitlosen Auftrag an die Menschenwelt anzuerkennen und zu bewerkstelligen haben.
Es liegt allein bei uns Menschen, wie wir zukünftig der spirituellen und digitalen Lebenswelt gegenübertreten – als eine oder als Parallelwelten, devot oder beherrschend, menschenfremd oder in zwischenmenschlicher Resonanz mit einem Raum für förderliche Stimmungen des Spirituellen und Digitalen.
Wir können heute beruhigt davon ausgehen, dass weder das Spirituelle noch das Digitale sich untereinander ihre etablierten Plätze in der menschlichen Lebenswelt streitig machen werden. Beide sind sie von unwiederbringlichem Charme. Sie zeugen von vom Menschen ausgehender, für den Menschen gewonnener Stärke.
Das Gute und die Güte sind in ihnen verborgen, was uns als Mensch in die Pflicht nimmt, beiden gleichermaßen Raum für ein gutes Gelingen an menschlicher Zukunft zu geben. Spiritualität und die mit der Digitalisierung begründete Digitalität brauchen einander, wenn das Menschliche in dieser Welt eine Chance auf eine nachhaltige Entwicklung haben will. Wie groß dieser Wille ausfallen wird, steht einzig und allein in der Verantwortung des Menschen. Er allein begründet den resonanten Humanismus und entscheidet darüber, inwieweit er ihm eine Chance auf Zukunft gibt.
2 Der Gebrauch des Terminus „Digitalisierung“ ist in unserem Alltagsverständnis weitaus üblicher als der der „Digitalität“. Insofern wird in der Einleitung i. S. einer Vereinfachung auf eine differenzierte Betrachtung zwischen ihnen verzichtet, d. h. Digitalität und Digitalisierung werden gleichgesetzt und im späteren Diskurs begrifflich differenziert betrachtet.
3 Das Buch des Autors erschien im Berliner Suhrkamp Verlag.
4 Vgl. GEO WISSEN, Heft 70, Die Kraft der Spiritualität, Gruner + Jahr, Hamburg 2020
5 Unter dem Anthropozän wird eine geochronische Epoche, eine Ära des Menschen im Umgang mit seiner Lebenswelt verstanden, die sich darin auszeichnet, dass der Mensch zu einer bestimmenden Einflussgröße auf die bestehenden biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse geworden ist.
6 Mit der von innen und außen initiierten Selbstdigitalisierung ist gemeint, dass z. B. das vom Menschen selbst einverleibte Smartphone als Teil seines eigenen Daseins anerkannt wird und die Tür zur inneren Digitalisierung, z. B. durch eingepflanzte Chips oder durch eine Infusion digital-codierter Flüssigkeit in den menschlichen Körper bereits offen steht.
7 Es sei hier an die Maschinenstürmerei (Mechanisierung) Anfang des 19. Jahrhunderts, an die Revolutionierung der technischen Mobilität in deren 2. Hälfte erinnert. Um die Jahrhundertwende veränderte die Entwicklung der Elektrotechnik einschneidend das gesellschaftliche Leben. Es folgte die Elektronik und die Lichter des Digitalen, in Null und Eins konfiguriert, waren in den 60er Jahren am Horizont auszumachen, bis der große gesellschaftliche Durchbruch in den 80er und in den 90er Jahren gelang. Das Analoge wurde zunehmend vom Digitalen abgelöst. Die Gesellschaft ist nicht digital, aber digitalisiert, was F. Stalder dazu hinführt, von einer Kultur der Digitalisierung zu sprechen.
ERSTER TEIL
WELTENWANDEL MENSCH ∙ BEWUSSTSEIN ∙ TECHNIKENTWICKLUNG
Eine philosophische Annäherung
Welt der Postmoderne im Wandel
Bewusstsein und bewusstes Sein
Technik und Digitalisierung
ERSTER TEIL
I. Kapitel
Weltenwandel ∙ Sprachphilosophische Miniaturen
Welten des Menschen und menschliche Lebenswelt
Die Geburt eines Kindes ist der Ausstieg aus seiner über Monate sicheren, geborgenen, sich gut anfühlenden Innenwelt, dem Mutterleib, und der Einstieg in eine Außenwelt, die mit gefühlter Unsicherheit und Abhängigkeit erfüllt ist. Vorstellungen, was das zukünftige Leben bringen wird, sind nicht fassbar. Alles liegt im Dunkeln. Nichts ist für das Kind vorausschaubar, planbar, berechenbar. Das Einzige, was dem Neugeborenen bleibt, ist seinem instinktiven Urvertrauen zu folgen, um sich eine Überlebenschance zu halten, bevor es sich auf den Weg macht, aus dem Überleben in das eigene Leben einzutreten.
Die Entscheidung dafür ist halbherzig, solange der Mensch sich seines Selbst nur mangelhaft bewusst ist. Seine Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit wird er nur eingeschränkt wahrnehmen oder bleiben bedingt aus, wenn es darum geht, die Geschicke des Lebens in die Hand zu nehmen. Hilfe ist in den Anfangsjahren der Persönlichkeitsentwicklung von Nöten.
Ein lebensentscheidender Diversikationspunkt tritt ein, wenn mit wachsendem Selbstbewusstsein der Mensch für sich die Macht der Selbsterkenntnis und Entscheidungsfähigkeit erkennt, über sein Leben bestimmen zu können. Er kann das Leben beenden oder weiterleben. Ist der Wille für das Leben ausgesprochen, steht die Frage im Raum: Was fange ich mit diesem, selbst nicht gewollten und doch geschenkten Leben an? Diese Grundsatzfrage des Lebens wird uns in Krisen immer wieder, mehr oder weniger, bewegen. Wert und Sinn des eigenen Lebens werden hinterfragt. Lebensentscheidungen sind neu zu justieren. Die Frage nach der eigenen, mit Entscheidungen verbundenen Zukunft, begleitet uns das ganze Leben. Schenken wir dieser Frage keine Bedeutung, stellen wir das Leben selbst in Frage.
Wird die Frage nach dem Leben positiv, entscheidungs- und handlungswillig beantwortet, spätestens dann zeigt sich der Mensch als ein waches, agierendes, sich selbst und seine Welt gestaltendes Wesen. Er nimmt mit den Lebensjahren seine Welt in seinen Besitz, reibt sich an ihr, wird an und mit ihr wachsen, sich entwickeln.
Der Mensch sieht sich nicht nur selbst. Er erkennt, dass um ihn herum sich verschiedene Welten befinden. Sie sind anders als er selbst. Er lebt entweder in einem eher urbanen oder ländlichen Umfeld. Der Mensch macht seine Erfahrungen mit der Natur; was sie ist, wo sie herkommt, ob und wie sie dem Menschen vermeintlich Gutes oder Böses antun kann.
Der Mensch erfährt Freude bei der Nutzung vielfältigster technischer Mittel, die ihm das Leben erleichtern. Zugleich erkennt er, dass Technik durch und für den Menschen aufbauend wie zerstörend wirkt, dass das Leben mit der Technik neben Segen auch Fluch bedeuten kann.
Der Mensch ist ein Wesen, das nur eine Chance auf ein gutes Leben hat, wenn er der Natur mit Respekt gegenübertritt, mit der von ihm kreierten Technik verantwortungsvoll umgeht und sich in die Sozialisation eingebunden fühlt.
Die Kraft der menschlichen Gemeinschaft hat ihre Quelle in der Naturund Technikentwicklung. Geistige Fähigkeiten und Lebensumstände ließen den Menschen eine zweite, technikbasierte Natur des Menschen entwickeln. Sozialisiertes Leben und die Fähigkeit des Menschen, Natur in Technik zu wandeln, ließen ihn zu einem Wesen mit einem Alleinstellungsmerkmal gegenüber der lebenden Natur wachsen.
Gesellschaftliche Umbrüche waren immer eng mit technischen verbunden. Technik revolutionierte die Gesellschaft, sprengte stets die Fesseln des Alten. Der Wandel von einer Gesellschaftsordnung in eine andere ist Zeugnis dieser Entwicklung.
Doch dieses Werden benötigt letztlich eine entscheidende Bedingung, die im Menschen selbst zu finden ist. Es ist dessen Fertigkeit und Fähigkeit, sich seines Seins und der Kraft seines Geistes bewusst werden zu können. Der Weg dorthin ist eng mit der Menschwerdung des Affen verbunden. Es brauchte Millionen von Jahren, bis der Mensch das wurde, was er heute ist. In ihm verschmelzen Körper, Geist und Seele. Sie sind Eins