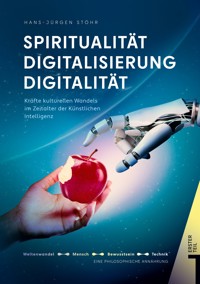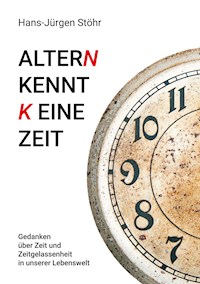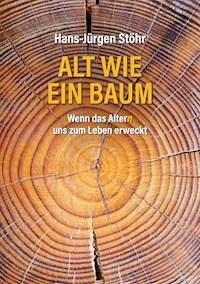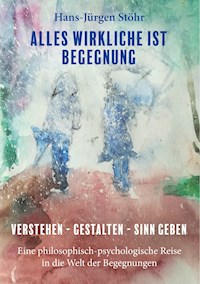Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im zweiten Teil wendet sich der Autor den Wachstumskräften und Werten neuzeitlichen Lebens zu. Spiritualität, Digitalität und Humanität werden ins Zentrum der philosophisch-ethischen Betrachtung gestellt. Für die Lesenden eröffnet sich die Welt des Wechselspiels spiritueller Digitalität und digitaler Spiritualität. Wechselwirkungen, gegenseitige Einflussnahmen, Gegensätzlichkeiten und Grenzräume tun sich auf. Im Zuge der Digitalisierung des gesellschaftlichen Lebens stellt sich die Frage nach dem Erfordernis eines ethischen Navigators, um einer ungezügelten KI-Entwicklung Grenzen setzen zu können. Braucht der Mensch das Spirituelle als Regulativ und Korrektiv, um einer wachsenden Übermacht des Digitalen entgegentreten zu können? Welches Instrument philosophischer Intervention erscheint tragfähig? Der geführte Diskurs über den spirituellen und digitalen Humanismus wird vom Buchautor als wertvoll und zugleich kritisch angesehen. Der Zusammenfluss von Spiritualität und Digitalität fordert den Menschen auf, sich dem spirituellen und digitalen Humanismus zuzuwenden und beide zum resonanten Humanismus zusammenzuführen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Intuition ist ein göttliches Geschenk, der denkende Verstand ein treuer Diener. Es ist paradox, dass wir heutzutage angefangen haben, den Diener zu verehren und die göttliche Gabe zu entweihen.
Albert Einstein (1879–1955)
Inhaltsverzeichnis
Zweiter Teil
Spiritualität ∙ Digitalität ∙ Humanität ∙ Resonanz
Werte neuzeitlichen Lebens
IV. Spirit und Spiritualität
Diesseits und Jenseits ∙ Seiten und Grenzgang in einer Lebenswelt
Spirit ∙ Das andere Seinsbewusstsein
Wege zum Spirituellen ∙ Quellen und treibende Kräfte
Spiritualität ∙ Korrektiv in der digitalen Lebenswelt
V. Kulturwandel und Digitalität
Digitalisierte Lebensqualität ∙ Zeit und Schnelllebigkeit
Digitalität ∙ Kultur von gewandelter Drittnatur
Digitale Lebenskultur ∙ Über (Un-)Sinn und Kritik
VI. Spiritualität und Digitalität
Spirituelles und Digitales ∙ Von Dialektik beseelt
Digitale Spiritualität und spirituelle Digitalität ∙ Neue Lebenswirklichkeiten
Spiritualität und Digitalität ∙ Qualitäten des Lebens im Grenzgang
EPILOG
Spiritualität ∙ Digitalität ∙Resonante Humanität
Digitaler und spiritueller Humanismus ∙ Wegbereiter zur resonanten Humanität
Resümee ∙ Eine Lebenswelt mit einem resonanten Humanismus ∙ Vierzehn Thesen und Botschaften
Literaturempfehlungen
Personen- und Sachregister
Autor
ZWEITER TEIL
IV. Kapitel
Spirit und Spiritualität
Diesseits und Jenseits Seiten und Grenzgang in einer Lebenswelt
Es liegt im Wesen des Menschen, ein Grenzgänger zwischen Diesseits und Jenseits zu sein. Sein Leben ist dadurch bestimmt, sich alltäglich zwischen diesen beiden Welten des Seins zu bewegen, sie erfahren zu wollen und in das Leben zu integrieren. Es ist ein Leben zwischen dem Hier- und Wegsein, dem Suchen und Finden. Es ist ein Leben, mit sich Eins zu sein und zugleich tagtäglich die Erfahrung zu machen, wie weit entfernt und wiederum nah Körper und Geist, die gegenständliche Lebenswelt und von außen wahrgenommenes Spirituelles, einschließlich Göttliches stehen.
Diesseits und Jenseits sind keineswegs nur spirituell zu verorten. In der Alltagssprache sind sie ebenso präsent, wenn mit ihnen Räumlichkeiten bzw. Zuordnungen abgebildet werden. „Jenseits von“ bedeutet so viel wie „außerhalb“ oder „fernab“, z. B. von einer Debatte oder von Gut und Böse. Es werden Grenzüberschreitungen vom Standort des Bisherigen (sprich: Diesseitigen) in Meinungen, Werten oder auch Örtlichkeiten zum Ausdruck gebracht. Insofern ist die Struktur der Beziehungen zwischen Diesseits und Jenseits gleichwertig zu nachfolgenden Betrachtungen über Diesseits und Jenseits. Sie ist es auch wieder nicht, weil deutlich werden wird, wie sich Diesseitiges und Jenseitiges ineinander wandeln. Das heißt, sie sind einander vermittelt, bedingen sich in ihrem Dasein. Diesseitiges schlägt in Jenseitiges um und umgekehrt; sie vermögen sich sogar in- und miteinander aufzulösen und ein klares Verorten ist nicht mehr auszumachen.
Jede Wirklichkeitsbewältigung zielt darauf ab, ob bewusst oder unbewusst, gewollt oder auch ungewollt, zwischen ihnen zu vermitteln und Brücken zu schlagen. Nur in diesem Verbinden sehen Menschen ein Leben, das sie trägt und sie sein lässt, was sie sind – ein Wesen mit Spiritualität. Das menschliche Seinsbewusstsein darüber, in einer inneren und äußeren, ideell-geistigen und materiell-gegenständlichen Welt zu leben, hat sie zu einem Diesseits und Jenseits als zwei Seiten einer vom Menschen erfahrbaren Lebenswelt gemacht. Wie ist dies zu verstehen?
Es scheint das Schicksal eines vernunftbegabten Wesens wie dem des Menschen zu sein, sobald es sich seines Selbst bewusst wird und über sein Ich-Sein zu reflektieren vermag, an sich zu beobachten, wahrzunehmen und zu erkennen, dass er sich zwischen Erfahrbarem und Nicht-Erfahrbarem, Erklärbarem und Nicht-Erklärbarem bewegt.
Die Grenzen sind fließend, ebenso die zwischen Sinnlichem und Kognitivem. Manchmal sind wir uns gar nicht sicher, in welcher dieser Welten wir uns bewegen: Sind sie objektiv und real oder sind sie ein Produkt unseres menschlichen Bewusstseins, eine Verzerrung unserer Wahrnehmung, die wir als wahrhaftig erkannt haben wollen?
Wir brauchen gar nicht bis zum Ursprung des archaisch-animistischen Denkens zurückgehen, wenn wir den Grenzgang zwischen dem Diesseitigen und Jenseitigen erfahren wollen. Es sind zwei sich bewegende und zugleich sich wandelnde Seiten einer Lebenswelt.
Der Erfindergeist des menschlichen Bewusstseins hat uns mit der Digitalisierung eine Lebenswelt erschaffen, die wir als eine Welt mit Echtzeit kennenlernten. Wir sind stolz auf sie, weil sie uns an einer Welt teilhaben lässt, von der wir meinen, es ist unsere Lebenswelt. Hologramme sind mit holografischer Technik hergestellte dreidimensionale Bilder, die eine körperliche Präsenz im realen Raum zeigen. Sie vermitteln uns Gegenständlichkeit, ein Diesseits, das sich digital als jenseitig des Körperlichen, Dreidimensionalen auflöst. Mit diesem Wissen werden wir zunehmend mit der Frage konfrontiert: Ist sie das wirklich oder bewegen wir uns in eine Welt der Parallelität?
Vor dem Hintergrund einer auf Digitalisierung aufgebauten Lebenswelt erhalten Diesseits und Jenseits und die in der Philosophie internalisierten Begriffe Immanenz und Transzendenz eine neuerliche, inhaltliche Akzentuierung.
Weit weg von einer begrifflichen Verortung beschreibt das Diesseitseine gegenständliche, von der Natur aus begründete Lebenswirklichkeit. Das Diesseits ist in der Unmittelbarkeit erfahrbar, gegenständlich und rational erfassbar. Es ist durchschaubar und in den Wirkungszusammenhängen (meistens!) begründbar. Wir erkennen in dem Diesseits eine Logik, das in unserem Bewusstsein Nachvollziehbare. Mit diesem Wissen vermögen wir gestalterisch auf unsere Lebenswelt einzuwirken, sie zu beeinflussen bzw. zu verändern.
Die über das menschliche Bewusstsein sich realisierende Wirklichkeitsverarbeitung war in den Anfängen des Denkens bestimmt durch eine enge Verbindung zwischen dem Ich-Sein des Individuums und der Wirkungskraft der Natur. Mensch und Natur waren durch die Macht der Natur und die Ohnmacht des Menschen so miteinander verbunden, dass die Abhängigkeit des Menschen von der Natur nur derart bewältigt wurde, der Natur menschlichen Charakter zu verleihen und entsprechend abzubilden. Die Natur wurde über Jahrtausende „vermenschlicht“, indem der Mensch der Natur den Stempel seiner Ideen und Wirkungskraft aufdrückte.
Das geschah nicht nur durch die menschliche Handlungskraft an geleisteter Naturveränderung. Hinzu kommt, dass der Mensch seine innere Gedanken- und Lebenswelt auf seine Außenwelt projizieren konnte und der Anschein entstand, das von sich aus Übernatürliche bzw. Übermächtige zu tragen, die sich, verbunden mit der Außenwelt, verselbständigten. Die Folge war, dass der Mensch über sich wahrnahm, selbst über eine übermenschliche Kraft zu verfügen.
Da der Mensch sich seiner eigenen, begrenzten Seelen- bzw. Geisteskraft bewusst war und im Gegenzug das für ihn immanente Übermächtige, Unheimliche, Nicht-Beherrschbare auf die Natur übertrug und in Gestalt von Geistern, Göttern oder Dämonen personifizierte, ist es nachvollziehbar, dass sich im menschlichen Denken ein Welt herausbildete, die sich als Jenseits bzw. Jenseitiges etablierte.
In dem Jenseits zeigt sich für den Menschen eine Lebenswelt, in der nach menschlichem Verständnis Kräfte agieren und wirken, die ihr eigenes Dasein machtvoll zelebrieren. Das Jenseitige ist der (himmlische, göttliche, übernatürliche, übermenschliche) Lebensraum, der sich vom Diesseitigen bei gleichzeitigem Bemühen abgrenzt, die Grenze zwischen diesen Welten durchlässig zu halten.
Der Mensch schafft aus seinem Diesseits sein Jenseits, erzeugt aus seinem archaischen Denken eine jenseitige Welt, sieht sich mit ihr konfrontiert und entwickelt in Gestalt eigener Lebenshilfe eine Strategie des Brückenbaus zwischen ihnen. Seine vom ihm erzeugte Weltenteilung trägt in sich zugleich das innere Bestreben, das Jenseits ins Diesseits zu holen, indem er sich aus dem Diesseits in das Jenseits bewegt.
Mit Blick auf die griechische Mythologie spiegelt sich diese Weltenteilung wider, die im Zuge der Teilung wieder aufgehoben wird. Am Anfang war das Chaos, das Nichts, die gähnende Leere als Erstzustand der Welt vor dem Entstehen einer Welt danach. Schon hier war das Diesseits als weltlicher Urzustand, aus dem sich das Jenseits, das üppige Hervorbringen der Götterwelt, transformierte. Es wurde Göttliches gezeugt und geboren. Aus dem weltlichen Nichts wurde Gaia, die Erde, geboren; bei den Römern war es Tellus. Dieser Welt stand die Unterwelt, repräsentiert von Tartaros und Hedes, der als Totengott mit seiner Gemahlin Persephone über die Verstorbenen thront und die Verbindung zwischen dem Sein und Nichts, dem Diesseits und dem Jenseits hält.
Fernab von jeder Liebe bringt auf jungfräuliche Weise Gaia den Uranos, den Himmel ins Diesseits, das zugleich das Jenseits werden sollte, obwohl die „Erde“ mit dem „Himmel“ so manche Titanen, sechs Söhne und ebenso viele Töchter, zeugte.1 Die Weltenteilung nahm ihren Lauf, die in der Geschichte der Religionen einen etablierten Platz gefunden hat. Die Trennung von Himmel und Erde war genauso weit entfernt wie die Erde von der Unterwelt, die im Christentum sich als Hölle darstellte.
Die Ohn(e)macht des Menschen (Diesseits) gegenüber der Übermacht der Natur (Jenseits) führte dazu, dass der Mensch diese Weltenteilung vornahm. So hat er sich ein gedankliches Konstrukt geschaffen, um mit diesem lebensweltlichen Ungleichgewicht klarzukommen und sie so für sich beherrschbar zu machen. Die Eine-Welt wird uneins gedacht und gelebt. Sie zeigt sich in einem (realen) Raum zweier (gedachter) Gegensätze. Der so entstandene nichtgegensätzliche Gegensatz zieht sich durch die Geschichte des menschlichen Denkens und Verhaltens in der Gesellschaft. Durch seine von ihm vollzogene Weltenteilung zeigt sich der Widerspruch mit sich selbst. Indem der Mensch sich seine Welt in das Diesseits und Jenseits aufteilte, war dies zum einen die logische Konsequenz, seine Lebenswelt zu verstehen und mit diesem Verständnis in dieser Welt sich zurechtzufinden. Zum anderen hat er sich zum Knecht seines eigenen Daseins gemacht, sich seiner geschaffenen Weltenteilung unterworfen.2
Das Diesseits ist mit dem Jenseits verbunden. Sie sind vom Menschen gedacht zwei und doch eins mit der Natur, weil der Mensch Teil seiner selbst und seiner Natur ist. Aus dieser Warte ist es verständlich, Dies- und Jenseits als zwei Seiten einer Welt zu erfassen und als zwei Perspektiven des Lebens zu denken. Diese Weltenteilung ist begründet durch die kognitive Fähigkeit des Menschen, in- und ausseitige Welten auszumachen bzw. kreativ abzubilden. Diese Weltenkonstruktion von Wandelgängen zwischen Diesseits und Jenseits ist letztlich ein Produkt des Diesseits menschlichen Seins und Denkens.
Wie stellt sich das Konstrukt und der Wandelgang menschlicher dies- und jenseitiger Weltenteilung dar? Wenn es ein Diesseits menschlichen Denkens gibt, welches das Hier und Jetzt, das unmittelbar gegenständlich Erfahrbare zum Ausdruck bringt, so ist der Schluss naheliegend, dass auch von einem Jenseits des Denkens gesprochen werden kann, wenn wir mit ihm Raum und Zeit außerhalb des Hier und Jetzt verknüpfen.3
Das Jenseitige – so hier die Arbeitshypothese und das erweiterte Begriffsverständnis – ist zum einen ein Denkinhalt im Unterschied zum Diesseitigen und zum anderen eine Denkweise mit Blick auf Raum und Zeit. Das jenseitige Denken – im Gegensetz zum diesseitigen – ist das bewusste Hinwenden zu einer gedachten, im Geiste des Menschen existierenden Lebenswelt. Das Jenseitige ist im menschlichen Denken zu verorten. Das Diesseitige ist menschlich denkbar; im Inhalt steht es außerhalb des menschlichen Denkens – so der Ausgangspunkt in der Betrachtung zwischen dem Diesseits und Jenseits.4
Bei aller Differenziertheit zwischen Diesseits und Jenseits als Denkinhalt und -methode und einer daraus vom Menschen kreierten Weltenteilung ist er darauf bedacht und lässt nichts unversucht, den Kontakt zu jenem Teil des Lebens herzustellen, der ihm als das Jenseitige gegenübertritt. Der Alltag des Menschen ist von religiös-spirituellem Denken und Handeln bestimmt. Gebete, das Anrufen der Götter, Zeremonien, Rituale verschiedenster Art sind Zeugnisse, mit dem Jenseits in Kontakt zu treten.
Die griechischen Götter waren trotz ihres Eigenlebens, bestimmt durch Zank, Streit, List, Bestrafungen untereinander, Akteure ihres Daseins zum Menschen. Sie taten Gutes für den Menschen; sie ließen auch das Böse nicht unberührt. Es ist Zeus als das religiös-mythisch transformierte Himmelsbild, der es regnen lässt, was sich im späteren Sprachgebrauch widerspiegelt.5 Der Regen als das Gute für den Menschen war die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen Mensch und den Göttern. Gleichsam wussten die Götter auch die Menschen zu bestrafen – das Ebenbild von Bestrafungen unter den Menschen wie auch unter den Göttern.
In Anbetracht der Geschichte des menschlichen Denkens hat der Mensch seine eigene Magie hervorgebracht, um, wie in den Ursprüngen des erwachenden Denkens begründet, mit seinem Dasein verträglich umzugehen. Daran hat sich bis heute trotz aller moderner Wissenschaft, Technik und Gesellschaft, trotz gewonnener Macht des Menschen über die Natur, trotz des eingeleiteten Anthropozäns nichts geändert. Der Mensch bleibt seine, in den Ursprüngen archaischen Denken tief verbunden, auch wenn sich die Geschichte der Gesellschaft im Sinne der Aufklärung wandelte.
Lässt sich die Gedankenbeziehung von Diesseits und Jenseits auf das Verhältnis von Analogem und Digitalem übertragen?
Ein denkbarer Zusammenhang zwischen diesen beiden Paaren scheint nicht abwegig zu sein, solange das Jenseitige auf das Spirituelle reduziert wird. Insofern ist es interessant, diese Frage aufzunehmen und den beiden Verhältnissen von Spirituellem und Digitalem einerseits, Analogem und Digitalem andererseits assoziativ nachzugehen. Es mutet spekulativ an: Was würde es bedeuten, das Digitale als Jenseitiges zu erklären?
Alles Analoge wäre vom Charakter her im und als Diesseitiges aufgehoben. Alle Technik vor der Digitalisierung war von analoger Natur und hat ihren Platz in einer Lebenswelt zwischen Mensch und Natur: real, gegenständlich, fassbar. Es ist eine Technik im Hier und Jetzt. Das ließe sich auch von jener Technik sagen, die sich vom Analogen zum Digitalen wandelte, also eine Digitalisierung durchlief. Das macht keinen Unterschied. Beide haben ihre Materialität (Gegenständlichkeit) nicht eingebüßt. Was jedoch anders ist, ist der Wandel vom Diesseits hin zum Jenseits und der vom Analogen hin zum Digitalen. Beides sind Wandlungen, jedoch von jeweils qualitativ anderer Natur.
Der Übergang vom Diesseits zum Jenseits ist tradiert die Transformation vom Gegenständlichen bzw. aus dem menschlichen Bewusstsein hin zu einer Welt, die sich außerhalb von diesen beiden befindet. Das Jenseitige wird idealisiert, wird mit einem ideellen, göttlichen oder spirituellen Prinzip verknüpft, das oft im Verständnis mit Raum- und Zeitlosigkeit einhergeht.
Digitales ist transformiertes Analoges. Beides ist an Technisches geknüpft. Zwischen ihnen findet ein Wandel innerhalb des Technischen statt. Keiner von beiden verlässt diesen Raum. Dennoch erweckt im Auge des Menschen das Digitale den Eindruck, von einer anderen Welt zu sein. Diese Transformation gibt einen assoziativen Vergleich zu jener zwischen dem Diesseits und Jenseits her, weil der Wandel vom Analogen zum Digitalen (Digitalisierung) und das Digitale selbst für viele Menschen unerfahren, unerkannt, gedanklich genauso wenig nachvollziehbar und kontrollierbar ist wie das Jenseitige. Beides mutet transzendent an.
Diese Einschätzung verändert sich und erfährt Neuerliches, wenn das Digitale sich zusehends vom Analogen loslöst und eine Qualität annimmt, die sich für den Menschen immer weiter in Richtung des menschlichen Bewusstseins bewegt. Gemeint ist die Transformation ins Digitale im Charakter einer Künstlichen Intelligenz. Mit dem Digitalen kreiert der Mensch Welten, die in der Wahrnehmung den Eindruck vermitteln, mit ihr in einer anderen Welt zu sein. Wir nehmen Parallelwelten wahr: die eine spielt sich digital unterstützt in einer Welt des menschlichen Bewusstseins ab, während die andere, uns vertraute Welt als gegenständlich und fassbar entgegentritt. Wir können uns bereits in einer digitalen Welt der Hologramme und Avatare bewegen, die uns glauben lassen, in dieser Welt zu sein. Mensch und Virtualität verschmelzen, wenn auch derzeitig in Raum und Zeit begrenzt.
Ist das das neue Jenseits? Es ist zweifellos ein anderes Jenseits als das uns bekannte, tradierte, spirituell geprägte Jenseits. Es geht über das bisherige Jenseitsverständnis hinaus, erweitert es. Jener Teil steht für ein digitales Jenseits.
Soweit das Digitale das Verbindende zwischen diesen beiden Welten – gemeint sind das Analoge und Diesseitige – ist, werden Übergang, Wandel, Grenzüberschreitung ausgedrückt. In Bezug auf das Digitale zeigen sich Diesseits und Jenseits als „Grenzgänger“ wie das Digitale selbst.
Diesem Gedankengang folgend ist das Digitale auch Teil des Diesseits. Es ist digitales Diesseits – präsent in den Ziffern Null und Eins, mit den gebauten Endgeräten, in denen sich das Digitale realisiert bzw. virtuelle Welten erzeugt werden. Das Digitale (Virtuelle) präsentiert sich hier in einer Doppeleigenschaft, als und im Diesseits und Jenseits zu sein.
Soweit sich diese Überlegung verallgemeinern lässt, formuliere und behaupte ich: Phänomene mit einem derartigen Doppelcharakter, die sich wie Grenzgänger zwischen zwei Welten bewegen, sind nicht nur von einer inneren Gegensätzlichkeit6 bestimmt, sondern zeugen zugleich von einer besonderen Brisanz um Umgang mit ihnen.7 Vielleicht gibt diese Beschreibung und Anerkennung eines derartigen Markers – von innerem Gegensatz zu sein – Anlass, in Sorge zu sein. Hier wird in diesem Fall über die Sorge um ein wachsendes Risiko bei der Anwendung und Nutzung des Digitalen im gesellschaftlichen und privaten Leben gesprochen.
Gemeint ist die Fortsetzung des Gedankens, wenn wir jener Entwicklung im Digitalen unterstellen, dass der menschliche Geist neuronal eine perfekte digitale Nachbildung erfährt und diese in Kognition, Sprache, Verhalten und Gefühlsäußerungen der Natur des Menschen gleichkommt. Es sind die humanoiden Roboter, dem Menschen in allem nachempfunden und immer ähnlicher, fast gleich werdend, ohne selbst Mensch zu sein. Die Unterscheidung löst sich immer auf; sie zerfließt zwischen Analogem und Digitalem, Dies- und Jenseitigem, geht im In- und Miteinander auf.
Haben wir es dann mit einer Welt zu tun, in der sich die Parallelwelten immer mehr auflösen, weil sie sich angleichen, in ihren Charakteren immer ähnlicher werden? Ist das neue (digitale) Jenseits des Menschen, das digitalisiert Kompetenzen (Denken, Intelligenz, Lernen, Gefühle ausdrücken etc.) besitzt und ein digitales Eigenleben repräsentiert, vergleichbar und ähnlich im Charakter wie menschlicher, spirituell-religiöser Glaube, der Hoffnung und Liebe einschließt?
Das geistige Jenseits vermag der Mensch in seinem Diesseits aufzulösen, wenn er eine Umbewertung der geistig-religiös-spirituellen Welt zulässt. Eine derartige Rückholaktion vermag der Mensch mit eigener Kraft zu bewerkstelligen, wenn er es wollte. Denn dieser Wandel ist eine Transformation im Geiste. Ganz anders ist es, wenn sich das Digitale vom Menschen abgelöst hat und ein autarkes Leben führt, d. h. der Mensch über das Digitale nicht mehr die Kontrolle hat. Dieses Digitale ist zwar ein vom menschlichen Geist begründetes; aber auch ein technisches, außerhalb vom menschlichen Bewusstsein existierendes Produkt – jenseits, neben dem Menschen stehend: gegenständlich und digitalisiert. Ob das digitale Jenseits sich in das technische Diesseits zurückholen lässt, hängt nach meiner Auffassung davon ab, wie autark das digitale Jenseits geworden ist.
Es liegt ganz allein in der Macht und geistigen Kraft des Menschen, wie viel er an Jenseitigem über das Diesseitige entlässt.
Es bleibt die Anregung, das Jenseits nicht auf das Religiös-Spirituelle zu beschränken, sondern auch auf andere Lebensbereiche auszuweiten, um auf diesem Wege Transformationen in ihrer Wirkung auf Weiteres zu überprüfen.8
Wie die Geschichte der Philosophie zeigt, war sie stets fasziniert, in Erfahrung zu bringen, wie das tradierte, mit der Natur, Über- und Unterwelt verbundene Bewusstsein des Menschen – sich zwischen den Welten des Diesseits und Jenseits bewegend – darum bemüht war, zwischen ihnen Verbindendes, Einheitliches, Ganzes herzustellen. Insofern konnte das philosophische Denken das gedachte Dies- und Jenseits nicht unkommentiert liegen lassen. Es bewegte die Geschichte der Philosophie. Aus einem von den Menschen verinnerlichten Diesseits (Weltlichen) einerseits und Jenseits (Spirituellem, Geistig-Göttlichen) andererseits konfigurierten sich Transzendenz und Immanenz als Begriffe in der Philosophie.
Was hat die Philosophie aus dem menschlichen Verständnis über Diesseits und Jenseits, dem archaisch-animistischen, mythisch-spirituellen Denken rekrutiert? Welchen Grund gab es, sich dieser Problematik philosophisch anzunehmen?
Die erzählten griechischen Mythen standen mit dem Aufkommen der ionischen Philosophie in enger Verbindung. Die philosophische Beschreibung der Welt, das Herausfinden, was die Welt begründet und im Innersten zusammenhält, stand nicht im Gegensatz zum Götterglauben. Die Ergründung der Lebenswirklichkeit des Menschen erzeugte in keiner Weise einen Widerspruch zu der anerkannten Götterwelt.
So wie das Spirituelle seinen Grund in der Natur des menschlichen Bewusstseins hat, zeigt sich im Vergleich dazu im Philosophischen der Idealismus als weltanschauliche Denkrichtung. Die Fähigkeit des Menschen, die Lebensdinge abstrakt, d. h. verallgemeinert, begrifflich, in Form von Gesetzen zu beschreiben, machte es ihm auch möglich, die Welt an sich in einem göttlichen Wesenszustand zu erfassen. Diese in der Evolution angelegte Form des menschlichen Denkens hin zur Begriffs-, Gesetzesbildung und -beschreibung bildete die Grundlage für die Fähigkeit zur idealistischen Denkweise. Der Mensch vermag die Dinge des Lebens, die menschliche Außenwelt in Ideelles, in Produkte menschlichen Bewusstseins zu verwandeln. Ideen, wie es u. a. die Begriffe sind, repräsentieren dann in unserem Bewusstsein in abstrakter Weise unsere dingliche, außerhalb unseres Bewusstseins existierende Welt. Das Diesseitige und Jenseitige lässt sich hier neuerlich verorten. Die Welten-Dinge positionieren sich für uns Menschen mit deren Erfassung im Bewusstsein als das Jenseitige, während sich unsere Kreationen im Bewusstsein (Ideen, Gedanken, Erzählungen etc.) als Diesseitiges, als das Uns- bzw. Mitseitige, darstellen.
Wie bereits in der Abhandlung über das archaische-animistische Denken erwähnt, sind Dies- und Jenseitiges vermeintlich auf den Kopf gestellt. In der Philosophie Platons (427–347 v. Chr.) findet diese Kopfstellung ihren exponierten Ausdruck. Platon hebt mit seiner Philosophie das Göttliche als absolute Idee in den Stand des Philosophischen. Es sind vielmehr die Idee, das Abstrakte, Gesetzliche, Begriffliche, die sich aus dem unmittelbaren Erkenntnisprozess herauslösen und verselbständigen. Unter einer Idee verstand Platon einen allgemeinen Begriff, der weder im menschlichen Bewusstsein entsteht noch vergeht und damit keiner Veränderung unterliegt. Er ist durch sich selbst bestimmt, substanziell, ewig, immer sich selbst gleich. Mit der Idee (Substanz) werden die Dinge konkret, wirklich und werden das, was sie jenseits sind und uns diesseits erscheinen. Die Idee kreiert unsere Lebenswelt, strebt und lebt mit anderen Begriffen in einer hierarchischen Ordnung, in der die Idee des Guten den Höhepunkt bildet. Das Platon´sche Höhlengleichnis9 in Der Staat macht seine idealistische Weltsicht deutlich, die den objektiven Idealismus begründete.
Das Diesseits ist das Jenseits. Das Jenseits ist das Diesseits. Es macht letztlich keinen Unterschied, aus welcher Perspektive wir unsere Wirklichkeit betrachten, ob wir unsere Vorstellungen als Ursprung, Quelle, Ursache und unsere Äußerungen, Aus-Würfe menschlichen Bewusstseins als deren Produkt ansehen oder nicht. Beides ist beides. Nach Platon sind es im Diesseits die Begriffe, die Substanzen, die als Produzenten, Schöpfer einer realen, gegenständlichen und damit jenseitigen Welt auftreten und das Jenseitige präsentieren. Das Obst zeigt sich in der Substanz, macht das Wesen der Äpfel, Birnen, Pflaumen usw. aus. Die hier genannten Früchte sind das Produkt des Obstes, sind dessen Lebensäußerungen.
Es ist der nicht abebbende philosophische Streit, ob das Wesen, das Allgemeine der Dinge in den Dingen selbst angelegt oder lediglich ein Produkt des menschlichen Bewusstseins sei.10
Die Bestimmung, was sich als Dies- und Jenseitiges äußert, bleibt für unser herkömmliches Verständnis verwirrend und undurchsichtig. Das ist es auch, weil je nach Sicht auf das Verhältnis von Bewusstsein und dessen Außenwelt, je nachdem, was als Ursache und Wirkung, Quelle und Resultat betrachtet wird, das Diesseits und Jenseits in der Position wandelt und sich verändert. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie zueinander nicht absolut fixiert, sondern relativ bestimmt sind. Für das Verstehen von Diesseits und Jenseits und dessen Zuordnung ist der Kontext entscheidend und zu berücksichtigen.
Die Annahme von Doppelwelten ist nicht neu. In der Astronomie wird von einer Anti-Welt zu der uns bekannten kosmischen Welt gesprochen. Mit der Digitalisierung leben wir ebenso in zwei Welten: in einer realgegenständlichen und einen virtuellen. Menschen mit Alzheimer-Demenz leben in einer anderen Welt als jene, die von dieser Krankheit nicht betroffen sind. Wer will genau sagen können, ob die Welt der Normalen die richtige, diesseitige, und die der Alzheimer-Betroffenen jenseitig, verzerrt sei?11 Die Welt(sicht) jener wird nicht selten als verrückt erklärt. Ist sie deshalb besser oder schlechter? Wer will das beurteilen, solange wir aus eigener Erfahrung nur die Welt der Nicht-Demenz und jene Welt aus dieser Perspektive kennen und beurteilen?12
Was spricht dagegen, die Lebenswelt eines ungeborenen Kindes im Leib der Mutter als diesseitig zu betrachten und dass sich das Baby mit seiner Geburt in das Jenseits bewegt? Es mag diese Betrachtung als ungewöhnlich erscheinen. Zwei Welten sind es für Neugeborene auf jeden Fall. Im Mutterleib gewachsen: beschützt, geborgen, sicher und unbewusst vertraut, wird es nach der Reife gefühlt in eine unwirkliche Welt geworfen, um sich mit dem neuen Dasein auseinandersetzen zu müssen – das Jenseitige zum Diesseitigen zu transformieren. In den folgenden Monaten und Jahren wandelt sich das einstmals gespürte Jenseits zum Diesseits eigenen Lebens; und das Diesseitige des Ungeborenen schwindet in die Welt des Unbewussten – ins Jenseits.
Das Resümee dieser Überlegungen ist, dass wir mit dem Diesseits und Jenseits unterschiedliche Bedeutungen denken können, in und mit ihnen Grenzüberschreitungen stattfinden. Sie sind erstens irrational und immanent mit dem menschlichen Denken und Verhalten verbunden, soweit das Jenseitige aus dem Diesseitigen geschöpft wird. Das Jenseits ist eine auf den Glauben begründete Gedankenwelt, die nach außen in Gestalt einer eigenen Lebenswelt getragen wird, in der u. a. Götter, Elfen oder Trolle ihr Zuhause haben. Zweitens macht es auch Sinn, von einer dies- und jenseitigen Lebenswelt zu sprechen, wenn sie einen real-existierenden Hintergrund und keinen animistischen, glaubensbetonten Hintergrund hat. Das u. a. oben angeführte Beispiel der Lebenswelt von Menschen, die aufgrund ihrer Alzheimer-Demenz sich zusehends von der Welt des normalen Lebens wegbewegen und in ihre eigene Welt hineingehen, macht uns in der Erfahrung und im Umgang mit ihnen oft fassungs- und machtlos. Unsere Erfahrung ist, dass zwischen ihnen und uns zwei Welten existieren. Während wir ohne diese Erkrankung auf der diesseitigen Seite stehen, verorten wir die Betroffenen auf der Seite des Jenseits. Diese beiden Seiten sind durchlässig, wenn auch i. d. R. nur in eine Richtung, wenn wir es mit aller Kunst des Verhaltens und der Kommunikation vermögen, die Brücke hin zu deren Welt zu bauen.
Das Muster zwischen dem Diesseits und Jenseits ist immer das gleiche. Es ist nicht animistisch-spirituell, wie wir es z. B. bei vielen (a)religiösen Zeremonien (Ritualen, Sitten und Gebräuchen) kennen. Was diese Muster vergleichbar macht ist, dass in beiden Fällen Handhabungen, Verhaltensweisen und eine speziell gewählte Ansprache (Kommunikation) vonnöten sind, um sich in die andere Welt, die uns als fremd, jenseitig gegenübertritt, mit Verständnis und Annahme hineinzubewegen und mit den Subjekten13 dieser Welten einen Kontakt herzustellen.
Zurück zu Platon. Seine Philosophie etablierte und festigte sich als Philosophie des objektiven Idealismus. Ohne sie weiter verfolgen zu wollen, um den Blick auf das Spirituelle nicht zu verlieren, sei die weitere philosophische Aufmerksamkeit auf das in der Philosophie geprägte Begriffspaar Immanenz und Transzendenz gelenkt. Was ist darunter zu verstehen? Was unterscheidet dieses von dem obigen Diesseits und Jenseits? Inwieweit ist jenes Verständnis für unsere weiteren Überlegungen über das Verhältnis von Spirituellem und Digitalem interessant?
Während Diesseits und Jenseits in unserem alltäglichen Sprachgebrauch üblich sind, haben Immanenz und Transzendenz ihren Platz in der Theologie und Philosophie, aus denen in der Denkgeschichte Theorien bzw. Methoden hervorgingen. Das Immanente ist das im Inneren Bleibende, das Innenwohnende. Es sind Eigenschaften, Merkmale, die einem Gegenstand innewohnen; es sind auch Ideen, Gedanken, die ihren Platz im menschlichen Bewusstsein haben. Im tradierten Gottesglauben ist Gott transzendent, außerhalb des menschlichen Seins, dem Menschen gegenüberstehend. Die Vorstellung von ihm dagegen ist immanent, in unserem Bewusstsein präsent.
Für Baruch de Spinoza (1632–1677) als Verfechter des Pantheismus ist Gott gleich Natur, was bedeutet, dass das Göttliche der Natur immanent ist. Immanenz und Transzendenz haben ihre Plätze behalten, nur mit dem Unterschied, dass das Göttliche nicht in der Gestalt eines eigenständigen Wesens, sondern universell in den Dingen des Lebens existiert. Mit dem Pantheismus zeigt sich dessen Immanenz in der Transzendenz.
Für viele Menschen unserer heutigen, modernen Zeit mit christlichem Glauben steht Gott nicht außerhalb, transzendent von ihnen, obwohl Predigen und Sprechformeln auf den personifizierten Gott zurückgreifen. Stattdessen tragen sie in Überzeugung das Göttliche in und mit sich. Das Transzendente ist in ihnen gleichsam immanent. Die im Menschen innewohnende Seele verlässt den Menschen nach dem Tod. Die innewohnende Transzendenz im Menschen in Gestalt einer von Gott getragenen Seele wird transzendent; sich bewegt sich aus den Inseits in das Jenseits. Das macht die Seele für den Menschen immanent und transzendent zugleich.
All das bleibt außerhalb jeglicher und unmittelbarer Erfahrung. Es ist eine Frage des Glaubens. Insofern versteht sich das Transzendente als das außerhalb jeglicher menschlicher Erfahrung Stehende. Es ist das Göttlich-Immanente, im Menschen Wohnende. Es ist die Seele, die dem Menschen immanent ist und mit dem Sterben und Tod ins göttliche Sein transzendent wird.
Während das Transzendentale dem Jenseitigen gleichkommt, versteht sich das Transzendentale als philosophischer Begriff. Sogenannte Transzendentalien wie Sein, Qualität oder Quantität sind aus der Philosophie der Scholastik bekannt. Transzendentales ist außerhalb des empirisch Bestehenden. Das Transzendentale hat zur Bedingung die Erfahrung; sie ist Methode, ein Weg zur Erkenntnis, die das Subjekt aus der Erfahrungswelt führt.
Dieses Verständnis findet seine Kernaussage in der Kant´schen Philosophie, in seiner Kritik der reinen Vernunft (1781), in der er die Hauptfrage stellt: Ist und wie ist wissenschaftliche Erkenntnis möglich? Dabei geht es Immanuel Kant (1724–1804) nicht um die Erkenntnis der Gegenstände selbst, sondern vielmehr um die Bedingungen und die Möglichkeiten menschlicher Erkenntnisgewinnung. Er nennt den Erkenntnisweg transzendentale Methode. So heißt es: „Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, insofern diese a priori möglich sein soll, beschäftigt.“14
Für unser weiteres Verständnis, dem Spirituellen und Digitalen auf den Grund zu gehen, ist Immanenz und Transzendenz von Bedeutung. Immanenz als das in den Dingen Innenwohnende steht gleichsam in Beziehung zum Transzendenten, jenseits von der menschlichen Erfahrung, den irdischen Dingen liegend. Transzendenz versteht sich als das Überschreiten von Erfahrungsgrenzen, sich über das menschliche Bewusstsein hinauszubewegen.
Immanenz und Transzendenz charakterisieren für sich und zueinander ein Beziehungsverhältnis. Gemeint ist erstens, dass mit beiden – Transzendenz und Immanenz – ein Verhältnis zwischen dem Erkenntnisgegenstand und der menschlichen Erkenntnis (Erfahrung) zum Ausdruck gebracht wird. Sie zeigen an, wie wir im Rahmen unserer (gemachten!) Erfahrung zu diesen Dingen stehen. Zweitens repräsentieren Immanenz und Transzendenz ein Verhältnis zueinander. Das äußert sich darin, dass sie zueinander nicht einfach, formal, sprachlich, wie in der Begriffsbestimmung ersichtlich, oft einander gegenübergestellt werden und sich ausschließen, sondern dass sie zugleich einander bedingen, sich wechselseitig voraussetzen. Und das nicht nur in der begrifflichen Fassung, sondern auch inhaltlich-gegenständlich. Das bedeutet, dass es im Immanenten Transzendentes und umgekehrt zu entdecken gibt.
Ich betrachte diesen Gedanken für überlegenswert, weil er uns Raum gibt, Transzendentes und Immanentes nicht nur in der Gegenüberstellung in Bezug auf den Bereich außerhalb oder jenseits möglicher und diesseitiger Erfahrung anzusiedeln. Welchen Grund sollte es dafür geben, das Transzendente ausschließlich mit dem Überschreiten der endlichen Erfahrungswelt zu verknüpfen? Was spricht dafür, an der Komplementarität von Immanenz und Transzendenz festzuhalten, stattdessen sie zu erweitern und in einer dialektischen Gegensatzbeziehung zu verorten?
Immanenz und Transzendenz in einem dialektischen Gegensatzpaar zu sehen heißt, sie in einer wechselseitigen Ein- und Ausschließlichkeit anzuerkennen und in den Erfahrungsdingen als auch in jenen, die außerhalb unserer Erfahrungswelt stehen, beides in beidem anzuerkennen.
Kritiker mögen dem entgegenhalten, dass jede Trennung von Diesseits und Jenseits aufgehoben wird und damit ihre Bedeutung verliert. Es ist richtig, dass die vielfach bestimmte Gegenüberstellung von Transzendenz und Immanenz aufgehoben wird – und diese nicht nur komplementär, sondern auf dialektische Weise, im Sinne einer wechselseitigen Ausschließlichkeit und Bedingtheit. Transzendentes zeigt sich in seiner Immanenz. Immanentes trägt auch Transzendentes in sich.
Immanenz und Transzendenz verlieren ihren Erkenntniswert in der ausschließlichen Grenzziehung. Sie heben sich jedoch wieder zum Guten auf, erhalten eine wie oben beschriebene dialektische Wertigkeit, wenn wir uns den Lebensdingen zuwenden. Hier – auch wenn die hier angestellte Betrachtung einseitig daherkommen mag – ist die These von der Dialektik von Immanenz und Transzendenz auf den Gegenstand von Spirituellem und Digitalem fixiert.
In diesem Kontext bedeutet das und als These formuliert, dass Spirituelles und Spiritualität, Digitales, Digitalisierung und Digitalität nicht ohne Transzendenz und Immanenz zu denken und zu beschreiben sind. Auch hier gilt: Beides ist in beidem.
Im Gesamtbild des Dialektischen von Diesseits und Jenseits, von Immanenz und Transzendenz verkörpern sie Parallelwelten, zwischen denen aus Sicht des Menschen zum einen ein Ungleichgewicht und zum anderen das Jenseitige und Transzendente als Übermacht wahrgenommen wird. Im menschlichen Bemühen, die Welt für sich erklärbar zu machen, Erkenntnisse über sie zu gewinnen, stößt der Mensch auf seine Grenzen: Mit seinem Diesseits zeigt sich das Jenseits, mit der Immanenz wird er mit der Transzendenz konfrontiert. Doch die transzendente Welt als die Welt außerhalb des Erklär-, jenseits des Versteh- und Nachvollziehbaren, außerhalb jeder Logik menschlicher Gedanken und der unmittelbaren Lebenswirklichkeit bewegt sich nicht in starren Grenzen. Es sind Welten, deren Grenzen sich verschieben lassen, ohne dass sie sich vollständig auflösen und in ihnen Wandlungen möglich sind. Diesseits und Jenseits, Immanenz und Transzendenz sind kognitive und handlungstragende Verortungen, die uns bei unseren Grenzüberschreitungen hilfreich zur Seite stehen, soweit wir sie in ihrer dialektisch-widersprüchlichen Fassung akzeptieren.
Die als parallel in Grenzen gedachten Welten zeigen sich gleichermaßen in ihrer Durchlässigkeit. Diesseitiges gibt Raum frei für Jenseitiges. Jenseitiges löst sich im Diesseitigen auf, weil neue Erfahrungen und Erkenntnisse das Diesseits erweitern. Jede neue Weltenerfahrung und - erkenntnis ermöglicht Raum für Jenseitiges. Sie wird zu dem, wenn der Menschen vor nicht Erklärbarem bzw. Verstehbarem steht. Dabei ist es unwichtig, ob sich diese Welten im und zwischen dem Menschen, zwischen Mensch und seiner äußeren Lebenswelt bewegen.
Der weiterhin zu führende Diskurs, in dem es darum geht, die Dialektik zwischen Spirituellem und Digitalem, Spiritualität und Digitalität als Kulturkräfte wachsender Künstlicher Intelligenz zu beschreiben und in unserem Verständnis aufzuhellen, wird die bisherigen Überlegungen im Kapitel VI aufnehmen. So ist zu fragen, ob dieses angesprochene Wechselspiel zwischen Diesseits und Jenseits auf unsere analoge und digitale Lebenswirklichkeit übertragbar ist und Sinn macht.
1 Vgl. Fritz Jürß, Vom Mythos der alten Griechen, Deutungen und Erzählungen, Reclam, Leipzig 1988, S. 46 ff.
2 Das erinnert an das Hegel´sche Kapitel Herrschaft und Knechtschaft in seiner Phänomenologie des Geistes, in dem in bravouröser Weise die Dialektik zwischen Herr und Knecht herausgearbeitet wurde – und das hier mit dem Unterschied, dass Herr und Knecht vereinigt im Menschen selbst als Individuum und Gesellschaft als Subjekte auftreten.
3 Der nachfolgende Diskurs wird diesen Blick der Zuordnung korrigieren und verfeinern, weil sich herausstellen wird, solange das Diesseits und Jenseits in einem dialektischen Kontext betrachtet werden, beide Seiten beides und alles an Raum und Zeit in sich tragen.
4 Wie sich in der weiteren Betrachtung über die Beziehung zwischen Diesseits und Jenseits zeigen wird, ist sie eher mechanistisch gedacht. Es bedarf nachfolgend der Auflösung jener Vereinfachung durch eine dialektische Betrachtungsweise.
5 Vgl. Fritz Jürß, a .a. O, S. 77
6 Während hier das Digitale als Grenzgänger zwischen dem Diesseits und Jenseits ausgewiesen und als gegensätzlich beschrieben wird, wird in Fortsetzung des Diskurses deutlich, dass das in Beziehung gesetzte Diesseits und Jenseits von dialektischer Widersprüchlichkeit ist.
7 Die beiden Filme Avatar - Aufbruch nach Pandora (2009) und Ich bin dein Mensch (2021) sind beeindruckende Beispiele eines derartigen Wandels mit den darin wohnenden Chancen und Risiken, Möglichkeiten und Grenzen.
8 Ähnlich wie die Transformation von Analogem zum Digitalen ließen sich die Zeitebenen diskutieren. Gemeint ist der Gedankengang, die Gegenwart als diesseitige, Vergangenheit und Zukunft als jenseitige Zeitdimensionen zu betrachten. Die Wahrnehmung von Zeit in diesen drei Zeitgegebenheiten würde das zulassen. Es steht die Frage im Raum, welche Folgerungen sich aus diesem Gedankengang ableiten lassen.
9 Vgl. Reclam, Leipzig, 1978, Siebentes Buch, S. 301 ff.
10 Im Universalienstreit, geführt im Mittelalter, insbesondere in der Scholastik, erhielt der philosophische Diskurs über das Verhältnis von Idee und dingliche Realität einen seiner Höhepunkte. Es stand die Frage zum Zentrum, ob ein Allgemeines (Abstraktes) objektiv-real oder jene allgemeinen Begrifflichkeiten eine reine Konstruktion des menschlichen Bewusstseins sei. Es wirft die erkenntnistheoretische Frage nach der Existenz von Allgemeinem, Besonderem und Einzelnem und deren Beziehung zwischen menschlichem Bewusstsein, Erkenntnis, Wahrheit einerseits und objektiver Lebensrealität andererseits auf.
11 Alzheimer-Demenz gehört zu der größten Gruppe demenzieller Erkrankungen. Sie macht etwa zwei Drittel aus. Ihr folgt die vaskuläre Demenz, in unserem Alltagssprachgebrauch als Schlaganfall bekannt. De-menz heißt in der Wortbedeutung weg vom Geist. Analog betrachtet ließe sich hier ebenso das Diesseits und Jenseits platzieren. Was wem zugeordnet wird, ist Sache des Betrachters. Pathologisch und in unserem Alltagsverständnis, was die Wortbedeutung Demenz unterstreicht, befindet sich der Mensch mit einer Demenz im Jenseits des Lebens.
12 Vgl. H.-J. Stöhr: Alt wie ein Baum, Wenn das Altern uns zum Leben erweckt, BoD, Norderstedt 2021, S. 268 ff.
13 Als Subjekte sind einerseits jene Wesen wie Engel, Geister etc. gemeint, die in der spirituellen Welt leben; und es sind die Menschen mit einer demenziellen Erkrankung, die in ihrer eigenen Welt leben, und zu beiden Welten der Mensch einen Kontakt sucht. Aus der Sicht des Menschen sind sie Objekte, ihnen gegenüberstehend.
14 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Einleitung VII, Idee und Einleitung einer besonderen Wissenschaft, unter dem Namen einer Kritik der reinen Vernunft (nach Ausgabe B)
Spirit ∙ Das andere Seinsbewusstsein
Was wäre unser Bewusstsein ohne seinen fluiden Charakter. Es zeigt sich in seiner Unbestimmtheit; es trägt das gewisse Ungewisse in sich. Das macht sein Wesen, seine Substanz aus. Das Bewusstsein ist in seinem Entstehen und Funktionieren bis heute ein Geheimnis, trotz Vielem an Wissen, was die Neurowissenschaften zutage gefördert haben und was es an Gefühlen, Empfindungen und Wahrnehmungen, Erkenntnissen und Theorien etc. zu fabrizieren vermag.
Wir wollen die Eigenartigkeit des Bewusstseins wissenschaftlich dingfest machen und erfahren immer wieder bei jedem neuerlichen Versuch, wie es uns in unserem Denken zerrinnt.
Der Mensch hat sich das Ziel gesetzt, mittels Digitalisierung dem natürlichen Wunder Bewusstsein auf die Spur zu kommen und von ihm zu lernen, wie es im Sinne eines künstlichen Bewusstseins – sprich: Künstlichen Intelligenz – nutzbar gemacht werden kann. Das Bewusstsein des Menschen zu beherrschen und gestaltend einzugreifen ist ein Traum, dessen Verwirklichung schon über Jahrhunderte alt ist.
Es ist schwierig, unser Bewusstsein zu bemühen, über das Bewusstsein selbst und seine Funktionen nachzudenken. Vielleicht überfordern wir uns mit unseren auf der Metaebene angesiedelten wissenschaftlichen Gedankengängen. Vielleicht sollten wir, was uns in und an unserem Bewusstsein schwer erfassbar und unerklärlich erscheint, auf sich beruhen lassen. Stattdessen sind die Bemühungen ungebrochen, dem menschlichen Gehirn ein neuronal-digitales Antlitz zu geben und dessen Geheimnisse für einen neuerlichen Qualitätssprung in der Digitalisierung unserer Lebenswelt abzuringen.
Der Mensch wird sich von seiner wissenschaftlichen Neugier nicht abbringen lassen. Er folgt seinem inneren Abenteuer- und Entdecker-, Wissens- und Anwendertrieb. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn der systemische Blick für mögliche (nachhaltige) Konsequenzen nicht verloren geht und die wissenschaftliche Freiheit nicht nur im Rahmen des Machbaren, sondern gleichermaßen im Sinnvollen und Verantwortbaren bleibt.
Der Mensch schickt sich an, mit seinem natürlichen, analogen Bewusstsein ein digitales zu kreieren. Doch viel älter und mit dem Bewusstsein des Menschen, sowohl in seiner Stammes- wie Individualgeschichte eingebunden, ist ein Bewusstsein, das sich außerhalb jeglicher Kognition zu bewegen scheint. Es ist die Kraft des Bewusstseins, die wir eher jenseits bewussten Seins verorten und dennoch gehört es zu unserem Seinsbewusstsein. Es geht darum, einen Zugang zu dem zu finden, was wir nicht immer verstehen und sich vielfach fernab unserer kognitiven Zugangsmöglichkeiten bewegt. Wir gelangen an die Grenzen unseres Seinsbewusstseins. Überschreiten wir sie, sind wir in der Welt des Spirituellen. Wir sprechen im Alltäglichen von Spiritualität, wenn Menschen sich einem Erleben zuwenden, das mit den Sinnen schwer bzw. nicht erfassbar wird und sich einer begründbaren Erklärung entzieht. Gemeint sind die Mobilisierung innerer Kräfte, sich außerhalb des Körperlichen bewegen zu wollen, das Beschreiben von sogenannten Wundern im menschlichen Leben und die Beschreibung einer Kausalitätsbeziehung, die in ihrem Wesen keine ist oder das Herstellen eines Zusammenhangs von Zufallsereignissen, zwischen denen tatsächlich (nachweislich) keine Verknüpfung besteht.
Die Latte ist hoch gelegt, das Spirituelle zu begreifen und noch höher, wenn es letztlich darum geht, eine Gedankenbrücke zur Digitalisierung bzw. Digitalität herzustellen.
Der Versuch, sich darüber hinwegzusetzen, kann nicht unausstehlicher sein, dem Neuronalen des menschlichen Gehirns auf den Grund zu gehen. Die menschliche Neugierde treibt uns an, unseren Verstand zu gebrauchen und mit dessen Hilfe die Spiritualität zu entdecken.
Es gibt alles Grund zu fragen: Was ist Spiritualität? Was verstehen wir unter dem Spirituellen? Das Verständnis darüber ist uneinheitlich. Eine Klärung erleichtert unser Verständnis oder eine Verabredung in den Auffassungen, worüber wir reden wollen.
Das Spirituelle in der menschlichen Lebenswirklichkeit hat eine über Zehntausende von Jahren lange Geschichte. Es ist mit der Gesellschaftsentwicklung gewachsen und hat sich im Laufe der Zeit verändert. Bis heute hat das Spirituelle einen festen Platz im persönlichen Leben vieler Menschen und ist gesellschaftlich verankert. Trotz aller Aufklärung, gesellschaftlichem und wissenschaftlich-technischem Fortschritt hat es keineswegs an Bedeutung und Wirkungskraft verloren. Es liegt also nahe, davon auszugehen, dass gerade unsere schnelllebige, komplexe und an Wirkung trächtige Zeit mit dem Spirituellen verbunden ist.
Braucht das heutige Leben und die damit verknüpften Anforderungen mehr denn je Spiritualität? Wie viel an ihr ist hilfreich, förderlich, um gut durch die Digitalisierung des Lebens zu gehen? Wie lässt sich die Verfügbarkeit des Spirituellen in die heutige Lebenswelt einordnen? Sind ihm Grenzen auferlegt und zeigen sie uns dessen Unverfügbarkeit an?
Da das Spirituelle zum menschlichen Sein gehört und alle Bemühungen es wegzudenken keinen Sinn machen, sollten wir dem Spirituellen bzw. der Spiritualität gegenüber positiv gestimmt sein. Das schließt die Frage ein: Inwieweit ist Spirituelles, das in und mit dem Menschen lebt, wertschöpfend und von sinnvoller Bedeutung für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz? Doch zunächst bedarf es der Begriffsklärung des Spirituellen.
Spirit. Spirituell(es). Spiritualität. Sprechen wir über Spirit. Vielschillernder kann er in seiner Bedeutung und sprachlichen Nutzung nicht sein. Die Synonyme reichen sich gegenseitig die Hand. Hier findet sich Spirit in seiner Wortbedeutung wieder: Geist. Er steht für etwas, was neben, außerhalb bzw. gesondert vom Gegenständlichen existiert. Er zeigt sich in Gestalt menschlichen Denkens, mit dem das Fühlen eingeschlossen ist. Es ist die Klammer für eine tragende, alles in einem Ganzen stehende Grundidee, für ein Konzept eines vom Menschen geschaffenen Werkes. Oder wir verbinden Geist mit etwas Göttlichem, dem Heiligen Geist.
Der Heilige Geist ist im christlichen Glauben verankert. Beim Abschluss pastoral gesprochener Worte heißt es: „Im Namen des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Ahmen“. Der Geist steht – jenseits von menschlicher Erfahrung – für ein übernatürliches, vom menschlichen Verstand schwer fassbares, von menschlicher Logik nicht erklärbares Wesen. Es sind spukende Geister, die wir als Gespenster ausgemacht haben, durch welche wir in eine emotionale Spannung geraten, wenn wir ihnen Glauben schenken und von deren Existenz überzeugt sind. Oder wir lesen von Geistern in Märchen über Eisenhans, den Waldgeist, im gleichnamigen Märchen, der dem Königssohn beim Erwachsenwerden behilflich ist.
Im Wortursprung (indogermanisch gheis-) ist Geist verbunden mit Erschaudern, Erschrecken, Aufgeregtheit, Ergriffenheit, Entsetzen oder Furcht. Es ist Erzähltes oder Wahrgenommenes, das uns im Geiste, in unserer Vorstellung oder Einbildung in eine Welt versetzt, die uns unheimlich, außergewöhnlich, fernab erfahrener Realitäten erscheint.
Das Spirituelle steht für die Gesamtheit aller Formen bzw. Erscheinungen, die wir unerklärt zwischen Himmel und Erde zuordnen. Spirituell bedeutet auch, alles Fühlen, Denken und Handeln, das menschliche Leben mit dem Bewusstsein auf eine Wirklichkeit und mit innerer Überzeugung so auszurichten, dass hinter ihr eine Welt steht, deren Erfahrbarkeit aus der unmittelbaren Lebenspraxis nicht möglich ist, sondern es Mittel und Wege bedarf, über die ein Zugang in diese andere, höhere Welt erreicht wird.
Ein spirituelles Leben führt jener, der seinen Alltag, seine Aufgaben, Absichten und Ziele, seine Grund- bzw. Glaubenssätze und Werte darauf orientiert, das Diesseitige und Jenseitige im Leben zu erschließen, zwei Erfahrungswelten zu verbinden und in beiden Welten präsent zu sein.
Viel häufiger und mannigfaltiger im Wortgebrauch ist das der Spiritualität. Mit ihr bringen wir den Charakter, die Eigenheit von Spirituellem zum Ausdruck. Das heißt, der Geist existiert nicht losgelöst von den Dingen unserer Lebenswelt, sondern ist an diese gebunden. Es macht das Wesen einer Eigenschaft aus, Qualitätsmerkmal eines Sachverhaltes oder eines Gegenstandes zu sein.
Spiritualität ist die erklärte Eigenheit, die den Lebensdingen und Erscheinungen, dem menschlichen Fühlen, Denken und Handeln zugeordnet wird. Es ist die in ihnen innewohnende Geistigkeit, was sie miteinander verbindet.15
Was alle Spiritualitätserklärungen miteinander verknüpft, ist, dass sie das Irrationale, fernab von jeglicher Rationalität, Materialität, Gegenständlichkeit bzw. Körperlichkeit und Logik des Denkens, vereinigt. Doch dieses Irrationale zeigt sich in Vielfalt. Der Ansatz, Spiritualität zu erklären ist unterschiedlich a) aufgrund des jeweiligen weltanschaulichphilosophischen Standortes und b) unabhängig von jenem Standpunkt, ihr eine eigene, kontextbestimmte Erläuterung zu geben. Das haben wir zur Kenntnis zu nehmen und bei einem Diskurs zu berücksichtigen.
Wird der Begriff der Seele bei der Erklärung des Spirituellen hinzugezogen, macht es das Verständnis für beide nicht leichter. Seele ist Spirit. Sie verfängt sich im mythisch- religiösen Traditionsverständnis. In diesem Sinne ist sie stark mit dem Religiösen bzw. archaisch-animistischen Denken verbunden. Sie kann auch mit dem menschlichen Bewusstsein in Beziehung gebracht werden. Entweder steht sie für Psyche in Gleichsetzung mit dem Bewusstsein – für alles Denken und Fühlen – oder eingegrenzt für die Summe aller möglichen menschlichen Gefühlsregungen, Emotionen.
Im religiösen Glauben ist die Seele von eigener Substanz und Lebenskraft. Es ist die Überzeugung des Menschen, dass die Seele gegenüber dem Körper – und in dieser Gegenüberstellung tritt die Seele vordergründig auf – unsterblich ist, ein Eigenleben sowohl im und außerhalb des menschlichen Körpers besitzt, wenn dieser aufhört zu leben.
Spiritualität wird im alltäglichen Sprachgebrauch zumeist mit dem Konfessionellen, Religiösen verknüpft. Sie repräsentiert religiöse Werte und Sinnsuche im Göttlichen. Diese Reduktion habe ich auch bei meinen Recherchen über den Zusammenhang von Spiritualität und Digitalisierung bzw. Digitalität erfahren. Der Blick ist ausschließlich darauf gerichtet, wie mittels digitaler Technik die praktische Spiritualität unterstützt werden kann. Dieses Verständnis verrät Einseitigkeit und entspricht nicht dem, wie sich Spiritualität und Digitalisierung (Digitalität) begegnen.16
Alles Spirituelle steht nicht außerhalb der menschlichen Lebenswirklichkeit. Es ist ein Teil von ihm, soweit dieses von einem Menschen gelebt bzw. praktiziert wird. Das Spirituelle ist Teil menschlicher Entwicklungs- und Lebensgeschichte. Es offenbart sich in den verschiedensten Formen. In allem geht es darum zu verdeutlichen, dass Spiritualität eine Eigenschaft menschlichen Lebens, des Fühlens, Denkens und Verhaltens ist. Als solche macht sie eine Qualität des menschlichen Bewusstseins aus.
Spiritualität (Spirituelles) ist insofern ein anderesSeinsbewusstsein, weil das menschliche Bewusstsein sich nicht nur eines existierenden inneren (Gedanken, Gefühle, Seele) und des äußeren (Lebenswelt) Seins schlechthin bewusst ist, sondern weil es sich in Beziehung zwischen Diesseits und Jenseits bzw. Transzendenz und Immanenz bewegt. Es zeigt sich in einem Beziehungsverhältnis zwischen ihnen.
Zugleich zeigt sich die Spiritualität in verschiedenen Ausdrucksformen. Im Rahmen dessen werden wir erfahren, wie sie sich im Laufe der Menschen- und Gesellschaftsgeschichte verändert hat. Das deutet daraufhin, dass die Spiritualität sich selbst mit der Entwicklung von Mensch, Technik und Gesellschaft wandelte – in ihren Bildern, in Gestalt und Funktion. Im folgenden Kapitel wird deren Veränderung nachgezeichnet.
Es geht zuerst um einen Erklärungsversuch, beginnend mit der Frage: Was ist Spiritualität? Vorliegende Bestimmungen lassen viel Spielraum sowohl für einen weitläufigen Diskurs als auch für eigene Überlegungen.
Es ist unbestritten, dass uns die Spiritualität fasziniert und von besonderer Strahlkraft ist. Kommen wir mit ihr in Berührung, lassen wir uns gerne in die Welt des Spirituellen fallen. Wir fühlen uns nicht selten in ihr aufgehoben; spüren eine Geborgenheit, weil uns das Diesseits Fremdes und Ängste, Verlassenheit oder ein Gefühl emotionaler Kälte vermittelt. Die Suche nach einem Sehnsuchts- bzw. Rückzugssort ist das, was den Menschen von je her in seiner Lebenswirklichkeit begleitete, weil er einen steten Kampf um sich in seinem Lebensumfeld wahrnimmt, aus dem er sich allzu gerne auch einmal herausnehmen möchte.
Man könnte die Spiritualität des Menschen als ein Geschenk der Geschichte des menschlichen Bewusstseins betrachten. Für andere möge es ein Geschenk Gottes sein, den Menschen mit dieser Gabe ausgestattet zu sehen, um somit eine Brücke zwischen Himmel und Erde zu schaffen. Es bleibt den Lesenden überlassen, welchen Inhalt, Wert und Sinn sie der Spiritualität geben. Tatsache ist, sie ist existent, real und wirklich. Der Mensch kann sie für sich nutzen. Sie hat einen überaus wichtigen Wert an menschlicher Lebensregulation, worauf in den Kapiteln V und VI näher eingegangen wird. Spiritualität macht den Menschen menschlich, was so viel bedeutet, seinem Leben selbst Raum und Bedeutung zu schenken, statt tagtäglich den Kampf mit seiner Außenwelt aufnehmen zu müssen und danach zu trachten, sie zu seinem Herrschaftsobjekt zu machen.
Getrieben von Schnelllebigkeit und der Sucht nach materiellem Wohlstand verzehren wir uns selbst, vergessen wir, was wir auch sind: Menschen mit einem spirituell verbundenen Leben.
Sarah Bakewell schreibt in ihrem Buch Das Café der Existenzialisten: „Die berühmten Existenzialisten und Phänomenologen weilen nicht mehr unter uns […] Die Schwarzfotos mit dem Pfeife rauchenden Jean-Paul Sartre am Kaffeehaustisch, der Turban tragenden Simone de Beauvoir und einem grüblerischen Albert Camus mit hochgeschlagenem Mantelkragen verströmen zwar immer noch einen nostalgisch-romantischen Charme, aber ihre unmittelbar prägende Kraft ist für immer verloren gegangen.
Auf der anderen Seite sind existenzialistische Ideen und Vorstellungen so tief in der modernen Kultur verankert, dass wir sie kaum als solche wahrnehmen. Wir sprechen über Angst, Unaufrichtigkeit und Bindungsangst zumindest in den relativ wohlhabenden Ländern, wo die Grundbedürfnisse des Lebens gestillt sind. Wir fühlen uns von den Konsumentscheidungen überfordert, die wir zu treffen haben, und leben in dem Gefühl, dass uns die Kontrolle zunehmend entgleitet. Eine diffuse Sehnsucht nach einem „wirklicheren“ Leben ist der Grund dafür, dass sich Menschen übers Wochenende zurückziehen und sich ihr Smartphone wegnehmen lassen wie Kinder ihr Spielzeug, damit sie wenigstens zwei Tage lang in der freien Natur wandern und mit ihrem vergessenen Ich in Verbindung treten können.“17
Dieses Zitat, eindrucksvoll geschrieben, stimmt nachdenklich und macht deutlich, wo die Strahlkraft geblieben ist und gegen was Menschen sie eingetauscht haben. Es geht nicht darum, die archaisch-animistische Spiritualität der vergangenen Jahrtausende zurückzuholen, sondern vielmehr sich seines Selbst bewusst zu sein.
Insofern ist die Spiritualität in unserer heutigen Zeit auch eine inszenierte und mit Tragik verbundene Hinwendung zum vergessenen Ich und wir müssen uns fragen: Aus welchen Gründen musste es so weit kommen? Die sich ausbreitende Digitalisierung unserer Lebenswelt scheint für eine Antwortsuche wenig hilfreich und unterstützend zu sein, es sei denn, man ist sich der Wirkung des Spirituellen bewusst und weiß sie entgegensteuernd zu nutzen.
Die von uns allen erlebte Corona-Pandemie zeigte im Umgang mit ihr ihre Janusköpfigkeit. Sie war Anstoß, die Digitalisierung voranzutreiben und zugleich für viele Menschen, sich auf sich selbst zu besinnen. Wohnwagen und Fahrräder, Zelten und Schrebergärten hatten im Kauf bzw. in der Nutzung Hochkonjunktur.
Jeder wird einen Zugang zu seiner Spiritualität finden bzw. gefunden haben, weil jeder spürt, dass ein Leben ohne sie alles eher schwerer statt leichter macht. Die spirituelle Hingabe ist eng, sowohl mit dem eigenen Selbstverständnis über das Spirituelle als auch mit den persönlichen Wegen und Formen spiritueller Praxis verbunden. Insofern ist auch immer eine individuelle Vielfalt im Verstehen von Spiritualität und bei deren Ausübung verbunden.
Vor diesem Hintergrund erklärt sich meine kritische Sicht auf das, was Spiritualität ausmacht und welches Grundverständnis in den Diskurs eingebracht wird. Mit dem Verstehen von Spiritualität sind drei Auffälligkeiten erkennbar: Erstens wird Spiritualität vielfach mit Religiosität verknüpft oder sogar in der Bedeutung gleichgesetzt. Zweitens wird sie immer wieder und zumeist an Transzendenz geknüpft, so dass Spiritualität, Transzendenz und Religiosität oft im Verständnis zusammenfallen. Und drittens ist Spiritualität als eine Eigenschaft menschlichen Denkens, Fühlens und Verhaltens konfiguriert.
Hier wird der Versuch unternommen, in allen drei genannten Punkten von der Spiritualität auszubrechen und sie begrifflich anders als bisher zu fassen.
Die nachstehenden Überlegungen laufen auf folgende Gedanken hinaus: Erstens: Spiritualität schließt Religiosität als eine Qualitätsform des Spirituellen ein; sie ist mehr und nicht nur Religiosität. Die Reduktion und Gleichsetzung von Spirituellem und Religiösem wird m. E. der Vielfalt an Spirituellem nicht gerecht. Zweitens: Wenn Jenseits bzw. Transzendenz mit dem Spirituellen und das Spirituelle ausschließlich mit dem Religiösen verortet werden, so haben wir es m. E. mit einem verkürzten Verständnis von Spiritualität zu tun. Spiritualität und Transzendenz sind begrifflich voneinander zu trennen. Sie haben eine gemeinsame Schnittmenge; sie sind jedoch keine Synonyma. Anders formuliert: Jede Spiritualität ist von einer Transzendenz. Letztere kennzeichnet ein Überschreiten, ein Übertreten, einen Übergang von einem Bezugsfeld in ein anderes. Es findet eine Transformation statt. Aber nicht jede Transformation ist von Transzendenz und nicht jede Transzendenz hat den Charakter des Spirituellen.
Im Hinblick darauf macht es Sinn, die Begriffe transzendentale Transformation, spirituelle Transzendenz und spirituelle Transformation einzuführen und im Zusammenhang mit Diesseits und Immanenz zu erklären, was im Rahmen der Begriffsfassung Spiritualität nachstehend erfolgt.
Daraus leitet sich drittens ab, dass die Spiritualität keineswegs und allein eine dem Menschen bzw. dem menschlichen Bewusstsein zuzuordnende Eigenschaft ist. Das bedeutet, dass die Spiritualität keine Eigenschaft darstellt, die dem menschlichen Bewusstsein immanent ist. Die Spiritualität ist kein Attribut des Menschen oder dessen Bewusstseins, sondern sie ist das einer Beziehung und dieser innewohnend. Sie ist eine Eigenschaft des Verhältnisses zwischen Mensch und Bewusstsein im Menschen.
Dann ist zu fragen: Wie tritt uns dann die Spiritualität gegenüber, wenn nicht allein über das menschliche Bewusstsein? Worin besteht der Unterschied im Vergleich zur bisherigen Zuordnung von Spiritualität?
Es reicht nicht aus, was der DUDEN uns kurz und knapp als Erklärung anbietet: „Geistigkeit, geistiges Wesen“18. Sie stehen für Synonyme – als Eigenschaft oder als Subjekt.
Ken Wilbert geht bei der Suche auf Antwort in Vorleistung. Seinen „Integralen Ansatz“ für ein ganzheitliches Weltenverstehen überträgt er auf die Spiritualität und entwickelt ein Konzept der Integralen Spiritualität, auf dessen Grundlage er die Komplexität des Bewusstseins, in der die Entwicklungslinien des Bewusstseins aufgezeigt werden.19 Seine dezidierten Ausführungen haben eine zentrale Botschaft, die bereits im Untertitel des Buches prägnant formuliert ist: „Spirituelle Intelligenz rettet die Welt“. Dahinter verbirgt sich der Grundgedanke, dass die Globalisierung unserer heutigen Zeit eine Herausforderung darstellt, die jedoch ohne die spirituelle Intelligenz als Leitidee der gesellschaftlichen Entwicklung nicht zu bewältigen ist, was dem Göttlichen eine neue Perspektive gibt.
Es zeigt sich in vielen anderen Quellen, die die Spiritualität in unserem heutigen Leben zum Inhalt eines Diskurses haben, dass sie primär in Verbindung mit dem Religiösen gebracht werden. Hierfür lässt sich eine Vielzahl von Quellen anführen.20 Eine allgemeine Umfrage würde dieses Bild erhärten, obwohl das Verständnis über Spiritualität zusehends in den letzten Jahrzehnten begann, sich dahingehend zu wandeln, das Spirituelle nicht nur und ausschließlich an das Religiöse zu binden. Das Verstehen von Spiritualität beginnt sie über sich selbst hinauszuwachsen, sich aus der Enge der Anbindung an Religionen, vor allem von deren Institutionen (Kirchen, Organisationen, Sekten) zu befreien.
Obwohl das Heft GEO Wissen Nr. 70, Die Kraft der Spiritualität21, im Schwerpunkt seiner Beiträge die Anbindung von Spiritualität und Religiosität zum Ausdruck bringt, so sei stellvertretend für andere hervorgehoben, dass sich dieses Heft auch außerhalb dieser Verknüpfung bewegte. Es war darüber hinaus der Spiritualität in Beziehung zur individuellen Erfahrung des einzelnen Menschen mit sich und der Natur sowie der Beziehung zur Wissenschaft zugewandt.
So sehr traditionell das Spirituelle mit dem Religiösen bzw. einem Gottesglauben in Verbindung gebracht wird, so sollte gleichermaßen darauf aufmerksam gemacht werden, dass im Verständnis zwischen ihnen nicht zwingend Gemeinsames besteht und lediglich eine Schnittmenge zwischen ihnen besteht, die sie begrifflich eher unterschiedlich macht.
Spiritualität ist mehr als sie nur mit dem Religiösen in Verbindung zu bringen. Religion ist ein spirituelles Lebenskorsett. Sie steckt den Rahmen des Lebens eines Menschen oder einer Gemeinschaft ab. Sie gibt vor, nach welchen Regeln sich menschliches Denken und Verhalten zu gestalten hat. Es ist die normative Freiheit im Namen der Religion, des Sollens.
Die Spiritualität öffnet sich als ein menschliches Gebot des Dürfens.22 Sebastian Murken, Psychotherapeut und Religionswissenschaftler, klärt das Gemeinsame und den Unterschied zwischen Religion und Spiritualität, indem er schreibt: „Spiritualität hat mit Religion gemeinsam, dass beide sich auf eine transzendente Ebene beziehen. Das bedeutet, dass beide davon ausgehen, dass unsere sinnlich erfahrbare, sichtbare Welt nicht alles ist, was es gibt – sondern dass jenseits davon eine darüberhinausgehende Dimension existiert. […] Der Unterschied zwischen Religion und Spiritualität liegt nun darin, wie die Verknüpfung der Sphären gedacht und gelebt wird.
[…] Menschen, die sich als spirituell, aber nicht religiös bezeichnen, beziehen sich ebenfalls auf eine transzendente Welt und sehen die Möglichkeit, in Beziehung zu einer Wirklichkeit hinter dem Sichtbaren zu treten. Anders als bei den Religionen fehlt der Spiritualität […] eine Erwartungshaltung an die Gläubigen – also die moralische Pflicht, sich gemäß einem göttlichen Regelwerk zu verhalten. Wo die Religion sagt: „Du sollst“, sagt die Spiritualität: „Du darfst, wähle selbst“.“23
Rahmen, Bedingungen, Wirkung und Resultat sind trotz der gemeinsamen Klammer von Jenseitigem und Transzendentem unterschiedlich aufgestellt. Es sind nicht nur die Gebetsstätten oder religiösen Schriften, die den Unterschied ausmachen. Mit der Spiritualität verbinden wir zudem ein Inseits im Diesseits. Es ist das Schöne der Lebenswirklichkeit, das wir in uns hineinholen. Es ist der Moment des Eins-Seins mit der Natur. Es ist die Verbundenheit mit ihr und das daraus wachsende Gefühl, in eine sogenannte spirituelle Nähe zu gelangen. Es ist das Außergewöhnliche, das in uns entsteht und das Alltägliche zum gefühlten Besonderen macht.
Diese gelebte Spiritualität liegt fern von jener Macht, die menschliche Ohnmacht und Machtlosigkeit hervorbringt. Es ist das Außergewöhnliche im menschlichen subjektive, emotionale Erleben, das nicht begrenzt, sondern die innere Lebenswelt erweitert. Um ein derartiges Lebensgefühl zu haben, das zu mehr erweiterter Lebenslust inspiriert, braucht es das Wechselspiel von Diesseits und Jenseits, von Immanenz und Transzendenz – doch außerhalb eines religiösen Glaubens. Spiritualität konstituiert sich als „ein Gefühl von tiefer, tröstlicher oder freudiger Verbundenheit mit etwas oder jemandem.“24
Für Harald Lesch, Astrophysiker, sind die Suche nach Gott und das Erleben von Spiritualität eher fremd. Er schreibt: „Mich selber würde ich als einen zweifelnden Gläubigen bezeichnen. Im Gegensatz zu Atheisten25 bin ich mir jedenfalls keineswegs sicher, dass Gott nicht existiert. Ein philosophischer Begriff, der für mich am ehesten mit Spiritualität zu tun hat, ist jener der Kontingenz: das Wissen, dass unser Universum und das Leben auf dem Planeten Erde kein Uhrwerk sind, in dem lauter Zahnrädchen perfekt ineinandergreifen. Sondern dass es komplexe, offene Systeme sind, die immer wieder Neues hervorbringen und eine gewisse Freiheit ermöglichen.“26
Kontingenz versteht sich als einen Status des Wirklichen, von dem man ausgeht und nicht so recht weiß, ob es existiert oder nicht existiert, weder notwendig noch unmöglich ist. Wir können diese Kontingenz auch in Verbindung mit der Unverfügbarkeit bringen, was so viel bedeutet, dass es außerhalb unserer Macht der Erkenntnis liegt, den Glauben an das Göttliche in absolut Wahres zu wandeln. Die Überzeugung im Glauben von Göttlich-Spirituellem hebt die Kontingenz nicht auf. Nichts, was besteht, ist zwingend. Unser Weltengeschehen, das menschliche Denken und Verhalten unterliegen keinen weder göttlichen noch natürlichen Zwängen, sondern der Mensch vermag es, in diesem kontingenten Geschehen kreativ und gestalterisch zu wirken.
Die hier verfolgten Überlegungen zielen darauf ab, die Spiritualität von ihrer religiösen Enge zu befreien. Es ist mehr als nur das. Die Religiosität zeigt sich als eine Spielform des Spirituellen und ist es umgekehrt selbst nicht.
Die Spiritualität zeigt sich nicht nur in einer nach außen hin gerichteten transzendenten Erfahrung, sondern sie zeigt sich zudem und insbesondere auch als eine in und zum Menschen hin gerichtete Erfahrung. Es ist die Erfahrung mit sich selbst.
Es gibt noch etwas, was einer Betonung im Verständnis der Spiritualität bedarf, was auch der Religiosität zugestanden werden muss. Weder die Religiosität noch die Spiritualität sind nur das eine: Jenseitige bzw. Transzendente. Beide stehen in Verbindung mit dem Diesseits und dem Immanenten. S. Murken macht deutlich: „Das ist von entscheidender Bedeutung, denn ohne eine Verbindung hätte die transzendente Welt keine Relevanz für unser Leben im Diesseits.“27