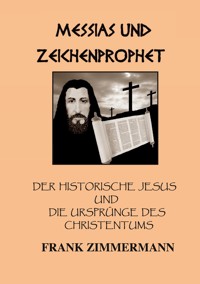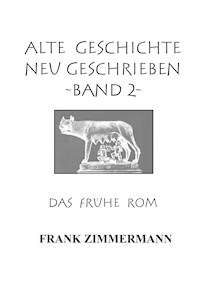
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Alte Geschichte neu geschrieben
- Sprache: Deutsch
Jahrgenaue Daten für Schlachten und Regierungszeiten altgeschichtlicher Herrscher, wie sie in populärwissenschaftlichen Medien und Fachpublikationen präsentiert werden, vermitteln der interessierten Öffentlichkeit den Eindruck, unser Wissen bezüglich der Datierung Jahrtausende zurückliegender Ereignisse sei gesichert. Die Geschichte des Altertums, so wie sie gelehrt wird, weist jedoch nicht nur etliche Leer- und Dunkelzeiten auf, sondern ist auch voll von Anachronismen, Ungereimtheiten und Widersprüchen. Die Ursache dieser Probleme, von denen der interessierte Laie nur selten etwas zu hören bekommt, ist hauptsächlich in den fehlerhaften Chronologien Ägyptens und Mesopotamiens zu suchen, deren Geschichte dadurch künstlich in die Länge gezogen wird. In seiner Buchreihe ALTE GESCHICHTE NEU GESCHRIEBEN überarbeitet Frank Zimmermann das gesamte gängige Zeitgerüst der Althistorie von Grund auf und stellt ein alternatives, verkürztes chronologisches Schema vor, in dem der Vordere Orient einen Großteil seines zeitlichen Vorsprungs gegenüber dem Okzident einbüßt. Von der in Band 1 vorgenommenen Revision der Chronologie attischer und korinthischer Keramik sind auch die Frühzeit Roms und die älteste Geschichte der Etrusker betroffen, denn auch deren archäologische Hinterlassenschaften werden letztendlich über griechische Importkeramik datiert. Noch immer steht die Fachwelt zerstritten vor der Beurteilung der literarischen Quellen zur römischen Königszeit und zur frühen Republik, die erst sehr spät ab etwa 210 v.Chr. langsam zu fließen begannen. Indem er die traditionell überlieferte Frühgeschichte der Ewigen Stadt kritisch beleuchtet und mit den archäologischen Befunden und seiner revidierten Keramikchronologie in Verbindung setzt, gelangt Frank Zimmermann zu jüngeren Daten für die Meilensteine Roms auf dem Weg zur Weltmacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Einleitung
Geographischer und geschichtlicher Rahmen
Die italienische Halbinsel
Völker, Sprachen, Wanderungen
Ein rätselhaftes Volk
Neuankömmlinge aus Hellas
Konflikte
Die Anfänge Roms
Die ewige Stadt
7-5-3 – Kein Rom und kein Ei
Die Problematik...
Gründungsdaten
Die sieben Hügel
Romulus und Remus
Rom und Troia – Griechische Gründungssagen
Fiktive Könige von Alba Longa
Die sieben Könige Roms
Addio, grande Roma dei Tarquini!
Rom während der Königszeit
Die Servianische Mauer
Die Cloaca maxima
Der Kapitolinische Tempel
Fresken der Tomba François
Etruskische Herrscher über Rom
Priesterannalen und Konsullisten
Die Problematik
Entwicklung der römischen Ämterlandschaft
Scaevolas
Annales maximi
Weitere Quellen
Erfundene Frühzeit
Fiktive Gesetze
Alles nur geklaut
Die Zwölftafelgesetze
Das Drama um Camillus
Kriege gegen Latiner und Samniten
Die Anfänge der römischen Flotte
Der archäologische Befund zur frühen Republik
Die Problematik
Das Forum Romanum
Frühe Tempelgründungen
Die Regia
Der Lapis niger
Weitere Befunde
Neue Datierungen für das frühe Rom
Die Stadtwerdung Roms
Vom Königtum zur Republik
Wann fand der Galliereinfall statt?
Die Zeit des Latinerkrieges
Resümee
Anhang: Die Keramikchronologie
Literaturverzeichnis
Einleitung
„Gestehen wir jedoch, es ist ein saures und trauriges Geschäft, das alte Rom aus dem neuen herauszuklauben, aber man muß es denn doch tun und zuletzt eine unschätzbare Befriedigung hoffen. […] Anderer Orten muß man das Bedeutende aufsuchen, hier werden wir davon überdrängt und überfüllt. Wie man geht und steht, zeigt sich ein landschaftliches Bild aller Art und Weise, Paläste und Ruinen, Gärten und Wildnis, Fernen und Engen, Häuschen, Ställe, Triumphbögen und Säulen, oft alles zusammen so nah, daß es auf ein Blatt gebracht werden könnte. Man müßte mit tausend Griffeln schreiben, was soll hier eine Feder! und dann ist man abends müde und erschöpft vom Schauen und Staunen.“1
Im Mittelpunkt dieses Bandes der Buchreihe steht das frühe Rom, worunter wir die Zeit von der Stadtwerdung bis zu den Samnitenkriegen verstanden wissen wollen. Es sind nach Meinung des Autors gerade die Ereignisse jener Zeitspanne, die einer neuen zeitlichen Einordnung bedürfen. Erst ab etwa – 300, sicherlich aber mit dem Krieg gegen Pyrrhos von Epirus ab – 280, an dessen Ausgang die Etablierung Roms als größte Macht der italienischen Halbinsel stand, bewegen wir uns auf chronologisch wirklich sicherem Terrain.
Der ursprünglich vom Autor gefasste Plan, die Revision der Geschichte des archaischen Griechenland und des frühen Rom in einem einzigen Band zu behandeln, ist aufgrund einiger bedauerlicher und auch bedenklicher Tendenzen in der Forschung aufgegeben worden. Denn in den letzten Jahren, ja mittlerweile sogar schon Jahrzehnten wird die eigentlich längst als fiktiv entlarvte und daher zu verwerfende Geschichtsschreibung der Annalisten von Teilen der Forschung wieder vermehrt zur Rekonstruktion der römischen Frühgeschichte herangezogen. Schon Ende des 20. Jhs. konstatierte der Althistoriker Jochen Bleicken: „Nachdem die erste Hälfte dieses Jhs. eher durch eine kritische Haltung gekennzeichnet war, wächst heute die Anzahl der Gelehrten, welche die ältere Annalistik trotz aller quellenkritischen Einwände nicht grundsätzlich verwerfen mögen, sondern jeden einzelnen Bericht jeweils auf das Für und Wider seiner Historizität untersucht wissen möchten. Methodische Argumente für ein solches Vorgehen werden meist nicht gebracht, gelegentlich durch den allgemeinen Hinweis ersetzt, daß man ja nicht blind vertraue, oder, schlimmer, mit der einem Lehrsatz gleichkommenden Behauptung abgewehrt, daß für die Ablehnung annalistischer Daten der Kritiker die Beweislast zu tragen habe, wie das mit einer Klarheit, die nichts zu wünschen übrig läßt, kürzlich CORNELL aussprach […]. Die historisch-kritische Methode, auf die alle Historiker seit den Anfängen des 19. Jhs. verpflichtet sind, wird damit geradezu auf den Kopf gestellt, und ein Historiker, der sich daran hält, zum Außenseiter deklariert.“2 So steht also die Romforschung zerstritten vor der Beurteilung ihrer frühesten literarischen Quellen, die erst ab dem Ende des – 3. Jhs. zu fließen begannen und somit schon allein aufgrund ihrer zeitlichen Distanz zur Königszeit und zur Frühzeit der Republik argwöhnisch zu betrachten sind. Diesen Umständen wird also durch den vorliegenden gesonderten Band Rechnung getragen, in dem wir noch einmal ausführlicher als ursprünglich geplant auf die Berichte der Annalisten und auf die Gründe für das Verwerfen derselben eingehen werden.
Der erste Band dieser Buchreihe wurde mit dem Entwurf einer neuen Chronologie der korinthisch- und attisch-schwarzfigurigen Vasenmalerei und der Feststellung abgeschlossen, dass nach dieser neuen Keramikchronologie die griechischen Pflanzstädte der ersten Generation in Sizilien und Unteritalien nicht vor – 670 gegründet wurden, also ca. 60 bis 70 Jahre später als herkömmlich angenommen. Nun werden anhand dieser Keramikchronologie nicht nur einige großgriechische Stadtgründungen datiert, sondern auch Bauphasen einzelner Gebäude, Tempelgründungen, Grablegungen und Grabbauten, Zerstörungsschichten in manchen kleinasiatischen und nahöstlichen Stätten sowie Entwicklungphasen verschiedener Bau- und Kunststile in Kleinasien, Etrurien und Latium. Auch das Datum der Stadtwerdung Roms, meist verbunden mit der ersten Pflasterung der Gegend des späteren Forum Romanum, wird letztenendes über Funde griechischer Keramik in den frühen Kultplätzen gewonnen.3 Da somit die Keramikchronologie in ihrer revidierten Form die Grundlage einiger Neudatierungen in diesem Buch bildet, werden im Anhang sowohl ihre Entstehungsgeschichte als auch die Argumente gegen die herkömmliche und für die neue Keramikchronologie noch einmal in Kurzfassung erläutert.
Die Geschichte der Stadt Rom kann natürlich nicht isoliert von jener der sie umgebenden Völker und Stämme betrachtet werden. Die Lage Latiums, des Stammesgebietes der Latiner, zwischen dem etruskischen Kerngebiet in Mittelitalien und dem von griechischen Kolonisten besiedelten Unteritalien sowie die Lage Roms selbst im nordwestlichen Latium, angrenzend an etruskisches Territorium und nahe der Tibermündung mit ihren Salzlagern, haben die frühe Geschichte der ewigen Stadt mitbestimmt und ihre Kultur stark geprägt. Daher werden wir zunächst einige Worte über den geographischen und geschichtlichen Rahmen zu verlieren haben.
1 Goethe, Tagebucheintrag vom 7. November 1776 im Rahmen seiner Italienischen Reise
2 Bleicken,1999,109
3 Gjerstad,1960,359-374; Gjerstad,1973,83; Forsythe,2005,86
(I)
GEOGRAPHISCHER UND GESCHICHTLICHER RAHMEN
Die italienische Halbinsel
„Kennst du das Land? wo die Citronen blühn,
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin!
Mögt ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.“4
Das Landgebiet, das wir heute als Italien bezeichnen, liegt größtenteils auf einer weit ins Mittelmeer ragenden, landschaftlich stark gegliederten und in ihrer Form an einen Stiefel erinnernden Halbinsel. Wie diese zu ihrem Namen kam, konnte bis heute nicht endgültig geklärt werden. Als einigermaßen gesichert gilt, dass zunächst nur der südliche Teil (Kalabrien und das südliche Apulien) als Italia bezeichnet wurde. Während der Name in der Antike auf eine legendäre Herrscherfigur Italos zurückgeführt wurde,5 nimmt man heute an, dass die Griechen den Süden Italiens nach einem ortsansässigen Stamm bezeichneten, der sich Itali („die Jungstierleute“)6 nannte und dass dieser Name nach und nach von den anderen Bewohnern der Halbinsel übernommen wurde.7 Als zur Zeit Caesars die Gallia cisalpina, also die oberitalienische Ebene nebst Istrien, ins römische Kernland eingegliedert wurde, weitete sich die vormals nur für die Halbinsel geltende Bezeichnung auch auf das Gebiet bis zu den Alpen aus. Erst in der spätrömischen Kaiserzeit gesellten sich die kulturell schon lange dazugehörigen Inseln Sizilien und Sardinien auch begrifflich zu Italien.8
Zwischen den die oberitalienische Ebene im Nordosten, Norden und Westen einrahmenden Alpen und der Südspitze des Stiefels wechseln sich Gebirgszüge, Hügelland und weite Ebenen ab. Zu letzteren zählen neben der oberitalienischen auch die latinische, die kampanische und im Südosten die apulische Ebene. In der Toscana, dem alten Etruskerland, findet man hügelige, ebene und bergige Gebiete in stetem Wechsel. Von Norden nach Süden dem Verlauf des Stiefels weitgehend folgend erstreckt sich das Gebirgsmassiv des Apennin, das seine Fortsetzung im gebirgigen Norden Siziliens findet und auf der Halbinsel die Hauptwasserscheide bildet. An großen Flüssen sind im Norden der Po, der die oberitalienische Ebene von Westen nach Osten durchschneidet, und in Mittelitalien der Tiber zu nennen, der in den Apenninen am Monte Fumaiolo entspringt und sich bis zu seiner Mündung ins Tyrrhenische Meer nach Süden durch die Toscana und Umbrien schlängelt. So wie er heute in seinem südlichen Teil die natürliche Grenze zwischen den Regionen Umbrien und Latium bildet, trennte er zur Zeit des frühen Rom das Etrusker- und das Latinerland.
Völker, Sprachen, Wanderungen
So vielseitig wie das Landschaftsbild war auch das Völkergemisch, das die italienische Halbinsel bewohnte. Den Ursprung der einzelnen Völker dachte man sich in der Antike nach dem Muster der griechischen Kolonisation als Einwanderungen von Osten über das Meer, die unter der Führung heroischer Kulturbringer bereits um die Zeit des Troianischen Krieges erfolgt seien.9 „Die Besetzung neuer Länder wurde manchmal mit einem fremden Heroen personifiziert, der zunächst die alteingesessene Bevölkerung bekämpfte, um dann aber schließlich die Tochter des dortigen Königs zu heiraten und dessen Reich zu erben. Das ist z.B. der Fall bei Diomedes in Apulien, wo der König Daunos herrschte, und bei Aeneas in Latium, wo Latinus König war. Im Grunde sah man also aus der Verschmelzung von Autochthonen und Neuankömmlingen die historischen Völker hervorgehen. Den Ursprung der Städte stellte man sich als einen gewollten und zeitlich festgelegten Gründungsakt vor, wiederum dem Vorbild der historischen griechischen Kolonien entsprechend. Weitere Wanderungen hätten dann zur Bildung neuer Völker aus bereits formierten Volksgruppen geführt.“10
Abb.1. Italien und die dort siedelnden Völker um ca. – 600 (nach der neuen Chronologie)
Obwohl diese Ursprungsgeschichten bereits von der historisch-kritischen Forschung des 19. Jhs. als Produkte antiker Fabulierkunst entlarvt und verbannt wurden, kommt man bis heute nicht umhin, solche Wanderungsbewegungen zur Erklärung der festgestellten Verteilung von Völkern, Stämmen und Sprachen anzunehmen und somit den antiken Einwanderungssagen einen wenn auch nur rudimentären historischen Kern zuzugestehen. Hierbei mag das Einwandern mal von kriegerischen Scharmützeln begleitet gewesen, ein anderes Mal auf friedlichem Wege erfolgt sein, indem die Neuankömmlinge nach und nach einsickerten und sich assimilierten bzw. Alteingesessene und Einwanderer sich wechselseitig beeinflussten. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass der Einfall der Kelten im – 5./– 4. Jh., zu dem auch Berichte antiker Historiker vorliegen, den Schlusspunkt dieser Einwanderungen ins vorchristliche Italien hinein darstellte. Das Aufspüren früherer Wanderungsbewegungen stellt jedoch die Archäologie vor schwierige Herausforderungen wie Jochen Bleicken erläutert: „Bei der Interpretation des archäologischen Materials vermag man oft schwer zu sagen, ob es sich bei Veränderungen um Wanderungen handelt oder nur um Kultureinflüsse. Ebenso ist die Entscheidung darüber schwer, bisweilen unmöglich, welche der später uns bekannten Völker mit diesem oder jenem archäologischen Substrat verbunden werden können. Mit einiger Sicherheit vermögen wir zu sagen, daß die Ligurer eine sehr alte Bevölkerung darstellen, wohl die älteste unter den Völkern der Halbinsel. Aber schon die Frage, wann die ersten großen Wanderungsbewegungen einsetzten, insbesondere seit wann aus dem Norden oder Osten indogermanische Bevölkerungsteile nach Italien strömten, ist schwierig und wird unterschiedlich beantwortet.“11
Bei den Italikern, d.h. bei diesen nach Italien eingewanderten indogermanischen Völkern, unterscheidet man zwei Sprachgruppen, die latino-faliskische und die oskisch-umbrische Sprachgruppe. Letzterer gehörten etwa die Sabiner, Samniten und Volsker an, ersterer – wie sich schon aus der Benennung erschliessen lässt – die Falisker und Latiner.
Eindeutig über das archäologische Material identifizieren lassen sich die Griechen und Etrusker, die sich schon dadurch von ihren italischen Nachbarn unterscheiden, dass sie in Städten siedeln und durch das viel höhere Niveau ihrer Kultur eine Ausnahmestellung einnehmen. Während im Falle der Griechen eine Einwanderung unbestreitbar ist, bleibt die Herkunft der Etrusker nach wie vor umstritten. Genau wie die Griechen sind sie nach konventioneller Ansicht ab dem – 8. Jh., nach unserer Neudatierung etwa ab dem Beginn des – 7. Jhs. auf italischem Boden nachweisbar.
Ein rätselhaftes Volk
Wenn es um die Wurzeln europäischer Kultur und Zivilisation geht, fristen die Etrusker bis heute ein eher stiefmütterliches Dasein im Schatten von Griechen und Römern. Die Gründe hierfür liegen zum einen im Mangel an ausführlichen Überlieferungen zu ihrer Geschichte, zum anderen im Fehlen spektakulärer Ruinenstätten wie sie Griechen und Römer aufweisen können. Viele Etruskerstädte wurden von den Römern zerstört oder überbaut. Ohnehin pflegten die Etrusker ihre Häuser aus vergänglichen Materialien zu errichteten, die die Zeiten nur schwerlich überdauern konnten. Ihre Chroniken wurden von den Römern vernichtet und auch die Tyrrenika, ein zwanzigbändiges Werk des Kaisers Claudius über die Geschichte und Kultur der Etrusker, ist uns leider nicht mehr erhalten.
Dass wir uns heute dennoch ein Bild vom Leben und von der Kultur der Etrusker machen können, ist ihren Gräbern zu verdanken. Da sie an ein wie auch immer geartetes Weiterleben nach dem Tod glaubten, gestalteten sie die Grabkammern ähnlich den Häusern der Lebenden, stellten Speisen und Getränke mit ins Grab und statteten die Toten mit ihren zu Lebzeiten erworbenen Besitztümern aus. So stammt das Gros der heute in den Museen zu bewundernden etruskischen Schmuck-, Kunst- und Gebrauchsgegenstände aus den wenigen unberaubten Gräbern. Dass sich die Gräber im Gegensatz zu den Häusern erhalten haben, liegt daran, dass man sie aus dem gewachsenen Fels schlug oder massiv aus Stein errichtete, wobei einige von ihnen monumentale Ausmaße erreichten. Aufschluss über ihre Kultur geben auch die Malereien, die die Wände der Grabkammern mit Szenen aus dem Leben schmückten.
Der Name Etrusker geht auf die römische Bezeichnung Etrusci oder Tusci für dieses Volk zurück, das auch der Toscana ihren Namen gab. Die Etrusker nannten sich selbst Rasna oder Rasenna.12 Bei den Griechen hießen sie Tyrsenoí oder Tyrrhenoí und noch heute trägt das Meer vor der ehemaligen Küste Etruriens zwischen den Inseln Korsika, Sardinien und Sizilien den Namen das Tyrrhenische.
Abb.2. Der Einflussbereich der Etrusker zur Zeit seiner größten Ausdehnung
Auch das Adriatische Meer östlich der Apenninen-Halbinsel verdankt seinen Namen den Etruskern bzw. der Stadt Hatria (heute Adria), die sie nahe der Mündung des Po gründeten. Damit hätten wir zugleich die Ost-West-Reichweite des etruskischen Kerngebietes grob umrissen. Von Nord nach Süd erstreckte es sich zur Zeit seiner größten Ausdehnung vom Gardasee bis zum Golf von Salerno.
Man darf sich aber dieses gewaltige Gebiet nicht als etruskisches Reichs- oder Staatsgebiet unter zentraler Führung vorstellen, vielmehr wurde jede Stadt von einem Priesterkönig regiert, der gleichzeitig als politischer und religiöser Führer, als oberster Richter und als Feldherr fungierte. Zu den Herrschaftsinsignien eines jeden lucumo, wie die Römer diese Priesterkönige nannten, gehörte ein Gewand, das mit einem Purpurstreifen verziert war. Er thronte auf einem Sessel aus Elfenbein und wurde auf der Straße stets von Leibwächtern, den sogenannten Liktoren, begleitet, die als Zeichen seiner Macht die sogenannten fasces trugen.13 Das sind Rutenbündel mit einem Beil darin – ein Symbol, das im 20. Jh. von Benito Mussolini als namensgebendes Wahrzeichen für seine nationalistische Bewegung, den Faschismus (fascismo), wieder aufgegriffen wurde.14 Einmal im Jahr kamen die Priesterkönige der einzelnen Stadtstaaten in Volsinii beim fanum voltumnae, dem Heiligtum des Gottes Voltumna, zu einem großen Fest mit Spielen und Wettkämpfen zusammen, um für das folgende Jahr ein neues Bundesoberhaupt zu wählen und wichtige wirtschaftliche und politische Fragen zu erörtern.15
Erstmals historisch fassbar werden die Etrusker in der Theogonie des griechischen Dichters Hesiod, der um ca. – 64016 von den „hochberühmten Tyrsenern“ spricht.17 Sie bewohnten zunächst das im Norden vom Arno und im Osten und Süden vom Tiber begrenzte Gebiet von der Küste des Tyrrhenischen Meeres bis zum Apenninen-Gebirge. Zu den bekanntesten von ihnen angelegten Städten zählen Populonia gegenüber der Insel Elba mit ihren reichen Erzvorkommen, Vetulonia, Volterra und noch weiter im Landesinneren Clusium, weiter südlich Vulci, Tarquinii samt seinem Hafen Graviscae und Caere mit Pyrgi als Hafen sowie das nördlich des späteren Rom auf der anderen Tiberseite gelegene Veii.
Reichtum und Macht der etruskischen Oberschicht, wie sie uns in der Ausstattung ihrer Gräber entgegentreten, beruhten nicht unwesentlich auf den bereits eben erwähnten Erzvorkommen, die nicht nur auf Elba beschränkt waren.18 „Vom Norden des Landes bis in die Gegend von Siena enthalten die Hügel, die heute unter dem Namen Colline Metallifere bekannt sind, in großen Mengen Eisen, Kupfer, Zink und Zinn“19, das von den Etruskern nach Kräften abgebaut und im Austausch gegen Gold, Silber und Elfenbein verhandelt wurde. Zur Sicherung des Handels diente ihnen eine gefürchtete Flotte, mit der sie sich eine Vormachtstellung im Tyrrhenischen Meer erringen konnten.
Als große Zeit der Etrusker gilt das – 6. Jh. Aus jener Zeit finden sich „etruskische Erzeugnisse – vor allem Amphoren für den Weintransport und Buccherogeschirr aus den Zentren des Südens – […] an den Küsten Korsikas, des von den Phöniziern besiedelten Sardinien, in Karthago und in den griechischen Kolonien auf Sizilien. Damit ist eine sehr rege Verkehrstätigkeit der in den Hafensiedlungen Südetruriens beheimateten etruskischen Schiffe und Schiffsverbände erwiesen.“20 In jenen Tagen hatte ihre Macht- und Einflusssphäre die größte Ausdehnung und auch Rom stand für einige Zeit unter etruskischer Herrschaft.
Das erste Auftauchen der Etrusker in Mittelitalien wird konventionell in die zweite Hälfte des - 8. Jhs. datiert, als sie die bis dahin dort vorherrschende Villanova-Kultur ablösten. Manche Forscher sind jedoch der Ansicht, die Etrusker wären aus der Villanova-Kultur hervorgegangen. Damit sind wir bei der schwierigen Frage der Herkunft der Etrusker angelangt, die schon die Gemüter der antiken Historiker bewegte.
Hellanikos sah im – 5. Jh. die Etrusker als identisch mit den Pelasgern an, einem sagenhaften Volk, dass aus dem griechischen Thessalien nach Italien ausgewandert sein soll.21 Sein Zeitgenosse Herodot gibt uns einen Bericht, wonach die Etrusker aus dem westkleinasiatischen Lydien nach Mittelitalien ausgewandert seien: „Zur Zeit des Königs Atys, Manes‘ Sohn, herrschte in ganz Lydien große Hungersnot. […] Als die Not aber nicht nachließ, sondern immer größer wurde, da schied der König das ganze lydische Volk in zwei Gruppen und ließ das Los entscheiden: die eine Hälfte sollte im Land bleiben, die andere sollte auswandern. Der König selber trat mit auf die Seite derer, die bleiben mußten, und gab den Auswandernden seinen Sohn mit, namens Tyrsenos. Da zog denn die Hälfte, die das Los zum Auswandern verurteilte, hinab nach Smyrna, baute dort Schiffe, belud sie mit allen nützlichen Gerätschaften und fuhr aus, Lebensunterhalt und Land zu suchen. An vielen Völkern schifften sie vorüber und gelangten zum Lande der Ombriker [d.i. Umbrien – F.Z.]. Dort siedelten sie sich an, bauten Städte und leben dort bis auf den heutigen Tag. Sie änderten ihren Namen und nannten sich nach dem Sohn ihres Königs, der sie geführt hatte. So erhielten sie den Namen Tyrsener.“22
Eine Synthese beider Theorien lieferte im – 3. Jh. Antikleides von Athen. Er lässt den Tyrsenos ein pelasgisches Volk nach Italien führen, bringt dieses aber mit den nordostägäischen Inseln Lemnos und Imbros in Verbindung, wobei er die Lemner sogar ausdrücklich als Tyrrhener bezeichnet.23
In dieselbe Kerbe wie Herodots Darstellung schlägt der Bericht des römischen Historikers Tacitus (ca. 55 – 120 n.Chr.), der von einer Rivalität kleinasiatischer Gesandter im Senat erzählt, die darum gestritten hätten, wer in seiner Stadt dem Kaiser Tiberius einen Tempel errichten dürfe. Die Gesandten der ehemaligen lydischen Königsstadt Sardes hätten dabei auf ihre Verwandtschaft mit den Etruskern verwiesen.24
Rund ein Jahrhundert zuvor hatte sich jedoch schon der griechische Geschichtsschreiber Dionysios von Halikarnassos gegen Herodots Ansicht ausgesprochen: „Ich glaube nicht, dass die Tyrrhener aus Lydien eingewandert sind. Sie sprechen auch nicht dieselbe Sprache wie die Lyder, und niemand kann behaupten, dass sie irgendein Merkmal aufweisen, das aus ihrem angeblichen Heimatland stammen könnte. Sie beten nicht zu denselben Göttern wie die Lyder. Sie haben nicht dieselben Gesetze, und zumindest in dieser Hinsicht unterscheiden sie sich stärker von den Lydern als von den Pelasgern. Daher stimme ich denjenigen bei, die meinen, die Etrusker seine nicht aus der Fremde gekommen, sondern ein einheimischer Stamm; meiner Ansicht nach scheint dafür die Tatsache zu sprechen, dass sie ein sehr altes Volk sind, das in Sprache und Sitte keinem anderen gleicht.“25
Diese beiden Positionen, d.h. die Theorie der lydischen Herkunft und jene des indigenen Stammes, stehen sich im Grunde genommen auch heute noch unversöhnlich gegenüber. Dionysios‘ Meinung war bestimmend für die römische Kaiserzeit und findet auch heute noch zahlreiche Befürworter, speziell in Italien, wo die Forschung mitunter durch eine gewisse pariotische Befangenheit beeinflusst wird. Da nun aber die lydische Sprache, die dem anatolischen Zweig der indogermanischen Sprachen zugerechnet wird, tatsächlich nicht mit dem Etruskischen verwandt ist, scheint vieles für die Theorie vom alteingesessenen, einheimischen Stamm zu sprechen, zumal außerhalb Italiens keine Bauten oder ähnliche materielle Hinterlassenschaften der Etrusker bekannt sind.
Doch ausgerechnet von der Insel Lemnos vor der Westküste Kleinasiens, also aus jenem Gebiet, das griechische Autoren als ursprüngliche Heimat der Etrusker ansahen, gibt es Schriftzeugnisse, die eine eindeutige Verwandtschaft mit dem Etruskischen aufweisen. Dort entdeckten 1885 französische Archäologen bei Kaminia eine Grabstele, die einen Krieger mit einer Lanze zeigte und eine Inschrift trug, deren Sprache sich weder mit dem Griechischen noch mit dem Lydischen in Verbindung bringen ließ. Es ergab sich in der Folge, dass die Sprache der Inschrift, ebenso wie jene der später auf Lemnos gefundenen beschrifteten Keramikfragmente, „mit dem Etruskischen sowohl in der grammatischen Struktur als auch im Wortschatz weitgehend Übereinstimmung zeigt. Hinzu kommt ein Worttrennungszeichen in der Form eines Doppelpunktes, wie es bisher nur im archaischen Südetrurien geläufig ist; und ebenso ungewöhnlich wie auffallend ist auch die jeweilige Nennung des Mutternamens (Matronymikum) auf Grabinschriften in Etrurien und auf der Stele von Lemnos.“26 Doch neben diesen sprachlichen Übereinstimmungen gibt es auf der Insel keinerlei kulturhistorische Hinweise auf die Etrusker. Keramik, Plastiken und Bauten sind echt ägäisch. Somit muss die Nähe des Lemnischen mit dem Etruskischen zunächst noch ungeklärt bleiben. Auch die Frage, ob diese sprachliche Übereinstimmung bereits den griechischen Historikern bekannt war, und sie deshalb die These von der Auswanderung aus diesem Gebiet entwickelten, bleibt vorerst noch unbeantwortet. Die etruskische Sprache steht jedoch auch der Theorie vom indigenen Volk entgegen, denn sie unterschied sich erheblich von jenen der benachbarten italischen Völker, die allesamt der indogermanischen Sprachfamilie angehörten. Wir werden zur Frage der Herkunft der Etrusker im dritten Band der Reihe Stellung nehmen und uns einstweilen mit der Feststellung begnügen, dass sie nicht dem lydischen Kerngebiet entstammen und auf italischem Boden nur insofern ihren Ursprung zu haben scheinen, als das sich erst dort aus der Vermischung von kulturell höher stehenden Einwanderern und alteingesessenen Villanova-Leuten jenes eigenwillige Kultursubstrat ergab, das wir heute als etruskisch zu bezeichnen pflegen. Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss hat hierbei noch ein anderes nach Italien eingewandertes Volk ausgeübt, das wenig später ankam und von dem die Etrusker nicht nur das Alphabet übernahmen.
Neuankömmlinge aus Hellas
Sowohl den literarischen Quellen als auch dem archäologischen Beweismaterial zufolge waren es, genau wie im Osten27, Siedler aus den euböischen Städten Chalkis und Eretria, die die ersten griechischen Kolonien im Westen gründeten. Sie ließen sich jedoch nicht etwa am nächstgelegenen südöstlichen Ende Italiens, am Absatz des Stiefels, nieder, sondern an der Westküste und dort zunächst auf der dem Golf von Neapel vorgelagerten Insel Ischia, an einem Ort, den sie Pithekoussai nannten.28 Die dortigen Funde bestätigen Handelskontakte mit Etruskern und Phöniziern, wobei einige Phönizier sich vermutlich dauerhaft in Pithekoussai niedergelassen hatten.29 Eine bescheidene ortsansässige Metallindustrie lässt auf den ursprünglichen Beweggrund der Neuankömmlinge schliessen, sich den Erzvorkommen Mittelitaliens anzunähern.30 Ein bis zwei Jahrzehnte später wechselte ein Teil der Siedler auf das gegenüberliegende Festland und gründete die nach der gleichnamigen Stadt auf Euboia benannte Polis Kyme, die für die Geschichte des frühen Rom noch eine große Rolle spielen sollte.
Wiederum einige Jahre später entstanden zur Absicherung des Seeweges durch die Strasse von Messina die gleichsam euböischen Kolonien Naxos, Leontinoi, Katane, Zankle und Mylai auf Sizilien und Rhegion auf dem gegenüberliegenden kalabrischen Festland.
Zur reichsten Stadt Siziliens sollte sich Syrakus entwickeln, das nach Thukydides fast zeitgleich mit Naxos von Korinthern gegründet worden sein soll.31 Scherben euböischer Keramik im nahegelegenen Castellucci und in Syrakus selbst sowie identische und ähnliche Ortsbezeichnungen in Syrakus und Chalkis – beispielsweise gab es in beiden Städten eine Arethusa-Quelle – legen auch hier zumindest eine Beteiligung euböischer Siedler nahe.32
Bleibt noch als letzte Pflanzstadt der „ersten Generation“ auf Sizilien Megara Hyblaia etwa 20 km nördlich von Syrakus zu nennen, die einzige westliche Gründung Megaras, das sich in der Folgezeit bei seinen Kolonisationsbestrebungen eher in Richtung Nordosten zum Schwarzen Meer hin orientierte.33
Es waren euböische Vasen, die als früheste griechische Importe im etruskischen Veii, im vorgriechischen Kyme und im vorkolonialen Villasmundo auf Sizilien aufgetaucht sind.34 Und es war das griechische Alphabet in euböischem Dialekt, das die Etrusker übernahmen.35 Möglicherweise besaßen die Euboier bzw. ihr Emporion Pithekoussai und ihre Kolonie Kyme kurzzeitig so etwas wie ein Handelsmonopol mit den Etruskern, doch schon kurz nach der Gründung von Megara Hyblaia entstanden am Golf von Tarent mit Sybaris, Kroton und Metapont weitere Pflanzstädte, diesmal durch achäische Siedler. Diese hatten, wenn sie am Handel mit den Etruskern interessiert waren und aktiv teilhaben wollten, ihre Siedlungsplätze gut gewählt, denn so konnten sie die von den Euböern kontrollierte Straße von Messina umgehen und über Land eine Handelsroute mit dem etruskischen Kampanien aufbauen, wo einige Jahrzehnte später mit Poseidonia (Paestum) eine von Siedlern aus Sybaris gegründete Kolonie entstand. Sowohl Sybaris, das anscheinend enge Handelsverbindungen mit Milet unterhielt, als auch Poseidonia gelangten zu Reichtum und Wohlstand, doch wurde Sybaris in einem kriegerischen Konflikt mit Kroton völlig zerstört.36
Abb.3. Frühe griechische Pflanzstädte in Sizilien und Unteritalien
Konflikte
Nicht nur zwischen einzelnen griechischen Kolonien kam es zu Zwistigkeiten, auch die anfangs wohl friedlichen Kontakte zwischen Griechen, Etruskern und Phöniziern37 wandelten sich aufgrund von sich überschneidenden Handels- und Kolonisierungsinteressen im westlichen Mittelmeer rasch in Konkurrenz und Feindseligkeit um. Etrusker und Phönizier jedoch wurden sich anscheinend einig38, sodass letztere die Küste Nordafrikas mit Karthago als wichtigster Gründung besiedeln sowie an der West- und Südküste Sardiniens, im Westen Siziliens und auf den Balearen einige Handelsniederlassungen gründen konnten, von wo aus sie den Südspanien-Handel mit den reichen Silbervorkommen von Tartessos kontrollierten.
Auf das Silber von Tartessos sollen es aber auch die Griechen, genauer gesagt, die Phokäer, abgesehen gehabt haben. Laut Herodot seien sie – wohl neben den Euböern – „die ersten Hellenen gewesen, die weite Seefahrten unternahmen. Sie entdeckten das Adriatische Meer, Tyrsenien, Iberien und Tartessos. Sie fuhren nicht in runden Handelsschiffen, sondern in Fünfzigruderern.“39 Ihre Gründung von Massalia, dem heutigen Marseille, fällt nach der neuen Keramikchronologie in die Zeit zwischen – 570 und – 560. Von dort aus wurde einige Jahre später als massalischer Handelsstützpunkt Emporion, das heutige Ampurias, im Nordosten Spaniens gegründet.40 Als um – 535 die Perser Phokaia bedrohten, „da rüsteten sich denn die Phokaier, nach Kyrnos [Korsika] zu fahren, wo sie zwanzig Jahre früher auf einen Orakelspruch hin eine Stadt, namens Alalia, gegründet hatten. […] Als sie in Kyrnos angelangt waren, siedelten sie sich gemeinsam mit den früheren Auswanderern an, wohnten fünf Jahre mit ihnen zusammen und bauten Tempel. Sie trieben Seeraub rings gegen ihre Nachbarn. Da schlossen die Tyrsener und Karchedonier [Etrusker und Karthager] ein Bündnis und zogen gegen sie aus mit je sechzig Schiffen. Auch die Phokaier setzten ihre Schiffe instand – es waren sechzig Schiffe – und segelten ihnen entgegen nach dem sogenannten sardonischen Meer. Es kam zur Seeschlacht, und die Phokaier erfochten einen Sieg, der aber einer Niederlage glich. Denn vierzig ihrer Schiffe gingen unter, und der Rest wurde gefechtsunfähig, weil die Schiffsschnäbel verbogen waren. Sie fuhren heim nach Alalia, nahmen ihre Kinder, Weiber und alles Gut, das die Schiffe irgend tragen konnten, an Bord, verließen Kyrnos und wanderten nach Rhegion.“41
Abb.4. Umzeichnung der Seeschlacht des Aristonothos-Kraters (nach Cristofani,1995,37)
Dies ist der erste derartige Konflikt im westlichen Mittelmeer von dem wir historische Kunde besitzen. Auf dem in Caere entdeckten Krater des Aristonothos, einem Weinmischgefäß mit der frühesten bisher bekannten griechischen Künstlersignatur, das nach unserer neuen Chronologie zwischen – 590 und – 580 entstand, ist eine Seeschlacht dargestellt, bei der sich zwei vollkommen unterschiedliche Schiffstypen gegenüberstehen und die von nicht wenigen Gelehrten als Auseinandersetzung zwischen Griechen und Etruskern gedeutet wird.
Im Gefolge der Schlacht von Alalia ist ein rasches Wachstum der Kolonie Massalia zu verzeichnen. Man nimmt an, dass die Karthager unmittelbar nach Alalia die spanischen Häfen und die Strasse von Gibraltar für die Griechen blockierten. „So verloren diese“, wie Barry Cunliffe erläutert, „den Zugang nicht nur zu den reichen Erzvorkommen in Tartessos, sondern auch zu den Handelsnetzen des Atlantiks, wo ein großer Teil des Zinns für den griechischen Markt beschafft wurde. Mit der Entwicklung Massalias und der anderen Häfen Südgalliens konnten sich die griechischen Siedler die direkte Kontrolle über andere, bedeutende Handelswege verschaffen: Sie führten durch das barbarische Europa hindurch, einerseits direkt nach Norden durch die Täler von Rhône und Saône, andererseits nach Westen, an Carcasonne vorbei und hinüber ins Flußtal der Garonne und so zur Gironde, dem Zugang zum Atlantik: Damit eröffnete sich ihnen ein alternativer Seeweg zu den unschätzbaren Zinnvorkommen Galiziens, der Bretagne und Cornwalls. Daß die Karthager den Seeweg durch die Meerenge von Gibraltar monopolisierten, hatte also eine stärkere und entschlossenere Präsenz der Griechen in Südgallien zur Folge. Und das wiederum führte zur Zurückdrängung etruskischer Interessen.“42
Die Etrusker reagierten darauf mit einer Neuorientierung und bauten die Handelswege durch das Apenninen-Gebirge nach Norden aus. Noch vor dem Ende des – 6. Jhs. entstanden am Fuss des Apennin in Richtung der Po-Ebene hin die Städte Felsina und Marzabotto sowie an der Mündung des Po Spina und Hadria, das diesem Teil des Mittelmeeres seinen Namen gab. Hierdurch gewannen sie zum einen direkten Zugang zu den Städten an der Adriaküste und zum griechischen Markt und konnten von nun an auf Mittelsmänner in Unteritalien und Sizilien verzichten, zum anderen erschloss sich ihnen dadurch ein neuer Markt im Norden über die östlichen Alpenpässe.
Zwar wurden die Küstenstädte am Tyrrhenischen Meer nicht komplett aufgegeben, doch ging die dortige Vormachtstellung nach und nach verloren. Ein Versuch, die griechische Pflanzstadt Kyme in Kampanien, die rings von etruskischen Kolonien umgeben und daher den Etruskern ein Dorn im Auge war, auf dem Landweg einzunehmen, schlug fehl.43 Noch schwerwiegender war die etruskische Niederlage – 474 in der Seeschlacht vor Kyme gegen die Flotte Hierons I. von Syrakus44, die nur wenige Jahre zuvor unter dem Kommando seines Bruders Gelon auch die Karthager in der Schlacht bei Himera vernichtend geschlagen hatte.45 So stieg Syrakus zur mächtigsten Stadt Magna Graecias auf und blieb es für lange Zeit. Sowohl die Etruskerstädte Kampaniens als auch Kyme fielen in den Jahren zwischen – 430 und – 420 in die Hände der Samniten. In die Po-Ebene einfallende Keltenstämme und die Expansion der römischen Republik führten in der Folgezeit den endgültigen Niedergang der Etruskerstädte herbei. Die Karthager erholten sich und lagen mit den Griechenstädten Siziliens im Dauerclinch. Ihr Verhältnis zu Rom war lange Zeit vertraglich geregelt, doch als die Römer ihren Machtbereich auf Unteritalien ausgeweitet hatten und nach Sizilien übergriffen, wurden sie ab – 264 zu deren erbittersten Feinden. Der dritte der sogenannten Punischen Kriege endete – 146 mit der Zerstörung Karthagos. Damit hatte Rom endgültig die uneingeschränkte Herrschaft über das westliche Mittelmeergebiet gewonnen und war zur führenden Großmacht des gesamten Mittelmeerraumes aufgestiegen – ein kleines Wunder, wenn man an seine bescheidenen Anfänge zurückdenkt.
Die Anfänge Roms
Zwischen dem späteren etruskischen Kerngebiet im Norden und Kampanien im Süden, wo später mit Kyme die nördlichste Griechenkolonie und mit Capua, Irna u. a. auch einige etruskische Gründungen entstehen sollten, lag das Stammesgebiet der Latiner. Es gehörte zum südlichen Einzugsgebiet der sogenannten Villanova-Kultur, die nach einem kleinen Dörfchen bei Bologna benannt ist, wo man Mitte des 19. Jhs. auf die ersten Funde stieß. Überreste der Villanova-Kultur in Form von Gräberfeldern sind sowohl nördlich als auch südlich des Apennin in der Po-Ebene, in der Toscana, in Umbrien und eben auch in Latium entdeckt worden. Wie damals vielerorts in Europa üblich pflegten auch die Villanova-Leute ihre Toten zu verbrennen. Charakteristisch für diese Ackerbau- und Viehzüchterkultur sind die ein- oder zweihenkligen, doppelkonischen, mit geometrischen Mustern verzierten Urnen, in denen die Asche der Toten aufbewahrt wurde und die man in einen Fels- oder Erdschacht zu stellen pflegte. Sie waren von Hand geformt, schlecht gebrannt und bestanden aus Impasto, einem porösen Ton vermischt mit reichlich groben Zusätzen aus Sand und Steinchen.
In Latium jedoch, speziell in den Albanerbergen, hatten die Aufbewahrungsgefäße für die Totenasche keine doppelkonische Form, sondern waren den ursprünglichen Wohnstätten der Toten nachgebildet. Solche sogenannten Hütten-Urnen wurden zuhauf im Gebiet der späteren Stadt Rom, vor allem auf dem ausgedehnten Gräberfeld im Areal des späteren Forum Romanum gefunden.
Abb.5. Typische Hüttenurne aus Tarquinia (aus Bloch,1960a,69,Fig.5)
Weitere große Gräberfelder, die zusammen betrachtet von der frühen Eisenzeit bis in die späte Republik hinein in Gebrauch waren, wurde gemeinsam mit Überresten zahlreicher alter Bauten bereits in den 1870er Jahren bei umfangreichen Baumaßnahmen auf dem Esquilin entdeckt, jedoch selbst unter Zugrundelegung der damaligen Standards nur unzureichend archäologisch erfasst: „Leider waren die Arbeiten, bei denen es oft an der nötigen Sorgfalt fehlte, alles andere als wissenschaftlich. Die Fundberichte sind meist recht summarisch. Sie wurden in entlegenen Zeitschriften veröffentlicht, und bis heute gibt es keine zusammenfassende Arbeit, in der alle verfügbaren Daten monographisch gesammelt sind (nur über die archaische Nekropole gibt es eine Monographie).“46
Die ältesten dort nachgewiesenen Grablegen (nur Körper-, keine Brandbestattungen) waren Fossa-Gräber, wie sie zeitgleich auch in der Forums-Nekropole angelegt worden waren. Während der späten Kulturstufe III, nach neuer Datierung etwa um – 670, war es zu einigen einschneidenden Veränderungen gekommen, die mit dem Auftauchen der Etrusker und Griechen in Italien in Zusammenhang zu bringen sind. Während die Körperbestattungen schon während der vorangegangenen Kulturstufe II neben die Brandbestattungen getreten zu sein scheinen47, lassen die Grabbeigaben anhand der bisweilen auftretenden Prestige- und Luxusobjekte auf eine soziale Differenzierung schliessen.
Zudem tauchten zu jener Zeit in Latium erstmals mit Hilfe einer Töpferscheibe produzierte Keramikobjekte auf. Selbst die handgeformte lokale Keramik zeigte sich hinsichtlich Material und Machart deutlich verbessert. Die Motive wurden nicht mehr nur eingeritzt, sondern manchmal auch aufgemalt. „Die Gefäßformen sind sowohl lokale als auch griechische. Technik und Dekorationsmotive stammen aus dem Repertoire der mittel- und spätgeometrischen griechischen Keramik vor allem euböischer und kykladischer Provenienz.“48
Im Bereich des Metallhandwerks löste das Eisen die Bronze als vorherrschendes Material für Schwerter, Messer und Lanzenspitzen ab, wobei eine Verwandtschaft mit etruskischen Produkten nicht geleugnet werden kann.
Für die Zeit von – 640 bis – 580 neuer Datierung deuten die gefundenen mittel- bis spätprotokorinthischen und etruskischen Vasen darauf hin, dass „es auf dem Esquilin-Friedhof einige Gräber gegeben haben muss, deren Inhalt mit den verschwenderischsten Gräbern von Latium in Castel di Decima, Acqua Acetosa, Laurentina und sogar Praeneste konkurrieren konnte.“49
Wenn wir uns von den Stätten der Toten ab- und uns den Behausungen der Lebenden zuwenden, so müssen wir wieder ein wenig in der Zeit zurückgehen. Die frühesten bisher ergrabenen Hüttenüberreste gehören zwar ebenfalls der Kulturstufe III an, müssen jedoch wohl ein bis zwei Jahrzehnte vor die einschneidenden Veränderungen der – 660er Jahre datiert werden. Sie wurden Anfang des 20. Jhs. und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im südwestlichen Teil des Palatin ausgegraben. Dass die früheste Besiedlung des späteren Rom gerade auf dem Palatin nachgewiesen ist, kann angesichts der Topographie nicht verwundern, denn mit seiner großen Fläche und seinen steil abfallendenen Hängen, die eine Verteidigung erleichterten, ist er von allen Hügeln sicherlich für eine Besiedlung am besten geeignet. Die Wasserversorgung war durch die sogenannte Quelle der Iuturna am Nordhang gesichert.
Die Fussböden der Behausungen waren in den anstehenden Tuff gehauen und die einzelnen Hütten jeweils durch einen kleinen Abwasserkanal voneinander getrennt. Die größte derartige Hütte maß 4,90 m x 3,60 m, ihr Grundriss war nicht rechteckig, sondern die Wände waren leicht nach aussen gebogen. „An der äußeren Begrenzung entlang sind sechs Löcher für die Pfosten, mit denen die Wände aus Streu und Lehm und das Dach gestützt wurden. In der Mitte ist ein Pfostenloch, das den Dachfirst abstützte. Auf einer der Schmalseiten war der etwas über 1 m breite Eingang, hier sind rechts und links zwei Pfosten für die Türachsen. Die beiden anderen Löcher vor der Tür sollten wohl das kleine Vordach tragen. An einer der Längsseiten muß ein Fenster gewesen sein.“50
Abb.6. Rekonstruktion und Grundriss einer archaischen Hütte (nach Coarelli,1975,139)
So siedelten denn also die „Römer“ als Viehhirten auf dem Palatin zu jener Zeit, als nach der annalistischen Tradition der Stadtgründer und erste König Roms angeblich bereits die Sabiner unterworfen51, die etruskischen Städte Fidenae und Veii erobert und sich das Gebiet der Sieben Gaue und die Salinen nördlich der Tibermündung unter den Nagel gerissen hatte.52
4 Goethe,1795,7
5 Antiochos von Syrakus bei Dionysios von Halikarnassos – Antiquitates Romanae I,12,3; Thukydides 6,4,2; Aristoteles – Politik 1329b
6 Nach oskisch víteliú ("Land der Kälber" ), lat. vitulus („Kalb“)
7 Bleicken,1999,1
8 Pallotino,1987,11
9 Vgl. etwa Dionysios von Halikarnassos – Antiquitates Romanae (im folgenden DH) I,11ff
10 Pallotino,1987,33f
11 Bleicken,1999,3
12 DH I,30,3
13 Stützer,1987,25
14 Keller,1970,57
15 Stützer,1987,25
16 Zur zeitlichen Einordnung des Dichters Hesiod siehe das Kapitel „Archilochos, Hesiod und der Lelantische Krieg“ in Zimmermann,2021, im besonderen S. 376-378
17Theogonie 1011ff
18 Pallotino,1987,75
19 Bloch,1960,71
20 Cristofani,1995,39
21 vgl. DH I,28
22Historien 1,94
23 vgl. Strabon V,2,4
24Annalen 4,55
25 DH I,30
26 Prayon,2010,32
27 In Al-Mina an der Orontes-Mündung im heutigen syrisch-türkischen Grenzgebiet hatten die Euböier ungefähr zur selben Zeit eine Handelsniederlassung gegründet.
28 Livius – Ab urbe condita (im folgenden Liv.) VIII,22,5f; Strabon – Geographika V,4,9
29 Boardman,1981b,197
30 Chemische Analysen ergaben, dass das in Mezzavia bei Pithekoussai gefundene Eisen von der Insel Elba stammte (Boardman,1981b,199).
31 Thukydides 6,3,1-2
32 Boardman1981b,203
33 Megara gründete später Astakos am Marmarameer, Chalkedon am Bosporus und Herakleia Pontike am Schwarzen Meer.
34 Boardman,1981b,195
35 Prayon,2010,48
36 Herodot - Historien V,44ff; VI,21
37 Für anfangs friedliche Beziehungen zwischen Etruskern und Griechen sprechen beispielsweise die Übernahme des griechischen Alphabets, die Aufnahme einiger griechischer Gottheiten in das etruskische Pantheon, etruskische Weihgaben im Heiligtum von Olympia (Prayon,2010,48-50) und ein eigenes Schatzhaus der Caeretaner in Delphi (Srabon – Geographika 5,2,3), was ansonsten ein Privileg griechischer Städte war. Für anfänglich friedliche Beziehungen zwischen Griechen und Karthagern sprechen z.B. Funde griechischer Artefakte in den ältesten Schichten Karthagos (Cunliffe,2000,378) und von in aramäischer und phönizischer Sprache beschrifteten Vasen in Pithekoussai (Boardman,1981b,197). Für friedliche Beziehungen zwischen Etruskern und Phöniziern bzw. Karthagern sprechen ein bei Herodot (Historien 1,165) erwähntes Bündnis und ein von Aristoteles (Politik 1280 a35) erwähnter Vertrag (so dieser denn historisch ist) sowie etwa die auf den zweisprachigen Goldtäfelchen von Pyrgi in etruskisch und punisch dokumentierte Verehrung der phönizischen Göttin Astarte im Heiligtum der etruskischen Göttin Uni (Prayon,2010,49).
38 Siehe den letzten Abschnitt der vorangegangenen Fussnote.
39Historien 1,163
40 Strabon – Geographika 3,4,8
41Historien 1,165f (eckige Klammern – F.Z.)
42 Cunliffe,2000,379
43 DH VII,3
44 Pindar – Pythie 1,70-80
45 Herodot – Historien 7,165-167; Diodor – Bibliotheca historica XI,20-24
46 Coarelli,1975,196, der auf Pinza,1905 u. 1912 anspielt.
47 Kolb,1995,34; anders etwa noch Bloch,1960b,75f, der diesen Wandel mit dem Erscheinen der Griechen zusammenbrachte.
48 Kolb,1995,37
49 Holloway,1996,22
50 Coarelli,1975,140
51 DH II,38,3; II,39,1; II,40,2
52 Liv. I,15,5; II,13,4; DH II,55,5f; Plutarch – Romulus 25,5
(II)
DIE EWIGE STADT
7-5-3 – KEIN ROM UND KEIN EI
„Man frage nach dem Gründungsjahr Roms, und man wird ein Datum genannt bekommen, das – verankert zwar noch in allen Lexika wie Schulbüchern – falsch und längst überholt ist – nämlich das Jahr 753 v.Chr. Auch die Antwort auf die Frage nach dem Gründer der Stadt wird – ebenso falsch – nicht anders lauten, als sie römische Schulknaben bereits vor 2000 Jahren gegeben haben – nämlich Romulus.“53
Die Problematik
Nach der traditionell überlieferten Geschichte wurde das auf sieben Hügeln erbaute Rom vor seiner Zeit als Republik von sieben Königen inklusive seines Gründers Romulus regiert. Die moderne Forschung hat bereits „seit dem 19. Jahrhundert den mythischen Charakter dieser erst seit etwa 200 v.Chr. schriftlich fixierten Überlieferungen freigelegt und gezeigt, daß sowohl das kanonische Gründungsdatum Roms (753 v.Chr.) als auch die sieben Könige und die sieben Hügel fiktiv sind.“54