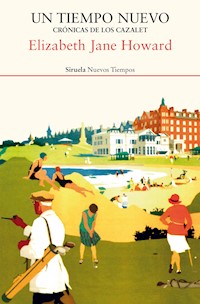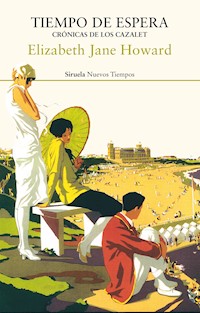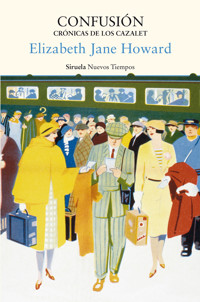9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cazalet-Chronik
- Sprache: Deutsch
»Diese Saga wird man als einen Klassiker über das Leben in England im 20. Jahrhundert lesen.« Sybille Bedford Der Zauber des Victory Day ist verblasst, die Kriegsjahre sind an der Familie Cazalet nicht spurlos vorübergegangen. Doch ihr Blick richtet sich nach vorn, die gesellschaftlichen Veränderungen eröffnen neue Möglichkeiten. Die Cousinen Polly und Clary müssen zwar erste Enttäuschungen in der Liebe verkraften, dafür feiern sie in der männerdominierten Berufswelt Erfolge. Und Louise, die sich zu lange gefangen gefühlt hat, bricht aus ihrer leidenschaftslosen Ehe aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 952
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Haupttitel
Widmung
Danksagung
Was bisher geschah
ERSTER TEIL
Die Brüder:
Juli 1945
Die Mädchen:
August 1945
Die Ehefrauen:
Oktober bis Dezember 1945
Die Außenstehenden:
Januar bis April 1946
ZWEITER TEIL
Archie:
Mai und Juni 1946
Archie:
Juli und August 1946
DRITTER TEIL
Edward:
1946
Rupert:
November 1946
Polly:
September bis Dezember 1946
Die Ehefrauen:
Dezember 1946 bis Mai 1947
VIERTER TEIL
Louise:
Frühjahr 1947
Clary:
1946 bis 1947
Die Außenstehenden:
Sommer 1947
Archie:
1946 bis 1947
Anmerkungen
Und so geht es im nächsten Band weiter …
Auszug aus Band 5
Über Elizabeth Jane Howard / Ursula Wulfekamp / Karl-Heinz Ebnet
Stammbaum
Die Familie Cazalet
Impressum
Landmarks
Cover
Haupttitel
Impressum
Über das Buch
Victory Day ist vorüber, der Jubel verklungen, der Alltag hält wieder Einzug. Doch so ganz ohne Weiteres kann die Familie Cazalet nicht an die Vorkriegsjahre anknüpfen: Rupert ist zwar aus dem Krieg heimgekehrt, findet aber nur mit Mühe zurück ins häusliche Leben, Edward schwankt weiter zwischen seiner Frau und seiner Geliebten Diana, während Hugh sich in seiner Trauer um seine verstorbene Frau vergräbt. Rachel widmet sich wie gewohnt aufopferungsvoll ihren Familienangehörigen. Doch denkt sie dabei wirklich nur an die anderen?
Auch bei den drei Cazalet-Cousinen ist nicht alles im Lot: Während Polly und Clary beruflich mehr und mehr auf eigenen Beinen stehen, erleben sie in der Liebe so manche Enttäuschung. Und Louise, die sich in einer leidenschaftslosen Ehe gefangen fühlt, denkt ernsthaft und freimütig über ihre weiteren Optionen nach.
Im vierten Band der ›Chronik der Familie Cazalet‹ erkundet Elizabeth Jane Howard die Möglichkeiten, die sich den britischen Frauen in der Nachkriegszeit eröffneten, und spiegelt die gesellschaftlichen Veränderungen in den Leben der einzelnen Familienmitglieder.
Für Sybille Bedford in Liebe und Ehrerbietung
DANKSAGUNG
Ich möchte Jane Wood danken, die mir bei dreien dieser vier Bände mit Geduld, Verständnis, Aufmerksamkeit und ständiger Ermutigung zur Seite stand … Ohne sie hätte ich es wohl gar nicht so weit geschafft.
WAS BISHER GESCHAH
Die folgende Vorgeschichte dieses Romans ist für Leserinnen und Leser gedacht, die mit den drei vorhergehenden Bänden, Die Jahre der Leichtigkeit, Die Zeit des Wartens und Die stürmischen Jahre, nicht vertraut sind.
Im Sommer 1945 führen William und Kitty Cazalet, von der Familie »der Brig« und »die Duchy« genannt, ein ruhiges Leben in Home Place, dem Familiensitz in Sussex. Der Brig ist mittlerweile blind. Die beiden haben eine ledige Tochter, Rachel, und drei Söhne, die alle im Holzunternehmen der Familie arbeiten. Hugh ist Witwer, Edward ist verheiratet, hat allerdings eine ernste Liebesaffäre. Rupert ist gerade nach England und zu seiner Frau Zoë zurückgekehrt; seit der Schlacht von Dünkirchen hatte er in Frankreich als vermisst gegolten.
Edwards Tochter Louise ist mit dem Porträtmaler Michael Hadleigh verheiratet, allerdings bereitet die Ehe ihr zunehmend Schwierigkeiten. Sie haben einen Sohn, Sebastian. Louises Bruder Teddy macht eine Ausbildung bei der Royal Air Force in Arizona und ist mit seiner amerikanischen Frau noch nicht zurückgekehrt.
Polly und Clary, die Töchter von Hugh und Rupert, leben zusammen in London. Polly arbeitet für einen Innenarchitekten, Clary für einen Literaturagenten. Pollys Bruder Simon studiert in Oxford, Clarys Bruder Neville besucht noch die Internatsschule Stowe.
In Ruperts Abwesenheit brachte Zoë die gemeinsame Tochter Juliet zur Welt.
Rachel opfert sich auf für andere, was ihre sehr gute Freundin Margot Sidney (Sid), die in London als Geigenlehrerin arbeitet, oft sehr schwierig findet.
Jessica, die Schwester von Edwards Frau Villy, ist mit Raymond Castle verheiratet. Die beiden haben vier Kinder. Angela, die Älteste, ist mit einem Amerikaner verlobt. Christopher lebt mit seinem Hund in einem Wohnwagen und arbeitet auf einem Bauernhof. Nora hat einen querschnittsgelähmten Mann geheiratet und das Haus der Castles in Surrey als Pflegeheim für Schwerverwundete eingerichtet. Judy geht noch auf einem Internat zur Schule.
Miss Milliment, die sehr betagte Hauslehrerin der Familie, soll bei Villy und Edward wohnen, wenn diese wieder nach London ziehen.
Diana Mackintosh, Edwards Geliebte, hat ein Kind von ihm bekommen.
Archie Lestrange, Ruperts ältester Freund, der noch in der Admiralität arbeitet, ist derjenige, dem die Familienmitglieder fast all ihre Geheimnisse anvertrauen.
Am Wendepunkt setzt im Juli 1945 ein, kurz nach Ruperts Rückkehr nach England.
ERSTER TEIL
DIE BRÜDER
JULI 1945
Ich dachte mir, wenn ich bis zum Herbst bleibe, hätten Sie noch genügend Zeit, sich jemand Geeignetes zu suchen. Natürlich möchte ich Ihnen keine Umstände bereiten.« Im nachfolgenden Schweigen suchte und fand sie ein kleines weißes Spitzentaschentuch im Ärmel ihrer Strickjacke und putzte sich dezent und nutzlos die Nase. Ihr Heuschnupfen war um diese Jahreszeit immer besonders schlimm.
Hugh betrachtete sie bestürzt. »Ich werde nie jemanden finden, der auch nur entfernt so geeignet ist wie Sie.« Ihrer Meinung nach war das ein zweischneidiges Kompliment. Sie zuckte zusammen. Genau das hatte sie befürchtet: dass er jetzt nett zu ihr sein würde.
»Niemand ist unersetzlich, so sagt man doch«, erwiderte sie, obwohl das letztlich, wenn es darauf ankam, gar nicht stimmte.
»Sie waren so lange bei uns, ohne Sie bin ich doch völlig aufgeschmissen.« Als sie hier angefangen hatte, trugen die jungen Frauen noch kurze Haare; ihre waren jetzt grau. »Es muss mehr als zwanzig Jahre her sein. Mein Gott, wie die Zeit verfliegt.«
»So sagt man.« Auch das, dachte sie, stimmte nicht. Aber in all diesen dreiundzwanzig Jahren wäre ihr nicht einmal im Traum eingefallen, ihm zu widersprechen. Sie sah, wie mitgenommen er war, sah das unmerkliche Pochen an seiner Schläfe. Jeden Moment wird er sich an die Stelle fassen und sich gleich darauf durch die Haare streichen.
»Ich nehme an«, sagte er, nachdem er sich am Kopf gekratzt hatte, »dass ich Sie nicht dazu bewegen kann, Ihre Meinung zu ändern?«
Sie schüttelte den Kopf. »Es geht um meine Mutter, wissen Sie. Wie gesagt, sie kann nicht mehr den ganzen Tag allein bleiben.«
Es folgte eine kurze Stille; sie waren damit wieder am Anfang ihres Gesprächs angelangt. Sie schob ihm sein Zigarettenkästchen aus Lorbeerholz hin – wie immer hatte sie es am Morgen aufgefüllt, für ihn mit seiner einen Hand war es so viel einfacher, wenn er nicht umständlich das Päckchen öffnen musste – und wartete, bis er sich eine Zigarette genommen und mit dem silbernen Feuerzeug angezündet hatte, das Mrs. Hugh ihm im Jahr der Krönung geschenkt hatte. Das Jahr, in dem die Firma beauftragt worden war, das Ulmenholz für sämtliche Hocker in der Westminster Abbey zu liefern. Sie hatte das Exemplar gesehen, das Mr. Edward nachher gekauft hatte – wie schön es aussah mit dem blauen Samt und den goldenen Borten. Wie stolz sie gewesen war, dass ihr Holz für diesen historischen Augenblick ausgewählt worden war. Im Ruhestand würde sie von vielen solchen Erinnerungen zehren.
»Ich habe mir gedacht«, sagte sie, »ich könnte Ihnen helfen, jemand Neues zu finden.«
»Kennen Sie denn jemanden, der infrage käme?«
»O nein! Ich dachte nur, ich könnte Ihnen bei der Auswahl der Bewerberinnen behilflich sein.«
»Sie können das bestimmt viel besser als ich.« Sein Kopf begann zu pochen.
»Soll ich das Fenster öffnen?«
»Ja. An einem Tag wie diesem sollte man sich nicht hermetisch einschließen.«
Sobald sie den Riegel geöffnet und das schwere Fenster nach oben geschoben hatte, strömte warme Luft herein, und mit ihr kamen auch die abgehackten heiseren Rufe des alten Zeitungsverkäufers unten an der Straßenecke. »Sonderausgabe zur Wahl! Zwei Kabinettsminister abgewählt! Große Gewinne für Labour!«
»Schicken Sie Tommy hinunter, Miss Pearson, er soll eine Zeitung holen. Das klingt nicht gut, aber schlechte Nachrichten sollten wir am besten sofort erfahren.«
Sie ging selbst, da Tommy, der Bürojunge, wie so häufig unauffindbar war und sich ansonsten nur in Zeitlupe bewegte, womit er, wie Mr. Rupert einmal bemerkt hatte, einem Zweifingerfaultier alle Ehre gemacht hätte. Sie alle würden ihr fehlen, redete sie sich ein und versuchte das schreckliche Gefühl des drohenden Verlusts auf alle anderen auszuweiten. Dabei war das jetzt nur der Anfang. Es würde eine Abschiedsfeier im Büro geben, alle würden ihr viel Glück wünschen und auf ihre Gesundheit anstoßen, und vielleicht – nein, bestimmt – würden sie für ein Abschiedsgeschenk gesammelt haben. Dann würde sie auf den Bus warten, der sie zum letzten Mal zur U-Bahn-Station brachte, würde die zwanzig Minuten von New Cross zum Laburnum Grove gehen, bis sie vor der Hausnummer vierundachtzig stand, würde den Schlüssel ins Schloss stecken – und dann hinter sich absperren, und das war es dann. Ihre Mutter hatte sie nie gemocht, weil sie ein uneheliches Kind war – was konnte man von so einem Balg schon erwarten, wie Mutter immer sagte, wenn sie richtig verärgert mit ihr war. Natürlich würde sie gelegentlich das Haus verlassen, würde einkaufen gehen und sich neue Lektüre in der Bücherei ausleihen und sich vielleicht, hin und wieder, zu einem Kinobesuch davonstehlen können, obwohl sie sehr aufs Geld achten musste. Durch ihren vorzeitigen Ruhestand verzichtete sie auf einen gehörigen Teil der Rente, die die Firma allen Angestellten gewährte. Urlaub käme auch nicht in Betracht, solange es mit Mutters Inkontinenz nicht besser wurde – zumindest hoffte sie, es würde damit besser werden, wenn sie den ganzen Tag zu Hause war und darauf achten konnte.
In den vergangenen Wochen hatte sie hin und wieder der Gedanke gestreift, dass Mutter es absichtlich machte, aber es war nicht nett, so etwas zu denken.
Als sie Mr. Hugh die Zeitung brachte, sah sie, dass er wieder einen seiner Kopfschmerztage hatte. Er hatte das Rollo so weit heruntergezogen, damit die Sonne nicht auf den Schreibtisch fiel, das Licht glänzte nur noch auf dem großen silbernen Tintenfass, das er nie benutzte. Sie legte die Zeitung auf den Tisch.
»Großer Gott«, sagte er. »Macmillan und Bracken haben ihren Wahlkreis verloren. Ein Erdrutsch wird vorhergesagt. Der arme Churchill.«
»Eine Schande, nicht wahr? Nach allem, was er für uns getan hat.« Dann ging sie, aber bevor sie sich im kleinen, hinten gelegenen Zimmer niederließ, wo sie die Akten aufbewahrte und sämtliche Schreibarbeiten erledigte, erschien es ihr nur recht und billig, ihm zu sagen, dass sie natürlich bleiben würde. Jedenfalls bis September und darüber hinaus, falls es sich als schwierig erweisen sollte, eine geeignete Nachfolgerin zu finden.
»Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, Miss Pearson. Ich muss Ihnen nicht sagen, wie sehr ich es bedaure, dass Sie überhaupt gehen.«
Sein Lächeln konnte nicht über seine Schmerzen hinwegtäuschen.
Auf der Damentoilette, wohin sie sich zurückzog, um kurz und still zu weinen, ging ihr der Gedanke durch den Kopf, wie anders doch alles wäre, wenn sie nicht kündigen würde, weil sie sich nicht um ihre Mutter kümmern müsste, sondern um jemanden wie Mr. Hugh. Es war eine lächerliche Vorstellung; sie wusste noch nicht einmal, woher sie so etwas überhaupt hatte.
Nachdem sie hinter sich die Tür geschlossen hatte, wie sie es immer tat, wenn er unter seinen Kopfschmerzen litt (sie konnte ihm auf viele Arten zu verstehen geben, dass sie von seinen Kopfschmerzen wusste, was ihn immer sehr verärgert hatte, bis sich mit jahrelanger Vertrautheit ein gewisser Gleichmut einstellte), schob Hugh die Zeitung beiseite, lehnte sich auf seinem Schreibtischstuhl zurück, schloss die Augen und wartete, dass die Tablette wirkte. Eine Labour-Regierung – danach sah es jetzt tatsächlich aus – war eine beunruhigende Aussicht. Da zeigte sich nur wieder einmal, dass, wenn es wirklich darauf ankam, Ideen wichtiger waren als einzelne Personen. Moralisch gesehen war das zwar durchaus begrüßenswert, konnte aber zu geschmacklosen Überraschungen führen. Churchill war zu Recht eine nationale Größe. Jeder kannte ihn – jeder wusste um seine Exaltiertheit, seine Redekunst, seine Bronchitis, seine Zigarren –, während man über Attlee nur sehr wenig bis gar nichts wusste. Die Stimmen der Militärangehörigen mussten den Ausschlag gegeben haben. Diese Betrachtungen wurden durch Cartwright unterbrochen, der vom Zustand der firmeneigenen Lastwagen berichtete, der zu Besorgnis Anlass gab. Die meisten befanden sich mittlerweile in einem Zustand, der ihren Weiterbetrieb wirtschaftlich nicht mehr rechtfertigte. Allerdings würde es noch einige Zeit dauern, bis neue Lastwagen in angemessener Stückzahl verfügbar sein würden. »Sie werden das Beste draus machen müssen, Cartwright.« Und Cartwright mit seinem ausgezehrten Lächeln – das eine erschreckend große Zahl gelber Zähne offenbarte – schloss mit seiner üblichen Beschwerde wegen der Fahrzeuglackierung. Cazalet-Laster waren blau und mit goldener Schrift versehen. In dieser Hinsicht waren sie einzigartig, aber das Blau verblich so schnell, dass ständig nachgebessert werden musste. Cartwright wollte nur ungern Geld aus seinem Budget dafür aufwenden, noch dazu für einen so veralteten Fuhrpark, aber der Brig hatte vor Jahren verfügt, dass die Lastwagen blau zu sein hatten, damit sie sich von anderen Lkw auf der Straße unterschieden. Weder Hugh noch Edward fühlten sich berufen, mit dieser Tradition zu brechen, und das umso mehr, seitdem ihr Vater nicht mehr in der Lage war, die Ausführung seines Dekrets zu überwachen. »Wir können das im Moment nicht ändern, Cartwright, aber warten Sie mit dem Lackieren, bis ich bei Rootes nachgefragt habe, ob sie nicht was für uns produzieren könnten.«
»Seddon-Laster wären besser als Commer, Sir, wenn wir es uns aussuchen könnten, angesichts der jetzigen Benzinpreise.«
»Ja … richtig. Gutes Argument.«
Cartwright sagte, gut, dann gehe er jetzt, machte aber keine Anstalten dazu. Wie sich herausstellte, hatte er einen Neffen, der in naher Zukunft aus dem Kriegsdienst entlassen würde – der Sohn vom Bruder seiner Frau, erklärte er. Die Familie lebe in Gosport, und er habe sich gedacht, ob es für ihn nicht eine Stelle im neuen Lager in Southampton geben könne. Hugh sagte, er werde mit seinem Bruder sprechen, und Cartwright sagte, vielen Dank, Sir, er sei ihm sehr verbunden. Erst dann ging er.
Wieder spürte Hugh den Anflug von Verdruss und Beklemmung, der sich einstellte, sobald Southampton erwähnt wurde, jetzt aber gesellten sich wegen Miss Pearsons Weggang dazu ähnliche Empfindungen, nur unmittelbarer und stärker. Nach dieser langen Zeit war er wenig geneigt, eine neue Sekretärin einzuarbeiten. »Du magst überhaupt keine Veränderungen, mein Liebling«, hatte Sybil einmal gesagt, nachdem er sich beschwert hatte, weil sie ihre Haare neu gescheitelt trug. Mein Gott, es wäre ihm egal, was sie mit ihrer Frisur anstellte, wenn sie nur noch am Leben wäre. Drei Jahre waren mittlerweile seit ihrem Tod vergangen – drei Jahre und vier Monate –, und ihm kam es so vor, als hätte er in dieser Zeit nichts anderes getan, als sich daran gewöhnt, dass sie ihm fehlte. Andere bezeichneten das als »darüber hinwegkommen«.
An diesem Punkt redete er sich gewöhnlich ein, dass sie jetzt zumindest keine Schmerzen mehr hatte – mehr davon hätte er ihr nicht zumuten wollen, und mehr hätte er selbst auch nicht ertragen. Es war besser, dass sie gestorben war und ihn zurückgelassen hatte, statt weiterhin so zu leiden.
Er las und unterschrieb die Briefe, die Miss Pearson ihm noch vorgelegt hatte, bevor sie ihm ihre Kündigung unterbreitet hatte. Sie würde die Briefe in Umschläge stecken, solange er beim Lunch war. Er klingelte bei ihr durch und sagte, sie möge ihm ein Taxi bestellen, und es könne bei ihm etwas später werden.
Er war mit Rachel verabredet – wenigstens stand kein Geschäftsessen mit Alkohol an, das er immer besonders anstrengend fand, wenn er unter seinen Kopfschmerzen litt. In letzter Zeit tröstete er sich unentwegt mit derartigen unbedeutenden Dingen.
Er traf sich mit ihr in einem kleinen italienischen Restaurant in der Greek Street – er hatte es ausgewählt, weil es ruhig und das Essen für Rachel höchstwahrscheinlich annehmbar war. Wie die Duchy, die unter keinen Umständen außer Haus speiste, hegte Rachel ein tief sitzendes Misstrauen gegen »gekauftes Essen« – entweder war es zu schwer oder zu aufwendig zubereitet oder in irgendeiner anderen Form bedrohlich. Bei dieser Gelegenheit hatte allerdings sie den Lunch vorgeschlagen – sie würde sowieso in London sein, weil sie abends mit Sid in ein Konzert ging. »Ich muss mit dir über Home Place und die Chester Terrace sprechen«, hatte sie gesagt. »Alle reden auf mich ein und erzählen mir, was sie wollen, nur wollen sie nicht dasselbe. Es ist aussichtslos, an einem Wochenende darüber zu reden – da werden wir unweigerlich gestört.«
Als er im Restaurant eintraf, wurde er allerdings von Edda, der älteren Inhaberin, begrüßt, die ihm mitteilte, dass die Damen oben seien. Und als er sich dem Tisch näherte, saß dort Rachel – mit Sid.
»Mein Lieber, es stört dich hoffentlich nicht. Sid und ich hatten vereinbart, den Tag miteinander zu verbringen, dabei hatte ich unseren Lunch ganz vergessen.«
»Natürlich nicht. Schön, dich zu sehen«, sagte er herzlich. Insgeheim hielt er Sid für ein wenig sonderbar. In ihrem unförmigen Tweedanzug, den sie anscheinend das ganze Jahr zu Bluse und Krawatte trug, mit ihren unmodisch kurzen Haaren und ihrem nussfarbenen Teint glich sie eher einem älteren Jungen, aber sie war die beste, wenn nicht gar die älteste und einzige Freundin der lieben Rachel und verdiente damit seine Gewogenheit. »Für mich gehörst du ja so gut wie zur Familie«, sagte er und wurde dafür mit einem leichten Erröten belohnt, das kurz auf der besorgten Miene seiner Schwester aufschimmerte. »Ich hab’s dir doch gesagt«, meinte sie dann an Sid gewandt und fügte ihm gegenüber hinzu: »Ich musste sie überreden, mitzukommen.«
»Ich weiß doch, dass ihr Familienangelegenheiten zu besprechen habt, da wollte ich nicht stören. Ich werde auch mucksmäuschenstill sein, versprochen, ich werde kein Wort sagen.«
Wie sich erwies, stimmte das ganz und gar nicht. Allerdings dauerte es, bis sie zur Sache kamen, erst musste das Essen bestellt werden. Nach eingehendem Studium der Speisekarte fragte Rachel schließlich, ob sie einfach nur ein schlichtes Omelette haben könne – nur ein kleines? Er und Sid hatten sich bereits auf eine Minestrone und geschmorte Leber verständigt und tranken Martini, den Rachel abgelehnt hatte.
Sie rauchten, während sie auf das Essen warteten. Er hatte für Rachel eine Packung Passing Clouds gekauft, die mochte sie am liebsten, nachdem ihre ägyptischen Zigaretten nur noch schwer zu bekommen waren.
»Oh, mein Lieber, danke. Aber Sid hat irgendwo meine alte Marke aufgetrieben – ich weiß nicht, wie sie das immer schafft.«
»Es gibt nur einen Laden, der sie manchmal hat«, sagte Sid leichthin wie jemand, für den die bescheidene Bedeutung solch kleiner Triumphe durch deren Häufigkeit mehr als ausgeglichen wurde.
»Gut, behalte sie trotzdem – zur Reserve«, sagte er.
»Du verwöhnst mich.« Rachel steckte sie in ihre Tasche.
Als die Minestrone serviert wurde, forderte er sie auf, von den Problemen der Eltern zu erzählen. Der Brig wollte wieder in die Chester Terrace ziehen, damit er dem Büro näher sei, »auch wenn der alte Herr dort kaum noch etwas tun kann«, aber die Duchy, die das Haus noch nie hatte leiden können – sie fand es öde und finster, außerdem sei es für sie beide sowieso zu groß –, wollte in Home Place bleiben. »Sie mag London eigentlich nicht, die Arme, sie will ihren Steingarten und ihre Rosen. Außerdem schade es den Enkelkindern, wenn sie nicht ihre Ferien dort verbringen könnten. Aber er sitzt in Home Place wie auf Kohlen, er kann ja nicht mehr ausreiten oder jagen oder sich mit irgendwelchen Umbauten beschäftigen … Und ständig sagen sie mir, was sie wollen, reden aber nicht miteinander darüber. Du verstehst also …«
»Könnten sie es nicht einfach so halten wie vor dem Krieg? Beide Häuser bewohnen, dann könnte die Duchy sich nach Belieben auf dem Land aufhalten.«
»Nein, ich glaube nicht, dass das geht. Für Eileen wären die Treppen in London zu viel, und der Brig hat das Cottage über der Garage Mrs. Cripps und Tonbridge versprochen, als sie geheiratet haben – es wäre ungerecht, wenn sie wieder ausziehen müssten. In der Chester Terrace bräuchte man mindestens drei Bedienstete, und soweit ich weiß, ist es nahezu unmöglich, zuverlässiges Personal zu bekommen. Laut den Agenturen gehen junge Frauen nicht mehr in Stellung.« Sie hielt kurz inne. »O Gott, ich verderbe dir doch hoffentlich nicht die Suppe – sie sieht so köstlich aus.«
»Möchtest du mal kosten?« Sid hielt ihr den Löffel hin.
»O nein, danke, meine Liebe. Wenn ich jetzt Suppe esse, bringe ich nichts anderes mehr hinunter.«
»Was würdest du denn wollen?«
»Gute Frage«, kam es von Sid wie aus der Pistole geschossen.
Rachel wirkte verlegen. »Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Alles, womit sie glücklich wären, glaube ich.«
»Das hat er nicht gefragt. Er hat gefragt, was du willst.«
»Wärst du nicht gern in London?«
»Na ja, in gewisser Hinsicht wäre das ganz schön.«
Während die Suppenteller abgeräumt und der Hauptgang aufgetragen wurde, erklärte Rachel, dass es für sie einfacher wäre, einen dritten Tag im Büro zu arbeiten, wenn sie in London wohnte. In den zwei Tagen, die sie im Moment beschäftigt war, kam sie mit ihrer Arbeit kaum hinterher. Bis sie sich nämlich die Probleme aller Mitarbeiter angehört hatte – und damit war sie auch schon mitten in der neuesten Unglücksgeschichte: Wilsons Frau musste ins Krankenhaus, es gab aber keine Großeltern, die sich um die Kinder kümmern konnten, außerdem waren sie ausgebombt und wohnten in zwei feuchten Kellerräumen, und die Schwester, die vielleicht die Kinder hätte nehmen können, ließ sich gerade scheiden, denn ihr Mann, der bald aus der Marine entlassen würde, wollte eine junge Frau heiraten, die er auf Malta kennengelernt hatte … wie auch immer, sie war jedenfalls nicht in der Lage, auf die Kinder aufzupassen …
Ihr Omelette auf dem Teller wurde kalt.
»O Gott«, sagte sie und nahm einen winzigen Bissen. »Ich langweile euch beide mit meinen albernen Büroproblemen …«
Nur dass es eben nicht ihre Probleme waren, dachte er, sondern die anderer Menschen. Kurz überlegte er, was seine Mitarbeiter getan hatten, bevor sie in die Firma gekommen war. Offiziell kümmerte sie sich um die Gehälter, um die Versicherungen und die Urlaubsplanung, dazu war sie für die Portokassenkonten und die Büromaterialien zuständig. Tatsächlich aber war sie diejenige, an die sich alle mit ihren Problemen wandten – beruflichen wie privaten. Daher wusste sie jetzt wesentlich besser über sämtliche Mitarbeiter der Firma Bescheid, als das bei ihm und seinen Brüdern jemals der Fall gewesen war.
»Aber das alles hat doch nichts mit dem zu tun, was du gern hättest«, sagte Sid. Sie klang gereizt, dachte Hugh, fast anklagend.
»Na ja, natürlich wäre das auch in anderer Hinsicht schön, aber so eine Entscheidung kann man doch nicht aus rein selbstsüchtigen Gründen treffen.«
»Warum denn nicht?« Es folgte ein kurzes, angespanntes Schweigen, dann wiederholte Sid: »Warum in aller Welt nicht? Warum sind die Gefühle von allen anderen wichtiger als deine eigenen?«
Fast klang es, als würde sie von ihren eigenen Gefühlen sprechen, dachte er – langsam überforderte ihn das Gespräch, und unwohl war ihm ohnehin. Die arme Rach. Immer wollte sie es allen recht machen; es war nicht fair, sie deshalb so hart anzugehen. Sie war ganz blass geworden und tat jetzt nicht einmal mehr so, als würde sie ihr Omelette essen.
»Gut«, sagte er, »ich habe den Eindruck, dass die Chester Terrace aufgegeben werden sollte. Das Haus ist viel zu groß, und es wäre besser, den Pachtvertrag zu verkaufen, solange die Laufzeit noch einigermaßen lang ist, dann müssen sie auch nicht mehr für die Renovierungskosten aufkommen. Wie wäre es also, Home Place zu behalten und für dich und den Brig eine Wohnung anzuschaffen, wenn er in London sein möchte? Dann kann die Duchy auf dem Land bleiben. Du bräuchtest für den Unterhalt der Wohnung bloß eine Bedienstete und eine Putzhilfe.«
»Eine Wohnung. Ich weiß nicht, ob die beiden sich damit anfreunden können. Dem Brig wird sie zu beengt sein, und die Duchy wird sie für anrüchig halten. Ihrer Meinung nach sind Wohnungen nur was für Junggesellen, bis sie verheiratet sind.«
»Unsinn«, sagte Sid. »Die Leute werden sich an Wohnungen gewöhnen müssen, genauso, wie sie auch das Kochen lernen müssen.«
»Aber nicht mehr in Duchys Alter. Du kannst von einer Achtundsiebzigjährigen nicht verlangen, dass sie noch kochen lernt.« Wieder ein betretenes Schweigen, dann sagte sie: »Nein. Wenn jemand kochen lernen sollte, dann ich.«
Reumütig legte Sid Rachel eine Hand auf den Arm. »Touché. Aber wir reden hier von deinem Leben, oder nicht?«
Allmählich ärgerte sich Hugh über ihre Versuche, ihn mit einzubeziehen. Trotz ihres Vorsatzes, kein Wort zu sagen, mischte sie sich jetzt in Dinge ein, die sie nichts angingen. Er winkte dem Kellner nach der Speisekarte und sagte, an Rachel gewandt: »Mach dir keine Sorgen, meine Liebe. Ich rede mit dem Brig über eine Alternative zur Chester Terrace, und wir beide können nach etwas Geeignetem Ausschau halten. Und wenn es ganz schlimm kommt, kannst du in der Zwischenzeit immer noch zu mir ziehen. So, wer möchte jetzt noch Eis oder Obstsalat oder ein wenig von beidem?«
Nachdem Rachel, die sofort verkündete, sie bekomme keinen Bissen mehr herunter, zu einem Obstsalat überredet war und er und Sid sich für beides entschieden und er für alle Kaffee bestellt hatte, hob er sein Glas. »Worauf sollen wir anstoßen? Auf den Frieden?«
»Wir sollten auf den armen Mr. Churchill anstoßen«, sagte Rachel, »jetzt, da wir ihn anscheinend so im Stich lassen. Kaum ist der Krieg vorbei, haben sie ihn so bitter enttäuscht – das muss man sich mal vorstellen.«
»Der Krieg ist noch nicht ganz vorbei. In Japan wird er meiner Ansicht nach noch gut zwei Jahre dauern. Aber wenigstens sind die anderen ans Regieren gewöhnt – jedenfalls auf Kabinettsebene.«
»Ich jedenfalls bin eher für die anderen«, sagte Sid. »Es ist Zeit, dass sich etwas ändert.«
»Die meisten wollen doch so schnell wie möglich zurück in ihr normales Leben«, sagte Hugh.
»Ich glaube nicht, dass wir zu irgendetwas zurück sollten«, sagte Rachel. »Ich glaube, dass alles anders wird.«
»Du meinst den Wohlfahrtsstaat und die schöne neue Welt?«
Ein hektisches Stirnrunzeln legte sich über ihr Gesicht, und plötzlich fiel ihm ein, dass er und Edward sie immer als Äffchen bezeichnet hatten, wenn sie sie hänseln wollten.
»Nein, ich meine, der Krieg hat die Menschen verändert, sie gehen jetzt freundlicher miteinander um.« Sie wandte sich an Sid. »Du denkst das doch auch, oder? Ich meine, die Menschen haben viel miteinander geteilt – vor allem die schrecklichen Erfahrungen, das Leid, sie wurden ausgebombt, Familien wurden getrennt, die Rationierungen, die Gefallenen …«
»Ich glaube, diese arrogante Gleichgültigkeit hat nachgelassen«, sagte Sid, »aber wenn Labour nicht an die Macht kommt, wird sie schnell wieder um sich greifen.«
»Ich verstehe von Politik wirklich nicht viel, wie ihr wisst, aber beide Seiten sagen doch dasselbe, oder? Alle wollen bessere Wohnungen, eine bessere Ausbildung, gleichen Lohn für gleiche Arbeit …«
»Das sagen sie doch immer.«
»Wir sagennicht dasselbe. Wir werden nicht die Eisenbahn und den Kohlebergbau verstaatlichen.« Finster sah er zu Sid. »Das wird nur im Chaos enden. Und für uns würde es heißen, dass wir nur noch mit einem Kunden zu tun haben und nicht mit mehreren, was besser ist fürs Geschäft.«
Der Kellner brachte den Kaffee, was Hugh nur recht war. Er wollte sich nicht mit Sid über Politik streiten – er fürchtete, er würde unhöflich werden, und das würde nur wieder Rachel aufregen.
Jetzt sagte sie: »Was willst du also tun? Mit dem Haus, meine ich. Willst du weiter dort wohnen? Edward und Villy verkaufen ihres und suchen sich etwas Kleineres, was mir sehr vernünftig erscheint.«
Damit er sich ein zweites Haus leisten kann, um dort diese Frau unterzubringen, dachte er. »Ich weiß es nicht«, sagte er. »Ich mag es gern. Sybil hat immer gesagt, sie würde dort nie ausziehen wollen.«
Kurz sagte niemand etwas. Dann entschuldigte sich Sid.
»Miss Pearson verlässt mich«, sagte er, damit sie beide auf andere Gedanken kamen.
»O Gott. Das habe ich befürchtet. Ihre Mutter ist mittlerweile sehr gebrechlich. Letzte Woche, als sie nach Hause kam, hat sie die alte Frau auf dem Boden vorgefunden. Sie wollte vom Stuhl aufstehen, ist hingefallen und nicht mehr hochgekommen.«
»Sie wird mir fehlen.«
»Bestimmt. Aber für sie ist es besonders schlimm, weil sie nicht ihre volle Rente bekommt. Darüber wollte ich mit dir reden. Sie wird ziemlich knapp bei Kasse sein.«
»Sie muss doch etwas gespart haben, immerhin arbeitet sie seit mindestens zwanzig Jahren bei uns.«
»Dreiundzwanzig, um genau zu sein. Aber ihre Mutter hat nur eine sehr kleine Witwenrente, die mit ihrem Tod erlischt. Bis auf das Haus wird Muriel nichts erben, und wenn ihre Mutter stirbt, wird sie wahrscheinlich zu alt sein, um wieder zu arbeiten. Angesichts dessen sollten wir vielleicht dafür sorgen, dass sie ihre volle Rente bekommt, meinst du nicht auch?«
»Der alte Herr würde sagen, wir schaffen damit einen gefährlichen Präzedenzfall. Wennsie die volle Rente bekommt, könnte jeder denken, dass ihm das ebenfalls zusteht.«
»Das ist doch absurd«, erwiderte sie, recht scharf für ihre Verhältnisse. »Er muss davon doch gar nichts erfahren, und die anderen Mitarbeiter auch nicht.«
Er sah sie an. In ihrer Miene lag eine für sie völlig untypische Heftigkeit, weshalb er am liebsten aufgelacht hätte. »Du hast absolut recht, natürlich. Du hast mein steinernes Tory-Herz erweicht.«
Darauf lächelte sie und zog die Nase kraus, wie sie es immer tat, wenn sie ihr Lächeln noch liebenswürdiger machen wollte. »Dein Herz ist überhaupt nicht aus Stein, mein lieber alter Junge.«
Dann kam Sid zurück. Er verlangte nach der Rechnung, und Rachel sagte, sie werde kurz die Toilette aufsuchen.
Als sie fort war, sagte Sid: »Danke für das Essen, es war sehr nett, dass ich dabei sein durfte.«
Er sah vom Scheck auf, den er gerade ausfüllte. Sie spielte mit dem Zucker, sodass ihm unweigerlich ihre kräftigen, eleganten, aber irgendwie unweiblichen Hände auffielen.
»Also«, fuhr sie fort, »ich weiß, ich hätte nichts sagen sollen, aus deiner Sicht sind das reine Familienangelegenheiten, aber nie kümmert sie sich um sich selbst. Immer sorgt sie sich um andere, nie denkt sie an sich. Und ich meine, jetzt, da der Krieg vorbei ist – jedenfalls hier –, könnte sie doch zumindest einmal daran denken, ein eigenes Leben zu führen.«
»Vielleicht will sie das gar nicht.«
Aus irgendeinem Grund schien er mit dieser harmlosen Bemerkung einen wunden Punkt getroffen zu haben, obwohl er beim besten Willen nicht verstehen konnte, welcher das sein sollte. Kurz war sie völlig bestürzt, dann sagte sie so leise, dass er sie kaum verstand: »Ich hoffe wirklich, dass du nicht recht hast.«
Rachel kam zurück. Auf der Straße verabschiedeten sie sich, er kehrte zurück ins Büro, sie wollten weiter in die Oxford Street, um bei HMV Schallplatten zu kaufen und Bücher bei Bumpus – »wie praktisch, die beiden Läden liegen fast nebeneinander«. Alle hatten scheinbar das unbestimmte Bedürfnis, sich bei den anderen zu entschuldigen.
Später, am frühen Abend, nachdem er im Büro Schluss gemacht, mit dem 27er-Bus nach Notting Hill Gate gefahren und über die Lansdowne Road in die Ladbroke Grove gegangen war und das stille Haus betreten hatte, erinnerte er sich wieder an Rachels Bemerkung über sein Herz, das nicht aus Stein sei. Für ihn war es weniger eine Frage nach der Beschaffenheit, sondern ob er überhaupt noch ein Herz hatte. Sein Bemühen, Trauer in Bedauern zu verwandeln, ganz und gar vom Vergangenen zu leben, weiterhin an seiner peinigenden Nostalgie festzuhalten (er musste feststellen, dass er zunehmend an den Details seiner kleineren Erinnerungen zweifelte), vor allem aber, dass es absolut nichts gab, was an ihre Stelle treten könnte, hatten ihn ausgelaugt. Gefühle waren zur reinen Anstrengung geworden, aber sie bereicherten die Gegenwart nicht mehr; er schleppte sich von einem Tag zum nächsten und erwartete nicht mehr, dass sich der eine vom anderen unterschied. Er war reizbar, natürlich, wegen Lappalien, wenn der Wagen nicht anspringen wollte oder wenn Mrs. Downs seine Wäsche nicht abholte, und er war besorgt – oder war es einfach nur Wut? – wegen Edwards Verhalten gegenüber Diana Mackintosh (er hatte sich rundweg geweigert, sie kennenzulernen). Seitdem er Edward nicht hatte überzeugen können, sich von ihr zu trennen, weigerte er sich, überhaupt darüber zu sprechen. Was zur Folge hatte, dass es grundsätzlich sehr schwer geworden war, mit Edward über irgendetwas zu sprechen – zumindest so zwanglos, wie sie sich früher unterhalten hatten. Daher waren sie mittlerweile stets uneins und gereizt, wenn es um Themen wie das Projekt in Southampton ging, das er für durchweg unklug hielt – eine verrückte Idee, die ihr Kapital auffraß – und das er Edward ohne dieses tiefe Zerwürfnis hätte ausreden können. So oder so, ihm fehlten ihre alte Vertrautheit und Zuneigung, wozu sich die Tatsache gesellte, dass er sich nicht mehr mit Sybil darüber austauschen konnte, um zu einer Lösung zu finden. Deren Umsicht und praktischen Menschenverstand hatte er mehr und mehr wertzuschätzen gelernt, seitdem er nicht mehr auf sie zugreifen konnte. Er versuchte sich vorzustellen, was sie ihm geraten hätte, aber es führte zu nichts – sie fehlte ihm, weil er eben nicht ihren Part im Dialog übernehmen konnte. Er sagte, was er zu sagen hatte – und dann Schweigen, in dem er sich vergeblich zu überlegen abmühte, was sie darauf hätte erwidern können. Mit Rupert hatte es diese Vertrautheit nie gegeben – die sechs Jahre Altersunterschied waren in dieser Hinsicht entscheidend. Als er und Edward 1914 nach Frankreich aufgebrochen waren, hatte Rupert noch die Schule besucht. Als er und Edward gemeinsam in die Firma einstiegen, hatte Rupert an der Slade studiert und war entschlossen gewesen, Maler zu werden und nichts mit dem Familienunternehmen zu schaffen zu haben. Als er schließlich doch in die Firma eintrat, geschah das nach langem Zögern und Zaudern und, wie Hugh mittlerweile meinte, vorwiegend deshalb, weil er um Zoës willen mehr Geld verdienen wollte. Seitdem, nach seinem erstaunlichen Wiederauftauchen – nachdem bereits alle (wiewohl unausgesprochen) jede Hoffnung aufgegeben hatten –, schien er sich, nach einer großen Familienfeier, seltsamerweise zurückgezogen zu haben. Hugh hatte einen schönen Abend mit ihm verbracht – am Abend seiner Entlassung aus der Marine war er mit ihm essen gewesen, davor hatten sie zu Hause noch eine Flasche Champagner getrunken. Rupert hatte sich nach Sybil erkundigt, und er hatte ihm von den letzten Tagen erzählt, an denen er und Sybil lange miteinander geredet und festgestellt hatten, dass ihnen beiden längst klar gewesen war, dass sie sterben würde, aber beide versucht hatten, den jeweils anderen zu schützen, und die wundervolle Erleichterung dann, als sie sich dazu nicht mehr gezwungen sahen. Er erinnerte sich, wie Rupert ihn stumm angestarrt hatte, seine Augen hatten sich mit Tränen gefüllt, und zum ersten Mal seit ihrem Tod hatte er sich getröstet gefühlt, hatte gespürt, wie der harte, starre Schmerz sich in diesem schweigsamen, unendlichen Mitgefühl aufzulösen begann. Danach waren sie zum Essen gegangen, und ihm war beinahe leicht ums Herz gewesen. Aber so sollte es später nie wieder sein; er spürte, dass ein Geheimnis hinter Ruperts langer Abwesenheit und seiner Verschwiegenheit lag, nach einem zögerlichen Versuch drang er allerdings nicht weiter in ihn. Wenn jemand so lange so isoliert gelebt hatte, dann, stellte er sich vor, musste es einem schwerfallen, in ein geregeltes Familienleben zurückzukehren, also beließ er es dabei.
Es gab die Kinder, aber seine Liebe für sie wurde von Angst und Gefühlen der Unzulänglichkeit getrübt. Ohne Sybil fühlte er sich mutlos. Zum Beispiel bei Polly – er war sich ziemlich sicher, dass sie sich verliebt hatte, irgendwann an Weihnachten war es ihm aufgefallen, aber sie hatte ihm nichts davon erzählt, hatte seine (vermutlich unbeholfenen) Versuche abgewiegelt, ihn ins Vertrauen zu ziehen. Es schien nichts daraus geworden zu sein; seit Monaten war sie lustlos, höflich, ja, aber ohne ihre übliche Lebhaftigkeit. Er machte sich Sorgen um sie, fühlte sich ausgeschlossen, fürchtete, sie zu langweilen (was das Schlimmste war, denn wenn es wirklich so sein oder so kommen sollte, würde sie ihn nur noch aus Mitleid besuchen). Als er erfuhr, dass Louise und Michael das Haus in St. John’s Wood aufgeben wollten, hatte er sehr beiläufig angemerkt, dass sie und Clary jederzeit ihre alten Zimmer oben im Haus beziehen könnten, aber Polly hatte nur erwidert, »das ist ganz lieb von dir, Dad«, und daraufhin das Thema gewechselt. Er ging also davon aus, dass sie nicht auf sein Angebot eingehen würde. Und das ließ den weiteren Verbleib in diesem Haus absurd erscheinen. Er nutzte nur sein Schlafzimmer, die Küche und den kleinen hinteren Salon, alles andere war geschlossen und staubte vermutlich fürchterlich ein, da Mrs. Downs an den beiden Vormittagen in der Woche unmöglich das ganze Haus putzen konnte. Das Haus brauchte Dienstpersonal, eine Familie – vor allem eine Hausherrin … Der Gedanke an einen Umzug entsetzte ihn. Einen Umzug hatte er sich bislang nur mit Sybil vorstellen können. Mit ihr war das jedes Mal ein Abenteuer gewesen. Zu Beginn ihrer Ehe hatten sie in einer Wohnung in Clanricarde Gardens gelebt – mehr hatten sie sich nicht leisten können. Schön war es nicht gewesen, das unzureichend umgebaute Stockwerk eines großen Stuckgebäudes, dessen Besitzer auf die Einnahmen angewiesen war. Die Zimmer hatten ungewöhnlich hohe Decken mit farbverkrusteten Friesen, riesige, zugige Schiebefenster und eine Gasuhr, die ebenso gierig mit Shilling gefüttert werden wollte, wie die breiten Spalten zwischen den Bodendielen Sybils Haarnadeln und seine Kleiderknöpfe verschluckten. Poll war dort zur Welt gekommen, bald darauf waren sie aber in das Haus in Bedford Gardens umgezogen. Das war eine wunderbare Veränderung gewesen. Endlich ein eigenes kleines Haus mit kleinen Gärten vorn und hinten und einer Glyzinie, die bis zum schmiedeeisernen Balkon vor ihrem Schlafzimmer emporrankte. Er erinnerte sich an ihre erste Nacht dort. Sie hatten zum ersten Mal eine Schweinefleischpastete von Bellamy’s gegessen und die Flasche Champagner getrunken, die Edward mitgebracht hatte, als er Poll abholte, die bei ihnen bleiben sollte, bis ihr Zimmer hergerichtet war. Hugh hatte sich eine Woche freigenommen, und er und Sybil hatten zusammen das Haus gestrichen, hatten ihre Picknickmahlzeiten genossen und auf einer Matratze im Wohnzimmer geschlafen, während er das Parkett im neuen Schlafzimmer verlegt hatte. Es war eine der glücklichsten Wochen seines Lebens. Simon wurde in diesem Haus geboren, in das jetzige Haus waren sie erst gezogen, als Sybil zum dritten Mal schwanger wurde.
Mittlerweile hatte er sich gewaschen, war in andere Schuhe geschlüpft, hatte sich einen Whisky-Soda eingeschenkt und sich hingesetzt, um die Achtzehn-Uhr-Nachrichten zu hören. Es war noch schlimmer, als er gedacht hatte. Churchill, gegen den in seinem Wahlkreis weder ein Labour- noch ein Kandidat der Liberalen angetreten war, hatte über ein Viertel der Stimmen an einen Unabhängigen verloren – einen Mann, von dem er noch nie gehört hatte. Er schaltete das Radio aus. Stille breitete sich im Zimmer aus. Mehrere Minuten saß er nur da und überlegte, womit er sich ablenken könnte. Er könnte in seinen Club gehen, dort würde er wahrscheinlich jemanden finden, mit dem er essen und vielleicht eine Partie Billard spielen konnte, trotzdem würden alle von nichts anderem als der Wahl reden – keine sehr erfreuliche Aussicht, wenn er nur an die allgemeine Depression dachte, die alle erfasst hatte. Er könnte Poll anrufen – könnte, aber er wusste, er würde es nicht tun. Er hatte sich auferlegt, nur einmal in der Woche mit ihr zu telefonieren, er wollte ihr nicht das Gefühl geben, dass er sich in ihr Leben einmischte, oder ihr gar zur Last fallen. Simon war irgendwo mit seinem Freund Salter unterwegs – auf einer Fahrradtour in Cornwall. Mittlerweile wusste er, warum sich Simon im letzten Schuljahr so angestrengt hatte, um es noch nach Oxford zu schaffen, dorthin würde nämlich auch Salter gehen. Nun, warum nicht? Sybil wäre begeistert gewesen, zum einen natürlich, weil er dadurch später eingezogen würde, was jetzt möglicherweise sogar bedeutete, dass er überhaupt nicht mehr in den Krieg musste. Doch davon abgesehen hätte sie es begrüßt, wenn Simon die Universität besuchen würde. Sie hatte Bildung schon immer einen sehr viel höheren Stellenwert beigemessen als der Rest der Familie. Für den Brig war es bloße Zeitverschwendung, und Edward stand jeder schulischen Ausbildung abschätzig gegenüber, aber er hatte seine Internatszeit auch gehasst und war heilfroh gewesen, sie durch den Krieg verkürzen zu können. Kam die Rede auf Universitäten, erwähnte Edward immer die Vorkriegsdebatte in der Oxford Union, bei der es eine fürchterliche Abstimmung zugunsten des Pazifismus gegeben hatte, was, wie Edward wiederholt betonte, zeigte, wie degeneriert die Jugend geworden sei, und was nur die Schlussfolgerung zulasse, dass Einrichtungen wie Oxford der Jugend dekadente Ideen in den Kopf setzten. Der nachfolgende Krieg hatte das natürlich rundweg widerlegt, jedoch kaum die Ansicht der männlichen Cazalets beeinflusst, dass eine Ausbildung so bald wie möglich zu beenden sei, damit das richtige Leben beginnen könne. Dass Simon Medizin studieren wollte, hatte das Projekt etwas respektabler erscheinen lassen. Die Duchy, Villy und Rachel waren sehr dafür. Stillschweigend ablehnend standen dem eigentlich nur der Brig und Edward gegenüber, und das auch nur, weil sie wollten, dass alle männlichen Cazalets im Familienunternehmen arbeiteten. Simon jedenfalls konnte ihm keine Gesellschaft leisten. Morgen würde er nach Sussex fahren, er dachte daran, was er mit Wills unternehmen würde, der seiner Meinung nach zu sehr unter dem Einfluss der Frauen stand. Heute Abend wollte er nicht mehr ausgehen. Er machte sich einen weiteren Drink und ging ins Souterrain, wo er nach einiger Suche eine Dose Frühstücksfleisch fand, dazu die recht altbackenen Überreste eines Brotlaibs, von dem er sich die ganze Woche schon seinen Morgentoast abgeschnitten hatte, sowie zwei Tomaten, die er vergangenes Wochenende von Home Place mitgebracht hatte. Das alles gab er zusammen mit einem Dosenöffner auf ein Tablett und kehrte in den Salon zurück. Ein ruhiger Abend zu Hause, sagte er sich, konnte nicht schaden.
⁓
Sie waren spät dran, dachte Edward, obwohl das eigentlich zu erwarten gewesen war. Bei jedem Besuch in Southampton tauchten unversehens Probleme auf, der heutige Tag bildete da keine Ausnahme. Er war für das Vorstellungsgespräch von zwei Männern angereist, die sich für den Posten des stellvertretenden Lagerleiters bewarben, und er hatte Rupert mitgenommen, weil sein Bruder die Lagerhalle noch nicht kannte und es so aussah, als wäre er der Einzige, der die Leitung hier übernehmen konnte, es war also allerhöchste Zeit, ihn ins Bild zu setzen. Er hatte vor, erst die beiden Burschen in Augenschein zu nehmen, anschließend einen netten Lunch einzulegen, dann würde er Rupe herumführen und ihn für das Projekt begeistern. Aber aus diesem Plan war nichts geworden. Der erste Bewerber war ein hoffnungsloser Fall – viel zu sehr von sich eingenommen und voll vorwitziger Anekdoten, mit denen er sich ins rechte Licht rücken wollte, was aber nur das Gegenteil bewirkte –, zudem gab er sich, auf seine bisherigen Tätigkeiten angesprochen, sehr zugeknöpft. Der zweite kam zu spät, war schon nicht mehr der Jüngste und äußerst nervös, räusperte sich jedes Mal, bevor er etwas sagte, und schwitzte, seine Arbeitserfahrung konnte sich jedoch sehen lassen: Er hatte während des gesamten Kriegs ein Sägewerk für Weichholz geleitet und hörte dort nur auf, weil die Firma einen Militärangehörigen übernahm, der davor schon die Stelle besetzt hatte. Edward hatte den Eindruck, dass er älter war, als er zugab, hakte aber nicht nach, und nach dem Bewerbungsgespräch fragte er Rupert nach seiner Einschätzung.
»Er macht einen ganz ordentlichen Eindruck, aber ich kann nicht im Geringsten beurteilen, ob er für die Stelle geeignet ist.«
»Andere Bewerber haben wir nicht.«
»Ja, noch nicht. Aber das kann sich jeden Moment ändern, dann wollen Hunderte – gut, Dutzende – die Stelle.«
»Aber wir brauchen jetzt jemanden. Es sei denn, du könntest die Arbeit in der Zwischenzeit mit übernehmen.«
»Großer Gott! Nie und nimmer. Ich habe nicht die mindeste Ahnung davon.« Er wirkte entsetzt. Nach einer Pause sagte er: »Das würde auch bedeuten, dass ich hier wohne, oder? Zoë hängt sehr an London.«
Das genau wollte er nun nicht hören. Hugh kam als Leiter nicht in Betracht, da er von Anfang an gegen Southampton gewesen war, und sein eigenes Privatleben gestaltete sich viel zu kompliziert, um die Lagerhalle von London aus zu leiten. Trotzdem, ein Cazalet sollte vor Ort sein.
»Gut«, sagte er, »schlafen wir eine Nacht darüber. Ich möchte dir alles zeigen, aber erst mal gehen wir etwas essen.«
Der Lunch – im Polygon Hotel – hatte eine Ewigkeit gedauert. Das Lokal war ungewöhnlich voll, und die Bar, wo sie etwas tranken, während sie auf einen Tisch warteten, war voller Männer, die in der frühen Ausgabe des lokalen Abendblatts die Wahlergebnisse studierten. Die Schlagzeilen waren nicht zu übersehen. SIEG FÜR LABOUR! VERNICHTENDE NIEDERLAGE FÜR KONSERVATIVE!
»Es gibt nicht viel, worauf wir anstoßen könnten«, sagte er, als ihr Pink Gin serviert wurde, aber Rupert meinte, vielleicht sei es gar nicht so schlecht. Darüber gerieten sie sich ein wenig in die Wolle. Edward war schockiert. »Churchill loswerden?«, fragte er mehr als einmal. »Das ist in meinen Augen der schiere Wahnsinn. Immerhin hat er uns durch den Krieg gebracht.«
»Aber der Krieg ist vorbei. Jedenfalls hier.«
»Die anderen werden lediglich das Empire zugrunde richten und mit ihrem verdammten Wohlfahrtsstaat die Wirtschaft ruinieren. Und nur, weil die Menschen alles wollen, ohne etwas dafür zu geben.«
»Na ja, sie haben eine ganze Weile alles gegeben und nichts dafür bekommen.«
»Wirklich, alter Junge, aus dir wird noch ein richtiger Roter.«
»Aus mir wird gar nichts. Ich war nie ein richtiger Tory, aber deshalb bin ich noch lange kein Kommunist. Ich will nur, dass es etwas gerechter zugeht.«
»Was soll das heißen, ›gerechter‹?«
Es folgte ein kurzes Schweigen, in dem sein Bruder damit beschäftigt war, die Folie von seiner Packung Senior Service zu dröseln.
»Die Körper«, sagte er schließlich. »Das ist mir aufgefallen, als ich Sub-Lieutenant auf dem Zerstörer war. Die Männer, die mit nacktem Oberkörper das Deck oder den Maschinenraum geschrubbt haben, ich habe sie auf meinen Runden gesehen. Die meisten einfachen Seeleute haben einen ganz anderen Körperbau: Sie haben schmale Schultern, eine breite Brust, krumme Beine, sie sind hager, haben schlechte Zähne – du wärst überrascht, wie viele von denen falsche Zähne haben. Sie sehen aus, als hätte ihr Körper nie eine Chance gehabt, so zu wachsen, wie es von Natur aus vorgesehen ist. Natürlich gab es Ausnahmen – kräftige Kerle, Stauer oder Bergleute –, aber es gab verdammt viele, die aus der Stadt kamen und einer Schreibtischtätigkeit nachgegangen waren. Die sind mir wahrscheinlich vorwiegend aufgefallen. Jedenfalls waren sie ganz anders als die Offiziere. Aber von unseren Uniformen mal abgesehen, hätten wir doch genauso aussehen sollen wie sie.« Er sah zu seinem Bruder und lächelte verhalten – eine stille, freudlose Entschuldigung. »Es gibt noch anderes …«
Vielleicht, dachte Edward, erzählt er mir jetzt von Frankreich. Darüber hat er noch nie geredet, kein einziges Mal. »Anderes?«
»Ähm … na ja, wenn du nicht viel zu verlieren hast, trifft es dich eben viel schlimmer, wenn du das wenige auch noch verlierst. Einer unserer Kanoniere hat bei den Luftangriffen sein Haus verloren. Wenn wir ein Haus verlieren, haben wir ein zweites, oder wir kaufen uns wieder eins. Aber er hat sein Haus und seine Möbel verloren, alles.«
»Das kann jedem passieren … das ist passiert …«
»Ja … aber das, was anschließend passiert, ist anders.«
Er würde nicht über Frankreich reden, sich nicht alles von der Seele reden. Edward war erleichtert, als der Kellner kam und ihnen mitteilte, dass ihr Tisch bereit war.
Aber selbst als sie Platz genommen hatten, wurden sie nur schleppend bedient, sodass sie erst nach drei Uhr zur Lagerhalle zurückkehrten. Er beschloss, mit Rupert noch kurz einen Rundgang zu unternehmen, bevor er aufbrechen musste, um rechtzeitig zum Dinner bei Diana zu sein und wie versprochen den Freitagabend mit ihr zu verbringen, bevor er nach Home Place fuhr. Bei ihrer Rückkehr erfuhr er allerdings von dem Mitarbeiter, der das Gebäude und die Reparaturen am Sägewerk beaufsichtigte, dass der Bezirkssachverständige mit einer Liste von Veränderungen auf ihn warte, die aus feuerschutzrechtlichen Gründen durchzuführen seien. Sie mussten diese Liste vor Ort durchgehen, was dann fast drei Stunden dauerte. Rupert ließ sie nach kurzer Zeit allein und sagte, er würde sich auf eigene Faust umsehen.
Ein Großteil dieser Umbauten hätte bereits während des Wiederaufbaus des Sägewerks vorgenommen werden müssen – sie jetzt noch umzusetzen würde sehr viel kostspieliger werden. Er wies Turner, den Verantwortlichen, an, ihm eine Kopie der Liste zu senden, dann würde er ihren eigenen Sachverständigen fragen, warum er sich nicht schon früher mit dem Bezirkssachverständigen ins Benehmen gesetzt habe. Anschließend konnte er Rupert nicht finden, und nachdem er jemanden losgeschickt hatte, um ihn zu suchen, rief er bei Diana an und teilte ihr mit, dass er es nicht zum Dinner schaffen werde. »Ich bin immer noch in Southampton. Ich muss erst Rupert nach London bringen, bevor ich zu dir kommen kann. Tut mir leid, Liebling, aber es geht nicht anders.«
Sie war offensichtlich sehr verärgert, und bis er schließlich auflegen konnte und sich in seinem Stuhl herumdrehte, um die Zigarette auszudrücken, stand Rupert in der offenen Bürotür.
»Ach, ich wusste nicht, dass ich dir Umstände bereite. Ich kann auch mit dem Zug zurückfahren.«
»Schon gut, alter Junge.« Er war hochgradig verstimmt: Rupert musste jedes Wort mitbekommen haben.
»Mir war nicht klar, dass du noch woanders hinwillst – dann wäre es doch viel besser, wenn du mich in den Zug setzt.«
Wenn er vom Bahnhof aus direkt zu Diana fuhr, wäre er in eineinhalb Stunden bei ihr …
»Gut, wenn es dir nichts ausmacht … Aber genehmigen wir uns noch einen auf die Schnelle. An der Straße gibt es einen netten kleinen Pub.«
Über den Drinks erzählte er Rupert schließlich von Diana, wie lange die Affäre schon ging, dass er für Villy nicht mehr »solche Gefühle« aufbringe, dass Dianas Mann gestorben sei und ihr und ihren Kindern so gut wie nichts hinterlassen habe. »Eine schreckliche Sache«, sagte er. »Ich weiß nicht, was ich tun soll.« Es war für ihn eine enorme Erleichterung, mit jemandem über alles reden zu können.
»Willst du sie heiraten?«
»Na ja, genau das ist das Problem.« Und während er das sagte, wurde ihm klar, dass er nichts lieber wollte als genau das. »Weißt du, wenn du von jemandem Kinder hast …«
»Das hast du bislang nicht erwähnt …«
»Nein? Höchstwahrscheinlich hat sie sogar zwei von mir. Du verstehst also … da fühlt man sich verantwortlich … Es wäre schwierig, einfach zu gehen … sie sitzenzulassen.«
Rupert schwieg. Edward fürchtete schon, er würde ihm seine Missbilligung aussprechen, wie es Hugh getan hatte. Aber diesen Gedanken ertrug er nicht, er wollte unbedingt jemanden auf seiner Seite haben. »Ich liebe sie wirklich«, sagte er. »Die Beziehung hätte nie so lange gehalten, wenn ich sie nicht mehr lieben würde als jede andere. Außerdem, wie würde sie sich vorkommen, wenn ich sie jetzt einfach verlassen würde?«
»Villy würde es wahrscheinlich auch nicht gefallen, wenn du sie verlässt. Weiß sie davon?«
»Großer Gott, nein! Nicht das Geringste.«
Als Rupert nichts darauf erwiderte, sagte er: »Was soll ich deiner Meinung nach tun?«
»Vermutlich kommt dir alles, was du tun könntest, falsch vor.«
»Genau. Genau so ist es.«
»Und ich vermute, dass sie – Diana – dich heiraten möchte?«
»Na ja … darüber haben wir noch nicht geredet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das will.« Ihm entschlüpfte ein verlegenes Lachen. »Sie sagt immer, sie betet mich an – so in der Art. Willst du noch was?« Rupert starrte schon seit einigen Minuten in sein leeres Glas, schüttelte dann aber nur den Kopf.
»Du wirst dich wohl für das eine oder andere entscheiden müssen.«
»Eine schreckliche Entscheidung, nicht wahr?« Rupert hatte leicht reden – er war in der Familie nicht unbedingt für seine Entscheidungsfreudigkeit bekannt. »Ich dachte mir, ich sollte noch so lange warten, bis Villy ein Haus gefunden hat, das ihr gefällt … bis sie eingezogen ist, du verstehst … bevor ich … etwas unternehme. Wir sollten los. Ich rufe nur noch schnell bei ihr an – bei Diana, meine ich – und sage ihr, dass ich zum Dinner da bin.«
Auf dem Weg zum Bahnhof sagte er: »Ich würde sie dir gern vorstellen.«
»Gut.«
»Wirklich? Hugh hat sich entschieden dagegen verwahrt.«
»Hugh weiß von ihr?«
»In gewisser Weise. Aber er weigert sich, die Situation zu verstehen. Er will den Tatsachen nicht ins Auge sehen. Diana und ich sind hingegen der Meinung, dass es besser ist, offen über alles zu reden.«
»Nur nicht mit Villy?«
»Das ist was anderes, alter Junge, das muss dir doch klar sein. Ich kann mit ihr nicht darüber reden, bevor ich mich nicht zu diesem Schritt entschieden habe.«
Als er Rupert aussteigen ließ, sagte er: »Übrigens, es weiß keiner davon.«
»Schon gut«, antwortete Rupert.
»Ich bin dir wirklich dankbar, dass du mich so davonkommen lässt.«
»Ich lasse dich überhaupt nicht …«
»Ich meine, dass du den Zug nimmst, damit ich Diana nicht enttäuschen muss.«
»Ach, das! Schon in Ordnung – ich habe alle Zeit der Welt.«
Mit der Sonne im Rücken fuhr Edward an dem klaren, sonnigen Abend nach Osten, um mit seiner Geliebten zu Abend zu essen und mit ihr die Nacht zu verbringen. Diese Aussicht, bei der sich immer ein aufregendes, sorgloses Gefühl einstellte – wie am Abend vor einem Urlaub –, hatte inzwischen aber eine andere Dimension angenommen. Die hermetisch abgedichteten Abteile, in denen er seine beiden Leben während des Krieges voneinander abgeschottet hatte, waren nicht mehr undurchlässig; Schuldgefühle sickerten stetig vom einen Abteil ins andere. Das Gespräch mit Rupert hatte allem eine gewisse Dringlichkeit verliehen. Mit seiner Aussage, Diana habe noch nicht von Heirat gesprochen, hatte er diesen Punkt doch etwas vereinfacht. Obwohl sie das Wort »Hochzeit« nie klar aussprach, schaffte sie es immer wieder, das Gespräch in die Nähe davon zu lenken. So konnte sie zum Beispiel nicht mehr im Cottage bleiben. Was durchaus verständlich war: Es lag abgelegen, ein armseliges Häuschen, in dem sie sich hoffnungslos isoliert fühlte. Aber was sollte sie tun?, hatte sie – mehr als einmal – gefragt und ihn dabei unumwunden mit ihren wunderschönen Augen angesehen. Daneben stellte sie verräterische Fragen über Villy – ob sie weiter auf dem Land leben oder nach London zurückkehren wolle. Er hatte ihr nicht davon erzählt, dass er Lansdowne Road verkaufen wollte, sonst würde sie bloß voreilige Schlüsse ziehen. Natürlich war es ganz schrecklich für sie, die Arme, mit dieser Ungewissheit zu leben. Aber ihm ging es ja genauso. Nichts wäre ihm lieber, als Villy irgendwo glücklich versorgt zu wissen, damit er sich um sie keine Gedanken mehr zu machen brauchte und er mit Diana ein wundervolles neues Leben anfangen könnte. Vielleicht, dachte er und griff nach seiner Schnupftabaksdose (großartiges Zeug, wenn man beim Autofahren müde wurde), vielleicht sollte er ihr das sagen. Er nahm es sich fest vor.
Nach dem Essen, beim Brandy, erzählte er ihr daher davon. Sie war überwältigt. »O Liebling, wie wunderbar!«, rief sie und zeigte auch großes Verständnis für das fürchterlich schwierige Problem, das Villy darstellte. »Natürlich verstehe ich das! Natürlich musst du zuerst an sie denken. Wir müssen beide als Erstes an sie denken, mein Liebling.«
⁓
Er hatte eine Fahrkarte gekauft und festgestellt, dass der nächste Zug nach London erst in zwanzig Minuten abfuhr, also ging er auf dem Bahnsteig auf und ab, vorbei an den Zeitungsständen – die alle geschlossen hatten – zur Bahnhofswirtschaft. Er trat ein: Vielleicht bekam er dort ja Zigaretten, nachdem seine zur Neige gingen. Es gab keine. Das Lokal war trostlos dreckig, es roch nach Bier und Kohlestaub. Von den einstmals glänzend blassgrün gestrichenen Wänden blätterte die Farbe, auf der langen Theke standen schwere gläserne Speiseglocken mit Sandwiches, die so alt waren, dass sie sich bereits bogen. Gerade als er sich fragte, wer, um alles in der Welt, sich so etwas antun konnte, kam ein Seemann herein und bestellte eines der Sandwiches zusammen mit einer Flasche Bass. Rupert verließ die Wirtschaft und ging ans Ende des Bahnsteigs. Der Abend war schön, ein zartes gelbes Licht und nachtfalterhafte Farben lagen über allem; aber mit den »nachtfalterhaften Farben« drückte er sich nur davor, einen genaueren Ausdruck dafür zu finden – Falter hatten schließlich alle möglichen Farben. Er wandte den Blick ab: Er war kein Maler, er war Holzhändler. Wie sein Leben kam ihm auch diese Aussage ganz und gar unwirklich vor – er sollte lieber an etwas anderes denken. Also dachte er an seinen Bruder, seinen älteren, einst strahlenden Bruder, den er für einen Helden gehalten hatte oder zumindest für eine heldenhafte Gestalt, eine Vorstellung, die aber bald zur reinen Gewohnheit geronnen war – schließlich war er im Ersten Weltkrieg ja noch ein Schuljunge gewesen, der es nicht besser gewusst hatte. Der arme Edward. Er hatte sich wirklich in eine unschöne Lage gebracht. Egal, was er jetzt tat, irgendjemand würde unglücklich sein … Plötzlich stellte er fest, dass er jetzt auch darüber nicht nachdenken konnte. »Letztlich wird sie sich wohl daran gewöhnen«, ging ihm durch den Kopf – vielleicht hatte er es auch laut vor sich hingesprochen; wobei »sie« Villy sein musste. Irgendwie glaubte er zu wissen, dass Edward den leichtesten Weg gehen würde. Dabei musste es gar nicht der leichteste Weg sein, nur würde er Edward als solcher erscheinen. Wenn man sowieso jemanden unglücklich machte, wäre es dann nicht das Beste, wenn Edward den schwierigeren Weg wählte? Er wusste, das Schwierigere war implizit das Richtige, aber das, auch das wusste er, tröstete einen auch nicht immer. Immerhin hatte Edward seit Jahren sowohl das eine als auch das andere gehabt; höchste Zeit also, endlich dafür einzustehen und eine Entscheidung zu treffen. Seit Jahren musste sein Leben eine einzige große Lüge sein, voller Ausflüchte, voller verschwiegener Wahrheiten.
Zorn und Wut lagen ihm nicht. Jede Verstimmung, jede Missbilligung, die er gegen Edward hegte, löste sich sofort in Luft auf, sobald er sie in Worte fasste. Es war nicht nur eine Frage des Wollens, sondern auch, dass man gemäß seiner Entscheidung leben sollte und die lebenslangen Folgen zu tragen hatte …
Sein Zug war eingefahren. Er wusste nicht, wie lange er schon dagestanden hatte, und beeilte sich einzusteigen. Er fand ein leeres Abteil und machte es sich in der Ecke bequem, weil er schlafen wollte. Aber sobald er die Augen schloss, war sein Kopf voll mit vertrauten, stummen Bildern, die nur darauf warteten, in seinen Träumen zum Leben erweckt zu werden – damit sie zu ihm reden, sich wiederholen, Schlüsselmomente der vergangenen drei Monate wiederaufleben lassen konnten: Michèle, deren Kopf aufs Kissen sank, nachdem er sie geküsst hatte, die dann (wie er sich vorstellte) reglos dalag, während sie seinen sich entfernenden Schritten lauschte – einmal hatte er sich zum Haus umgedreht, um zu sehen, ob sie ans Fenster getreten war, was sie aber nicht getan hatte; die Zeit auf dem Boot, die ihm so schmerzhaft erschienen war und ihm jetzt fast wie ein seliges Zwischenspiel vorkam, wenn ihm wieder ihr Bild vor Augen stand und er sich seinem Kummer hingab. Er hatte eine Nacht allein in London verbringen wollen, bevor er sich auf den letzten Abschnitt der Heimreise machte, aber das Geld, das er sich vom Kapitän auf dem Boot geliehen hatte, reichte bloß für die Zugfahrkarten. Er hatte nicht daran gedacht, um mehr zu bitten – so war er also zu Fuß von der Waterloo Station zum Bahnhof Charing Cross gegangen. Der schäbige, zerschundene Anblick Londons hatte ihn erschreckt. Er hatte sich eine Fahrkarte gekauft, hatte auf die vertraute Landschaft hinausgesehen und seine letzte Zigarette aus dem Päckchen geraucht, das sie ihm auf dem Boot geschenkt hatten, und hatte sich das Wiedersehen mit Zoë vorzustellen versucht.
Es war ihm nicht gelungen. Nichts, was ihm auf der Fahrt nach Battle durch den Kopf gegangen war, besaß irgendeine Lebendigkeit, irgendeine Glaubwürdigkeit. Vielleicht würde sie kühl sein, vielleicht überschwänglich vor Freude, vielleicht würde sie nicht einmal da sein: Er wusste nichts und schon gar nicht, wie es ihm ergehen würde, wenn er sie wiedersah. Als er schließlich in Home Place eintraf, mitten am Nachmittag, war sie gerade unterwegs. Er ging durch das alte weiße Tor, das zum Haus führte, und da war seine Mutter auf den Knien in ihrem Steingarten. Erst da kam ihm der Gedanke, dass sein plötzliches Erscheinen zu viel für sie sein könnte. Sie wandte den Kopf und erblickte ihn. Er eilte zu ihr, kniete sich hin und umarmte sie; der Ausdruck auf ihrem Gesicht trieb ihm Tränen in die Augen. Sie klammerte sich an ihn, war sprachlos, dann legte sie ihm die Hände auf die Schultern und schob ihn ein Stück von sich weg. »Lass dich ansehen«, sagte sie und lachte – mit hoher Stimme, nach Luft japsend; Tränen liefen ihr übers Gesicht.
»Oh, mein lieber Junge!«
»So«, sagte sie später. »Wir müssen jetzt vernünftig sein. Zoë ist mit Juliet nach Whatlington in den Laden gegangen. Ihr beide wollt sicher ein wenig Ruhe und Zeit für euch.« Sie zog ihr kleines weißes Taschentuch heraus, das immer unter ihrer Armbanduhr steckte, und trocknete sich die Augen. Voller Zuneigung bemerkte er den erdbeerroten Fleck auf ihrem Handrücken.
»Geht es ihr gut?«
Sie sah ihm in die Augen, aber sobald er die vertraute Offenheit ihres Blicks wiederzuerkennen glaubte, zauderte sie.
»Ja«, sagte sie. »Es war nicht leicht für sie. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Deine Tochter ist ein richtiger Schatz. Geh ihnen doch entgegen.«
Also hatte er das getan – war die Anfahrt zurückgegangen und die steile Straße hinaufspaziert und hatte sie oben auf der Anhöhe am Tor zu ihrem Anwesen angetroffen. Juliet saß auf dem Tor, Zoë stand daneben, und noch bevor er hören konnte, was sie sprachen, wusste er, dass sie sich stritten.
» … gehe immer da nach Hause. Sogar Ellen weiß, dass ich da am liebsten heimgehe …«
Er beschleunigte seine Schritte.
»Ich habe heute keine Lust, Omnibus zu spielen.«