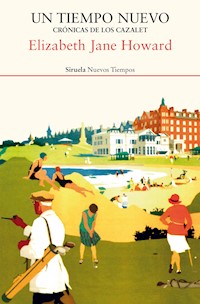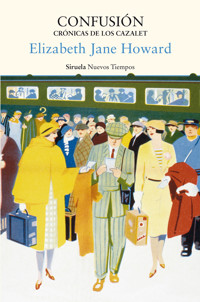9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cazalet-Chronik
- Sprache: Deutsch
»So vollendet, elegant und kultiviert, wie es ihre vielen Verehrer erwarten dürfen.« Julian Barnes Clary und Polly wird es zu eng in Sussex, wie ihre Cousine Louise zieht es sie nach London. Gemeinsam leben sie ihren Traum von Unabhängigkeit: Sie teilen sich eine Wohnung, lernen Stenografie und Maschineschreiben und bieten den Schwierigkeiten in der zunehmend kriegsmüden Hauptstadt mit jugendlichem Schwung die Stirn. Die eigensinnige Louise wiederum entscheidet sich zur Überraschung aller für die Ehe – ihr Eintritt in die High Society. Schon bald allerdings muss sie erfahren, was es bedeutet, in Kriegszeiten nicht nur Mutter, sondern auch die Gattin eine ehrgeizigen Marineoffiziers zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 761
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
England, 1942: Im dritten Band der ›Chronik der Familie Cazalet‹ wollen sich die Cousinen Clary und Polly endlich ins Leben stürzen. Es zieht sie nach London, die drohenden Luftangriffe schrecken sie nicht. Gemeinsam leben sie ihren Traum von Unabhängigkeit: Sie teilen sich eine Wohnung, lernen Stenografie und Maschineschreiben und bieten den Schwierigkeiten in der zunehmend kriegsmüden Hauptstadt mit jugendlichem Schwung die Stirn.
Die eigensinnige Louise wiederum entscheidet sich zur Überraschung aller gegen eine Karriere als Schauspielerin und für die Ehe – ihr Eintritt in die High Society. Schon bald allerdings muss sie erfahren, was es bedeutet, in Kriegszeiten nicht nur Mutter, sondern auch die Gattin eines ehrgeizigen Marineoffiziers zu sein.
Für meine Brüder Robin und Colin Howard
WAS BISHER GESCHAH
Die folgende Vorgeschichte dieses Romans ist für Leserinnen und Leser gedacht, die mit den zwei vorhergehenden Bänden, Die Jahre der Leichtigkeit und Die Zeit des Wartens, nicht vertraut sind.
William und Kitty Cazalet, von der Familie »der Brig« und »die Duchy« genannt, verbringen die Kriegsjahre in Home Place, ihrem Landsitz in Sussex. Der Brig ist mittlerweile so gut wie blind und fährt kaum noch nach London, um über die in Familienbesitz befindliche Holzfirma zu präsidieren. Die beiden haben drei Söhne sowie eine ledige Tochter, Rachel.
Der älteste Sohn, Hugh, ist mit Sybil verheiratet, sie haben drei Kinder: Polly, Simon und William (Wills). Polly wird zu Hause unterrichtet, Simon besucht das Internat, Wills ist vier Jahre alt. Sybil ist seit einigen Monaten sehr krank gewesen.
Der zweite Sohn, Edward, ist mit Villy verheiratet, gemeinsam haben sie vier Kinder. Louise lässt sich auf die Liebe ein – zu Michael Hadleigh, einem erfolgreichen Porträtmaler, der wesentlich älter ist als sie und derzeit bei der Marine dient – und strebt keine Bühnenlaufbahn mehr an. Teddy steht kurz davor, in die Royal Air Force einzutreten. Lydia wird zu Hause unterrichtet, Roland (Roly) ist noch ein Kleinkind.
Der dritte Sohn, Rupert, gilt seit 1940 bei Dünkirchen in Frankreich als verschollen. Er war mit Isobel verheiratet, mit der er zwei Kinder hatte: Clary, die mit ihrer Cousine Polly zu Hause Unterricht erhält (obwohl die beiden es kaum erwarten können, nach London zu ziehen und endlich ihr Leben als Erwachsene zu beginnen), und Neville, der ein Internat besucht. Nach Isobels Tod (sie starb bei Nevilles Geburt) heiratete Rupert die wesentlich jüngere Zoë. Bald nachdem er als vermisst gemeldet wurde, bekam sie eine Tochter, Juliet, die er nie gesehen hat.
Rachel lebt für andere Menschen, was ihre sehr gute Freundin Margot Sidney (Sid), die in London Geigenunterricht gibt, oft sehr schwierig findet.
Edwards Frau Villy hat eine Schwester, Jessica, die mit Raymond Castle verheiratet ist. Die beiden haben vier Kinder. Angela, die Älteste, lebt in London und neigt dazu, sich unglücklich zu verlieben. Christopher ist von labiler Gesundheit und führt mit seinem Hund ein sehr zurückgezogenes Leben in einem Wohnwagen. Er arbeitet auf einem Bauernhof. Nora ist Krankenschwester, und Judy besucht ein Internat. Die Castles haben ein Haus in Surrey und etwas Geld geerbt.
Miss Milliment ist die sehr betagte Hauslehrerin der Familie; sie war bereits Villys und Jessicas Gouvernante und unterrichtet jetzt Clary, Polly und Lydia.
Diana Mackintosh, eine Witwe, ist die ernsthafteste von Edwards zahlreichen Geliebten. Sie erwartet ein Kind. Sowohl Edward als auch Hugh besitzen jeweils ein Haus in London, allerdings ist das von Hugh in Ladbroke Grove momentan das Einzige, das bewohnt wird.
Die Zeit des Wartens endete mit der Nachricht, dass Rupert noch am Leben ist, und mit dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbour. Die stürmischen Jahre setzt im März 1942 ein, kurz nach Sybils Tod.
ERSTER TEIL
POLLY
MÄRZ 1942
Seit einer Woche hatte niemand den Raum betreten. Das Kattunrollo vor dem Fenster, das nach Süden auf den vorderen Garten hinausging, war herabgelassen, pergamentfarbenes Licht füllte die kalte, stickige Luft. Polly trat zum Fenster und zog an der Kordel, das Rollo schnellte nach oben. Ein helleres, kühles Grau flutete ins Zimmer – heller noch als der stürmische Wolkenhimmel. Einen Moment blieb sie dort am Fenster stehen. Osterglocken blühten grüppchenweise unter der Araukarie in Erwartung des Märzwetters, das ihre entsetzliche Fröhlichkeit ertränken und zerstören würde. Sie ging zur Tür und drehte den Schlüssel im Schloss. Eine Störung welcher Art auch immer wäre unerträglich. Sie würde aus dem Ankleidezimmer einen Koffer holen, und dann würde sie den Kleiderschrank und die Schubladen der Rosenholzkommode neben dem Frisiertisch leeren.
Sie wählte den größten Koffer, den sie finden konnte, und legte ihn aufs Bett. Ihr war eingeschärft worden, Koffer nie aufs Bett zu legen, aber dieses war unbezogen und sah unter der Tagesdecke so flach und trostlos aus, dass es ihr gleichgültig erschien.
Doch als sie den Schrank öffnete und die Kleidungsstücke sah, die gedrängt an der unendlich langen Stange hingen, graute ihr plötzlich davor, sie in die Hand zu nehmen – sie hatte das Gefühl, als würde sie sich dann aktiv an dem unerbittlichen Abschied, dem Verschwinden beteiligen, das ganz allein vollbracht worden war, für immer und entgegen dem Wunsch aller, und das bereits vor einer Woche. Das war alles Teil ihrer Unfähigkeit, dieses »für immer« zu begreifen. Sie konnte sich durchaus vorstellen, dass jemand fort war, das Schwierige war, zu erfassen, dass diese Person niemals wiederkehren würde. Die Kleidung würde nie mehr getragen werden, und ohne Wert für die Person, der sie einst gehört hatte, konnte sie andere nur traurig stimmen – oder vielmehr einen anderen. Sie räumte die Sachen nur ihrem Vater zuliebe aus, damit die alltäglichen, elenden Habseligkeiten ihn nicht erinnerten, wenn er von der zweiwöchigen Reise mit Onkel Edward zurückkam. Wahllos nahm sie einige Bügel heraus, kleine Schwaden von Sandelholz stiegen auf und dazu der zarte Duft, den sie mit dem Haar ihrer Mutter verband. Da war das Kleid mit den grünen, schwarzen und weißen Blüten, das sie im vorletzten Sommer bei ihrem Ausflug nach London getragen hatte, der beige Tweedrock mit dem dazu passenden Mantel, der immer zu klein oder zu groß an ihr gewirkt hatte, das uralte grüne Seidenkleid, das sie nur angezogen hatte, wenn sie den Abend allein mit Dad verbrachte, die Jacke aus Prägesamt mit den Markasitknöpfen, die sie ihre Konzertjacke genannt hatte, das olivgrüne Leinenkleid, das sie getragen hatte, als sie mit Wills schwanger war – du meine Güte, das musste fünf Jahre alt sein. Es kam ihr vor, als hätte ihre Mutter wirklich alles aufgehoben: Kleider, die ihr nicht mehr passten, Abendroben, die sie seit Kriegsbeginn nicht mehr getragen hatte, ein Wintermantel mit Eichhörnchenkragen, den sie nie an ihr gesehen hatte … Sie nahm alles heraus und legte es aufs Bett. An einem Ende hing ein zerschlissener grüner Seidenkimono über einem Goldlamékleid. Vage erinnerte sie sich, dass es eines von Dads überflüssigeren Weihnachtsgeschenken gewesen war, unendlich lange Zeit war das her; sie hatte es taktvoll den einen Abend getragen und danach nie wieder. Keines der Kleidungsstücke war wirklich hübsch, dachte sie traurig – die Abendgarderobe wirkte leblos durch das lange, unnütze Hängen, die Alltagskleider waren durch das viele Tragen fadenscheinig oder glänzend oder formlos geworden und auf jeden Fall das, was sie nicht sein sollten. Nichts kam für mehr als den Flohmarkt in Betracht, und genau das hatte Tante Rachel auch vorgeschlagen, »obwohl du alles behalten solltest, was dir gefällt, Polly, mein Schatz«, hatte sie hinzugefügt. Aber sie wollte nichts behalten, und selbst wenn, hätte sie es nie tragen können – Dads wegen.
Nachdem sie die Kleider verpackt hatte, stellte sie fest, dass auf dem oberen Brett noch die Hüte lagen und ganz unten im Schrank regaleweise Schuhe standen. Sie würde einen zweiten Koffer holen müssen. Es gab nur noch einen – und der trug die Initialen ihrer Mutter, S. V. C. »Sybil Veronica« hatte der Geistliche bei der Beerdigung gesagt. Seltsam, einen Namen zu haben, der nur bei der Taufe und der Beerdigung verwendet wurde. Wie schon so oft in der vergangenen Woche stieg wieder das entsetzliche Bild vor ihr auf, wie ihre Mutter dort eingeschlossen in der Erde lag. Es gelang ihr nicht, sich eine Leiche als etwas anderes vorzustellen als einen Menschen, der Licht und Luft brauchte. Stumm und frierend hatte sie dabeigestanden, als Gebete gesprochen wurden und Erde auf den Sarg gestreut wurde und ihr Vater als Letztes eine rote Rose hinabgeworfen hatte, und hatte gewusst, dass sie sie, wenn alles vorbei war, kalt und allein zurücklassen würden – für immer. Aber das konnte sie niemandem sagen. Alle hatten sie die ganze Zeit wie ein Kind behandelt, hatten ihr bis zum Ende muntere, aufbauende Lügen erzählt, die sich von möglicher Genesung über Schmerzfreiheit bis hin zu gnädiger Erlösung gespannt hatten – und hatten nicht einmal den Widerspruch bemerkt. (Worin sollte die Gnade bestehen, wenn es keine Schmerzen gegeben hatte?) Sie war kein Kind mehr; sie war fast siebzehn. Abgesehen von diesem letzten, endgültigen Schock – denn natürlich hatte sie die Lügen glauben wollen –, war sie jetzt wie erstarrt vor Erbitterung, vor Wut, dass man gemeint hatte, sie wäre der Realität nicht gewachsen. Die ganze Woche hatte sie sich den Umarmungen und Küssen entzogen und keine Notiz von der Rücksichtnahme und den Freundlichkeiten genommen. Erleichterung empfand sie nur darüber, dass Onkel Edward zwei Wochen mit Dad verreist war, so konnte sie ihrem Hass auf die anderen freien Lauf lassen.
Als das Thema angesprochen wurde, hatte sie ihren Entschluss verkündet, die persönlichen Gegenstände ihrer Mutter wegzuräumen, und jede Hilfe abgelehnt – »das ist das Mindeste, was ich tun kann«, hatte sie erklärt –, und Tante Rach, die ihr allmählich etwas erträglicher erschien als die anderen, hatte »natürlich« gesagt.
Auf dem Frisiertisch lagen die vielen silbernen Haarbürsten ihrer Mutter sowie ein Schildpattkamm, dazu ein Kristalldöschen mit den Haarnadeln, die sie nicht mehr gebraucht hatte, nachdem sie sich das Haar hatte schneiden lassen, und ein kleiner Ringständer mit zwei oder drei Ringen, darunter der, den Dad ihr zur Verlobung geschenkt hatte: ein Cabochon-Smaragd umgeben von kleinen Diamanten und gefasst in Platin. Sie schaute auf ihren eigenen Ring – ebenfalls ein Smaragd –, den Dad ihr im vergangenen Herbst geschenkt hatte. Nicht, dass er mich nicht lieben würde, dachte sie, er merkt nur einfach nicht, wie alt ich schon bin. Ihn wollte sie nicht hassen. Die ganzen Dinge auf der Kommode konnte sie nicht einfach zu den Flohmarktsachen geben. Sie beschloss, alles in einen Karton zu legen und eine Weile aufzubewahren. Die paar Tiegel mit Cold Cream, Puder und trockenem Rouge sollten am besten weggeworfen werden. Sie wanderten in den Papierkorb.
In den Kommodenschubladen stapelten sich Unterwäsche und zwei Arten von Nachthemden: die, die Dad ihr geschenkt und die sie nie getragen, und diejenigen, die sie selbst gekauft und auch angezogen hatte. Dads waren aus reiner Seide und Chiffon, verziert mit Spitze und Schleifen, zwei in Grün und eines aus dunkel-mokkafarbenem Satin. Die Selbstgekauften waren aus Baumwolle oder leichtem Flanell und geblümt – Nachthemden wie von Beatrix Potter. Sie arbeitete sich weiter vor: BHs, Strumpfhalter, Hemdchen, Hemdhöschen, Unterröcke, alles mehr oder minder in einem schmuddelig pfirsichfarbenen Ton, Seiden- und Wollstrümpfe, einige Viyella-Unterhemden, Dutzende von Taschentüchern in einem Etui, das sie ihr vor Jahren gehandarbeitet hatte, Trapuntotechnik auf Rohseide. Ganz hinten in der Schublade mit der Unterwäsche versteckte sich ein kleiner Beutel, wie für Kamm und Bürste, darin befanden sich eine Tube, auf der »Volpar Gel« stand, und ein kleines Kästchen mit einem komischen runden Ding aus Gummi. Sie steckte beides in den Beutel zurück und warf ihn in den Papierkorb. In derselben Schublade fand sich auch ein sehr flacher viereckiger Karton, in dem, eingehüllt in verfärbtem Seidenpapier, ein Halbkranz aus silbrigen Blättern mit weißlichen Blüten lag, die bei der leisesten Berührung zerfielen. Oben auf dem Karton stand in der Handschrift ihrer Mutter ein Datum: 12. Mai 1920. Es muss ihr Hochzeitsgebinde gewesen sein, dachte sie und versuchte, sich an das lustige Hochzeitsbild auf der Kommode ihrer Großmutter zu erinnern, auf dem ihre Mutter ein ausgefallenes schlauchartiges Kleid trug, ohne jede Taille. Den Karton legte sie beiseite. Es erschien ihr unmöglich, etwas wegzuwerfen, das so lange gehütet worden war.
Die unterste Schublade enthielt Babysachen. Das Taufkleid, das Wills als Letzter getragen hatte – aus feinstem Batist mit gestickten Wiesenblumen, eine Handarbeit von Tante Villy –, ein Beißring aus Elfenbein, ein Stapel winziger Spitzenmützen, eine offenbar indische Rassel aus Silber und Korallen, eine Reihe blassrosa ungetragener Stricksachen, vermutlich für das Baby, das gestorben war, dachte sie, und ein großer, sehr zarter vergilbter Kaschmirschal. Sie war ratlos, was sie mit all diesen Dingen tun sollte. Zu guter Letzt entschied sie, sie erst einmal beiseitezulegen, bis sie sich überwinden konnte, eine der Tanten zu fragen, was sie damit machen solle.
Wieder war ein Nachmittag vergangen. Bald war es Zeit für den Nachmittagstee, danach würde sie sich um Wills kümmern, mit ihm spielen, ihn baden und ins Bett bringen. Ihm wird es wie Neville ergehen, dachte sie – nur schlimmer, weil er sich mit seinen vier Jahren noch lange an sie erinnern wird, während Neville seine Mutter überhaupt nie gekannt hat. Wills konnte es nicht begreifen. Natürlich hatten alle versucht, es ihm verständlich zu machen – sie selbst eingeschlossen. »Fort«, wiederholte er nur unbewegt. »Tot im Himmel?«, fragte er, aber trotzdem suchte er beharrlich weiter nach ihr – unter Sofas und Betten, in Schränken, und wann immer er entwischen konnte, ging er schnurstracks zu diesem verwaisten Raum. »Flugzeug«, hatte er gestern gesagt, nachdem er das mit dem Himmel wiederholt hatte. Ellen hatte ihm erzählt, sie sei im Himmel, aber das hatte er mit Hastings verwechselt und wollte sie an der Bushaltestelle abholen. Er weinte nicht, aber er war sehr still. Er saß auf dem Boden und schob lustlos seine Autos hin und her, spielte mit dem Essen, ohne es tatsächlich hinunterzuschlucken, und schlug nach allen aus, die ihn auf den Arm zu nehmen versuchten. Mit ihr fand er sich ab, aber die Einzige, die er wirklich um sich haben wollte, war Ellen. Früher oder später wird er sie wohl vergessen, dachte sie. Er wird sich kaum daran erinnern, wie sie aussah. Er wird wissen, dass er seine Mutter verloren hat, aber nicht, wer und wie sie war. Das fand sie auf eine ganz andere Art traurig und beschloss, nicht darüber nachzudenken. Dann fragte sie sich, ob es nicht fast genauso schlimm war, über eine Sache nicht nachzudenken, wie nicht darüber zu reden. Denn sie wollte um keinen Preis wie ihre schreckliche Familie sein, die sich nach Kräften bemühte, einfach weiterzuleben, als wäre nichts passiert. Zumindest kam es ihr so vor. Sie hatten vorher nicht darüber gesprochen, und sie sprachen auch jetzt nicht darüber. Soweit sie es beurteilen konnte, glaubte keiner von ihnen an Gott, niemand ging je in die Kirche, aber sie alle – mit Ausnahme von Wills und Ellen, die bei ihm zu Hause blieb – hatten an der Beerdigung teilgenommen. Sie hatten in der Kirche gestanden und Gebete gesprochen und Kirchenlieder gesungen, und dann waren sie nach draußen zu dem tiefen Loch gegangen, das bereits ausgehoben war, und hatten zugesehen, wie zwei sehr alte Männer den Sarg hinabließen. »Ich bin die Auferstehung und das Leben«, sprach der Herr. »Wer an mich glaubt, wird nicht sterben.« Aber sie hatte ja nicht an ihn geglaubt, und die anderen ihres Wissens auch nicht. Welchen Sinn hatte das Ganze dann? Sie hatte über das Grab hinweg zu Clary gesehen, die dastand und nach unten starrte und sich auf die Fingerknöchel biss. Auch Clary konnte nicht darüber reden, aber sie tat zumindest nicht so, als wäre nichts passiert. Der entsetzliche letzte Abend – nachdem Dr. Carr gekommen war und ihrer Mutter eine Spritze gegeben hatte und sie sie zu ihr ins Zimmer geführt hatten (»Sie ist nicht mehr bei Bewusstsein«, hatten sie gesagt, »jetzt spürt sie nichts mehr«, in einem Ton, als wäre das eine Leistung), und sie hatte dagestanden und den flachen, röchelnden Atemzügen gelauscht und lange gewartet, dass ihre Mutter die Augen öffnete, damit etwas gesagt werden oder dass es zumindest einen stillen Abschied geben konnte …
»Gib ihr einen Kuss, Poll«, hatte ihr Vater gesagt, »und dann geh, mein Schatz, sei so gut.« Er saß auf der anderen Seite des Bettes und hielt die Hand ihrer Mutter, die mit der Handfläche nach oben auf seinem mit schwarzer Seide bezogenen Stumpf lag. Sie beugte sich vor, küsste die trockene, warme Stirn und verließ den Raum.
Draußen war es Clary, die sie an der Hand nahm und in ihr Zimmer führte, sie umarmte und weinte und weinte, aber sie selbst war zu wütend, um zu weinen. »Zumindest konntest du dich von ihr verabschieden!«, wiederholte Clary ständig im Versuch, etwas Tröstliches zu sagen. Aber darum ging es ja – oder zumindest unter anderem: Sie hatte sich eben nicht verabschieden können. Die anderen hatten gewartet, bis ihre Mutter sie nicht mehr erkannte, sie nicht einmal mehr wahrnahm … Sie hatte sich aus Clarys Umarmung befreit und gesagt, sie gehe spazieren, sie wolle allein sein, und Clary hatte sofort verständnisvoll zugestimmt. Sie hatte ihre Gummistiefel und den Regenmantel angezogen und war in die stahlgraue, nieselige Dämmerung hinausgeschlüpft, die Stufen in der Böschung hinauf zu der Pforte, die zum Wäldchen hinter dem Haus führte.
Sie ging bis zu dem großen umgestürzten Baum, an dem Wills und Roly immer ein geheimnisvolles Spiel spielten, und setzte sich neben den ausgerissenen Wurzeln auf den Stamm. Sie hatte gedacht, dass sie hier weinen würde, dass ganz normale Trauer sie überwältigen würde, aber nichts kam aus ihr heraus als lautes, keuchendes Stöhnen der Wut und der Hilflosigkeit. Sie hätte eine Szene machen sollen – aber wie hätte sie das tun können angesichts des Kummers ihres Vaters? Sie hätte darauf bestehen sollen, sie am Vormittag zu sehen, nachdem Dr. Carr sich verabschiedet hatte mit den Worten, er werde am Nachmittag wiederkommen – aber woher hätte sie wissen sollen, was er dann tun würde? Die anderen mussten es gewusst haben, aber wie immer hatten sie ihr nichts gesagt. Ihr hätte klar sein sollen, dass ihre Mutter jeden Moment sterben würde, als sie Simon aus dem Internat holten. Er war am Morgen gekommen und gleich bei ihr gewesen, dann hatte sie gebeten, Wills zu sehen, und danach hatten die anderen gesagt, das sei genug für den Vormittag. Aber der arme Simon hatte auch nicht gewusst, dass er sie zum letzten Mal sehen würde. Es war ihm einfach nicht klar gewesen. Er glaubte, sie sei nur furchtbar krank, und das ganze Mittagessen hindurch hatte er von der Mutter eines Freundes erzählt, die fast an ihrem Blinddarm gestorben, aber wie durch ein Wunder genesen war. Nach dem Essen hatte Teddy eine lange Fahrradtour mit ihm unternommen, von der sie noch nicht zurückgekehrt waren. Hätte ich mit ihr gesprochen – hätte ich irgendetwas gesagt, dachte sie, hätte sie mich vielleicht gehört. Aber dafür hätte sie mit ihr allein sein müssen. Sie hatte ihr sagen wollen, dass sie sich um Dad und um Wills kümmern werde, und vor allem hatte sie fragen wollen: »Ist es für dich in Ordnung? Kannst du es ertragen zu sterben, was immer das bedeutet?« Vielleicht hatten die anderen auch ihre Mutter hintergangen. Vielleicht würde sie einfach nicht mehr aufwachen – würde den Moment ihres Todes gar nicht wahrnehmen. Bei dieser entsetzlichen Vorstellung hatte sie weinen müssen. Sie hatte lange Zeit geweint, und als sie wieder nach Hause kam, hatten sie ihre Mutter schon abgeholt.
Seitdem hatte sie gar nicht mehr geweint. Sie hatte den ersten, entsetzlichen Abend überstanden, als alle beim Dinner gesessen hatten, das keiner essen wollte, hatte mit angesehen, wie ihr Vater versuchte, Simon aufzumuntern, und ihn nach seinem ganzen Sport am Internat gefragt hatte, bis Onkel Edward in die Bresche sprang und Geschichten aus seiner Internatszeit erzählte, ein Abend, an dem alle nach sicherem Boden suchten, nach fadenscheinigen, unverfänglichen Scherzen, über die man gar nicht lachen sollte und die nur dem Zweck dienten, eine Minute nach der anderen mit einem Anschein von Normalität zu vertreiben; und obwohl sie die indirekten, beiläufigen Beweise von Zuneigung und Besorgnis bemerkte, weigerte sie sich, sie anzunehmen. Am Tag nach der Beerdigung war Onkel Edward mit ihrem Vater und Simon nach London aufgebrochen. Sie brachten Simon zum Zug, der wieder ins Internat fuhr. »Muss ich wirklich zurück?«, hatte er gefragt, aber nur einmal, weil sie sagten, natürlich müsse er zurück, bald fingen die Ferien an, und er dürfe die Abschlussprüfungen nicht versäumen. Archie, der zur Beisetzung gekommen war, schlug nach dem Dinner auf dem Boden des Frühstückszimmers eine Pelman-Patience für alle vor, »Polly, du auch«, und Clary spielte natürlich ebenfalls mit. Es war eiskalt, weil das Feuer ausgegangen war. Simon störte das nicht – er sagte, es sei wie im Internat, außer auf der Krankenstation, wohin man allerdings nur komme, wenn man am ganzen Körper Ausschlag habe oder halb tot sei –, aber Clary holte allen eine Strickjacke, und Archie musste einen alten Mantel des Brig anziehen und den dicken Schal, den Miss Milliment gestrickt hatte, der aber nicht für würdig befunden worden war, den Truppen geschickt zu werden, und Halbhandschuhe, mit denen die Duchy Klavier spielte.
»Im Büro, in dem ich arbeite, ist es brutheiß«, erklärte er. »Ich bin ein richtiger Weichling geworden. Jetzt brauche ich nur noch einen Krückstock. Im Gegensatz zu euch allen kann ich nicht auf dem Podex sitzen.« Also ließ er sich in einem Sessel nieder, streckte sein kaputtes Bein von sich und deutete auf einzelne Karten, die Clary dann für ihn umdrehte.
Das war ein Aufschub gewesen. Archie spielte mit derartiger Verve ums Gewinnen, dass alle sich davon anstecken ließen, und als doch Simon ein Spiel gewann, strahlte er vor Freude. »Verdammt!«, sagte Archie. »Verdammt und zugenäht! Noch eine Runde, und ich hätte alles eingesackt.«
»Du bist kein guter Verlierer«, bemerkte Clary liebevoll. Sie konnte ebenso wenig verlieren wie er.
»Aber ich bin ein wunderbarer Gewinner. Verständnisvoll und freundlich, und da ich fast immer gewinne, erlebt mich kaum jemand von meiner schlechten Seite.«
»Du kannst nicht ständig gewinnen«, wandte Simon ein. Archie verhielt sich beim Spielen auf eine Art, sodass alle anderen ganz erwachsene Bemerkungen machten. Das war Polly schon öfter aufgefallen.
Aber als sie später aus dem Bad kam, stand Simon wartend davor.
»Du hättest doch reinkommen können, ich habe mir bloß die Zähne geputzt.«
»Darum geht’s gar nicht. Könntest du vielleicht … könntest du einen Moment zu mir mitkommen?«
Sie folgte ihm den Gang entlang zu dem Zimmer, das er normalerweise mit Teddy teilte.
»Aber«, sagte er zögernd, »versprichst du, dass du niemandem davon erzählst? Und auch nicht lachst?«
Natürlich nicht, versprach sie.
Er zog sein Jackett aus und lockerte die Krawatte.
»Ich muss etwas drüber tun, sonst scheuern sie unter dem Kragen.« Mittlerweile hatte er sein graues Flanellhemd aufgeknöpft, und sie sah, dass überall auf seinem Nacken verschmutzte Leukoplaststückchen klebten. »Du musst sie wegreißen, dann siehst du’s.«
»Aber das tut weh.«
»Am besten ist es, wenn du’s schnell machst«, sagte er und beugte den Kopf vor.
Zuerst versuchte sie, vorsichtig zu sein, merkte aber bald, dass sie ihm damit keinen Gefallen tat. Beim siebten Pflaster wusste sie, dass sie die Haut mit zwei Fingern festhalten und das Pflaster mit der anderen Hand rasch wegreißen musste. Darunter kam eine Vielzahl eitriger Pusteln zum Vorschein – entweder große Pickel oder kleine Furunkel, das konnte sie nicht genau sagen.
»Die Sache ist, wahrscheinlich müssen sie ausgedrückt werden. Das hat Mum immer gemacht, und dann hat sie ein tolles Zeug draufgerieben, und manchmal sind sie danach einfach verschwunden.«
»Du solltest richtiges Pflaster mit Verbandmull verwenden.«
»Ich weiß. Sie hat mir eine Packung fürs Internat mitgegeben, aber die ist schon aufgebraucht. Und selbst kann ich sie mir ja nicht ausdrücken. Dad kann ich nicht darum bitten. Ich dachte, dass du vielleicht nichts dagegen hast, das zu machen.«
»Natürlich nicht. Weißt du, was sie draufgetan hat?«
»Irgend so ein tolles Zeug«, antwortete er. »Vielleicht Wick?«
»Das ist für die Brust. Ich hole jetzt mal etwas Watte und richtiges Pflaster und was immer ich sonst noch finden kann. Ich bin gleich wieder da.«
Im Medikamentenschränkchen im Bad lag eine Rolle Pflaster mit einer gelben Mullauflage, aber zur Behandlung der Pusteln entdeckte sie lediglich eine Flasche Friar’s Balsam, die aber nur noch einen kleinen Rest enthielt.
»Außerdem bekomme ich wieder ein Gerstenkorn«, sagte er, als sie zurückkam. Da saß er bereits im Pyjama auf dem Bett.
»Womit hat sie das immer behandelt?«
»Sie hat mit ihrem Ehering darübergerieben, und danach war es manchmal einfach weg.«
»Zuerst kümmere ich mich um die Pickel.«
Es war eine eklige Aufgabe, zumal sie wusste, dass sie ihm wehtat. Einige Pusteln eiterten, aber andere hatten einen harten, gelb glänzenden Kern, den sie fest zusammenpressen musste, damit der Eiter austrat. Simon zuckte nur einmal zusammen, aber als sie sich entschuldigte, sagte er: »Ach, das macht nichts. Drück sie so fest aus, wie du kannst.«
»Macht die Hausmutter das nicht für dich?«
»Guter Gott, nein! Sie kann mich sowieso nicht leiden, außerdem ist sie fast immer giftig. Eigentlich mag sie nur Mr. Allinson – das ist der Sportlehrer –, weil der lauter Muskeln hat, und einen Jungen, Willard heißt er, dessen Vater ein Lord ist.«
»Du Armer! Ist es wirklich nur schrecklich dort?«
»Grauenhaft.«
»Nur noch zwei Wochen, dann sind Ferien.«
Kurz herrschte Stille.
»Aber es wird nicht dasselbe sein, oder?«, sagte er, und seine Augen füllten sich mit Tränen. »Das kommt jetzt nicht von der scheußlichen Schule und auch nicht von dem dämlichen Krieg«, erklärte er und fuhr sich mit den Fingerknöcheln übers Gesicht, »das ist das blöde Gerstenkorn. Davon tränen mir die Augen. Das passiert ganz oft.«
Sie legte ihm einen Arm um die angespannten, knochigen Schultern. Sie hatte das Gefühl, als würde seine furchtbare Einsamkeit ihr ein Loch ins Herz bohren.
»Ich meine, wenn man daran gewöhnt ist, von jemandem jede Woche einen Brief zu bekommen, und dann bekommt man keinen mehr, dann ist es ja eigentlich klar, dass man das zuerst ein bisschen komisch findet. Das würde doch jedem so gehen, denke ich«, sagte er so entschlossen vernünftig, als wollte er jemand anderen über seinen Kummer hinwegtrösten. Doch dann platzte es aus ihm heraus: »Aber sie hat mir nie etwas gesagt! Zu Weihnachten ist es ihr so viel besser gegangen, und das ganze Trimester hat sie mir jede Woche geschrieben und kein Wort davon gesagt!«
»Mir auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie mit irgendjemandem darüber gesprochen hat.«
»Ich bin aber nicht irgendjemand!«, fuhr er auf und unterbrach sich dann. »Du natürlich auch nicht, Poll.« Er drückte ihr die Hand und schüttelte sie gleichzeitig. »Du warst klasse mit meinen blöden Pickeln.«
»Geh ins Bett, du zitterst ja vor Kälte.«
In der Tasche seiner Hose, die auf dem Boden lag, fischte er nach einem unsäglichen Taschentuch und putzte sich die Nase.
»Poll – bevor du gehst, wollte ich dich noch etwas fragen. Ich muss immer wieder daran denken … und ich kann nicht …« Er machte eine Pause und sagte dann langsam: »Was ist mit ihr passiert? Ich meine, hat sie einfach aufgehört? Oder ist sie woanders hingegangen? Vielleicht findest du es ja dumm von mir, aber diese ganze Sache – der Tod und das alles, du weißt schon … Ich habe keine Ahnung, was es genau bedeutet.«
»Ach, Simon, ich auch nicht! Ich muss auch ständig daran denken.«
»Glaubst du, dass sie«, er deutete mit dem Kopf abrupt zur Tür, »es wissen? Ich meine, sie erzählen uns sowieso nichts, also ist es vielleicht bloß eine der vielen Sachen, bei denen sie es nicht für nötig halten, uns etwas zu sagen.«
»Das habe ich mich auch schon gefragt«, erwiderte sie.
»In der Schule würden sie ständig vom Himmel reden, weil sie so schrecklich fromm tun – du weißt schon, jeden Tag beten und besondere Gebete für alle Ehemaligen, die im Krieg gefallen sind, und am Sonntag hält der Direx immer eine Rede über Patriotismus und dass man ein Streiter Christi und reinen Herzens sein muss und dass wir uns der Schule als würdig erweisen müssen. Und ich weiß, wenn ich wieder da bin, erzählt er mir garantiert etwas vom Himmel, aber so, wie sie den beschreiben, finde ich ihn dermaßen dämlich, dass ich gar nicht weiß, wieso überhaupt jemand in den Himmel kommen möchte.«
»Du meinst, die ewige Harfenmusik und die weißen Gewänder?«
»Und dass alle die ganze Zeit so glücklich sind«, stieß er abschätzig hervor. »Wenn du mich fragst, gewöhnen sich die Leute das Glücklichsein einfach ab. Außerdem sind sie sowieso dagegen, weil sie einen ständig zu Sachen zwingen, die einen nur unglücklich machen. Zum Beispiel, dass man das halbe Leben ins Internat gesteckt wird, gerade wenn es einem zu Hause richtig gut gehen würde. Und dann erwarten sie, dass man so tut, als würde es einem gefallen. Das ist das, was mich wirklich aufregt. Die ganze Zeit muss man nach ihrer Pfeife tanzen und obendrein noch so tun, als würde es einem Spaß machen.«
»Könntest du ihnen das nicht sagen?«
»In der Schule doch nicht!«, rief er entgeistert. »Wenn man in der Schule auch nur ein Wort darüber sagen würde, würden sie einen lynchen!«
»Aber es können doch nicht alle Lehrer so sein!«
»Von den Lehrern rede ich ja nicht. Ich meine die Jungs. Weißt du, jeder will so sein wie die anderen. Wie auch immer«, sagte er, »ich dachte einfach, ich frage dich mal … du weißt schon, wegen dem Tod und so.«
Danach hatte sie ihn kurz umarmt und war gegangen.
Jetzt beschloss sie, noch bevor sie mit Wills spielte, an Simon zu schreiben. Sie hatte sich vorgenommen, den wöchentlichen Brief ins Internat zu übernehmen. Sie ließ im Schlafzimmer ihrer Eltern die Rollos herunter und brachte das Kästchen mit den Wertsachen in das Zimmer, das sie nach wie vor mit Clary teilte. Auf ihrem Weg die vielen Gänge entlang zur Galerie über der Halle hörte sie die Geräusche des Hauses – die Duchy spielte Schubert, auf dem Grammofon im Kinderzimmer lief die mittlerweile stark verkratzte Platte »The Teddy Bears’ Picnic«, von der weder Wills noch Roly je genug bekommen konnten, das Radio des Brig, das er einschaltete, sobald er niemanden zum Unterhalten hatte, und das sporadische Rattern der alten Nähmaschine, auf der vermutlich Tante Rach Laken flickte – ein undankbares, weil nie endendes Unterfangen. Es war Freitag, der Tag, an dem normalerweise Dad und Onkel Edward, seitdem er wieder in der Firma arbeitete, zum Wochenende nach Hause kamen, aber nicht heute, denn Onkel Edward war mit Dad nach Westmorland verreist. Abgesehen davon führen alle ihr Leben weiter, als wäre nichts passiert, dachte sie erbittert, während sie nach Briefpapier suchte. Sie würde den Brief im Bett schreiben, weil es dort etwas wärmer war als in irgendeinem anderen Raum (der Kamin im Salon wurde erst nach dem Tee angezündet, eine weitere Einsparung der Duchy).
Das Beste wäre, überlegte sie, Simon so viel wie möglich von der Familie zu erzählen. »Hier kommen Neuigkeiten von allen Personen, aufgelistet nach Alter«, schrieb sie, und das bedeutete, mit der noch lebenden Großtante zu beginnen.
Die arme alte Bully hat beim Frühstück wieder unentwegt vom Kaiser geredet – sie lebt im völlig falschen Krieg. Von ihm – also dem Kaiser – abgesehen, spricht sie viel über Menschen, von denen keiner von uns jemals gehört hat, was eine sinnvolle Antwort ziemlich schwierig macht. Außerdem schafft sie es, selbst kostbares Essen wie gekochtes Ei auf ihre Strickjacke zu kleckern, sodass Tante Rach ständig am Waschen ist. Komisch, bei Miss Milliment haben wir uns daran gewöhnt, dass ihre Kleidung Flecken hat, aber bei Bully kommt es mir ziemlich armselig vor. Die Duchy überträgt ihr kleine Aufgaben, von denen sie aber meistens nur die Hälfte macht. [An der Stelle wollte sie schreiben: »Ihr fehlt Tante Flo einfach immer und überall«, überlegte es sich aber anders.] Der Brig fährt jetzt dreimal die Woche nach London. Eine Weile fuhr er gar nicht mehr, aber dann wurde ihm furchtbar langweilig, und Tante Rach fand es so schwierig, sich hier ständig etwas zu seiner Beschäftigung einfallen zu lassen, dass sie jetzt mit ihm im Zug nach London und weiter ins Büro fährt, und einmal die Woche lässt sie ihn allein dort und geht einkaufen und derlei. An den anderen Tagen plant er seine neue Schonung; er will die große Wiese – die auf dem Weg zu der Stelle von deinem und Christophers Lager – mit Bäumen bepflanzen. Abgesehen davon hört er Radio oder bittet Miss Milliment oder Tante Rach, ihm vorzulesen. Die Duchy nimmt nicht sonderlich Notiz von ihm (was ihn meiner Ansicht nach nicht stört), sie spielt immer weiter Klavier und arbeitet im Garten und erstellt Essenspläne, obwohl auf unseren Marken mittlerweile so wenig Lebensmittel stehen, dass Mrs. Cripps die Gerichte bestimmt schon auswendig kennt. Aber mir ist aufgefallen, dass alte Menschen ihre Gewohnheiten nicht mehr ändern, selbst wenn sie dir oder mir sehr langweilig erscheinen. Tante Rach macht alles, was ich schon schrieb, aber darüber hinaus ist sie sehr lieb zu Wills. Tante Villy steckt bis zum Hals in Rotkreuzarbeit, außerdem hilft sie noch im Genesungsheim – aber sie arbeitet dort richtig als Krankenschwester und nicht wie Zoë, die nur bei den armen Patienten am Bett sitzt. Zoë ist wieder sehr schlank geworden, und wann immer sie Zeit hat, näht sie ihre Kleider enger oder macht neue für Juliet. Clary und ich haben beide das Gefühl festzustecken. Wir wissen einfach nicht, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Clary sagt, dass Louise mit siebzehn das Haus verlassen durfte, also sollten wir das auch dürfen, aber ich meinte, dass sie uns dann nur auf die dumme Kochschule schicken, die Louise besucht hat. Clary findet allerdings, dass selbst das unseren geistigen Horizont erweitern würde, der (ihrer Ansicht nach) Gefahr läuft, unsäglich eng zu werden. Andererseits kommt es uns beiden vor, als wäre Louises Horizont noch enger geworden, seit sie in der großen weiten Welt unterwegs ist. Sie hat nichts als Dramen und Schauspielen im Kopf und versucht, ein Engagement in Hörspielen für die BBC zu bekommen. Sie tut, als gäbe es keinen Krieg, oder zumindest nicht für sie. Unter uns gesagt, sie ist in der Familie ziemlich unten durch, alle finden, sie sollte zu den Wrens gehen. Mittlerweile wird Heizmaterial rationiert – recht viel schlimmer kann es für uns dadurch allerdings nicht werden, Kohle wird sowieso nur noch im Kochherd verfeuert. Simon, wenn du heimkommst, gehe ich mit dir zu Dr. Carr. Ich wette, dass er dir etwas für deine Pickel geben kann. Jetzt muss ich aufhören, weil ich Ellen versprochen habe, Wills zu baden, denn es tut ihrem Rücken gar nicht gut, sich über die Wanne zu beugen.
Liebe Grüße von deiner dich liebenden Schwester Polly
So, dachte sie. Kein besonders interessanter Brief, aber besser als nichts. Unvermittelt wurde ihr klar, dass sie eigentlich sehr wenig über Simon wusste, denn unter dem Jahr war er im Internat, und in den Ferien hatte er bislang immer etwas mit Christopher oder Teddy unternommen. Aber jetzt arbeitete Christopher auf einer Farm in Kent, und Teddy war diese Woche zur RAF gegangen – in den bevorstehenden Ferien gab es niemanden, mit dem er sich zusammentun konnte. Seine Einsamkeit, die ihr am Abend nach der Beerdigung so nahegegangen war, kam ihr wieder in den Sinn. Wie schrecklich, dass sie von ihm nur Dinge wusste, die ihn bedrückten. Unter normalen Umständen hätte sie mit Dad über ihn gesprochen, doch das erschien ihr jetzt schwierig, wenn nicht gar unmöglich: In den vergangenen Wochen hatte ihr Vater sich immer weiter von allen zurückgezogen, sodass er beim Tod ihrer Mutter wie gestrandet wirkte, gelähmt vor Kummer. Aber Clary war noch da, und die hatte schier endlose Ideen. Selbst wenn viele davon nichts taugten, fand sie die bloße Menge beflügelnd.
Clary saß gerade mit Juliet im Kinderzimmer und gab ihr ihren Tee – ein zeitraubendes und eher missliches Unterfangen: Sirupverklebte Toastkrümel hafteten am Tablett ihres Hochstuhls, an ihrem Lätzchen und an ihren pummeligen Händen, mit denen sie ständig herumwedelte. Wann immer Clary ihr einen Bissen in den Mund stecken wollte, drehte sie abwehrend den Kopf zur Seite. »Runter«, wiederholte sie nur unablässig. Sie wollte zu Wills und Roly, die mit ihren Autos gerade ihr Lieblingsspiel »Unfall« spielten. »Dann trink wenigstens ein bisschen Milch«, sagte Clary und reichte ihr den Becher, aber den kippte sie nur über das Tablett und klatschte mit ihren Patschhändchen in die weiße Lache.
»Du bist wirklich sehr unartig, Jule. Könntest du mir eine Windel oder so etwas geben? Babys sind wirklich das Hinterletzte. Es nützt nichts, ich muss einen Waschlappen holen. Passt du bitte derweil auf sie auf?«
Polly setzte sich zu Juliet, beobachtete aber Wills. Ihr war aufgefallen, dass er von seinen Autos aufgeblickt hatte, als sie die Tür öffnete, und die unvermittelte Hoffnung auf seinem Gesicht war einer Ausdruckslosigkeit gewichen, die noch schlimmer war als jede Verzweiflung. Wahrscheinlich macht er das bei jeder Tür, die aufgeht, dachte sie – wie lange wohl noch? Als Clary zurückkam, setzte sie sich zu ihm auf den Boden. Er hatte das Interesse am Unfallspiel verloren und saß da, zwei Finger im Mund, und zog mit der rechten Hand an seinem linken Ohrläppchen. Er schaute nicht zu ihr.
Bislang hatte sie sich überlegt, dass der Tod ihrer Mutter wohl Simon am schwersten traf, weil die Familie seinem Verlust keine besondere Aufmerksamkeit schenkte, aber jetzt fragte sie sich, ob ihr Tod nicht für Wills am allerschlimmsten war, der seine Verzweiflung nicht in Worte fassen konnte; er verstand nicht einmal, was mit seiner Mutter geschehen war. Aber ich verstehe es ja auch nicht, genauso wenig wie Simon – und die anderen tun nur so, als verstünden sie es.
»Ich glaube, alle Religionen wurden nur erfunden, damit die Leute besser mit dem Tod zurechtkommen«, sagte Clary, als sie an dem Abend zu Bett gingen. Diese – für Polly recht verblüffende – Bemerkung machte ihre Cousine am Ende eines langen Gesprächs über Simons Traurigkeit und was sie unternehmen könnten, damit seine Ferien schöner würden.
»Glaubst du das wirklich?« Überrascht stellte sie fest, dass der Gedanke sie tatsächlich schockierte.
»Doch. Ja, das glaube ich wirklich. Die Indianer mit ihren ewigen Jagdgründen, das Paradies und der Himmel, oder dass man als jemand anderer wiedergeboren wird – ich weiß nicht, was sie sich alles ausgedacht haben, aber ich wette, das war der Ausgangspunkt aller Religionen. Die Tatsache, dass früher oder später jeder stirbt, hilft doch keiner Menschenseele weiter. Sie waren gezwungen, sich irgendeine Zukunft auszudenken.«
»Meinst du, dass Menschen einfach verlöschen – wie eine Kerze?«
»Ehrlich, Poll, ich weiß es nicht. Aber allein schon der Umstand, dass niemand darüber spricht, beweist doch, wie viel Angst es ihnen macht. Und sie verwenden so grauenvolle Ausdrücke wie ›dahinscheiden‹, aber wohin? Das wissen sie nicht. Sonst würden sie es sagen.«
»Das heißt, du denkst also nicht …« Ob der Ungeheuerlichkeit der Vorstellung zögerte sie. »Könnte es sein, dass sie es wissen, aber nicht darüber reden, weil es zu furchtbar ist?«
»Das glaube ich nicht. Ich meine, unserer Familie würde ich in der Hinsicht ja alles zutrauen, aber andere hätten darüber geschrieben. Denk an Shakespeare und das unentdeckte Land und dass die Rücksicht Elend zu hohen Jahren kommen lässt. Er wusste doch mehr als jeder andere, und wenn er’s gewusst hätte, dann hätte er es gesagt.«
»Ja, das stimmt.«
»Natürlich könnte er bloß Hamlet diese Gedanken zugeschrieben haben, aber Leute wie Prospero – hätte er selbst es gewusst, hätte er es Prospero auch wissen lassen.«
»Aber an die Hölle hat er geglaubt«, wandte Polly ein. »Und das geht ja nicht, an das eine zu glauben und nicht an das andere.«
Doch Clary widersprach hochfliegend: »Da hat er bloß dem Zeitgeist nach dem Mund geredet. Ich glaube, die Hölle war nur ein politisches Mittel, damit die Menschen taten, was man von ihnen wollte.«
»Clary, es haben aber ziemlich viele sehr ernsthafte Menschen daran geglaubt.«
»Menschen können ernsthaft sein und sich trotzdem irren.«
»Wahrscheinlich.« Sie hatte das Gefühl, dass dieses Gespräch schon seit ein paar Minuten am eigentlichen Thema vorbeiging.
»Wie auch immer«, sagte Clary und zerrte ihren sehr zahnlückigen Kamm durchs Haar, »wahrscheinlich hat Shakespeare doch an den Himmel geglaubt. Denk an ›Gute Nacht, mein Fürst! Und Engelscharen singen dich zur Ruh!‹ – Jule hat mir blöderweise Sirup in die Haare geschmiert –, außer, das war eine höfische Art, sich von seinem besten Freund zu verabschieden.«
»Ich weiß es nicht. Aber ich bin deiner Meinung, ich glaube nicht, dass jemand anderes es wirklich weiß. Allerdings bedrückt mich das Ganze ziemlich. In letzter Zeit.« Ihre Stimme zitterte, und sie schluckte schwer.
»Poll, mir ist etwas Wichtiges an dir aufgefallen, und deswegen möchte ich es dir sagen.«
»Was?« Auf einmal fühlte sie sich verletzlich und sehr müde.
»Es geht um Tante Syb. Um deine Mutter. Die ganze vergangene Woche hast du getrauert um sie, aber ihretwegen – und deines Vaters wegen und Wills’ wegen und jetzt Simons wegen. Ich weiß, das tust du, weil du so ein netter Mensch bist und viel weniger egoistisch als ich, aber du hast nie wegen deines eigenen Verlusts getrauert. Ich weiß, dass du es tust, aber du lässt es nicht zu, weil du die Gefühle der anderen für wichtiger hältst als deine. Das sind sie aber nicht. Mehr wollte ich nicht sagen.«
Einen Moment begegnete Polly ihren grauen Augen, die sie ruhig im Frisierspiegel betrachteten, dann mühte Clary sich weiter mit ihrem Kamm ab. Sie öffnete den Mund, um zu sagen, dass Clary einfach nicht begreife, wie es Wills und Simon ergehe – dass Clary sich täusche –, aber dann wurde das alles von einer warmen Woge der Trauer hinweggespült. Sie legte die Hände vors Gesicht und weinte um ihren eigenen Verlust.
Clary blieb ruhig stehen, ohne etwas zu sagen, und dann holte sie einen Waschlappen und setzte sich ihr gegenüber auf ihr eigenes Bett und wartete, bis Polly sich mehr oder minder ausgeweint hatte.
»Besser als drei Taschentücher«, sagte sie. »Ist es nicht komisch, dass Männer riesengroße haben, dabei weinen sie so gut wie nie, und unsere reichen gerade einmal, um sich das Näschen abzutupfen, dabei weinen wir viel öfter als sie. Soll ich uns einen Becher Fleischbrühe machen?«
»Nachher. Ich habe den ganzen Nachmittag ihre Sachen zusammengepackt.«
»Ich weiß. Tante Rach hat es mir gesagt. Ich habe dir nicht angeboten zu helfen, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass du dir von irgendjemandem helfen lassen wolltest.«
»Das stimmt, aber, Clary, du bist nicht irgendjemand, ganz und gar nicht.« Clary errötete ein wenig. Und da sie wusste, dass Clary derlei Dinge immer zweimal hören musste, sagte sie: »Wenn ich Hilfe von jemandem gewollt hätte, dann von dir.«
Als Clary später mit zwei dampfenden Bechern ins Zimmer zurückkam, unterhielten sie sich über ganz praktische Fragen, etwa, wie sie – und Simon – in den Ferien alle bei Archie unterkommen könnten, obwohl er nur zwei Zimmer und ein Bett hatte.
»Nicht, dass er uns eingeladen hat«, sagte Clary, »aber wir sollten uns gegen jede dumme Ausrede von wegen Platzmangel wappnen.«
»Wir könnten auf seinem Sofa schlafen – wenn er eins hat –, und Simon in der Badewanne.«
»Oder wir könnten Archie bitten, dass Simon ihn allein besucht und wir ein anderes Mal kommen. Oder du könntest allein mit Simon zu ihm fahren«, fügte Clary hinzu.
»Aber du möchtest doch bestimmt mitkommen, oder?«
»Ich könnte ihn ja später besuchen«, antwortete Clary – eine Nuance zu unbekümmert, dachte Polly. »Wir sollten aber niemandem davon erzählen, sonst wollen Lydia und Neville auch mit.«
»Das geht überhaupt nicht. Aber ich würde lieber mit dir fahren.«
»Ich frage Archie, was er für das Beste hält«, meinte Clary.
Die Stimmung hatte sich wieder geändert.
Danach weinte sie relativ oft und fast immer völlig unerwartet, was ihr unangenehm war. Sie wollte nicht, dass die restliche Familie ihre Tränen bemerkte, obwohl sie letztlich glaubte, dass es niemandem auffiel. Sowohl sie als auch Clary bekamen eine furchtbare Erkältung, was die Sache einfacher machte, und sie lagen im Bett und lasen sich gegenseitig Eine Geschichte aus zwei Städten vor, da sie bei Miss Milliment gerade die Französische Revolution behandelten. Tante Rach veranlasste, dass die Kleidung ihrer Mutter zum Roten Kreuz gebracht wurde, was Tonbridge übernahm. Als ihr Vater zehn Tage mit Onkel Edward fort war, fragte sie sich beklommen, ob er wohl weniger traurig sein würde, wenn er zurückkäme (aber das war doch unmöglich, nach so kurzer Zeit, oder nicht?), und vor allem, wie sie sich ihm gegenüber verhalten sollte.
»Mach dir nicht so viele Gedanken darüber«, riet Clary ihr. »Natürlich wird er noch sehr traurig sein, aber früher oder später kommt er darüber hinweg. Das tun Männer immer. Denk an meinen Vater.«
»Du meinst, er könnte eine andere Frau heiraten?« Die Vorstellung entsetzte sie.
»Ich weiß es nicht, aber denkbar ist es. Ich vermute, dass zweite Ehen in der Familie liegen – du weißt schon, wie Gicht oder Kurzsichtigkeit.«
»Ich finde nicht, dass sich unsere Väter wirklich ähnlich sind.«
»Natürlich nicht in allem, aber in vielem doch. Ihre Stimmen zum Beispiel. Und dass sie wegen ihrer knochigen Füße ständig die Schuhe wechseln. Aber bestimmt erst in ein paar Jahren, Poll. Ich möchte ihm gar nichts unterstellen. Ich habe nur die menschliche Natur vor Augen. Wir können nicht alle Sydney Carton sein.«
»Das möchte ich auch nicht hoffen! Wenn, dann gäbe es uns ja nicht mehr!«
»Ach, du meinst, wenn wir alle unser Leben für jemand anderen aufopfern würden? Aber dann muss es ja diesen jemand anderen geben, Dummchen.«
»Nicht, wenn wir uns alle aufopfern würden …« Und damit waren sie bei ihrem Spiel gelandet, das auf die rhetorische Frage zurückging, die Ellen Neville immer stellte, wenn er sich am Esstisch danebenbenahm. »Wenn sich alle auf der Welt gleichzeitig übergeben müssten, wäre das sehr interessant. Ich glaube, dann würden wir alle ertrinken«, hatte er nach einigem Überlegen gesagt und damit, wie Clary meinte, die Vorstellung großartig ad absurdum geführt. Aber kaum hatten sie mit dem Spiel begonnen, merkten sie beide – unabhängig voneinander –, dass es seinen Reiz verloren hatte. Ihnen fiel nichts Zündendes mehr ein, und sie mussten auch nicht mehr haltlos darüber lachen. »Wir sind aus dem Spiel herausgewachsen«, sagte Clary traurig. »Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die anderen das nicht mitbekommen, Wills zum Beispiel oder Jule oder Roly.«
»Es muss andere Dinge geben«, sagte Polly und fragte sich, was in aller Welt das sein könnte.
»Natürlich. Dass der Krieg zu Ende geht und Dad nach Hause kommt und wir tun und lassen können, wozu wir Lust haben, weil wir zu alt sind, um noch herumkommandiert zu werden, und Weißbrot und Bananen und Bücher, die nicht schon zerlesen sind, wenn wir sie kaufen. Und du wirst dein Haus haben, Poll – stell dir das einmal vor!«
»Das tue ich auch, manchmal«, antwortete sie. Aber gelegentlich fragte sie sich, ob sie dem Haus nicht ebenfalls entwachsen war, ohne in etwas hineingewachsen zu sein. Zumindest konnte sie nichts Derartiges erkennen.
DIE FAMILIE
FRÜHJAHR 1942
Fährst du nach London, Tante Rach?«
»Ja. Aber woher weißt du das denn?«
»Du trägst deine London-Kleidung«, erklärte Lydia und fügte dann nach sorgfältiger Erwägung hinzu: »Ehrlich gesagt finde ich, dass du hübscher aussiehst, wenn du sie nicht trägst. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich dir das sage.«
»Keinesfalls. Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe mir schon ewig nichts Neues gekauft.«
»Was ich meine, ist, dass dir deine London-Kleidung meiner Ansicht nach nicht besonders gut steht. Du bist wahrscheinlich jemand, der eine Uniform tragen sollte, damit du immer gleich aussiehst. Dann bräuchte man nur darauf zu achten, ob deine Augen glücklich sind oder nicht.« Sie stand im Flur vor der offenen Tür zu Rachels Zimmer und sah ihr beim Packen ihres kleinen Koffers zu. »Kleider machen dich alt«, schloss sie. »Im Gegensatz zu Mummy. Ich finde, Kleider machen sie jünger – zumindest ihre schönsten.«
»Mein Schatz, tritt nicht gegen die Fußleiste, sonst blättert die Farbe ab.«
»Der Großteil ist schon abgeblättert. Dieses Haus fällt immer mehr auseinander. Ich wünschte, ich würde auch nach London fahren.«
»Was würdest du denn dort tun, Herzchen?«
»Bei Archie sein, wie die anderen, die Glückspilze. Er würde mit mir ins Kino gehen und mich ganz groß zum Essen ausführen, und ich könnte den ganzen Schmuck tragen, den ich zur Taufe bekommen habe, und wir würden Steak und Schokoladenkuchen essen und Crème de Menthe trinken.«
»Sind das die Sachen, die du am liebsten magst?« Sie überlegte gerade, ob sie Pantoffeln einpacken sollte.
»Ich würde sie am liebsten mögen, wenn ich sie je bekommen würde. Archie hat gesagt, dass sie bei ihm auf dem Schiff jeden Tag Fleisch gegessen haben. Es ist schlimm genug, ein Zivilist zu sein, aber ein Zivilistenkind erst … In Restaurants ist es bestimmt besser. Es ist wirklich großes Pech, in einem Ort zu leben, wo es keine gibt. Du trägst auch keine Schminke, oder? Aber ich werde mich schminken. Ich werde einen schwarzroten Lippenstift haben, wie Filmstars, und einen weißen Pelzmantel, aber nicht im Sommer. Und ich werde anstoßende Bücher lesen.«
»Was für Bücher?«
»Du weißt schon, Bücher, die nicht ganz anständig sind. Die werde ich dutzendweise lesen, wenn ich Zeit habe.«
»Apropos Zeit, solltest du nicht bei Miss Milliment sitzen?«
»Es sind Ferien, Tante Rach. Ich hätte gedacht, dass dir das aufgefallen wäre. Und, ach ja, ich würde Archie bitten, mit mir zu Madame Tussauds ins Gruselkabinett zu gehen. Du kennst es wahrscheinlich, oder?«
»Wahrscheinlich war ich einmal dort, aber das ist Jahre her.«
»Was gibt es denn da Gruseliges? Das würde ich gern wissen, bevor ich es sehe. Neville tut, als wäre er schon dort gewesen. Er sagt, dass Ströme von Blut über den Boden fließen, aber Blut finde ich ein bisschen langweilig. Und er sagt, man würde Stöhnen und Ächzen von Gefolterten hören, aber er erzählt nur selten die Wahrheit, also bin ich mir nicht so sicher. Also, was gibt es da Gruseliges?«
»Es ist wirklich eine Ewigkeit her, dass ich dort war, Herzchen, ich weiß es einfach nicht mehr – nur an die Szene mit der Hinrichtung Maria Stuarts erinnere ich mich. Aber ich vermute, dass Mummy in den Ferien einmal mit dir nach London fahren wird.«
»Das bezweifle ich. Sie fährt mit mir höchstens nach Tunbridge Wells – zum Zahnarzt. Weißt du, bei Mr. Alabone ist mir etwas Lustiges aufgefallen. Wenn man sein Zimmer betritt, steht er immer neben dem Stuhl, und dann macht er zwei Schritte vor, um einem die Hand zu geben. Auf dem Teppich sind zwei abgewetzte Stellen, genau dort, wo er auftritt; sie sehen wirklich ziemlich schäbig aus. Wenn er an einer anderen Stelle stehen würde, würde das nicht passieren. Jetzt würde man doch meinen, dass jemand, der schlau genug ist, um Löcher in anderer Leute Zähne zu bohren, das merken würde, oder nicht? Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, denn jetzt im Krieg ist es doch eher unwahrscheinlich, dass er einen neuen Teppich bekommt. Aber er sagte nur: ›Genau, genau‹, also wusste ich, dass er mir gar nicht zuhört.«
»Menschen nehmen Ratschläge höchst selten an«, antwortete Rachel zerstreut. Dabei dachte sie insbesondere an Sid und ihre vielen inständigen Bitten an sie, sich nicht ausschließlich von Sandwiches zu ernähren und sich eine Untermieterin zu suchen, die zumindest etwas Geld zum Unterhalt des Hauses beisteuern und bisweilen vielleicht sogar kochen würde. »Aber es gefällt mir, das Haus für mich zu haben. Und wenn du dann kommst, mein Schatz, können wir es für uns haben«, erwiderte Sid dann immer. Heute, der heutige Abend, würde eines dieser zunehmend selteneren Male sein. Vielleicht sollte ich kochen lernen, dachte sie. Schließlich hat Villy es auch gelernt. Aber Villy kommt ja mit allem Neuen unglaublich gut zurecht.
»Warum packst du so viele Taschentücher ein? Glaubst du, dass du in London ganz furchtbar traurig sein wirst?«
»Nein. Aber die Duchy hat mir beigebracht, für ein Wochenende sechs mitzunehmen, und ein Dutzend, wenn ich für eine Woche verreise. Es ist einfach eine Gewohnheit. Weißt du, früher musste man jeden Tag ein sauberes haben, selbst wenn man das vom Vortag nicht benutzt hatte.«
»Wenn du also für einen Monat weggefahren bist, musstest du achtundvierzig mitnehmen. Und wenn du für drei …«
»Nein, dann wurden sie gewaschen. Und jetzt geh und schau doch, ob du Eileen finden und zu mir schicken kannst.«
»Mache ich.«
Rachel warf einen Blick auf ihre Liste. Auf der einen Seite standen die Dinge, die sie unbedingt noch erledigen musste, bevor sie in den Zug stieg, auf der anderen diejenigen, die sie sich nach ihrer Büroarbeit in London zu tun vorgenommen hatte. Im Büro saß sie in ihrem dunklen Kabäuschen über der Buchhaltung und hörte sich stets dieselben Klagen der Mitarbeiter an, die sehr bald spitzgekriegt hatten, dass sie für jeden ein offenes Ohr hatte, und ihr ihr Herz ausschütteten. Zumindest fuhr sie nicht mit dem Brig, dessen Erkältung sich zu einer Bronchitis ausgewachsen und dem Dr. Carr bis zu seiner vollständigen Genesung verboten hatte, das Haus zu verlassen. Miss Milliment würde dafür sorgen, dass ihm nicht langweilig wurde. Er gab ein Kompendium über Bäume heraus, und Rachels Ansicht nach übernahm Miss Milliment einen so großen Teil der Arbeit, dass sie im Grunde als Mitautorin genannt werden sollte. Um Tante Dolly mussten sich die Duchy und Eileen kümmern, was genau genommen auf Eileen hinauslief, denn ihrer Schwester gegenüber wahrte die Großtante den völlig fiktiven Schein von Selbständigkeit und lehnte jede Hilfe von ihr ab. So würde Eileen stundenlang herumstehen und nach Kleidungsstücken suchen, die Tante Dolly zu tragen wünschte. Rachel wollte Eileen warnen, dass die Suche vielfach erfolglos sein würde, da Tante Dolly häufig nach Kleidern verlangte, die sie schon seit Jahren nicht mehr besaß. »Das Beste ist, zu sagen, dass sie in der Wäsche sind«, riet sie Eileen. »Miss Barlows Gedächtnis ist leider nicht mehr so gut wie früher. Und wählen Sie einfach das, was Sie für das Richtige halten.«
»Jawohl, Ma’am.«
»Und dann ihre Medikamente. Die mag sie sehr gern. Das heißt, wenn sie vergisst, dass sie sie bereits eingenommen hat, nimmt sie sie ein zweites Mal. Am besten geben Sie sie ihr zum Frühstück und stecken sie dann weg – wenn Sie möchten, können Sie sie zu mir ins Zimmer legen. Abends bekommt sie dann noch eine gelbe Tablette.«
»Und was ist mit dem Bad, Ma’am? Wird sie erwarten, dass ich es für sie einlaufen lasse?«
»Wahrscheinlich wird sie sich lieber in ihrem Zimmer waschen.« Rachel zögerte, Tante Dollys tiefe Abneigung gegen Baden zu offenbaren – ihrer Ansicht nach war es gefährlich, außerdem hatte ihr Vater ihr angeblich verboten, häufiger als einmal die Woche zu baden. »Sie geht nach den Neun-Uhr-Nachrichten zu Bett, wenn Sie also auf die Zeit achten könnten, Eileen, danke. Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann.«
Noch ein Punkt, den sie von ihrer Liste streichen konnte. Was für ein Aufwand für zwei Nächte, dachte sie, aber wenn ich dann im Zug sitze, kann ich mich auf zwei schöne Abende freuen. Seit Wochen wurden sie und Sid vom Pech verfolgt. Zuerst natürlich wegen der armen Sybil, dann war der Brig krank geworden, und die Duchy hatte sich furchtbar erkältet und durfte nicht in seine Nähe. Dann war Simon für die Ferien nach Hause gekommen, und Polly hatte ihr Sorgen bereitet – aus dem einen oder anderen Grund war es ihr unmöglich gewesen, das Haus für länger als ihre Stunden im Büro zu verlassen. Aber irgendwie verstand Sid nicht, dass sie innerhalb der Familie – und auch im Haus – gewisse Pflichten hatte, die notgedrungen Vorrang vor dem Vergnügen hatten. Ihre bislang letzte Auseinandersetzung darüber, in einem Teesalon in der Nähe von Rachels Büro, wo sie mit Sid ein kärgliches Sandwich gegessen hatte, war ihr sehr nah gegangen, und hinterher hatte sie geweint, obwohl sie das Sid natürlich nicht erzählt hatte. Weinen konnte sie nur in der wirklich sehr abstoßenden Damentoilette im sechsten Stock des Büros, wo das Toilettenpapier aus Rechtecken des Evening Standard bestand, die an einer Schnur an der Wand hingen, und wo das Verbindungsrohr zum Wasserkasten leckte. Sid ging entweder davon aus, dass es ihr Wunsch war, nach Home Place zurückzufahren, um sich um Wills und Tante Dolly und den Brig zu kümmern (was in gewisser Hinsicht auch stimmte, weil sie tun wollte, was in ihren Augen das Richtige war), oder, schlimmer noch, sie warf Rachel vor, sie sei ihr gleichgültig – und manchmal, wie bei dem Besuch im Teesalon, beides. Sie wusste, dass Sid einsam war und ihr das Unterrichten an der Jungenschule fehlte, obwohl sie seit Neuestem ein oder zwei Privatschüler hatte, was ihre bescheidenen Mittel aufbesserte, und dass sie die Arbeit auf der Sanitätswache meistens sehr langweilig fand. Aber schließlich konnte man in Kriegszeiten nicht erwarten, dass das Leben etwas anderes als eintönig und ermüdend war. Das war noch das geringste Problem. Wenn sie an Clarys feste Überzeugung dachte, dass ihr Vater noch lebte – von dem sie natürlich nichts mehr gehört hatten, seit der kleine Franzose Pipette O’Neil die Briefchen gebracht hatte –, an Hughs abgrundtiefe Trauer über Sybils Tod, oder an Villy, die sich jetzt damit abfinden musste, dass ihr Sohn Jagdflieger wurde und sie Edward immer seltener sehen konnte; und wenn sie an Wills und Polly und Simon dachte, die Ärmsten, die alle auf ihre Art versuchten, mit dem Tod ihrer Mutter zurechtzukommen … Im Vergleich zu all dem, oder auch nur zu einem dieser Dinge, erschien es ihr belanglos und keiner Klage würdig, wenn sich jemand langweilte oder einsam vorkam oder schlicht erschöpft war. Für sie stehen andere nicht an erster Stelle, sagte sie sich in Bezug auf Sid – eine gravierende Vorhaltung. Sie machte sich auf die Suche nach der Duchy, die im Salon am Kartentisch saß, den sie mit einer Zeitung abgedeckt hatte, und Porzellan klebte.
»Duchy, meine Liebe, ich fahre jetzt. Kann ich dir aus London etwas mitbringen?«
»Nichts, außer vielleicht einem neuen Küchenmädchen.«
»Will Edie uns denn verlassen?«
»Mrs. Cripps hat gesagt, dass sie zur Women’s Air Force gehen möchte. Das bringt sie derart in Harnisch, dass Edie völlig verschreckt ist, und so ist noch ein Copeland-Teller zu Bruch gegangen. Wie sie sagt, zerbricht Edie nur das Beste.«
»Hast du mit Edie gesprochen?«
»Noch nicht. Aber wie dem auch sei, ich fände es nicht richtig, sie zum Bleiben zu bewegen. Im Grunde bewundere ich ihre Entscheidung, ihrem Land zu dienen. Sie ist unmittelbar nach der Schule zu uns gekommen und hat das Dorf nie verlassen. Ich finde es ausgesprochen mutig von ihr. Aber Mrs. Cripps ist natürlich außer sich. Wie lästig – ich werde einen Ersatz finden müssen, doch das könnte schwierig werden. Weißt du, ob Mrs. Lines’ Agentur noch existiert? Sie war recht gut, in Kensington lag das Büro doch, oder nicht? Vielleicht hat sie jemanden. Küchenmädchen sind schließlich gemeinhin noch nicht im Einberufungsalter. Aber jetzt geh, mein Schatz, sonst verpasst du noch deinen Zug. Vielleicht kannst du ja herausfinden, ob es Mrs. Lines noch gibt, und dort nachfragen. Wenn du Zeit hast.«
»Das mache ich. Und vergiss nicht, Tonbridge zu erinnern, den Klavierstimmer abzuholen.«
»Das mache ich.«
Zumindest hat sie mich nicht gebeten, etwas aus den Army and Navy Stores mitzubringen, dachte sie. Die Duchy tätigte ihre Einkäufe in wenigen ausgesuchten Geschäften, sie war überzeugt, dass alle anderen nicht an deren Qualität heranreichten. Haushaltswäsche bezog sie von Robinson and Cleaver, ihre Garderobe, von der sie nur sehr selten etwas benötigte, von Debenham and Freebody, Stoffe von Liberty und so gut wie alles andere von den Army and Navy Stores. Die lagen allerdings in der Victoria Street und damit meilenweit von allen anderen Geschäften entfernt. Da sie seit Kriegsanfang nicht mehr in London gewesen war, mussten ihre Schwiegertöchter und Rachel ihre bescheidenen, aber doch anspruchsvollen Besorgungen zu ihrer Zufriedenheit erledigen.
»Haben Sie Ihre Gasmaske dabei, Miss?«
»Danke, Tonbridge, sie ist in meiner Tasche.«