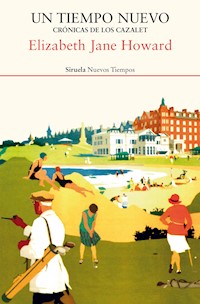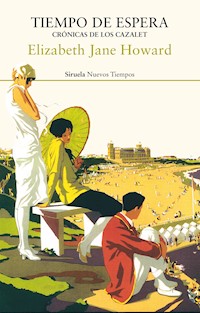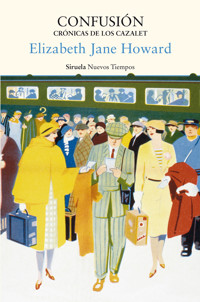9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cazalet-Chronik
- Sprache: Deutsch
Eine Familie – zwei Jahrzehnte – drei Generationen – vier Geschwister Willkommen bei den Cazalets! Eine großbürgerliche Familie im England der späten Dreißigerjahre – unruhige Zeiten. Aus dem Familiensitz Home Place in der malerischen Grafschaft Sussex wird unerwartet ein Zufluchtsort für mehrere Generationen. Feinfühlig erkundet Elizabeth Jane Howard die Sehnsüchte und Geheimnisse der Familie Cazalet und erweckt eine vergangene Welt zu neuem Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 851
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Elizabeth Jane Howard
Die Jahre der Leichtigkeit
Die Chronik der Familie Cazalet~ Band 1 ~
Roman
Aus dem britischen Englisch übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Ursula Wulfekamp
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Jenner Roth
Stammbaum der Familie Cazalet
Die Familie Cazalet und ihr Personal
William Cazalet, genannt Brig
Kitty Barlow, genannt Duchy (seine Frau)
Rachel, ihre ledige Tochter
Hugh Cazalet, der älteste Sohn
Sybil Carter (seine Frau)
Polly
Simon
William, genannt Wills
Edward Cazalet, der zweite Sohn
Viola Rydal, genannt Villy (seine Frau)
Louise
Teddy
Lydia
Rupert Cazalet, der jüngste Sohn
Zoë Headford (seine zweite Frau)
Isobel (seine erste Frau, starb bei Nevilles Geburt)
Clarissa, genannt Clary
Neville
Jessica Castle (Villys Schwester)
Raymond (ihr Mann)
Angela
Christopher
Nora
Judy
Mrs. Cripps (Köchin)
Eileen (Hausmädchen)
Peggy und Bertha (Dienstmädchen)
Dottie (Küchenmädchen)
Tonbridge (Chauffeur)
McAlpine (Gärtner)
Wren (Pferdeknecht)
Billy (Gärtnerjunge)
Nanny (Kindermädchen)
Inge (deutsches Dienstmädchen)
Emily (Köchin)
Phyllis (Hausmädchen)
Edna (Dienstmädchen)
Nanny (Kindermädchen)
Edie (Haushaltshilfe in Sussex)
Ellen (Kindermädchen)
Erster Teil
Lansdowne Road
1937
Für Phyllis begann der Tag um fünf vor sieben, als der Wecker (den ihre Mutter ihr geschenkt hatte, bevor sie ihre erste Stellung antrat) läutete und schepperte und rasselte, bis sie ihn zum Verstummen brachte. Im zweiten quietschenden Metallbett wälzte sich Edna mit einem Stöhnen zur Wand. Selbst im Sommer kam sie nicht aus den Federn, und im Winter musste Phyllis ihr manchmal sogar die Decke wegreißen. Sie setzte sich auf, zog die Klemmen aus dem Haarnetz und entfernte vorsichtig die Lockenwickler: Heute war ihr freier Nachmittag, und sie hatte sich die Haare gewaschen. Sie stand auf, hob das Überbett vom Boden, das nachts hinuntergefallen war, und öffnete die Vorhänge. Sonnenlicht verlieh dem Zimmer einen frischen Anstrich, das Linoleum verwandelte sich in Karamell, die angeschlagenen Stellen am weißen Email-Waschkrug färbten sich schieferblau. Sie knöpfte ihr Flanellnachthemd auf und wusch sich, so wie ihre Mutter es ihr beigebracht hatte: Gesicht, Hände und, mit einem ins kalte Wasser getauchten Waschlappen, vorsichtig unter den Achseln. »Jetzt mach schon«, sagte sie zu Edna. Sie schüttete das Schmutzwasser in den Eimer und zog sich an. Zuerst die Unterwäsche, dann streifte sie das Nachthemd über den Kopf und schlüpfte in das dunkelgrüne baumwollene Tageskleid. Sie stülpte die Haube über ihre unausgebürsteten Korkenzieherlocken und band die Schürze um. Edna, die morgens nur eine Katzenwäsche machte, zog sich noch halb im Bett an – eine Angewohnheit, die sie vom Winter beibehalten hatte (das Zimmer konnte nicht geheizt werden, und das Fenster blieb sowieso immer geschlossen). Um zehn nach sieben waren sie beide bereit, durch das schlafende Haus leise nach unten zu gehen. Im ersten Stock öffnete Phyllis die Tür zu einem der Schlafzimmer und trat hinein. Sobald sie die Vorhänge aufzog, hörte sie den Wellensittich ungeduldig im Käfig herumhüpfen.
»Miss Louise! Es ist Viertel nach sieben.«
»Aber Phyllis!«
»Sie haben mir gesagt, dass ich Sie wecken soll.«
»Ist es schön draußen?«
»Strahlender Sonnenschein.«
»Nehmen Sie Ferdie das Tuch ab.«
»Wenn ich’s nicht mache, stehen Sie schneller auf.«
In der Küche (im Souterrain) hatte Edna schon den Kessel aufgesetzt und richtete auf dem sauber geschrubbten Tisch die Tassen her. Zwei Kannen Tee mussten gebrüht werden: die dunkelbraune mit den Streifen für die Dienstboten, von der Edna jeden Morgen Emily, der Köchin, eine Tasse brachte, sowie die weiße Minton für oben, die Edna mitsamt den passenden Tassen und Untertassen, dem Milchkännchen und der Zuckerdose bereits aufs Tablett gestellt hatte. Der Morgentee für Mr. und Mrs. Cazalet war Phyllis’ Aufgabe. Danach würde sie im Salon, den Edna dann gerade lüftete und putzte, die ganzen Kaffeetassen und Gläser einsammeln. Doch vorher gab es für sie beide eine erste brühheiße Tasse starken indischen Tee. Für oben war es chinesischer, von dem Emily behauptete, sie könne den Geruch nicht ausstehen, vom Geschmack ganz zu schweigen. Sie tranken ihn im Stehen, noch bevor sich der Zucker richtig aufgelöst hatte.
»Was macht dein Pickel?«
Vorsichtig fasste sich Phyllis an die Nase.
»Ich glaube, er ist ein bisschen kleiner geworden. Gut, dass ich ihn nicht ausgedrückt habe.«
»Hab ich dir doch gesagt.« Edna, die nie Pickel hatte, war die Expertin dafür. Die widersprüchlichen Ratschläge, die sie freigebig und ungefragt verteilte, fand Phyllis dennoch tröstlich, in ihren Augen bewiesen sie Anteilnahme.
»Na, da können wir uns jetzt auch nichts von kaufen.«
Das konnten sie sowieso von nichts, dachte Edna trübsinnig, und auch wenn Phyllis Hautprobleme hatte, war sie ein Glückspilz. Edna fand Mr. Cazalet wirklich liebenswert, aber im Gegensatz zu Phyllis durfte sie ihn nie im Pyjama sehen.
***
Kaum hatte Phyllis die Tür geschlossen, sprang Louise aus dem Bett und nahm das Tuch vom Vogelkäfig. Der Wellensittich tat entsetzt und hopste umher, aber sie wusste, dass er sich freute. Ihr Zimmer ging zum Garten hinaus und hatte etwas Morgensonne, die ihm ihrer Ansicht nach gut bekam. Sein Käfig stand vor dem Fenster auf dem Tisch, daneben gleich das Goldfischglas. Das kleine Zimmer quoll über vor ihren Besitztümern: die Theaterprogramme, die Kokarden und die zwei sehr kleinen Pokale, die sie bei Gymkhanas gewonnen hatte, die Fotoalben, das Buchsbaumkästchen mit den flachen Schubladen, in denen sie ihre Muschelsammlung aufbewahrte, die Porzellan-Tierfigürchen auf dem Kaminsims, das Strickzeug auf der Kommode neben ihrem heiß geliebten Tangee-Lippenstift – der knallig orange aussah, aber die Lippen rosa färbte –, der Pond’s Cold Cream und einer Dose Talkumpuder Californian Poppy, ihr bester Tennisschläger und, das Wichtigste, ihre Bücher: alles von Pu der Bär bis hin zu ihren neuesten und kostbarsten Errungenschaften, den zwei Bänden der Phaidon Press mit Reproduktionen von Holbein und van Gogh, momentan ihre Lieblingsmaler. Außerdem standen in dem Zimmer noch eine Kommode voll Kleider, die sie so gut wie nie trug, und – das Geschenk ihres Vaters zu ihrem letzten Geburtstag – ein Schreibtisch aus englischer Eiche, gezimmert aus einem Baum, dessen Maserung sich als außergewöhnlich herausgestellt hatte. Darin bewahrte sie ihre wertvollsten Schätze auf: eine Fotografie von John Gielgud, und zwar signiert, ihren Schmuck, ein sehr dünnes Bündel mit Briefen, die ihr Bruder Teddy ihr aus dem Internat geschickt hatte (darin erzählte er ihr zwar nur vom Sport und riss dumme Witze, aber es waren ihre einzigen Briefe von einem Jungen), und ihre Siegelwachs-Sammlung – vermutlich die größte in ganz England, dachte sie oft. Außerdem gab es noch eine große alte Truhe mit lauter Kleidern zum Kostümieren – die abgelegte Abendgarderobe ihrer Mutter, zylindrische Perlen, Chiffon und Satin, Jacken aus Prägesamt, hauchdünne, entfernt orientalisch anmutende Schals und Stolen aus einer früheren Zeit, angeschmuddelte Federboas, eine handbestickte chinesische Robe, die irgendjemand aus der Verwandtschaft von seinen Reisen mitgebracht hatte, und Hosen und Tuniken aus Baumwollsatin, eigens genäht für Familienaufführungen. Beim Öffnen der Truhe stieg einem ein ganz besonderer Duft in die Nase, eine Mischung aus altem Parfüm, Mottenkugeln und Aufregung. Aufregung war ein leicht metallischer Geruch, vermutlich von den vielen angelaufenen Gold- und Silberfäden, die einige Kleidungsstücke durchzogen. Sich zu kostümieren und Theater zu spielen, das tat man im Winter. Jetzt aber war es Juli, und die endlosen, wunderbaren Sommerferien hatten fast schon begonnen. Sie zog eine Leinentunika und eine Aertex-Bluse an – tiefrot, ihre Lieblingsbluse – und verließ das Haus, um Derry auszuführen.
Derry war nicht ihr Hund. Sie durfte keinen haben, und um ihren Unmut darüber nicht einschlafen zu lassen, ging sie jeden Morgen mit dem sehr betagten Bullterrier der Nachbarn um den Block. Ein weiterer Grund, ihn auszuführen, war das Haus, in dem er lebte und das sie faszinierend fand. Es war groß – man konnte es von ihrem Garten aus sehen –, aber völlig anders als ihres und die ihrer Freundinnen. Zum einen gab es dort keine Kinder. Der Diener, der ihr die Tür öffnete, musste Derry immer erst holen gehen, was ihr Zeit gab, das Foyer mit dem schwarz-weißen Marmor zu den offenen Doppeltüren einer Galerie zu durchqueren, von der aus man in den Salon hinuntersah. Jeden Morgen herrschte dort die verschwenderische Unordnung eines rauschenden nächtlichen Fests: Es roch nach ägyptischen Zigaretten – wie diejenigen, die Tante Rachel rauchte –, und überall standen Blumen, die fast schon stanken, im Frühling Hyazinthen, jetzt Lilien, im Winter Nelken und Rosen. Unzählige farbige Seidenkissen lagen umher, und Dutzende von Gläsern und offenen Konfektschachteln waren über den ganzen Raum verstreut, manchmal auch Kartentische mit Spielkarten, Schreibblöcken und Bleistiften mit Quasten. Immer herrschte dort Dämmerlicht, die cremefarbenen Seidenvorhänge waren halb geschlossen. In Louises Vorstellung waren die Besitzer – die sie nie sah – phänomenal reich, vermutlich fremdländisch und möglicherweise ziemlich dekadent.
Gassigehen mit Derry, der mit seinen angeblich dreizehn Jahren einundneunzig zählte, laut der von ihr erstellten Alterstabelle für Hunde, gestaltete sich etwas langweilig, denn mehr als einen kurzen Spaziergang mit häufigen, endlos langen Zwischenhalten an praktisch jedem Laternenpfahl schaffte er nicht. Aber es gefiel ihr, einen Hund an der Leine zu führen. Dann konnte sie die anderen Passanten mit Besitzerstolz anlächeln, damit sie dachten, er gehöre ihr. Außerdem gab sie die Hoffnung nicht auf, dass jemand von den Hausbewohnern oder einer ihrer dekadenten Freunde im Salon besinnungslos zusammengebrochen wäre und sie ihn näher in Augenschein nehmen könnte. Der Spaziergang musste kurz sein. Vor dem Frühstück um Viertel vor neun sollte sie nämlich noch eine Stunde üben und davor kalt baden, denn nach Dads Ansicht tat einem ein kaltes Bad richtig gut. Sie war vierzehn, und manchmal kam sie sich jung und tatendurstig vor, dann wieder fühlte sie sich altersmatt – zu erschöpft, um irgendetwas zu tun, das von ihr erwartet wurde.
Nachdem sie Derry zurückgebracht hatte, begegnete sie dem Milchmann. Sein Pony Peggy kannte sie gut, sie hatte nämlich einmal auf einem Streifen Stoff Gras für sie gezogen, weil Peggy nie aufs Land kam, dabei wusste doch jeder, der Black Beauty gelesen hatte, wie schlimm es für Pferde war, nie auf einer Weide zu stehen.
»Famoser Morgen«, sagte Mr. Pierce, als sie Peggys Nüstern streichelte.
»In der Tat.«
»Manch jungen Morgen sah ich flammend steigen«, wisperte sie im Weitergehen. Ihr zukünftiger Ehemann würde sie bemerkenswert finden, weil ihr zu allem ein Shakespeare-Zitat einfiel, wirklich zu allem. Andererseits würde sie vielleicht nie heiraten, denn Polly hatte gesagt, Sex sei langweilig, und ohne den könne man sich eigentlich nicht auf eine Ehe einlassen. Außer natürlich, Polly täuschte sich. Das tat sie oft, und Louise hatte bemerkt, dass sie Sachen als langweilig bezeichnete, die sie ablehnte. »Davon verstehst du nichts, George«, fügte sie hinzu. So nannte ihr Vater jeden, den er nicht kannte – das heißt jeden Mann –, und der Satz gehörte zu seinen Lieblingssprüchen. Sie läutete dreimal an der Haustür, damit Phyllis wusste, wer draußen stand. »Sprecht nicht, wo treue Geister eng verschlungen, von Hindernissen.« Es klang etwas widerwillig, mit diesen Worten eine Hochzeit zu erlauben, aber auch edel. Wäre sie nur Ägypterin, dann könnte sie Teddy heiraten, so wie die Pharaonen früher; immerhin war Kleopatra das Ergebnis von sechs Generationen Inzest, was immer Inzest sein mochte. Nicht zur Schule zu gehen hatte den ganz großen Nachteil, dass man völlig andere Sachen wusste. In den Weihnachtsferien hatte sie einen dummen Fehler begangen und ihrer Cousine Nora, die eine Schule besuchte, gegenüber behauptet, dass Sex ein alter Hut sei, was nur besagte, dass sie überhaupt keine Ahnung hatte. Gerade wollte sie noch einmal läuten, da öffnete Phyllis die Tür.
***
»Louise könnte hereinkommen.«
»Unsinn. Sie wird mit dem Hund unterwegs sein.« Bevor sie noch ein Wort erwidern konnte, drückte er seinen Mund mit dem kleinen borstigen Schnurrbart auf ihren. Nach einer Minute zog sie ihr Nachthemd hoch, und er lag auf ihr. »Mein Liebling Villy«, sagte er dreimal, bevor er kam. Der Name Viola hatte ihm nie über die Lippen gehen wollen. Als er fertig war, seufzte er tief, nahm seine Hand von ihrer linken Brust und küsste sie auf den Hals.
»Chinesischer Tee. Ich weiß nicht, wie es dir gelingt, immer nach Veilchen und chinesischem Tee zu duften. War’s schön?«, fragte er noch. Das fragte er immer.
»Sehr schön.« Sich selbst gegenüber bezeichnete sie das als fromme Lüge, und im Lauf der Jahre hatten die Worte fast schon einen wohligen Beiklang angenommen. Sie liebte ihn, natürlich, was sollte sie also sonst antworten? Schließlich war Geschlechtsverkehr etwas für Männer. Frauen, zumindest anständige Frauen, sollten sich nichts daraus machen, aber ihre eigene Mutter hatte ihr zu verstehen gegeben (das eine, einzige Mal, als sie vage auf das Thema zu sprechen kam), dass eine Frau keinen gravierenderen Fehler begehen könne, als ihren Ehemann abzuweisen. Also hatte sie ihn nie abgewiesen, und wenn sie vor achtzehn Jahren neben dem durchdringenden Schmerz auch einen gewissen Schock darüber empfunden hatte, was es damit tatsächlich auf sich hatte, war dieses Gefühl durch Übung einem duldsamen Widerwillen gewichen. Gleichzeitig diente das Ganze auch als eine Art Liebesbeweis, also musste es in Ordnung sein.
»Lass mir die Badewanne einlaufen, mein Schatz«, rief sie ihm nach, als er das Zimmer verließ.
»Aber gerne.«
Sie schenkte sich eine zweite Tasse Tee ein, aber die war kalt. Also stand sie auf, öffnete die Türen des großen Mahagonischranks und überlegte, was sie anziehen sollte. Am Vormittag musste sie mit Nanny und Lydia zu Daniel Neal Sommergarderobe kaufen gehen, mittags war sie mit Hermione Knebworth zum Lunch verabredet, und anschließend wollte sie noch einmal zu ihr ins Geschäft. Vielleicht konnte sie ein oder zwei Abendkleider erstehen – zu dieser Jahreszeit, bevor ganz London für den Rest des Sommers wegfuhr, gab es bei Hermione meist ein paar Stücke im Saisonverkauf. Dann würde sie nicht umhinkommen, Mummy zu besuchen. Das hatte sie gestern nicht geschafft, allerdings konnte sie nicht lange bleiben, denn sie musste nach Hause zurück und sich fürs Theater und das Essen mit den Warings umziehen. Aber man konnte Hermiones Laden nicht betreten, ohne sich wenigstens zu bemühen, elegant auszusehen. Sie entschied sich für das hellbeige Leinen mit der marineblauen Rips-Paspelierung, das sie im Jahr zuvor bei ihr gekauft hatte.
Ich führe genau das Leben, das von mir erwartet wird, dachte sie (es war kein neuer Gedanke, sondern fast schon eine Beschwörung): was die Kinder erwarten, was Mummy immer schon erwartet hat und natürlich was Edward erwartet. So ist es eben, wenn man heiratet, und die wenigsten heiraten einen Mann, der so gut aussieht und so nett ist wie Edward. Nach einer sehr früh getroffenen Entscheidung hatte sie jede weitere Wahlfreiheit aufgegeben und damit ihr Leben um die erstrebenswerte Dimension der Pflichterfüllung erweitert: Sie war, als ernsthafter Mensch, zu einem oberflächlicheren Leben verurteilt, als ihrem Wesen entsprochen hätte (wenn alles sehr viel anders gekommen wäre). Sie war nicht unglücklich – sie hätte nur sehr viel mehr sein können.
Als sie über den Treppenabsatz zum großen Ankleidezimmer ihres Mannes mit der Badewanne ging, hörte sie über ihr Lydia schreien, was bedeutete, dass ihr von Nanny die Zöpfe geflochten wurden. Unter ihr setzte auf dem Klavier eine Etüde in C-Dur von Hans von Bülow ein. Louise übte.
***
Im Speisezimmer gab es Terrassentüren, die in den Garten hinausführten. Die Möbel beschränkten sich auf das Wesentliche: acht sehr schöne Chippendale-Stühle – ein Hochzeitsgeschenk von Edwards Vater –, ein großer, im Moment weiß gedeckter Tisch aus Lebbekbaumholz, ein Sideboard mit elektrischen Wärmeplatten, auf denen jetzt Nierchen, Rührei, Tomaten und Speck bereitstanden, cremefarbene Wände, einige Bilder aus Furnierintarsien, Wandleuchter im Pseudo-Adamstil mit kleinen muschelförmigen Schirmen, ein Gasfeuer im Kamin und ein abgewetzter alter Ledersessel, in den Louise sich gerne zum Lesen kuschelte. Insgesamt war es ein auf dezente Weise hässlicher Raum, was aber niemand bemerkte außer Louise, die ihn trist fand.
Lydia saß da, Messer und Gabel wie die sich öffnende Tower Bridge auf dem Tisch aufgestützt, während Nan Tomaten und Speck für sie zerschnitt. »Wenn Sie mir Nierchen geben, spucke ich sie aus«, hatte Lydia zuvor gesagt. Ein Großteil der frühmorgendlichen Unterhaltung zwischen ihr und Nan bestand aus beiderseitigen Drohungen, aber da keine der beiden es je darauf ankommen ließ, blieben die möglichen Konsequenzen unbekannt. Schließlich wusste Lydia genau, dass Nan nicht im Traum daran denken würde, den Besuch bei Daniel Neal abzusagen, und Nan ihrerseits konnte sich darauf verlassen, dass Lydia in Daddys Gegenwart niemals ein Stück Niere oder sonst etwas ausspucken würde. Er, Daddy, hatte sich wie jeden Morgen über sie gebeugt und ihr einen Kuss auf den Scheitel gegeben, und sie hatte seinen wunderbaren Holzgeruch gemischt mit Lavendelwasser eingeatmet. Jetzt saß er am Kopfende des Tisches, vor sich einen Teller mit allem und, an das Marmeladenglas gelehnt, den Telegraph. Mit Nierchen hatte er kein Problem. Er schnitt sie auf, und das scheußliche, eklige Blut lief heraus, das er mit gebratenem Brot auftunkte. Sie trank ganz laut von ihrer Milch, damit er aufschaute. Im Winter aß er arme tote Vögel, die er geschossen hatte: Rebhühner und Fasane, deren kleine schwarze Klauen fest zusammengekrampft waren. Er blickte nicht auf, aber Nan stellte den Becher aus ihrer Reichweite. »Iss dein Frühstück«, sagte sie in der ganz besonderen leisen Stimme, die Lydia nur von den Mahlzeiten im Esszimmer kannte.
Mummy kam herein. Sie lächelte Lydia an und ging um den Tisch, um ihr einen Kuss zu geben. Sie roch nach Heu und irgendeiner Blume, bei der Lydia immer niesen musste, aber nur fast. Mummy hatte wunderschöne Locken, allerdings mit ein bisschen Weiß darin, was ihr Sorgen machte, weil Lydia nicht wollte, dass Mummy je starb, was bei Leuten mit weißen Haaren leicht passieren konnte.
»Wo ist Louise?«, fragte Mummy, was eigentlich dumm war, weil man sie noch üben hörte.
»Ich gebe ihr Bescheid«, sagte Nan.
»Danke, Nan. Vielleicht ist die Uhr im Salon stehen geblieben.«
Mummy aß zum Frühstück Grape Nuts, Kaffee und Toast und bekam ein eigenes Kännchen mit Sahne. Sie öffnete ihre Post, das waren Briefe, die durch die Haustür gesteckt wurden und über den gebohnerten Boden schlitterten. Einmal hatte Lydia auch Post bekommen: an ihrem letzten Geburtstag, als sie sechs wurde. Später war sie dann auf einem Elefanten geritten, hatte Tee in ihre Milch bekommen und ihr erstes Paar geschnürte Straßenschuhe getragen. Für sie war es der schönste Tag in ihrem ganzen Leben, was wirklich etwas hieß, weil sie ja schon so viele Tage gelebt hatte. Das Klavierspielen hatte aufgehört, und Louise kam herein, gefolgt von Nan. Sie hatte ihre Schwester sehr lieb. Louise war unglaublich alt und trug im Winter richtige Strümpfe.
»Mummy«, sagte Lou, »du triffst dich mittags mit jemandem. Das sehe ich an deiner Garderobe.«
»Ja, mein Schatz, aber ich komme noch mal zu dir, bevor Daddy und ich abends ausgehen.«
»Wohin?«
»Ins Theater.«
»Was seht ihr euch an?«
»Ein Stück, das Der Kaiser von Amerika heißt. Von George Bernard Shaw.«
»Ihr habt es gut!«
Edward blickte aus seiner Zeitung auf. »Mit wem?«
»Den Warings. Vorher treffen wir uns zum Essen. Punkt sieben. Smoking.«
»Sag Phyllis, sie soll meine Sachen rauslegen.«
»Ich darf nie ins Theater.«
»Louise! Das ist nicht wahr. Du gehst immer zu Weihnachten. Und zu deinem Geburtstag.«
»Geschenke zählen nicht. Ich meine, ich gehe nicht ins Theater, als wäre es etwas Normales. Wenn ich Schauspielerin werden will, sollte ich aber.«
Villy achtete nicht auf sie, ihre Augen waren auf die erste Seite der Times gerichtet. »Ach je. Mollie Strangways Mutter ist gestorben.«
»Wie alt war sie?«, fragte Lydia.
Villy sah auf. »Ich weiß es nicht, mein Schatz. Aber wahrscheinlich schon ziemlich alt.«
»Waren ihre Haare ganz weiß?«
»Woher wissen sie bei der Times, welche Gestorbenen sie in die Zeitung setzen sollen?«, fragte Louise. »Ich wette, dass auf der Welt sehr viel mehr Menschen sterben, als auf eine Seite passen. Wonach entscheiden sie, welche sie reinnehmen?«
»Das entscheidet nicht die Zeitung«, erklärte ihr Vater. »Leute bezahlen dafür, dort zu stehen.«
»Wenn du der König wärst, müsstest du auch dafür bezahlen?«
»Nein – bei ihm ist es etwas anders.«
Lydia hatte aufgehört zu essen. »Wie alt leben Leute?«, fragte sie, aber so leise, dass offenbar keiner sie hörte.
Villy, die aufgestanden war, um sich Kaffee nachzuschenken, bemerkte Edwards leere Tasse und füllte sie nach. »Heute hat Phyllis ihren freien Nachmittag«, sagte sie. »Ich kümmere mich um deine Garderobe. Versuch, nicht zu spät zu kommen.«
»Wie alt leben Mütter?«
Als Villy den Gesichtsausdruck ihrer Tochter bemerkte, sagte sie schnell: »Richtig uralt. Denk an meine Mutter – und an Daddys. Sie sind beide schrecklich alt und immer noch gesund und munter.«
»Aber natürlich könnten sie jederzeit ermordet werden – das kann in jedem Alter passieren. Denk an Tybalt. Und an die Prinzen im Tower.«
»Was heißt ermordet? Louise, was heißt ermordet?«
»Oder im Meer umkommen. Nach einem Schiffbruch«, fügte sie verträumt hinzu. Was würde sie nicht dafür geben, Schiffbruch zu erleiden!
»Louise, halt den Mund. Siehst du nicht, was du damit anrichtest?«
Aber es war zu spät. Lydia war in haltloses Schluchzen ausgebrochen. Villy nahm sie auf den Schoß und drückte sie fest an sich. Vor Scham wurde Louise ganz heiß, und sie machte ein trotziges Gesicht.
»Keine Sorge, mein Küken. Du wirst sehen, ich werde ganz uralt, und du bist dann schon richtig erwachsen und hast fabelhafte große Kinder, genau wie du, die Schnürschuhe tragen …«
»Und eine Reitjacke?« Die Tränen liefen ihr zwar noch übers Gesicht, aber sie wünschte sich eine Reitjacke – aus Tweed, hinten geteilt und mit Taschen, die sie beim Reiten auf ihren Pferden anziehen konnte –, und der Moment schien günstig.
»Das sehen wir noch.« Sie setzte Lydia wieder auf ihren Stuhl, und Nan sagte: »Trink deine Milch aus.« Das tat sie dann auch, weil sie Durst hatte.
»Und was ist mit mir?«, fragte Edward sie, nachdem er Louise einen strengen Blick zugeworfen hatte. »Wünschst du dir nicht, dass ich auch ewig lebe?«
»Nicht so sehr. Aber natürlich schon.«
Louise sagte: »Also, ich wünsche mir das. Wenn du über achtzig bist, fahre ich dich zahnlos und sabbernd im Rollstuhl durch die Gegend.«
Daraufhin lachte ihr Vater dröhnend, wie sie es gehofft hatte, sodass sie wieder in seiner Gunst stand.
»Darauf freue ich mich jetzt schon.« Er stand auf und verließ den Raum, die Zeitung in der Hand.
»Er geht auf die Toilette«, erklärte Lydia. »Um sein großes Geschäft zu machen.«
»Das genügt«, sagte Nanny scharf. »Über solche Dinge sprechen wir bei Tisch nicht.«
Lydia sah ausdruckslos zu Louise, ahmte mit dem Mund aber lautlos das Kollern eines Truthahns nach. Wie erhofft, prustete Louise los.
»Kinder, Kinder«, sagte Villy matt. Manchmal war Lydia zum Schreien komisch, aber Nannys Selbstachtung musste gewahrt werden.
»Geh nach oben, mein Schatz. Wir fahren bald.«
»Um wie viel Uhr sollen wir fertig sein, Madam?«
»Gegen zehn, Nanny.«
»Komm, guck dir meine Pferde an.« Lydia rutschte von ihrem Stuhl und lief zur Terrassentür, die Louise ihr öffnete.
»Komm schon.« Sie griff nach Louises Hand.
Sie hatte ihre Pferde im Garten ans Geländer gebunden. Es handelte sich um lange Holzstangen in unterschiedlichen Farben: ein Platanenstecken als der Schecke, ein silbriger Stock als der Grauschimmel, ein Buchenast, der aus Sussex stammte, als der Braune. Alle hatten kunstvoll aus Schnur geflochtene Halfter, neben jedem stand in einem Blumentopf Rasenschnitt, und auf einem Stück Karton war in farbiger Kreide ihr Name geschrieben. Lydia band den Grauschimmel los und trabte durch den Garten. Hin und wieder hüpfte sie unbeholfen in die Höhe und tadelte dann ihr Ross: »Du sollst nicht so bocken!«
»Schau, wie ich reiten kann«, rief sie. »Lou! Schau mir zu!«
Aber Louise, die Nannys Unmut fürchtete und noch beinahe eine Stunde Zeit hatte, ehe Miss Milliment kam, wollte vorher unbedingt Überredung auslesen und sagte nur: »Das habe ich doch, ich habe dir zugeschaut«, und ging – genauso schlimm wie ein Erwachsener.
***
Nachdem Edward Villy im Flur einen Kuss gegeben und Phyllis ihm seinen grauen Homburg gereicht hatte – zu anderen Jahreszeiten half sie ihm in den Mantel –, nahm er sein Exemplar des Timber Trades Journal und verließ das Haus. Vor der Tür erwartete ihn der glänzende schwarze Buick. Wie immer sah er Brackens massige Gestalt unbewegt wie eine Wachsfigur hinter dem Steuer sitzen, bei Edwards Erscheinen aber sprang er mit einem Satz aus dem Wagen, als hätte ihn ein Streifschuss getroffen, und stellte sich stramm neben die hintere Tür, die er für Edward öffnete.
»Morgen, Bracken.«
»Guten Morgen, Sir.«
»Zu den Lagerhallen.«
»Sehr wohl, Sir.«
Nach diesem Wortwechsel – jeden Morgen derselbe, sofern Edward kein anderes Ziel nannte – wurde nichts mehr gesagt. Edward ließ sich auf der Rückbank nieder und blätterte abwesend in den Seiten seiner Zeitschrift, ohne darin zu lesen. In Gedanken ging er den Tag durch. Eine oder zwei Stunden im Büro, um seine Post zu erledigen, dann würde er sehen, wie sich die Furnierproben von dem Ulmenholz machten, das sie aus den Überresten der alten Waterloo Bridge gekauft hatten. Nach einem Jahr Lagerung hatten sie vergangene Woche die ersten Blätter geschnitten, und jetzt endlich würden sie herausfinden, ob der alte Herr mit seiner Ahnung richtiggelegen oder sie ihn getrogen hatte. Das würde spannend werden. Dann Lunch in seinem Club mit ein paar Männern von der Great Western Railway, das höchstwahrscheinlich zu einem ansehnlichen Auftrag für eine Mahagoni-Lieferung führen würde. Nachmittags eine Besprechung der Direktoren – das heißt mit dem alten Herrn und seinem Bruder –, seine Briefe unterschreiben, dann blieb vielleicht noch Zeit für eine Tasse Tee mit Denise Ramsay, die gleich zwei Vorzüge aufzuweisen hatte: einen Mann, der häufig auf Geschäftsreise ging, sowie keine Kinder. Aber wie alle Vorzüge hatten auch diese ihre Nachteile: Denise war zu unabhängig und deswegen etwas zu sehr in ihn verliebt. Schließlich sollte aus der Sache nichts Ernstes werden, wie sie es nannte. Vielleicht würde für den Besuch aber auch gar keine Zeit bleiben, weil er nach Hause und sich fürs Theater umziehen musste.
Hätte jemand ihn gefragt, ob er seine Frau liebe, hätte Edward das natürlich bejaht. Er hätte nicht hinzugefügt, dass Villy die sinnlichen Freuden des Ehelebens trotz achtzehn Jahren relativen Glücks und dreier großartiger Kinder nicht goutierte. Das kam bei Ehefrauen häufiger vor – ein armer Kerl im Club, Martyn Slocombe-Jones, hatte ihm einmal spätabends nach einer Runde Billard und ziemlichen Mengen herausragend guten Ports gestanden, seine Frau verabscheue das Ganze derart, dass sie es nur gestatte, wenn sie ein Kind wolle. Dabei war sie eine verdammt attraktive Frau und eine wunderbare Ehefrau, wie Martyn betonte. In jeder anderen Hinsicht. Sie hatten fünf Kinder, und Martyn glaubte nicht, dass sie sich auf ein sechstes einlassen würde. Pech für ihn. Als Edward ihm vorschlug, er solle sich doch anderweitig Trost suchen, sah Martyn ihn nur aus seinen traurigen braunen Augen an und sagte: »Aber ich liebe sie, alter Junge, habe sie immer schon geliebt und nie eine andere angesehen. Du weißt doch, wie es ist.« Und Edward, der es nicht wusste, sagte: »Ja, natürlich.« Zumindest hatte er durch das Gespräch erfahren, dass er von Marcia Slocombe-Jones die Finger lassen konnte. Doch das störte ihn nicht weiter. Sie hätte ihm zwar gefallen, aber es gab so viele andere hübsche Frauen zum Flirten. Was hatte er doch für Glück gehabt! Dass er nicht nur lebend aus Frankreich zurückgekehrt war, sondern auch noch relativ unversehrt! Im Winter machte ihm die Lunge etwas zu schaffen, weil er in den Schützengräben gelebt hatte, über denen wochenlang das Gas hing, aber sonst … Er war zurückgekommen, direkt ins Familiengeschäft eingestiegen, hatte bei einer Party Villy kennengelernt und sie geheiratet, sobald ihr Vertrag mit der Balletttruppe ausgelaufen war und sie sich dem Verdikt des alten Herrn gefügt hatte, dass ihre Karriere mit der Hochzeit ein Ende finden müsse. »Du kannst keine Frau heiraten, die etwas anderes im Kopf hat. Wenn die Frau nicht die Ehe als ihre Hauptaufgabe begreift, wird die Ehe nie gut.«
Seine Einstellung war natürlich viktorianisch bis auf die Knochen, aber trotzdem, ganz unrecht hatte er nicht. Jedes Mal, wenn Edward seine Mutter betrachtete – was er selten tat, dann aber mit großer Zuneigung –, sah er das vollendete Abbild dieser Anschauung: eine Frau, die abgeklärt alle familiären Pflichten erfüllte und sich gleichzeitig ihre jugendlichen Leidenschaften bewahrte – für ihren Garten, den sie über alles liebte, und für die Musik. Mit ihren gut siebzig Jahren konnte sie noch jederzeit Doppelkonzerte mit professionellen Musikern spielen. Da er nichts von den dunkleren, komplexeren Wesenszügen verstand, die Menschen voneinander unterscheiden, konnte er nicht nachvollziehen, weshalb Villy nicht ebenso glücklich und erfüllt sein sollte wie die Duchy. (Die viktorianische Vorliebe seiner Mutter für eine schlichte Lebensweise – kein üppiges Essen, kein Firlefanz und nichts Prätentiöses, weder für sich noch im Haushalt – hatte ihr schon vor langer Zeit den Spitznamen »Duchess« eingetragen, den ihre Kinder zu Duch verkürzt und ihre Enkelkinder wieder zu Duchy erweitert hatten.) Er hatte Villy nie daran gehindert, ihren Interessen nachzugehen: ihr Wohltätigkeitskram, das Reiten und Skifahren, ihr Spleen, die verschiedensten Musikinstrumente zu erlernen, ihre Handarbeiten – Spinnen, Weben und so weiter. Und wenn er an die Ehefrauen seiner Brüder dachte – Sybil war ihm zu hochgestochen und Zoë zu anspruchsvoll –, kam er zu dem Schluss, dass er es gar nicht so schlecht getroffen hatte …
***
Louises Cousine Polly Cazalet kam schon eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn, weil sie und Louise Wonder Cream hergestellt hatten, eine Gesichtscreme aus Eiweiß, gehackter Petersilie, Zaubernuss und einem Tropfen Koschenille für die rosa Farbe. Heute brachte Polly die hübschen, von ihr gestalteten Etiketten mit, und die wollten die beiden jetzt auf die ganzen Tiegel kleben, die sie von ihren Müttern bekommen hatten. Momentan bewahrten sie die Creme in einer Puddingschüssel im Gartenschuppen auf. Sie sollte an ihre Tanten und Cousinen verkauft werden und an Phyllis zu einem billigeren Preis, weil sie wussten, dass die nicht viel Geld hatte. Außerdem mussten die Tiegel sowieso unterschiedlich viel kosten, weil sie praktisch alle von anderer Größe und Form waren. Louise hatte sie ausgespült, und jetzt standen sie ebenfalls im Schuppen. Sie hatten alles dorthin gebracht, weil Louise, als Emily beim Einkaufen gewesen war, aus der Speisekammer sechs Eier stibitzt hatte sowie den Rührbesen. Die Eigelbe hatten sie zum Teil an Louises Schildkröte verfüttert, die sich aber nichts daraus gemacht hatte, nicht einmal vermischt mit Löwenzahn (ihrem Lieblingsfressen) aus Pollys Garten.
»Ich finde, die sieht komisch aus.«
Sie untersuchten die Creme noch einmal genauer.
»Ich glaube, die Koschenille war keine so gute Idee, sie war ein bisschen zu grün.«
»Dummkopf, mit Koschenille wird alles rosa.«
Polly errötete. »Ich weiß«, schwindelte sie. »Das Schlimme ist, sie ist ganz flüssig geworden.«
»Deswegen ist sie trotzdem gut für die Haut. Außerdem wird sie im Lauf der Zeit von selbst fester.«
Polly steckte den mitgebrachten Abfülllöffel in die Mischung. »Das Grüne ist gar keine Petersilie, das ist eine dicke Schicht.«
»Die setzt sich doch immer ab.«
»Wirklich?«
»Natürlich. Denk an Sahne.«
»Sollten wir sie nicht an uns selbst ausprobieren, bevor wir sie verkaufen?«
»Jetzt hör auf, ständig herumzunörgeln. Du klebst die Etiketten auf, ich übernehme das Abfüllen. Die Etiketten sind wirklich klasse«, fügte sie hinzu, und Polly wurde wieder rot. Auf den Schildchen stand »Wonder Cream« und darunter »Nachts großzügig auftragen. Bewirkt Wunder für Ihr Aussehen«. Auf einige Gläschen passten sie allerdings nicht drauf.
Miss Milliment traf ein, bevor sie fertig waren. Sie taten, als hörten sie die Glocke nicht, aber Phyllis kam, um es ihnen auszurichten.
»Sinnlos, ihr etwas zu verkaufen«, brummelte Louise.
»Ich dachte, du hättest gesagt …«
»Sie meine ich doch nicht. Ich meine Miss M.«
»Guter Gott, nein. Eulen nach Athen wäre das.« Polly brachte Sachen oft durcheinander.
»Eulen nach Athen würde bedeuten, dass Miss M. bildschön ist.« Darüber schüttelten sie sich beide vor Lachen.
Miss Milliment, eine freundliche und ungemein intelligente Frau, habe ein Gesicht wie eine riesige alte Kröte, hatte Louise einmal gesagt. Als ihre Mutter sie wegen der unfreundlichen Bemerkung tadelte, erwiderte Louise, dass sie Kröten gern möge. Aber sie wusste selbst, dass die Antwort unaufrichtig war, weil ein Gesicht, das sich für eine Kröte gehörte, bei einem Menschen eher unpassend wirkte. Danach sprachen sie und Polly nur noch unter sich über Miss Milliments – zweifellos erstaunliches – Aussehen. Sie hatten sich für ihre Lehrerin ein von Tragödien bestimmtes Leben ausgedacht, oder vielmehr mehrere Leben, weil sie sich nicht über die Art der mutmaßlichen Schicksalsschläge einigen konnten. Außer Zweifel stand allerdings Miss Milliments betagtes Alter: Sie war Villys Gouvernante gewesen, und die hatte eingeräumt, dass sie ihr bereits damals, vor weiß Gott wie vielen Jahren, alt erschienen war. Sie sagte »Chymie« und natürlich »Chymikus« und hatte Louise einmal erzählt, dass sie in ihrer Jugend wilde Rosen in der Cromwell Road gepflückt hatte. Sie roch nach ungelüfteten alten Kleidern, was man besonders wahrnahm, wenn man sie küsste, wozu Louise sich, als Art Buße, seit der Krötenbemerkung zwang. Sie wohnte in Stoke Newington und kam an fünf Vormittagen die Woche, um die beiden Mädchen drei Stunden lang zu unterrichten, freitags blieb sie zum Lunch. Heute trug sie ihr flaschengrünes Kostüm aus Doublejersey und einen kleinen flaschengrünen Strohhut mit einem Ripsband, der direkt über ihrem sehr festen, fettigen Knoten saß. Zu Beginn des Unterrichts lasen sie, wie immer, eineinhalb Stunden laut Shakespeare.
Heute kamen sie zu den letzten beiden Akten von Othello, dessen Part Louise übernahm. Polly, die weibliche Rollen lieber mochte – und offenbar nicht merkte, dass es sich dabei nicht um die besten handelte –, las die Desdemona, und Miss Milliment war Iago und Emilia und alle anderen. Louise, die immer heimlich vorauslas, hatte Othellos letzte Ansprache auswendig gelernt, was wahrscheinlich nur gut war, denn sobald sie zu der Stelle
In Euren Briefen, bitt ich,
Wenn Ihr von diesem Unheil Kunde gebt,
Sprecht von mir, wie ich bin, verkleinert nichts,
Noch setzt ihm Bosheit zu.
kam, traten ihr Tränen in die Augen, und sie hätte nicht weiterlesen können. Am Ende fragte Polly: »Sind die Leute wirklich so?«
»Was meinst du mit ›so‹, Polly?«
»Wie Iago, Miss Milliment.«
»Ich denke nicht, dass viele Menschen so sind. Aber natürlich gibt es möglicherweise mehr, als wir meinen, denn jeder Iago braucht für seine Verruchtheit einen Othello.«
»Wie bei Mrs. Simpson und König Edward?«
»Natürlich nicht. Polly, du bist dumm! Der König war in Mrs. Simpson verliebt – das ist etwas völlig anderes. Er hat für sie auf alles verzichtet, dabei hätte er für alles auf sie verzichten können.«
Polly errötete. »Mr. Baldwin könnte Iago sein, der schon«, murmelte sie.
Miss Milliment sagte wogenglättend: »Wir können die beiden Situationen nicht ganz miteinander vergleichen, obwohl es zweifellos ein interessanter Gedanke ist, Polly. Und jetzt, glaube ich, sollten wir uns mit unserer Geografie beschäftigen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Landkarte, die ihr für mich gezeichnet habt. Louise, holst du bitte den Atlas?«
***
»Ich finde, es steht Ihnen sehr gut.«
»Es ist bildschön. Nur habe ich diese Farbe noch nie getragen.«
Villy probierte gerade eines von Hermiones Schnäppchen: ein Kleid aus lindgrünem Chiffon mit einem Mieder, das einen tiefen, mit Goldperlen besetzten V-Ausschnitt hatte und ein kleines Plisseecape, das von den perlenbesetzen Trägern herabfloss. Der Rock war schlicht, aber geschickt geschnitten mit Bahnen, die eng an ihren Hüften anlagen und sich zu einem schwingenden Rock weiteten.
»Ich finde, Sie sehen hinreißend aus. Fragen wir doch Miss MacDonald nach ihrer Meinung.«
Schon trat Miss MacDonald hinzu. Sie war eine Dame unbestimmten Alters, die immer einen grauen Flanellrock mit Nadelstreifen und dazu eine Wildseidenbluse trug, Hermione treu ergeben war und in deren häufigen Abwesenheiten das Geschäft leitete. Hermione führte ein geheimnisvolles Leben, das aus Partys, Wochenenden auf dem Land und winterlichen Jagden bestand. Darüber hinaus richtete sie in Mayfair nette Wohnungen ein, die sie kaufte und zu horrenden Preisen an Menschen vermietete, die sie auf Partys kennenlernte. Jeder und jede verehrte sie: Ihr Ruf beruhte auf allumfassender Vergötterung. Der jeweils aktuelle Liebhaber, wer immer das sein mochte, verlor sich in einer Schar angeblich verzweifelter, angeblich hoffnungsloser Verehrer. Sie war keine Schönheit, aber stets hinreißend und gepflegt, und hinter ihrem schleppenden Tonfall verbargen sich ein kluger Kopf und Tollkühnheit bei der Jagd und wann immer es sonst von ihr verlangt wurde. Edwards Bruder Hugh war während des Kriegs in sie verliebt gewesen – er zählte angeblich zu den einundzwanzig Männern, die ihr in dieser Zeit einen Heiratsantrag machten –, aber sie hatte Knebworth geheiratet und sich kurz nach der Geburt ihres Sohnes von ihm scheiden lassen. Im Umgang mit Ehefrauen hatte sie großes Geschick, aber Villy war ihr aufrichtig ans Herz gewachsen, weshalb sie ihr immer einen besonders günstigen Preis machte.
Villy stand fast wie in Trance. Das zarte Kleid schien sie in eine grazile, exotische Fremde zu verwandeln. Dann bemerkte sie den Ausdruck der Billigung auf Miss MacDonalds Gesicht.
»Wie für Sie gemacht, Mrs. Cazalet.«
»Das Nachtblaue wäre aber so viel praktischer.«
»Ach, Lady Knebworth, wie wäre es mit der Café-au-lait-farbenen Spitze?«
»Eine fabelhafte Idee, Miss MacDonald. Holen Sie es doch.«
Sobald Villy die kaffeefarbene Spitze sah, wusste sie, dass sie es haben wollte. Sie wollte alle, und dazu gehörte auch ein Kleid aus weinroter Moiréseide mit großen Puffärmeln aus Ripsrosetten, das sie zuvor schon anprobiert hatte.
»Die reinste Qual, nicht wahr?« Hermione hatte bereits beschlossen, dass Villy, die gekommen war, um zwei Kleider zu kaufen, drei kaufen sollte, und da sie Villy kannte, war es unerlässlich, dass sie auf eines verzichtete. Ein Gespräch in vernehmlichem Flüsterton begann.
»Wie viel kosten sie?«
»Wie viel, Miss MacDonald?«
»Das Moiré zwanzig, das Chiffon fünfzehn, die Spitze und die nachtblaue Crêpe könnten jeweils bei sechzehn liegen. Ist das korrekt, Lady Knebworth?«
Kurz herrschte Stille, während Villy vergeblich versuchte, die Zahlen zu addieren. »Ich kann nicht vier nehmen, das kommt überhaupt nicht infrage.«
»Ich finde«, sagte Hermione bedächtig, »das Blaue ist etwas zu auffällig für Sie, aber die anderen drei stehen Ihnen ausgezeichnet. Wie wäre es, wenn wir für das Moiré und die Spitze jeweils fünfzehn ansetzen und für das Chiffon als Dreingabe zehn? Wie viel macht das insgesamt, Miss MacDonald?« (Das wusste sie zwar genau, aber sie wusste auch, dass Kopfrechnen nicht zu Villys Stärken gehörte.)
»Das sind insgesamt vierzig, Lady Knebworth.«
»Ich nehme sie«, sagte Villy, noch bevor sie weiter überlegen konnte. »Ausgesprochen leichtsinnig, aber ich kann nicht widerstehen. Sie sind alle wunderschön. Allerdings weiß ich nicht, was Edward dazu sagen wird.«
»Er wird begeistert sein, wenn er Sie darin sieht. Lassen Sie sie doch einpacken, Miss MacDonald, ich bin mir sicher, Mrs. Cazalet möchte sie gleich mitnehmen.«
»Eines davon werde ich heute Abend tragen. Vielen Dank, Hermione.«
Im Taxi auf der Fahrt zu Mummy dachte sie: Ich sollte mich schämen! Früher habe ich nie mehr als fünf Pfund für ein Kleid ausgegeben. Aber sie werden ewig halten, und ich habe es satt, immer dasselbe zu tragen. Außerdem gehen wir häufig aus, fügte sie im Stillen hinzu, als müsste sie sich jemand anderem gegenüber rechtfertigen, und beim Schlussverkauf im Januar habe ich mich wirklich sehr beherrscht und nur Haushaltswäsche gekauft. Und die Sachen heute für Lydia waren alle dringend notwendig – abgesehen von der Reitjacke, und die hat sie sich so sehr gewünscht. Das Einkaufen mit Lydia war tränenreich verlaufen. Sie konnte es nicht leiden, wenn ihre Füße in den neuen Schuhen geröntgt wurden.
»Ich will keine scheußlichen grünen Füße!«, protestierte sie, und dann weinte sie, weil Nan sagte, sie sei nicht alt genug für eine Reitjacke, und dann weinte sie, weil Nan ihr verbot, die Jacke auf der Heimfahrt im Bus zu tragen. Sie hatten zwei warme Unterhemden für den Winter gekauft, zwei Paar Schuhe, einen dunkelblauen Faltenrock aus Serge an einem weiten Oberteil und dazu ein reizendes passendes Jäckchen aus Baumwollsamt und zur Abrundung des Ganzen eine Leinenmütze für den Sommer und vier Paar weiße Baumwollsöckchen. Lydia hatte nur die Reitjacke gewollt. Sie wünschte sich Strümpfe wie Lou und keine Söckchen, die was für Babys waren, und sie wollte eine rote Samtjacke anstatt der marineblauen. Ihre Hausschuhe gefielen ihr nicht, weil sie mit einem Riemen zum Knöpfen geschlossen wurden anstatt mit Schnürsenkeln. Nach alldem hatte Villy das Gefühl, sich eine Belohnung verdient zu haben. Jetzt standen ihr noch die neuen Sachen für Louise bevor und für Teddy, wenn er aus dem Internat kam, aber er würde nicht viel brauchen. Sie sah zu ihren drei wunderbaren Kleiderkartons, in denen die Ausbeute ihres Einkaufs lag, und überlegte, welches sie am Abend im Theater tragen sollte.
***
Angesichts des herrlichen Wetters ging Miss Milliment an diesem Mittag zu Fuß nach Notting Hill Gate, um im ABC zu essen. Sie bestellte ein Tomatensandwich und eine Tasse Tee und danach, weil sie noch Appetit hatte, ein Vanilletörtchen. So kostete der Lunch fast einen Shilling und damit mehr, als sie sich eigentlich leisten konnte. Beim Essen las sie die Times, das Kreuzworträtsel hob sie sich für die lange Heimfahrt auf. Ihre Vermieterin setzte ihr eine passable Abendmahlzeit vor und zum Frühstück Tee und Toast. Manchmal wünschte sie sich, sie könnte sich für abends einen Radioapparat leisten, denn das viele Lesen bekam ihren Augen nicht. Seit dem Tod ihres Vaters – ein Geistlicher im Ruhestand – wohnte sie möbliert, wie sie es nannte. Im Grunde störte es sie wenig, sie war nie der häusliche Typ gewesen. Der Mann, von dem sie geglaubt hatte, sie werde ihn heiraten, war vor Jahren im Burenkrieg ums Leben gekommen, und ihre Trauer war im Lauf der Zeit der ehrlichen Einsicht gewichen, dass sie ihm kein besonders behagliches Zuhause bereitet hätte. Jetzt arbeitete sie als Hauslehrerin. Ein Geschenk des Himmels war es gewesen, als Viola ihr schrieb und sie bat, Louise und dann auch ihre Cousine Polly zu unterrichten. Zu dem Zeitpunkt war sie bereits der Verzweiflung nahe: Das Geld, das ihr Vater ihr hinterlassen hatte, reichte gerade eben für ein Dach über dem Kopf; sie hatte nicht einmal das Geld für den Bus zur National Gallery, ganz zu schweigen von den Sonderausstellungen, bei denen Eintritt verlangt wurde. Ihre Leidenschaft galt Gemälden – vor allem den französischen Impressionisten, und insbesondere Cézanne. Es entbehrte ihrer Meinung nach nicht einer gewissen Ironie, dass andere sie nicht gerade für eine Augenweide hielten. Genau genommen war sie eine der hässlichsten Frauen, die sie kannte, aber seitdem sie das einmal zweifelsfrei festgestellt hatte, interessierte sie sich nicht mehr für ihr Äußeres. Ihre Kleidung bestand aus dem, womit sie ihren Körper am billigsten und einfachsten bedecken konnte, sie badete einmal die Woche (ihre Vermieterin verlangte extra für ein Bad), und sie hatte das Nickelbrillengestell ihres Vaters übernommen, das ihr gute Dienste leistete. Wäsche zu waschen kostete entweder viel Mühe oder viel Geld, deswegen war ihre Kleidung nicht allzu sauber. Abends las sie philosophische oder kunstgeschichtliche Bücher und Gedichte, und am Wochenende sah sie sich Bilder an. Aber was hieß »ansehen«! Sie weidete sich an jedem Bild, ging weiter zum nächsten, kehrte zu ihm zurück, bis sie es in die geheimen Teile ihres unförmigen Körpers aufgenommen hatte, aus denen die Erinnerung besteht, und dort reiften sie zu geistiger Nahrung. Wahrheit – deren Schönheit und auch Vermögen, bisweilen über das gewöhnliche Erscheinungsbild von Dingen hinauszugehen – bewegte und beflügelte sie, bis sie ganz und gar beseelt war von Bewunderung. Die fünf Pfund, die sie sich jede Woche mit dem Unterrichten der beiden Mädchen verdiente, ermöglichten es ihr, sich alles anzusehen, wozu ihre Zeit genügte, und eine kleine Summe auf die hohe Kante zu legen für die Jahre, wenn Louise und Polly sie nicht mehr brauchten. Mit dreiundsiebzig würde sie kaum eine neue Anstellung finden. Sie war einsam und gänzlich daran gewöhnt. Sie hinterließ für die Bedienung zwei Pence auf dem Tisch und bahnte sich mit ihrem leicht mäandernden Gang den Weg zur U-Bahn.
***
An ihrem freien Nachmittag ging Phyllis als Erstes zu Pontings. Dort war Sommerschlussverkauf, und sie brauchte Strümpfe. Außerdem machte es ihr Spaß, sich in aller Ruhe umzuschauen, obwohl sie wusste, dass sie sich dann stark versucht fühlen könnte, etwas zu kaufen – eine Bluse oder auch ein Sommerkleid, das sie nicht brauchte. Um sich das Geld für den Bus zu sparen, ging sie zu Fuß von Campden Hill zur Kensington High Street. Sie kam vom Land, der Fußmarsch störte sie nicht. Sie trug ihren Sommermantel aus blassgrauem Grobgewebe mit dem dazugehörigen Rock, die Bluse, die Mrs. Cazalet ihr zu Weihnachten geschenkt hatte, und einen Strohhut, den sie seit Ewigkeiten besaß und ab und zu neu verzierte. Außerdem hatte sie graue Baumwollhandschuhe und ihre Handtasche dabei. Phyllis verdiente achtunddreißig Pfund im Jahr und schickte ihrer Mutter jeden Monat zehn Shilling. Mittlerweile war sie seit vier Jahren mit dem Untergärtner des Guts verlobt, auf dem ihr Vater als Wildhüter gearbeitet hatte, bis er die Stelle wegen seiner Arthritis aufgeben musste. Die Verlobung mit Ted war ins große Ganze ihres Lebens eingegangen. Es war nicht mehr aufregend – war es im Grunde nie gewesen, da er und sie von Anfang an wussten, dass sie sich eine Hochzeit in absehbarer Zeit nicht leisten konnten. Wie auch immer, sie kannte ihn, seit sie zurückdenken konnte. Seit sie in London im Dienst stand, sahen sie sich vielleicht viermal im Jahr – wenn sie in ihren zwei Wochen Urlaub nach Hause fuhr sowie die wenigen Male, wenn sie ihn überreden konnte, einen Tag nach London zu kommen. London gefiel ihm nicht, aber er war ein guter, zuverlässiger Mann und erklärte sich manchmal bereit, sie zu besuchen – meistens im Sommer, denn sonst wussten sie nicht, was sie angesichts des Wetters machen sollten. Sie saßen in Teestuben und gingen ins Kino, was das Schönste überhaupt war, denn mit ein bisschen Ermutigung ihrerseits legte er den Arm um sie. Dann hörte sie ihn atmen, und hinterher wusste er nie, worum es in dem Film gegangen war. Einmal im Jahr brachte sie ihn zum Nachmittagstee in die Lansdowne Road mit. Da saßen sie dann in der Küche, und Emily und Edna stellten ihm einen Teller nach dem anderen hin, und obwohl er sich ständig räusperte, brachte er kein Wort heraus, und sein Tee wurde kalt. Wie auch immer, sie sparte zehn Shilling im Monat fürs Heiraten, und so blieben ihr zwei Pfund, drei Shilling und drei Pence für ihre freien Tage, für ihre Kleidung und alles andere, was sie brauchte, also musste sie aufpassen. Aber immerhin lagen auf der Post fast dreißig Pfund. Über die Zukunft brauchte sie sich keine Gedanken zu machen, das gefiel ihr, und bevor sie heiratete, wollte sie noch ein bisschen was vom Leben sehen. Sie würde bei Pontings herumschauen, dann würde sie in den Kensington Gardens spazieren gehen und sich eine Bank suchen, um in der Sonne zu sitzen. Am Round Pond sah sie gern den Enten und den Spielzeugbooten zu. Danach würde sie im Lyons Tee trinken und zum Schluss in Notting Hill Gate ins Coronet oder ins Embassy gehen, je nachdem, wo ein Film mit Norma Shearer lief. Sie mochte Norma Shearer, weil Ted einmal gesagt hatte, sie sehe ihr ein bisschen ähnlich.
Bei Pontings gab es die Strümpfe im Schlussverkauf, drei Paar für vier Shilling. Es war proppenvoll. Sehnsüchtig betrachtete sie die Ständer mit den Sommerkleidern, die auf drei Shilling reduziert waren. Eines hatte ein Butterblumenmuster und einen Rundkragen, das genau das Richtige für sie wäre – das wusste sie einfach, aber dann kam ihr die gute Idee, bei Barker’s nach einem Stoffrest zu gucken und sich selbst eins zu nähen. Sie fand einen hübschen grünen Voile mit einem Muster aus rankenden Rosen – drei Meter für zwei Shilling sechs Pence! Ein Schnäppchen! Edna, die etwas vom Nähen verstand, hatte Schnitte, also brauchte sie keinen zu kaufen. Sechs Pence zu haben oder nicht zu haben war schon ein Shilling, wie ihre Mutter zu sagen pflegte. Als sie schließlich den Round Pond erreichte, war sie müde, und dann wurde sie wohl schläfrig von der Sonne, denn sie döste ein. Danach musste sie einen Herrn nach der Uhrzeit fragen. Am Rand des Teichs trieb sich vor ihr eine Schar zerlumpter Kinder herum mit einem Säugling in einem ramponierten alten Kinderwagen. Sie fischten nach Stichlingen, die sie in ein Marmeladenglas taten. Als der Mann gegangen war, sagte eines von ihnen geziert: »Mein Herr, dürfte ich Sie wohl fragen, wie spät es ist?«, und dann kreischten sie vor Lachen und äfften den Satz im Singsang nach, nur der Säugling nicht, der hatte einen Schnuller im Mund. »Das ist sehr ungezogen«, sagte sie und merkte, dass sie rot wurde. Aber diese Gören gaben nichts darauf. Ihre, Phyllis’, Mutter hätte sie nie in einem solchen Aufzug aus dem Haus gehen lassen.
Sie hatte leichte Kopfschmerzen, und einen Moment dachte sie panisch, sie hätte ihre Regel bekommen. Das wäre zwar vier Tage zu früh, aber wenn, dann müsste sie sofort nach Hause, weil sie nichts dabeihatte. Doch auf dem Weg durch die Gärten zur Bayswater Road überlegte sie, dass es nicht sein konnte, sonst wäre ihre Haut viel schlimmer, und sie hätte mehr als nur den einen Pickel. Phyllis war fast vierundzwanzig und seit gut zehn Jahren in Stellung. Beim ersten Mal – in ihrem ersten Haushalt, wo sie wegen des Bluts weinend zur Haushälterin gelaufen war – hatte Amy ihr bloß gezeigt, wie man die Flanellstreifen faltete, und gesagt, dass jede Frau das bekam, und zwar einmal im Monat. Danach hatte niemand mehr ein Wort darüber verloren, außer Mrs. Cazalet, als sie ihr zeigte, wo im Wäscheschrank die Stoffstreifen aufbewahrt wurden. Aber mehr hatte sie nicht gesagt. Von ihr als Dame hatte Phyllis sowieso nichts anderes erwartet. Und obwohl sie und Edna wussten, wann es bei der anderen so weit war, erwähnten sie es auch nicht, schließlich waren sie in Stellung und wussten, was sich für Damen gehörte. So merkwürdig ihr die ganze Angelegenheit auch vorkam, es musste ja in Ordnung sein, wenn es jeder so ging wie ihr. Die Stoffstreifen wurden in einen Leinenbeutel gesteckt und jede Woche in die Wäscherei gebracht, »Hygienebinden« hießen sie auf der Liste. Natürlich hatte das Personal einen eigenen Beutel. Aber wie auch immer, alles war in Ordnung, und sie trank zwei Tassen Tee und aß dazu ein Rosinenbrötchen, und als sie beim Coronet ankam, ging es ihr viel besser.
***
Nach dem Unterricht blieb Polly zum Lunch bei Louise. Nan und Lydia saßen ebenfalls am Tisch. Zu essen gab es eine dunkelbraune Hackfleischsoße mit dicken weißen Spaghetti. Lydia nannte sie Würmer und bekam eine Ohrfeige, weil ihre Mutter nicht da war, aber sie weinte fast gar nicht, weil sie ihre Reitjacke über Louises ledernen Lesesessel gebreitet hatte, damit sie sie beim Essen anschauen konnte. Louise sprach fast die ganze Zeit über Othello, aber Polly, die sich Gedanken über die Gefühle anderer machte und sah, dass Nan sich nicht besonders für Othello interessierte, fragte sie, an was sie da stricke und wo sie ihren Urlaub verbringen werde. Nan strickte ein rosa Bettjäckchen für ihre Mutter und würde in zwei Wochen nach Woburn Sands in Urlaub fahren. Mit das Schlimmste an dieser noch so minimalen Unterhaltung war, dass Louise ihr anschließend vorwerfen würde, sich bei Nan einschmeicheln zu wollen, dabei stimmte das gar nicht: Sie konnte gut nachvollziehen, dass sich nicht jeder für Othello interessierte.
»Die Beine von Nans Mutter sind schlimm«, sagte Lydia. »Sie muss sie die ganze Zeit hochlegen für den Fall, dass sie abfallen. Sie sind wirklich sehr, sehr schlimm«, ergänzte sie nach kurzem Nachdenken.
»Das genügt, Lydia. Bei Tisch sprechen wir nicht über die Beine anderer Menschen.«
Was nur dazu führt, dass wir alle an sie denken, dachte Polly. Zum Nachtisch gab es Stachelbeerpüree mit Eischaum, was Polly nicht mochte, sich aber nicht zu sagen traute. Lydia waren derartige Bedenken fremd.
»Es riecht nach Kotze«, befand sie, »grünliche grausliche Kotze.« Nan hob sie aus dem Stuhl und zog sie aus dem Zimmer.
»Zum Donnerschlag!«, sagte Louise, die eine Vorliebe hatte für das, was sie für Shakespeare’sche Flüche hielt. »Die arme Lydia. Jetzt darf sie sich auf was gefasst machen.« Und tatsächlich war von oben gedämpftes Heulen zu hören.
»Ich mag keins.«
»Das wundert mich nicht, mir schmeckt es auch nicht besonders. Wir sollten die Wonder Cream fertig machen. Du hast Nan furchtbar Honig um den Mund geschmiert.«
»Das ist gar nicht wahr!«
Nachdem sie die Creme abgefüllt und alle Gläschen etikettiert hatten, brachten sie sie in Louises Zimmer. Danach lagen sie im Garten auf dem Rasen, bis der Eismann mit seinem Dreirad und dem Eiswagen angefahren kam. Jede kaufte sich ein Zitronenwassereis, dann legten sie sich wieder auf den Rasen und unterhielten sich über die Ferien und was sie tun würden, wenn sie groß waren.
»Mummy möchte, dass ich in die Gesellschaft eingeführt werde.«
»Was – du sollst Debütantin werden?« Louise konnte ihre Verachtung kaum verhehlen. »Du willst doch bestimmt einmal einen richtigen Beruf haben, oder nicht?«
»Was könnte ich denn machen?«
»Du kannst ziemlich gut zeichnen. Du könntest Malerin werden.«
»Ich könnte eingeführt werden und dann Malerin werden.«
»So funktioniert das nicht, Polly, ehrlich nicht. Dann musst du auf Bälle gehen, wo lauter dumme Leute herumstehen, und die halten alle ständig um deine Hand an, und du willigst aus reiner Menschenfreundlichkeit ein, einen von denen zu heiraten. Du weißt doch selbst, wie schlecht du Nein sagen kannst.«
»Ich würde niemanden heiraten, den ich nicht liebe.«
»Manchmal reicht nicht einmal das.« Insgeheim dachte sie an John Gielgud und ihre endlosen Träume, ihm auf atemberaubende und tollkühne Weise so oft das Leben zu retten, dass er nicht umhinkonnte, sie zu heiraten. Sie würden in einer Etagenwohnung leben (das Nonplusultra der Eleganz – sie kannte nur eine einzige Familie, die tatsächlich in einer Wohnung lebte) und in allen Stücken die beiden Hauptrollen spielen und zum Dinner Hummer und Mokkaeis essen.
»Arme Lou! Irgendwann kommst du drüber hinweg.«
Louise lächelte ihr trauriges, tapferes, verletzliches Lächeln, das sie vor dem Badezimmerspiegel einstudiert hatte. »Bestimmt nicht. Darüber kommt man nie hinweg.«
»Wahrscheinlich nicht.«
»Ehrlich gesagt gefällt es mir manchmal sogar«, gestand Louise. »Weißt du – mir vorzustellen, wie es wäre. Und ich denke auch nicht ständig dran.« Das kam der Wahrheit fast nahe: Manchmal dachte sie tagelang nicht daran. Ich bin die Art unaufrichtige Person, dachte sie, die es nicht ertragen kann, völlig unaufrichtig zu sein.
Sie sah zu Polly, die auf dem Rücken lag, die Augen vor der Sonne geschlossen. Obwohl Polly erst knapp dreizehn war, also ein Jahr jünger, wirkte sie nicht so. Sie war ausgesprochen direkt und ohne jeden Arg. Taktlos, wurde es oft genannt. Wenn man sie fragte, was sie dachte, sagte sie es – wenn sie es denn wusste. Aber wegen ihrer Aufrichtigkeit, die sie bisweilen quälte, war sie oft unentschlossen. Wenn man sie etwa fragte, ob sie es aushalten könne, eine Weile in einem U-Boot zu verbringen, ob sie ihr Pony erschießen könnte, falls es sich das Bein brach, oder ob sie, wenn sie eine Spionin wäre und gefasst würde, für ihre Heimat sterben könnte, ohne etwas zu verraten, dann sah sie einen aus ihren ziemlich kleinen dunkelblauen Augen an, und auf ihrer milchweißen Stirn bildeten sich Fältchen, während ihr Blick einen immer wieder streifte und sie mit der Wahrheit rang – häufig vergeblich. »Ich weiß es nicht«, sagte sie dann oft. »Ich wünschte, ich wüsste es, aber ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls nicht so sicher, wie du es bist.« Insgeheim wusste Louise allerdings genau, dass sie selbst ihre Entscheidungen je nach Laune traf und dass Pollys Unentschiedenheit im Grunde ernsthafter war. Das ärgerte sie, aber sie hatte deswegen auch etwas Respekt vor Polly. Nie bestimmte sie, nie setzte sie sich in Szene, wie Nan es nannte, und oft konnte sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Außerdem war sie unfähig zu lügen, bei was auch immer. Louise log nicht direkt – das galt in der Familie Cazalet als schweres Verbrechen –, aber einen Großteil der Zeit verkörperte sie andere Menschen, und die dachten verständlicherweise anders als Louise und sahen Dinge auch anders, also zählte es nicht, was sie in der Zeit sagte. Als Schauspielerin war diese Art Flexibilität schlicht notwendig. Aber obwohl Polly sie manchmal wegen ihrer wechselhaften Reaktionen aufzog und sie wiederum Polly aufzog, weil sie so ernsthaft war und sich nicht entscheiden konnte, gingen sie in ihren Sticheleien nie zu weit. Ihrer beiden schlimmsten, realsten Ängste waren tabu: Louise litt entsetzlich unter Heimweh (sie konnte nirgendwo bleiben außer bei der Familie, und ihr graute bei der Vorstellung, auf ein Internat geschickt zu werden), und Polly fürchtete sich davor, dass wieder ein Krieg ausbrechen könnte und sie alle vergast würden, allen voran ihr Kater Pompey, der, als Katze, kaum eine Gasmaske bekommen würde. Bei dem Thema kannte Polly sich bestens aus. Ihr Vater besaß viele Bücher über den Krieg, er war dabei gewesen, hatte eine Hand verloren und war mit über hundert Granatsplittern im Leib heimgekehrt, die sich nicht entfernen ließen, und er bekam immer wieder furchtbare Kopfschmerzen – die schlimmsten auf der Welt, sagte ihre Mutter. Und alle Männer auf dem Foto, das auf seiner Kommode stand – lauter Soldaten in gelblichen, schlotternden Uniformen –, waren tot, bis auf ihn. Polly hatte seine ganzen Bücher gelesen und ihm beiläufig kleine Fangfragen gestellt. Die bewiesen ihrer Ansicht nach, dass alles, was sie gelesen hatte – das Schlachten, der endlose Schlamm und der Stacheldraht, die Granaten und Panzer und ganz besonders das entsetzliche Giftgas, das Onkel Edward irgendwie überlebt hatte –, wirklich stimmte: ein echter, ununterbrochener Albtraum, der mehr als vier Jahre gedauert hatte. Wenn es wieder einen Krieg gäbe, könnte er nur noch schlimmer werden. Schließlich sagten die Leute immer wieder, dass die Schlachtschiffe, die Flugzeuge, die Waffen und alles, was ihn schlimmer machen konnte, durch technische Entwicklungen verbessert worden waren. Also würde der nächste Krieg doppelt so entsetzlich sein und doppelt so lange dauern. Ganz insgeheim beneidete sie Louise, die nur vor dem Internat Angst hatte: Schließlich war sie schon vierzehn, und in zwei oder drei Jahren würde sie zu alt dafür sein. Aber für den Krieg war niemand zu alt oder zu jung.
Louise fragte: »Wie viel Taschengeld hast du?«
»Weiß ich nicht.«
»Schau mal nach.«
Gehorsam öffnete Polly den Reißverschluss der kleinen Lederbörse, die sie an einer Schnur um den Hals trug. Ein paar Münzen und einige eher graue Zuckerwürfel fielen ins Gras.
»Du solltest den Pferdezucker nicht zusammen mit dem Geld aufbewahren.«
»Ich weiß.«
»Wahrscheinlich ist er mittlerweile schon giftig.« Louise setzte sich auf. »Wir könnten in die Church Street gehen, und danach könnte ich dich nach Hause begleiten und zum Nachmittagstee bleiben.«
Beide liebten die Church Street, insbesondere das obere Ende in der Nähe von Notting Hill Gate, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Louise trieb sich immer in der Zoohandlung herum, die einen schier unbegrenzten Vorrat an begehrenswerten Lebewesen bereithielt: Grasschlangen, Molche, Goldfische, Schildkröten, riesige weiße Kaninchen, und dann die Tiere, die sie sich wünschte, aber nicht haben durfte – alle möglichen Vögel, Mäuse, Meerschweinchen, kleine Katzen und Hunde. Polly hatte manchmal keine Lust zu warten, während Louise alles bestaunte, und wenn es ihr zu langweilig wurde, ging sie nach nebenan. Dort gab es einen Trödelladen, der sich bis auf den Bürgersteig ausdehnte und alles Mögliche feilbot, von gebrauchten Büchern bis hin zu Porzellan, Seifensteinen, Elfenbein, Holzschnitzereien, Perlen und Möbelstücken, manchmal auch Gegenstände, deren Sinn und Zweck sich einem nicht erschloss. Die beiden Männer in dem Laden waren wenig hilfsbereit: Der Vater lag fast ausschließlich auf einer verblichenen roten Samt-Chaiselongue und las in der Zeitung, der Sohn saß in einem vergoldeten Sessel, die Füße auf einen gewaltigen Schaukasten mit ausgestopften Hechten gelegt, aß Kokosbrötchen und trank Tee. »Damit werden Handschuhe gedehnt«, sagte der Vater, wenn man ihn fragte; der Sohn wusste nie etwas. An diesem Tag entdeckte Polly zwei sehr hohe blau-weiße Kerzenleuchter, zwar ziemlich rissig und bei einem fehlte oben ein Stück, aber sie fand sie trotzdem wunderschön. Und dann gab es noch einen Keramikteller mit blauen und gelben Blumen darauf, ein dunkles Ritterspornblau und Sonnengelb, und mit ein paar grünen Blättern – fast der schönste Teller, den sie je gesehen hatte. Die Kerzenleuchter kosteten sechs Pence, der Teller vier: Das war zu viel.
»An dem fehlt etwas«, sagte Polly und deutete auf die Stelle.
»Das ist Delfter Keramik.« Der Vater legte seine Zeitung beiseite. »Wie viel hast du denn?«
»Siebeneinhalb Pence.«
»Dann musst du dich entscheiden. Dafür kann ich die Stücke nicht hergeben.«
»Um wie viel würden Sie sie denn hergeben?«
»Neun Pence ist mein bester Preis. Der Teller ist portugiesisch.«
»Ich frage schnell meine Freundin.«
Sie lief in die Zoohandlung, wo Louise in ein ernstes Gespräch vertieft war. »Ich kaufe einen Wels«, verkündete sie. »Den wollte ich immer schon haben, und der Mann sagt, dass jetzt eine gute Zeit dafür ist.«
»Kannst du mir ein bisschen Geld borgen? Nur bis Samstag?«
»Wie viel?«
»Eineinhalb Pence.«
»In Ordnung. Allerdings kann ich jetzt nicht zum Tee zu dir mitkommen, weil ich meinen Wels nach Hause bringen möchte.« Der Fisch schwamm in einem Marmeladenglas, das der Mann mit einer Schnur als Henkel versehen hatte. »Ist er nicht putzig? Schau dir nur seine hübschen kleinen Barteln an.«
»Putzig.« Polly gefielen sie zwar nicht besonders, aber sie wusste, dass Geschmäcker verschieden waren.
Sie ging in ihren Laden zurück und gab dem Mann neun Pence, und er wickelte den Teller und die Leuchter nachlässig in eine zerlesene Zeitung.