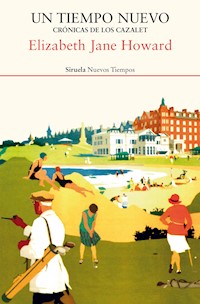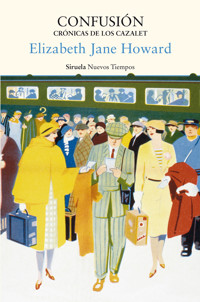9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cazalet-Chronik
- Sprache: Deutsch
Das große Finale der britischen Kultserie Die Fabulous Fifties in England – in den zehn Jahren seit Kriegsende hat sich vieles verändert, die Gesellschaft ist im Umbruch, vertraute Traditionen verlieren an Bedeutung. Auch die Familie Cazalet kann nicht an Altbewährtem festhalten. Als die geliebte Matriarchin Duchy stirbt, spüren alle, dass der Familiensitz Home Place seine Seele verloren hat. Mehr noch: Die Zukunft des Anwesens ist ungewiss. Während die drei Cousinen Louise, Polly und Clary zunehmend an Selbstvertrauen gewinnen und ihre eigenen Wege gehen, haben ihre Väter dem drohenden Bankrott des einst florierenden Holzhandels wenig entgegenzusetzen. Es beginnt eine neue Zeit, in der sich die Cazalets auf ihre alte Stärke besinnen: den familiären Zusammenhalt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 743
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Die Fabulous Fifties in England – in den zehn Jahren seit Kriegsende hat sich vieles verändert, die Gesellschaft ist im Umbruch, lieb gewonnene Traditionen verlieren an Bedeutung. Auch die Familie Cazalet kann nicht an Altbewährtem festhalten. Den Tod der geliebten Matriarchin Duchy empfinden alle als Einschnitt; ohne sie ist der Familiensitz Home Place nicht mehr derselbe. Mit den Herausforderungen der neuen Zeit gehen die Familienmitglieder höchst unterschiedlich um: Während die drei Cousinen Louise, Polly und Clary längst eigene Wege gehen, auch wenn nicht nur ein Traum an der Realität zerschellt ist, haben ihre Väter dem drohenden Bankrott des einst florierenden Holzunternehmens wenig entgegenzusetzen. Doch wie so oft in stürmischen Zeiten besinnen sich die Cazalets trotz mancher Differenzen auch jetzt auf ihre alte Stärke: den familiären Zusammenhalt.
Im fünften und letzten Band der ›Chronik der Familie Cazalet‹, der erstmals auf Deutsch erscheint, spürt Elizabeth Jane Howard den Auswirkungen nach, die gesellschaftliche Umbrüche auf das Leben der einzelnen Menschen haben – und ergründet feinfühlig, was es heißt, eine Familie zu sein.
WAS BISHER GESCHAH
Die folgende Vorgeschichte dieses Romans ist für Leserinnen und Leser gedacht, die mit den vier vorhergehenden Bänden der Cazalet-Chronik – Die Jahre der Leichtigkeit, Die Zeit des Wartens, Die stürmischen Jahre und Am Wendepunkt – nicht vertraut sind.
Ab dem Sommer 1945 führten William und Kitty Cazalet, von der Familie »der Brig« und »die Duchy« genannt, ein ruhiges Leben in Home Place, dem Familienlandsitz in Sussex. Der Brig starb 1946 an einer Lungenentzündung, doch die Duchy wohnt nach wie vor dort. Sie ist nicht allein. Sie und ihr Mann hatten vier Kinder: eine ledige Tochter namens Rachel und drei Söhne, die alle im Holzunternehmen der Familie arbeiten. Hugh ist Witwer, allerdings trauert er nicht mehr um seine erste Frau Sybil, mit der er drei Kinder hatte – Polly, Simon und Wills –, denn mittlerweile hat er Jemima Leaf geheiratet, die bei Cazalets’, der Firma der Familie, arbeitete. Edward hat sich von seiner Frau Villy getrennt und überlegt, seine Geliebte Diana zu heiraten, mit der er zwei Kinder hat. Rupert, der während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich als vermisst galt, ist zurückgekehrt zu seiner Frau Zoë, zu Clary und Neville – den Kindern mit seiner ersten Frau Isobel, die bei Nevilles Geburt gestorben ist – und zu Juliet, der gemeinsamen Tochter, die Zoë 1940, nach seinem Verschwinden, bekam. Nach schwierigen Anfängen ist es den beiden gelungen, wieder als Paar zusammenzufinden.
Edward hat Villy ein Haus gekauft, wo sie mit Roland, ihrem jüngsten Sohn, lebt, wenn auch unglücklich. Außerdem hat sie Miss Milliment bei sich aufgenommen, die betagte ehemalige Hauslehrerin der Familie. Villys Schwester Jessica und ihr Mann Raymond haben von einer alten Tante Geld geerbt. Ihr Sohn Christopher, Pazifist und Vegetarier, ist Mönch geworden.
Edwards und Villys Tochter Louise wollte Schauspielerin werden, hatte allerdings mit neunzehn geheiratet. Dann verließ sie ihren Mann, den Porträtmaler Michael Hadleigh, und auch ihren kleinen Sohn Sebastian. Ihr Bruder Teddy heiratete während seiner Ausbildung bei der Royal Air Force in Arizona eine Amerikanerin, Bernadine Heavens, und brachte sie nach England mit, doch konnte sie sich dort nicht einleben, verließ ihn nach wenigen Jahren und kehrte nach Amerika zurück.
Polly und Clary leben zusammen in London, wo Polly für einen Innenarchitekten und Clary für einen Literaturagenten arbeitete. Durch ihre Arbeit lernte Polly Gerald Lisle, Earl of Fakenham, kennen und besuchte seinen Familiensitz, der renoviert werden muss. Aus Geldmangel konnten keine Arbeiten vorgenommen werden, doch dann entdeckte Polly im Haus eine große Anzahl von Aquarellen J. M. W. Turners, von denen einige die Kosten der Renovierung decken könnten. Polly und Gerald sind verheiratet.
Clary hatte eine unglückliche Affäre mit dem Betreiber der Literaturagentur. Sie fühlte sich schon immer zum Schreiben hingezogen und hat mit dem Zuspruch Archie Lestranges, eines langjährigen Freunds ihres Vaters, ihren ersten Roman fertiggestellt. All die Jahre betrachtete sie Archie als väterlichen Freund, im Lauf der Zeit aber sind die beiden sich immer näher gekommen, und schließlich verliebten sie sich ineinander. Es hat den Eindruck, dass sie heiraten werden.
Rachel lebt für andere Menschen, was ihre sehr gute Freundin und jetzt Geliebte Margot Sidney, genannt Sid, eine Geigenlehrerin, oft sehr schwierig findet. So schwierig, dass sie eine Affäre mit einer anderen Frau hatte. Als Rachel das herausfand, begann eine Phase der Entfremdung, aber mittlerweile sind sie wieder glücklich vereint.
Die neue Zeit setzt neun Jahre später ein, 1956.
ERSTER TEIL
JUNI 1956
RACHEL
Nicht mehr lange.«
»Duchy, meine Liebe!«
»Ich bin ganz ruhig.« Einen Moment schloss sie die Augen. Das Sprechen – wie alles andere – fiel ihr schwer. Nach einer Pause sagte sie: »Schließlich habe ich die Zeit überschritten, die Mr. Housman uns zugesteht. Um zwanzig Jahre! ›Der schönste aller Bäume‹ – da war ich nie seiner Meinung.« Sie blickte in das zerquälte Gesicht ihrer Tochter – blass, dunkle Ringe unter den Augen vom Schlafmangel, der Mund verkniffen vor Anstrengung, nicht zu weinen – und hob mit unendlicher Mühe die Hand vom Laken. »Rachel, meine Liebe, du darfst nicht so betrübt sein. Das macht mich unglücklich.«
Rachel umfasste die zitternde, knochige Hand mit ihren beiden Händen. Nein, sie durfte ihr keinen Kummer bereiten, das wäre wirklich sehr egoistisch. Der von Leberflecken übersäte Arm ihrer Mutter war so dünn, dass ihr das goldene Uhrenband ums Handgelenk schlackerte, mit dem Ziffernblatt nach unten; ihr Ehering war halb über den Fingerknöchel gerutscht. »Für welchen Baum würdest du dich denn entscheiden?«
»Eine gute Frage. Lass mich überlegen.«
Sie beobachtete das Gesicht ihrer Mutter, plötzlich belebt ob der Fülle, die zur Wahl stand – die Entscheidung war eine ernsthafte Angelegenheit …
»Mimosen«, sagte die Duchy unvermittelt. »Der himmlische Duft! Aber bei mir sind sie nie gediehen.« Sie fuhr mit der Hand unruhig über die Zudecke und knetete sie nervös. »Jetzt gibt es niemanden mehr, der mich Kitty nennt. Du kannst dir nicht vorstellen …« Plötzlich würgte es sie, sie versuchte zu husten.
»Ich gebe dir einen Schluck zu trinken, meine Liebe.« Aber die Wasserkaraffe war leer. Im Bad entdeckte Rachel eine Flasche Malvern Water, und als sie damit zurückkehrte, war ihre Mutter tot.
Sie lag noch in derselben Position, gestützt auf die quadratischen Kissen, die sie ihr Leben lang bevorzugt hatte. Eine Hand ruhte auf der Bettdecke, die andere umfasste den Haarzopf, den Rachel ihr jeden Morgen flocht. Ihre Augen standen offen, doch die freimütige, direkte Aufrichtigkeit, die immer in ihrem Blick gelegen hatte, war verschwunden. Sie starrte ins Leere.
Fassungslos und ohne nachzudenken legte Rachel die erhobene Hand vorsichtig neben die andere. Mit einem Finger schloss sie ihrer Mutter die Augen, beugte sich vor und küsste die kühle weiße Stirn. Dann stand sie wie erstarrt da, unzusammenhängende Gedanken stürzten über sie herein. Es war, als wäre plötzlich eine Schleuse geöffnet. Kindheitserinnerungen. »Es gibt keine Notlügen, Rachel. Eine Lüge ist eine Lüge, und lügen darfst du nie.« Als Edward, in seinem Gitterbett stehend, sie angespuckt hatte: »Rachel, Petzern höre ich nicht zu.« Aber ihr Bruder wurde ermahnt und tat es nie wieder. Die Abgeklärtheit der Duchy, die durch nichts zu erschüttern war – bis auf ein einziges Mal, nachdem sie Hugh und Edward, damals achtzehn beziehungsweise siebzehn, zum Zug nach Frankreich begleitet hatte; gefasst hatte sie gelächelt, bis die Lokomotive langsam zur Victoria Station hinausfuhr. Dann hatte sie sich abgewandt und das kleine Spitzentaschentuch, das immer in ihrem Uhrenarmband steckte, herausgeholt. »Sie sind doch noch Jungen!« An der Innenseite dieses Handgelenks hatte sie einen kleinen, aber nicht zu übersehenden Leberfleck, und Rachel wusste noch, dass sie sich gefragt hatte, ob ihre Mutter das Taschentuch wohl genau dort aufbewahrte, um den Fleck zu verbergen, und dann, wie sie auf einen derart leichtfertigen Gedanken kommen konnte. Die Duchy weinte sehr wohl, allerdings vor Lachen: über die Possen Ruperts, der von klein auf jeden zum Lachen gebracht hatte, über Ruperts Kinder, allen voran Neville, über Menschen, die sie als aufgeblasen bezeichnete. Dann liefen ihr Tränen über die Wangen. Aber auch bei makabren viktorianischen Reimen: »Knabe – Waffe: wie er lacht! Und dann hat es ›peng‹ gemacht. Waffe rot, Knabe tot«, und bei schwarzem Humor: »Papa, Papa, was ist der rote Haufen da unter dem Bus?« »Sei still, mein Junge, das ist deine Mama, gib ihr noch einen Kuss.« Und Musik rührte sie ebenfalls zu Tränen. Sie war eine erstaunlich gute Pianistin, die häufiger mit Myra Hess im Duett spielte, und hatte Toscanini und dessen Aufnahmen der Beethoven-Sinfonien geliebt. Schlichtes Essen war ihr ein Gebot (man gab nicht Butter und gleichzeitig Marmelade auf den Frühstückstoast; Mahlzeiten bestanden aus einem Braten, der zuerst heiß, dann kalt und schließlich mit gekochtem Gemüse als Haschee gegessen wurde, und einmal die Woche aus gedünstetem Fisch, gefolgt von Obstkompott und Blancmanger, das sie »Mandelsulz« nannte, oder Reispudding), und sie führte ein zurückgezogenes Leben, in dem neben Musik auch der Garten eine große Rolle spielte; darin zu arbeiten bereitete ihr sehr viel Freude. Sie hatte großblütige Duftveilchen im Frühbeet, aber auch Landnelken, dunkelrote Rosen, Lavendel und alles, das süß duftete, außerdem baute sie Obst in Hülle und Fülle an: gelbe und rote Himbeeren, Tomaten, Nektarinen, Pfirsiche, Weintrauben, Melonen, Erdbeeren, riesige rote Stachelbeeren, Johannisbeeren für Konfitüren, Feigen, Reineclauden und andere Pflaumen. Die Enkelkinder liebten das viele Obst und kamen allein schon deswegen für ihr Leben gern nach Home Place.
Über ihr Verhältnis zu ihrem Mann, dem Brig, hatte sie sich – ganz viktorianisch – stets in Schweigen gehüllt. Als Kind hatte Rachel ihre Eltern lediglich in Beziehung zu sich selbst gesehen – ihre Mutter, ihr Vater. Doch da sie ihr ganzes Leben lang bei ihnen wohnte, hatte sie sie im Lauf der Jahre als zwei sehr unterschiedliche Menschen wahrgenommen, was ihrer bedingungslosen Liebe zu ihnen allerdings keinen Abbruch tat. Und die beiden hätten auch wirklich nicht gegensätzlicher sein können. Der Brig war auf nahezu exzentrische Art gesellig – er hatte jeden, dem er in seinem Club oder auf der Rückfahrt im Zug begegnet war, ohne die geringste Vorwarnung in das eine oder andere seiner zwei Zuhause mitgebracht, ob zum Dinner oder fürs ganze Wochenende, und hatte den Gast präsentiert wie ein Fischer oder Jäger seinen soeben gefangenen Lachs oder die gerade erlegte Wildgans. Woraufhin die Duchy nach einer sehr milden Rüge dem Besuch in aller Seelenruhe gekochtes Hammelfleisch und Blancmanger vorgesetzt hatte.
Nicht, dass sie Gesellschaft scheute, aber sie war vollauf zufrieden mit ihrer wachsenden Familie, ihren Kindern und Enkelkindern und den drei Schwiegertöchtern, die sie herzlich in der Familie aufnahm. Ihr eigenes Leben jedoch behielt sie für sich: Ihre Jugendstreiche (einer eher harmlosen Art) oder das Mehrfachverstecken, das sie abenteuerlich in einem abgelegenen schottischen Schloss gespielt hatte, kamen nur beiläufig ans Licht, wenn sie etwa einem Enkelkind, das aus dem Baum gefallen oder vom Pferd abgeworfen worden war, eine Geschichte erzählte. Ihr Vater, Großpapa Barlow, war ein anerkannter Naturwissenschaftler und Mitglied der Royal Society gewesen. Von den vier Schwestern galt sie als die Schönheit (obwohl sie immer den Eindruck erweckte, als wäre ihr dies nicht im Geringsten bewusst). Einen Blick in den Spiegel warf man nur, so hatte sie Rachel beigebracht, um sicherzustellen, dass die Frisur richtig saß und die Brosche gerade angesteckt war.
Als ihr die Gartenarbeit mit dem Alter zu beschwerlich wurde, war sie regelmäßig ins Kino gegangen, vor allem, um Gregory Peck zu sehen, in den sie sich regelrecht verliebt hatte.
Ich habe ihr nicht genügend Fragen gestellt. Ich weiß kaum etwas über sie. Angesichts der sechsundfünfzig Jahre intimer Nähe erschien das Rachel jetzt erschreckend. Die vielen Vormittage, an denen sie Brot geröstet hatte, während die Duchy auf ihrem Petroleumkocher Wasser für den Tee erhitzt hatte, die vielen Sommernachmittage im Freien, die behaglichen Tage im Frühstückszimmer, wenn es für draußen zu kalt war, in den Ferien mit den Enkelkindern, die alle zuerst eine Scheibe Brot mit Butter essen mussten, bevor ihnen entweder Marmelade oder Kuchen erlaubt war, aber die meiste Zeit zu zweit: Während die Duchy Vorhänge für Home Place an der Nähmaschine säumte, für Rachel wunderschöne Kleider nähte, aus blauer oder kirschroter gesmockter Rohseide, und dann für die Enkelkinder, für Louise und Polly, Clary und Juliet und sogar für die Jungen, Teddy und Neville, Wills und Roland, bis sie drei oder vier waren und sich gegen Mädchenkleidung wehrten, während Rachel sich mit Strickarbeiten für Anfängerinnen abmühte, dicken Schals und Fäustlingen. Das war während der endlos langen Kriegsjahre gewesen – den grauenhaften, nicht enden wollenden Monaten, in denen man Briefe sehnlich erwartet und Telegramme gefürchtet hatte …
Sie, die Tochter des Hauses, war herangewachsen, und abgesehen von drei schrecklichen heimwehgeplagten Jahren in einem Internat hatte sie ihr Zuhause nie verlassen. In allen Schulferien hatte sie darum gebettelt, zu Hause bleiben zu dürfen – »Wenn sie in meiner Bürste auch nur ein einziges Haar entdecken, bekomme ich einen Eintrag«, hatte sie einmal geschluchzt, worauf die Duchy erwidert hatte: »Dann sorg dafür, dass kein einziges Haar in deiner Bürste ist, mein Schatz.«
Ihre Aufgabe im Leben bestand darin, sich um andere zu kümmern, nicht auf ihr Äußeres zu achten, zu verstehen, dass Männer wichtiger waren als Frauen, ihre Eltern zu pflegen, Speisepläne zu erstellen und sich mit den Dienstboten auseinanderzusetzen, die Rachel allesamt, ob Mann oder Frau, wegen ihrer Rücksicht und ihrer Anteilnahme ins Herz geschlossen hatten.
Aber nun, wo ihre beiden Eltern tot waren, hatte sie ihre Aufgabe erfüllt. Jetzt konnte sie so viel Zeit mit Sid verbringen, wie sie beide wollten. Ein solches Ausmaß an Freiheit erschreckte sie. Der Satz, den ein junger Schüler angeblich einmal in einer der freidenkerischen Schulen gesagt hatte: »Müssen wir jetzt immer tun, wozu wir Lust haben?«, galt jetzt für sie.
Ihr wurde bewusst, dass sie die ganze Zeit neben dem Totenbett ihrer Mutter gestanden hatte, während diese unzusammenhängenden Gedanken sie überwältigten. Ihr wurde auch bewusst, dass sie weinte, dass sie unerträgliche Rückenschmerzen hatte, dass sie jede Menge tun musste: den Arzt holen, Hugh anrufen – sicher würde er es übernehmen, die anderen zu informieren, Edward, Rupert und Villy – und natürlich Sid. Sie musste den Dienstboten Bescheid geben. Kurz stockte sie: Seit dem Krieg bestand das Personal nur noch aus Mr. und Mrs. Tonbridge, dem uralten Gärtner, dessen Arthritis ihm mittlerweile höchstens erlaubte, den Rasen zu mähen, einem Mädchen, das drei Vormittage die Woche zum Putzen kam, und Eileen, die, nachdem sie sich um ihre kranke Mutter gekümmert hatte, nach Home Place zurückgekommen war.
Rachel drehte sich wieder zu ihrer geliebten Mutter. Sie sah friedlich aus und unvorstellbar jung. Rachel nahm eine weiße Rose aus dem kleinen Krug und steckte sie ihr zwischen die Hände. Der kleine Leberfleck an ihrem Handgelenk trat deutlicher zutage, die Uhr war auf die Handfläche gerutscht. Sie nahm sie ab und legte sie auf das Nachtkästchen.
Als sie das große Schiebefenster öffnete, strömte die warme Luft herein, getragen von einem lauen Windhauch, in dem sich die Musselinvorhänge regten, und plötzlich hing der Duft der Rosen im Raum, die im darunterliegenden Beet wuchsen.
Sie trocknete sich das Gesicht, putzte sich die Nase und sagte laut (damit sie mit den Dienstboten sprechen konnte, ohne zu weinen): »Lebwohl, meine Liebe.«
Dann verließ sie den Raum und nahm den Tag in Angriff.
DIE FAMILIE
Na ja, einer von uns sollte hinfahren. Wir können das Rachel nicht allein überlassen.«
»Natürlich nicht.«
Edward hatte gerade erklären wollen, dass er nicht so einfach seinen Lunchtermin mit den Typen von der verstaatlichten Eisenbahn absagen konnte, bemerkte aber, wie Hugh sich über die Stirn fuhr, und zwar auf eine Art, die verriet, dass sich sein höllisches Kopfweh meldete. Edward kam zu dem Schluss, dass seinem Bruder die ersten schmerzlichen Pflichten erspart werden sollten. »Was ist mit Rupe?«, meinte er.
Rupert, der jüngste Bruder und offiziell einer der Direktoren der Firma, nahm jeden für sich ein. Er wäre der offensichtliche Kandidat, wenn er nicht wegen seiner Entscheidungsschwäche und seines großen Verständnisses für jede Sichtweise, die jemand ihm unterbreitete, sei es Kunde oder Mitarbeiter, von zweifelhaftem Nutzen gewesen wäre. Edward sagte, er werde sofort mit ihm reden. »Wir müssen es ihm sowieso sagen. Mach dir keine Sorgen, alter Junge. Am Wochenende können wir alle hinfahren.«
»Rachel hat erzählt, dass sie völlig friedlich gestorben ist.« Das hatte er schon einmal gesagt, aber offenbar beruhigte es ihn, das zu wiederholen. »Das Ende einer Ära, würde ich meinen. Jetzt stehen wir an vorderster Front, oder?«
Da mussten sie beide an den Ersten Weltkrieg denken, aber keiner sprach es aus.
Nachdem Edward gegangen war, griff Hugh nach seinen Tabletten und bat Miss Corley, ihm zum Mittagessen ein Sandwich zu holen. Mehr als einen Bissen würde er kaum hinunterbringen, aber dann würde sie wenigstens nicht anfangen, ihn zu bemuttern.
Als er mit seiner dunklen Brille auf dem Ledersofa lag, weinte er. Die Gelassenheit der Duchy, ihre Offenheit, die Art, wie sie Jemima und ihre beiden Jungen in die Familie aufgenommen hatte … Jemima. Wenn er jetzt an vorderster Front stand, dann mit Jemima an seiner Seite – ein unglaublicher Glücksfall, das Herz ging ihm deswegen jeden Tag aufs Neue auf. Nach Sybils Tod hatte er gedacht, seine Zuneigung würde künftig einzig Polly gelten, die natürlich heiraten würde, was sie ja auch getan hatte, und selbst Kinder bekommen würde, was sie zweifellos getan hatte, und er den Rest seines Lebens für niemanden an erster Stelle stehen würde. Welches Glück ich doch gehabt habe, dachte er und setzte die Brille ab, um sie trocken zu wischen.
»Mein Schatz, natürlich komme ich. Wenn ich mich beeile, erwische ich den sechzehn Uhr zwanzig – meinst du, Tonbridge könnte mich abholen? Rachel, hör auf, dir Sorgen um mich zu machen. Mir fehlt nichts. Es war nur ein Anflug von Bronchitis, und ich bin gestern schon aufgestanden. Kann ich etwas mitbringen? Also gut, dann sehen wir uns kurz nach sechs. Bis dann, Liebste.«
Und sie legte auf, bevor Rachel weiter versuchen konnte, es ihr auszureden.
Während sie auf wackligen Beinen nach oben ging, wurde ihr bewusst, welch gewaltige Veränderungen jetzt im Raum standen. Sie war noch geschwächt, auch wenn das großartige Penizillin den Infekt mehr oder minder außer Gefecht gesetzt hatte. Sie beschloss, aufs Mittagessen zu verzichten und lieber ein paar Sachen in eine Tasche zu packen, die ihr nicht zu schwer sein würde. Rachel würde am Boden zerstört sein über den Tod ihrer Mutter, aber jetzt konnte sie – Sid – sich um sie kümmern. Endlich würden sie richtig zusammenleben können.
Sie hatte die Duchy geliebt und bewundert, aber die gemeinsame Zeit mit Rachel war so lange und so oft beschnitten worden, weil Rachel das Gefühl gehabt hatte, ihre Mutter brauche sie. Das war nach dem Tod des Brig noch schlimmer geworden, trotz der liebevollen Zuwendung ihrer drei Söhne und deren Frauen. Diese letzte Krankheit hatte Rachel über die Maßen beansprucht, seit Ostern war sie nicht mehr von der Seite ihrer Mutter gewichen. Aber jetzt war es vorbei, und im Alter von sechsundfünfzig Jahren konnte Rachel nun endlich ihr eigenes Leben führen. Sid war allerdings auch klar, dass Rachel das ängstigen würde, zumindest anfangs, fast so, als würde ein Vogel aus seinem vertrauten Käfig plötzlich ins Freie gesetzt. Sie würde sie nicht nur ermutigen, sondern auch schützen müssen.
Sie war so früh am Bahnhof, dass noch Zeit blieb, sich zu setzen und ein Sandwich zu essen (was auch beides nötig war). Nach geduldigem Anstehen bekam sie zwei Scheiben graues, schwammiges Brot, sparsam mit leuchtend gelber Margarine bestrichen, dazwischen eine hauchdünne Scheibe von schmierigem Cheddar. Es gab kaum Sitzplätze, und sie versuchte, sich auf ihrem Koffer niederzulassen, der allerdings zusammenzubrechen drohte. Nach kurzer Zeit stand ein sehr alter Mann von einer überfüllten Bank auf und ließ eine Ausgabe des Evening Standard liegen – »Burgess und Maclean sind auf langem Auslandsurlaub«, verkündete die Schlagzeile. Sie klangen wie zwei Kekshersteller, fand Sid.
Nachdem sie sich gegen den Strom der aussteigenden Passagiere vorgekämpft hatte, stieg sie erleichtert in den Zug. Der Waggon war schmutzig, das Sitzpolster fadenscheinig und staubig, der Boden übersät mit Kippen, und durch die stark verqualmten Fenster konnte sie kaum hinaussehen. Doch als der Pfiff des Schaffners ertönte und der Zug keuchend zum Bahnhof hinaus und über die Brücke fuhr, fiel die Müdigkeit von ihr ab. Wie oft hatte sie in diesem Zug gesessen, um bei Rachel zu sein? Die vielen Wochenenden, als ein Spaziergang mit ihr das höchste Glück bedeutet hatte, als Diskretion und Heimlichkeit all ihr Tun bestimmt hatten. Selbst wenn Rachel sie am Bahnhof abholte, hatte Tonbridge am Steuer gesessen und jedes Wort mitgehört. Damals war es allein schon so wunderbar gewesen, in ihrer Gesellschaft zu sein, dass es sie lange Zeit nach nichts anderem verlangt hatte. Aber dann hatte sie sich doch mehr gewünscht – hatte Rachel bei sich im Bett haben wollen –, und damit hatte eine neue Art von Heimlichkeit begonnen. Körperliches Verlangen und alles, was auch nur annähernd damit zu tun hatte, musste unter Verschluss gehalten werden – nicht nur vor den anderen, sondern auch vor Rachel selbst, die das alles furchteinflößend und unverständlich fand. Dann war sie krank geworden, und Rachel war sofort gekommen, um sie zu pflegen. Und dann … Wann immer sie daran zurückdachte, wie Rachel sich ihr angeboten hatte, traten ihr Tränen in die Augen. Ihre größte Leistung, dachte sie jetzt, bestand vielleicht darin, Rachel die Freuden körperlicher Liebe nahegebracht zu haben. Und selbst dann, dachte sie mit einem ebenso wehmütigen wie amüsierten Lächeln, hatten sie Rachels Schuldbewusstsein niederringen müssen, ihr Gefühl, dass ihr so viel Vergnügen gar nicht zustand und sie sich davon niemals von ihrer Pflicht abhalten lassen durfte.
Den Rest der Fahrt verbrachte Sid damit, herrlichste Zukunftspläne zu schmieden.
»Ach, Rupe, das tut mir leid. Ich könnte morgen kommen, dann müssen die Kinder nicht in die Schule. Aber du solltest lieber anrufen und Rachel fragen, ob es ihr auch recht ist. Soll ich Villy Bescheid sagen? … Gut. Also bis morgen, mein Schatz – das hoffe ich zumindest.«
Seit Rupert in die Firma eingetreten war, ging es ihnen finanziell wesentlich besser; sie hatten sich ein ziemlich heruntergekommenes Haus in Mortlake kaufen können, direkt am Fluss. Es hatte nicht viel gekostet – sechstausend Pfund –, war allerdings in schlechtem Zustand, und bei Hochwasser wurde das Erdgeschoss oft überflutet, trotz der Mauer im Vorgarten und der Aufsteighilfe anstelle der früheren Pforte. Aber das alles störte Rupert überhaupt nicht: Er hatte sich in die wunderschönen Schiebefenster und die prächtigen Türen verliebt, den fantastischen Raum im ersten Stock, der sich über die ganze Breite des Hauses erstreckte und an beiden Enden einen hübschen Kamin hatte, den Eierstab-Stuck an der Decke, die Schlafzimmer, die im obersten Stock alle ineinander übergingen und mit dem kleinen Bad mit Toilette abschlossen, das in den Vierzigerjahren modernisiert worden war und eine lachsfarbene Wanne und schwarz glänzende Fliesen hatte.
»Es ist hinreißend«, hatte Rupert gesagt. »Das ist unser Haus, Liebling. Natürlich müssen wir etwas Arbeit hineinstecken. Sie haben gesagt, dass der Boiler nicht funktioniert, aber das ist ja nur eine Kleinigkeit. Es gefällt dir doch auch, oder?«
Und natürlich hatte sie Ja gesagt.
1953 waren sie eingezogen, im Jahr der Krönung, und einige der »Kleinigkeiten« hatten sie mittlerweile behoben: Die Küche war mit der Spülküche zusammengelegt und dadurch vergrößert und im Zuge dessen auch mit einem neuen Boiler, einem neuen Herd und einem Spülbecken ausgestattet worden. Aber eine Zentralheizung konnten sie sich nicht leisten, deshalb war es im Haus immer kalt und im Winter eisig. Rupert hatte den Kindern vorgeschwärmt, dass sie vom Haus aus die Ruderregatta verfolgen könnten, aber die Aussicht hatte Juliet nicht überzeugt: »Eine der Mannschaften muss doch gewinnen, oder? Das liegt auf der Hand.« Und Georgie hatte gemeint, interessant wäre das Rennen nur, wenn die Ruderer ins Wasser fielen. Georgie war sieben und begeisterte sich seit dem Alter von drei Jahren für Tiere. Sein Zoo, wie er ihn bezeichnete, bestand aus einer weißen Ratte namens Rivers, zwei Schildkröten, die ständig im Garten untertauchten, zur entsprechenden Jahreszeit Seidenraupen, einer Strumpfbandnatter, die sich als Ausbruchskünstlerin erwiesen hatte, zwei Meerschweinchen und einem Wellensittich. Er wünschte sich sehnlich einen Hund, ein Kaninchen und einen Papagei, aber dafür reichte sein Taschengeld bislang noch nicht. Er schrieb an einem Buch über seinen Zoo und hatte ernsthaft Ärger bekommen, weil er Rivers im Ranzen versteckt in die Schule mitgenommen hatte. Während der Schulstunden wurde Rivers jetzt in seinen Käfig verbannt, aber Zoë wusste, dass er sie nach Home Place begleiten würde. Doch wie Rupert immer sagte, war er eine sehr diskrete Ratte, und oft wusste niemand, dass er überhaupt da war.
Während Zoë für die Kinder den Nachmittagstee herrichtete – Sardinen-Sandwiches und Haferkekse, die sie am Vormittag gebacken hatte –, fragte sie sich, was wohl aus Home Place werden würde. Bestimmt wollte Rachel nicht allein dort wohnen bleiben, aber vielleicht würden die Brüder sich den Familiensitz teilen, was allerdings mit ziemlicher Sicherheit bedeutete, dass sie dann nie woanders Urlaub machen würden. Dabei wünschte sie sich so, ins Ausland zu fahren – nach Frankreich oder Italien. St. Tropez! Venedig! Rom!
Die Haustür fiel krachend ins Schloss, darauf folgte der dumpfe Aufprall, mit dem ein Ranzen auf dem Steinboden im Flur landete, und dann erschien Georgie. Er trug seine Sommerschuluniform: weißes Hemd, graue Shorts, Tennisschuhe und weiße Socken. Alles, was weiß sein sollte, hatte einen gräulichen Schimmer.
»Wo ist dein Blazer?«
Überrascht sah er an sich herunter. »Keine Ahnung. Irgendwo. Wir hatten Sport. Da müssen wir keinen Blazer tragen.« Sein verschmiertes Gesicht war schweißnass, er erwiderte Zoës Kuss mit einer nachlässigen Umarmung. »Hast du Rivers seine Karotte gegeben?«
»Oje, das habe ich leider vergessen.«
»Ach, Mum!«
»Mein Schatz, er wird’s überleben. Er bekommt sehr viel zu fressen.«
»Darum geht’s doch gar nicht. Die Karotte muss er kriegen, damit’s ihm nicht langweilig wird.« Er sauste in die Spülküche und warf in seiner Eile einen Stuhl um. Einen Moment später war er mit Rivers auf der Schulter wieder da. Georgie machte immer noch eine vorwurfsvolle Miene, aber Rivers war unverkennbar entzückt, knabberte an seinem Ohr und schnoberte unter seinen Hemdkragen. »Ein dummer Blazer ist nichts im Vergleich zum Leben einer Ratte.«
»Blazer sind nicht dumm, und Rivers war nicht am Verhungern. Das ist Unsinn.«
»Also gut.« Bei seinem hinreißenden Lächeln schmolz sie wie immer dahin. »Können wir jetzt mit dem Tee anfangen? Ich habe richtig Hunger. Zum Mittagessen hat es Giftfleisch und Froschlaich gegeben, und Forrester hat über alles gekotzt, sodass ich nichts essen konnte.«
Beide saßen an einer Ecke des Tischs, und sie strich ihm das feuchte Haar aus der Stirn. »Wir müssen auf Jule warten. Und währenddessen muss ich dir etwas erzählen. Heute Vormittag ist die Duchy gestorben. Ganz friedlich, sagte Rachel. Daddy fährt heute nach Home Place, und vielleicht fahren wir morgen auch hin.«
»Wie ist sie gestorben?«
»Na ja, weißt du, sie war schon sehr alt, fast neunzig.«
»Für eine Schildkröte ist das nichts. Die arme Duchy. Es tut mir leid für sie, dass sie nicht mehr da ist.« Er schniefte und holte ein unsäglich dreckiges Taschentuch aus der Shortstasche. »Ich musste mir die Knie damit abwischen, aber es ist bloß Erde, kein Dreck.«
Wieder fiel die Haustür ins Schloss, und Juliet trat in die Küche. »’tschuldigung, dass ich so spät dran bin«, sagte sie und klang kein bisschen bedauernd. Sie zerrte sich die weinrote Krawatte und den ebenso roten Uniformblazer herunter, die mitsamt dem Ranzen auf dem Boden landeten.
»Mein Schatz, wo ist deine Mütze?«
»Im Schulranzen. Es gibt Grenzen, und die Mütze ist eindeutig eine.«
»Jetzt wird sie ganz zerdrückt sein«, sagte Georgie. In seinem Ton schwang eine Mischung von Bewunderung und Vorwitz mit. Mit ihren fünfzehn war Juliet acht Jahre älter, und Georgie wünschte sich nichts sehnlicher, als dass sie ihn liebte und sich mit ihm abgab. Meistens war sie entweder beiläufig nett, oder sie kanzelte ihn ab. »Weißt du was?«, sagte er.
Juliet hatte sich auf einen Stuhl drapiert. »Was?«
»Die Duchy ist tot. Sie ist heute Vormittag gestorben. Mum hat es mir gesagt, also hab ich’s vor dir gewusst.«
»Die Duchy? Wie tragisch! Aber sie ist doch nicht umgebracht worden oder so?«
»Natürlich nicht. Sie ist ganz friedlich mit Rachel an ihrer Seite gestorben.«
»Also ist die auch tot?«
»Nein. Ich meinte, dass Tante Rachel bei ihr war. Du wirst noch ein ganzes Stück älter werden müssen, bevor du jemanden kennst, der ermordet wurde«, fügte Zoë hinzu.
Georgie verdrückte die Sandwiches im Handumdrehen, und Rivers bekam Häppchen davon ab.
»Mummy, müssen wir Tee mit der Ratte trinken?« Als Jule dann merkte, dass die Bemerkung ziemlich herzlos war, sagte sie in ihrer besten Schultheater-Stimme: »Ich bin so traurig, ich glaube, ich bekomme keinen Bissen hinunter.«
Zoë verstand ziemlich viel vom Verhalten ihrer atemberaubend schönen Tochter (war sie in dem Alter nicht genauso gewesen?) und meinte nachsichtig: »Natürlich bist du traurig, mein Schatz. Das sind wir alle, weil wir sie geliebt haben. Aber sie war schon sehr alt, und es ist schön, dass sie keine Schmerzen hatte. Iss etwas, mein Schatz, dann geht’s dir besser.«
»Und«, fuhr Georgie fort, »Dad ist nach Home Place gefahren, und morgen in aller Früh fahren wir auch, wenn Tante Rachel das will. Was sie bestimmt will.«
»Ach, Mummy! Du wolltest mit mir einkaufen gehen, damit ich meine Jeans bekomme! Das hast du mir versprochen!« Bei der Vorstellung, dermaßen hintergangen zu werden, brach Juliet in echte Tränen aus. »Unter der Woche können wir sie wegen der blöden Schule nicht kaufen, das heißt, dass ich noch eine ganze lange Woche warten muss. Und meine Freundinnen haben alle schon eine. Das ist gemein! Können wir nicht vormittags einkaufen gehen und dann nachmittags mit dem Zug fahren?«
Zoë, die keine Lust auf eine längere Szene hatte, erwiderte matt: »Sehen wir mal.«
Und Georgie sagte: »Und was das heißt, wissen wir alle. Es heißt, dass wir nicht tun werden, was du willst, aber das sagen wir dir jetzt noch nicht.«
POLLY
Mit dem allem würde ich in den Schulferien anfangen.«
Sie hatte vor der Toilette gekniet und sich qualvoll übergeben, wie jeden Morgen in der vergangenen Woche. Es war eine Toilette der altmodischen Art, und sie musste die Kette zweimal ziehen. Sie spülte sich Wasser ins Gesicht und wusch sich die Hände, als es gerade anfing, lauwarm zu werden. Zeit zu baden blieb ihr nicht. Sie musste den Kindern Frühstück machen – sofort stieg ihr der ekelerregende Geruch von Spiegeleiern in die Nase. Die Kinder würden sich mit gekochten begnügen müssen.
Neben ihrem Bett stand eine der mit wattiertem Chintz bezogenen Keksdosen, ein Relikt ihrer Schwiegermutter, darin befanden sich jetzt schlichte ungesalzene Kräcker. Sie setzte sich aufs Bett und aß einige. Während der beiden vorhergehenden Schwangerschaften hatte sie doch den einen oder anderen einschlägigen Trick gelernt. In acht bis zehn Wochen würde sich die Übelkeit legen, dann würde das dicke Stadium mit Rückenschmerzen beginnen. »Es ist ja nicht so, dass ich sie nicht liebe, wenn sie einmal da sind«, hatte sie zu Gerald gesagt. »Es ist bloß die ganze Mühe, sie zu bekommen. Wäre ich zum Beispiel eine Amsel, bräuchte ich nur ein oder zwei Wochen hübsche, ordentliche Eier auszubrüten.«
»Denk an Elefanten«, hatte er geantwortet und ihr tröstend übers Haar gestrichen. »Bei ihnen dauert es zwei Jahre.« Ein anderes Mal hatte er gesagt: »Ich wünschte, ich könnte sie an deiner statt bekommen.«
Gerald sagte oft, er wünschte, er könnte die Sache, die gerade getan werden musste, für sie übernehmen, aber das konnte er nie. Weder konnte er sonderlich gut Entscheidungen treffen, noch entsprechend den halbherzigen Entschlüssen handeln, die er in Bezug auf dieses oder jenes fasste. Das Einzige, worauf Polly sich absolut, jederzeit und bedingungslos verlassen konnte, war seine Liebe zu ihr und den Kindern.
Das hatte sie zuerst überrascht: Sie hatte in Romanen über die Ehe gelesen und zu wissen geglaubt, dass die Phase der stürmischen Verliebtheit ins ruhige Fahrwasser des Status quo übergehen würde, wie immer dieser auch aussehen mochte. Aber so war es überhaupt nicht. Geralds Liebe zu ihr hatte Qualitäten in ihm geweckt, mit denen sie bei einem Mann nicht im Traum gerechnet hätte. Seine immerwährende Sanftmut, seine Scharfsicht, sein nie endendes Interesse an dem, was sie dachte und empfand. Und dann sein versteckter Humor. Im Umgang mit den meisten anderen Menschen war er schüchtern und schweigsam, seine Scherze bewahrte er für sie auf, und er konnte ausgesprochen witzig sein.
Sein wahres Talent zeigte er allerdings in seiner Rolle als Vater. Er war während der ganzen unsäglich langen ersten Geburt bei ihr geblieben, hatte geweint, als die Zwillinge zur Welt gekommen waren, und war ein sehr zupackender Vater gewesen, sowohl bei ihnen als auch bei Andrew, der zwei Jahre später folgte. »Irgendwie müssen wir dieses Haus ja bevölkern.« Er würde auch dieses vierte Kind gelassen aufnehmen, das wusste sie – vermutlich ahnte er es bereits und wartete, dass sie es ihm sagte.
Mittlerweile hatte sie sich Bluse, Trägerrock und Sandalen angezogen und sich das kupferfarbene Haar gebürstet und zum Pferdeschwanz gebunden. Übel war ihr nicht mehr, aber ganz behagte ihr der Gedanke ans Kochen trotzdem nicht. Dank des fantastischen Bestands an Turners, den Gerald und sie bei ihrem ersten Rundgang durch das Haus vor zehn Jahren entdeckt hatten, waren sie in der Lage gewesen, riesige Dachflächen zu reparieren und einen Gebäudeflügel in ein gemütliches Wohnhaus umzubauen, mit einer großen Küche, in der alle gemeinsam essen konnten, einem zweiten Bad und einem großen Spielzimmer für die Kinder. Sie hatten Nan ein warmes Zimmer im Erdgeschoss angeboten, aber sie hatte darauf bestanden, neben den Kindern zu schlafen: »O nein, M’lady. Das geht nicht an, dass meine Kleinen auf einem anderen Stockwerk schlafen. Das wäre nicht richtig.« Ihr Alter war unbekannt, musste aber beträchtlich sein, und sie litt unverkennbar an dem, was sie ihren Rheumatismus nannte, und so humpelte sie durchs Haus, konnte aber noch einwandfrei sehen und hören. Im Lauf der Jahre waren viele Veränderungen nötig geworden. Nan hatte ihre Vorstellungen von der Rolle, die Eltern in der Erziehung ihrer Kinder spielten (Tee mit Mummy im Sonntagsstaat und dann ein Gute-Nacht-Kuss von ihr und Daddy), zwangsläufig stark anpassen müssen. Das hatte Gerald durchgesetzt. In Nans Augen war er über jede Kritik erhaben, wenn er also seine Kinder baden, ihnen etwas vorlesen und sie in den ersten Monaten sogar wickeln wollte, schob sie das auf seine Exzentrik, auf welche die höheren Kreise, wie sie wusste, sehr hielten. »Jeder ist anders albern«, pflegte sie zu sagen, wann immer etwas passierte, das sie missbilligte oder nicht nachvollziehen konnte.
Trotz aller Arbeiten, die sie hatten vornehmen lassen, stellten die ausgedehnten restlichen Teile des Edwardianischen Hauses Polly vor große Herausforderungen. Es war wartungsintensiv. Die Räume mussten regelmäßig gelüftet werden, um die Feuchtigkeit im Zaum zu halten, die sich im Gebäude einnistete, sodass Tapeten wie Girlanden von den Wänden hingen und Dachkammern und Korridore mit schwarzen Pünktchen eines Pilzes überzogen waren, die an Napoleons Truppenaufstellung vor der Schlacht erinnerten, wie Gerald einmal gemeint hatte.
Die Kinder, oder zumindest die Zwillinge und ihre Freundinnen, spielten in den Räumen mit Vorliebe Fangen, Mehrfachverstecken und das von ihnen erfundene sogenannte Taschenlampenmonster-Spiel. Andrew ärgerte sich immer, nicht mitmachen zu dürfen, und mehrmals erlaubte Eliza es ihm, aber dann verirrte er sich regelmäßig und heulte. »Mummy, ich hab dir doch gesagt, dass es ihm nicht gefallen würde«, sagte Jane dann immer. Solche Streitereien waren an der Tagesordnung, und meist kam Gerald dann mit einem neuen einfallsreichen Vorschlag an, der die allgemeine gute Laune wiederherstellte.
Er empfing Polly am Fuß der Treppe mit der Nachricht, dass die Duchy gestorben war. Rupert sei nach Home Place gefahren und werde ihnen das Datum der Trauerfeier mitteilen, sobald alles organisiert sei.
RACHEL
Ich hatte ihr ein Ei pochiert. Für ein Ei ist sie doch meistens zu haben.«
»Ich kann nichts dafür, Mrs. Tonbridge. Ich habe das Tablett heute Morgen im Frühstückszimmer neben sie gestellt, und sie hat sich einfach bedankt und gesagt, dass sie nichts möchte.«
Das pochierte Ei lag gebettet auf einem vor Butter triefenden Toast. Eileen beäugte es hoffnungsvoll. Falls Mrs. Tonbridge es aus Pietätsgründen verschmähen sollte, würde sie es nicht den Vögeln vorsetzen. »Ich habe im ersten Stock alle Rollos herabgelassen«, berichtete sie mitteilsam. »Und Miss Rachel hat gesagt, dass Mr. Rupert heute Abend kommt. Sie möchte mit Ihnen sprechen.«
»Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Was wird sie bloß denken – dass ich hier herumtrödle, während Mrs. Senior oben liegt?« Sie steckte eine Haarklemme brachial an die richtige Stelle, zog die Schürze aus, strich sich das Kleid über der Brust glatt und verschwand.
Der Arzt sei schon da gewesen, die Gemeindeschwester werde später vorbeischauen. Tonbridge solle wohl besser nach Battle fahren und Lebensmittel besorgen – zum Wochenende würden weitere Familienmitglieder kommen. Und ach ja, Miss Sidney werde mit dem vier Uhr zwanzig eintreffen, ob er sie bitte abholen könne? »Das Essen überlasse ich Ihnen, Mrs. Tonbridge – etwas Leichtes, Einfaches.« An Essen zu denken überforderte sie im Moment.
Das stürzte Mrs. Tonbridge in Gewissenskonflikte. Einerseits war es ja nur recht und billig, dass Miss Rachel ihrer Mutter auf diese Art Respekt zollte, andererseits machte sie sich ernsthaft Sorgen, denn Miss Rachel war eindeutig völlig erschöpft, außerdem wusste sie, dass die Arme die ganzen letzten Wochen sehr wenig gegessen hatte. So ging das nicht an. Als Köchin der Familie, als die sie seit fast zwanzig Jahren arbeitete – sie hatte die Stelle lang vor der Hochzeit mit Tonbridge angetreten und, wie bei Köchinnen damals üblich, den Ehrentitel Mrs. Cripps getragen –, kannte sie die Essgewohnheiten aller bis ins Detail. Miss Rachel mochte wie ihre Mutter einfache Speisen und auch davon nur wenig, aber seit Mrs. Seniors Krankheit hatte sie in ihrem Essen nur noch herumgestochert.
»Wenn ich Ihnen eine Tasse heiße Consommé bringen lasse, bevor Sie sich bis zu Mr. Ruperts Ankunft ausruhen?«
Rachel erkannte, dass es viel leichter war, dem Vorschlag zuzustimmen, als ihn abzulehnen, und bejahte dankend.
Als Eileen die Consommé brachte, lag sie auf der harten kleinen kapitonierten Liege, die die Duchy eigens für ihren Rücken hatte anschaffen lassen. Das war ein beträchtliches Zugeständnis ihrerseits gewesen, denn sie selbst hatte zeit ihres Lebens auf harten, geraden Stühlen gesessen und von Bequemlichkeit nie und unter keinen Umständen etwas gehalten. Dabei war die Liege unbequem, wenn auch auf andere Art, doch indem sich Rachel ein Kissen ins Kreuz steckte, war es ihr möglich, die Liege zu benutzen.
Eileen fragte in ihrer Kirchenstimme, wie die Familie sie nannte, ob sie die Rollos herunterlassen solle und ob Miss Rachel, wenn sie die Füße hochlegen wolle, ihre Häkeldecke wünsche. Rachel stimmte allem zu und verfolgte, wie Eileen sich mühsam hinkniete, um die Schnürsenkel ihrer vernünftigen Schuhe zu lösen (das Rheuma bereitete dem Hausmädchen eindeutig Schmerzen), ihre Beine auf die Liege hob und die Decke sorgsam um sie feststeckte. Dann, als würde Rachel bereits schlafen, ging sie auf Zehenspitzen zum Fenster, um die Rollos herunterzulassen, und schwebte förmlich aus dem Zimmer. Zuneigung, dachte Rachel. Alles aus Zuneigung zur Duchy. Solange es sich auf derartige indirekte Gesten beschränkte, konnte sie damit umgehen. Sie stellte den Becher ab und streckte sich auf der harten Liege aus. Meine geliebte Mutter, dachte sie, und als langsam ein paar Tränen aus ihren Augen rannen, schlief sie gnädigerweise ein.
CLARY
Liebes, du solltest dir wirklich nicht so viele Gedanken machen. Schließlich ist es nur eine Woche. Eine Woche im Wohnwagen. Es wird ein richtiger Tapetenwechsel sein – und erholsam.«
Clary erwiderte nichts. Wenn Archie wirklich glaubte, dass eine Woche mit den Kindern im Wohnwagen für sie auch nur annähernd erholsam sein würde, dann war er entweder verrückt, oder es interessierte ihn nicht, wie es für sie sein würde, weil er sie nicht mehr liebte.
»Außerdem ist es viel billiger. Beim letzten Mal haben wir ein Vermögen ausgegeben, die kleinen Bälger mit Ausflügen in London bei Laune zu halten und mit ihnen essen zu gehen. Und nie wollten beide dasselbe machen. Als ich ein Kind war, wurde man zweimal im Jahr verwöhnt, zum Geburtstag und zu Weihnachten.«
»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass es billiger wird, wenn wir zu viert mit dem Auto auf der Fähre übersetzen und uns dort einen Wohnwagen mieten! Du willst doch bloß nach Frankreich fahren.«
»Natürlich will ich nach Frankreich fahren.« Vor Ärger hob er die Stimme. Er legte den Pinsel beiseite, den er gerade reinigte, und sah zu ihr, wie sie sich über das Spülbecken beugte und versuchte, die Haferbreireste aus dem Topf zu entfernen. Das Haar hing ihr ums Gesicht. »Clary! Meine Süße! Es tut mir leid!«
»Was tut dir leid?« Ihre Stimme war dumpf. Er drehte sie zu sich, sodass sie ihn ansehen musste.
»Deine Tränen sind wirklich außergewöhnlich groß, mein Liebling. Und du bist mein Liebling, wie ich es dir seit mindestens zehn Jahren versichere. Kommt das allmählich bei dir an?«
Sie schlang ihm die Arme um den Hals. Er war viel größer als sie. »Hättest du nicht lieber Polly geheiratet?«
Er tat, als würde er über die Frage nachdenken. »Ich glaube nicht, nein.«
Nachdem er ihr einen Kuss gegeben hatte, fragte sie: »Oder Louise?«
»Offenbar hast du vergessen, dass sie weggeschnappt wurde, bevor ich es mir überhaupt überlegen konnte. Nein – ich musste mit dir vorliebnehmen. Ich wollte eine Schriftstellerin, eine schlechte Köchin, eine Art schlampiges Genie. Und jetzt haben wir den Salat. Außer, dass du mittlerweile sehr viel besser kochst. Nein, mein Schatz, ich muss jetzt los. Bei mir im Atelier sitzt ein aufgeblasener vergreister Altmeister der Ehrwürdigen Sardinengesellschaft und wartet darauf, dass ich sein abscheuliches Gesicht auf Leinwand banne. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Kunst zu entehren.«
»Ich meine«, sagte sie und beobachtete, wie er seine Pinsel einpackte, »du könntest doch auch ein gutes Bild von ihm machen, oder? Und malen, was du siehst?«
»Das ist leider ausgeschlossen. In dem Fall würden sie es nicht nehmen. Das wären tausend Pfund weniger. Dann könnten wir unseren Urlaub, wenn überhaupt, in einem Wohnwagen irgendwo neben der Great Western Road verbringen.«
Wir haben beide Gespräche schon hundertmal geführt, dachte er auf dem Weg zum Bus in der Edgware Road. Ich baue sie auf, und sie will, dass ich nur das male, was ich möchte. Das störte ihn nicht. Für Clary war ihm das alles wert. Er hatte erst nach einer ganzen Weile erkannt, dass sich die grauenhaften Verunsicherungen ihrer Kindheit – der Tod ihrer Mutter, der Vater den Großteil des Kriegs in Frankreich vermisst und für tot gehalten – erst rückblickend gefahrlos manifestieren konnten. Zehn Jahre Ehe und ihre zwei Kinder hatten natürlich tiefgreifende Veränderungen bewirkt: Von den ersten, relativ unbeschwerten gemeinsamen Monaten zu den Jahren, in denen sie gereist waren oder in einem Atelier mit dem Bett auf der Galerie gewohnt hatten, als das Geld knapp gewesen war, was sie nicht weiter störte, er sich um Aufträge bemüht und Landschaften gemalt hatte, die bisweilen in Gemeinschaftsausstellungen in der Redfern und einmal in der Sommerausstellung der Academy gezeigt wurden, und sie ihren zweiten Roman geschrieben und John Davenport ihn wohlwollend rezensiert hatte – der Anfang war wunderbar gewesen. Aber nach der Geburt Harriets, bald gefolgt von Bertie – »Ich könnte genauso gut ein Kaninchen sein!«, hatte sie ins Spülbecken geschluchzt –, hatten sie sich eine größere Wohnung suchen müssen, und mit zwei kleinen Kindern hatte Clary weder die Zeit noch die Energie, auch nur ein Wort zu schreiben. Er hatte wieder angefangen, Teilzeit zu unterrichten.
In den Sommerferien waren sie nach Home Place gefahren, Weihnachten hatten sie mehrmals bei Polly verbracht, aber Clary war als Hausfrau etwas sprunghaft, und mittlerweile waren sie chronisch knapp bei Kasse und mit der Strom- und Gasrechnung in Verzug. Seit die Kinder in die Grundschule gingen, arbeitete Clary Teilzeit als Korrekturleserin, was sie großteils zu Hause erledigen konnte, und Mrs. Tonbridge hatte ihr freundlicherweise einige Gerichte beigebracht, etwa ein Corned-Beef-Ragout aus nur einer Dose Corned Beef, überbackenen Blumenkohl sowie eine Speckrolle, die wenig Frühstücksspeck erforderte. Sie hatte sich ein französisches Kochbuch von Elizabeth David gekauft, und mit Knoblauch (der bis nach dem Krieg unbekannt gewesen war) wurde alles eindeutig besser. Der sowie Bananen, die endlich wieder erhältlich waren und die Harriet und Bertie ebenso liebten wie Eiscreme, hatten die Bandbreite erweitert. Das eigentliche Problem waren die Kosten. Für eine Lammschulter bezahlte man dreizehn Shilling, aber sie reichte gerade für zwei Mahlzeiten und einen Rest als Haschee. Clary erhielt für ihr Korrekturlesen drei Pfund die Woche, während Archies Arbeit immer unsicher war – wochenlang verdiente er nichts, bis auf einmal ein ganzer Batzen hereinkam. Dann leisteten sie sich abends einen Babysitter, gingen ins Kino und anschließend ins Blue Windmill, ein sehr billiges zypriotisches Lokal, wo man Lammkoteletts, Dolmades und köstlichen Kaffee bekam. Auf der Rückfahrt im 59er Bus legte sie den Kopf auf seine Schulter und schlief oft ein – das merkte er, weil ihr Kopf und seine Schulter spürbar schwerer wurden. Wir hätten uns ein Taxi gönnen sollen, dachte er dann häufig auf dem sich hinziehenden Fußweg nach Hause. Dort fanden sie Mrs. Sturgis über ihrem Strickzeug schlafend vor, und er bezahlte sie, während Clary nach den Kindern sah, die sich ein kleines Zimmer teilten. Bertie war umrahmt von vierzehn Kuscheltieren, aufgereiht zu beiden Seiten seines Betts, die Pfote des einen – seines Lieblingsäffchens – in den Mund gesteckt. Harriet schlief flach auf dem Rücken. Fast immer hatte sie die Zöpfe gelöst und das ganze Haar nach oben geschoben, was sie »zum Kühlen« tat, wie sie einmal erklärt hatte. Wenn Clary ihr einen Kuss gab, huschte ein verstohlenes Lächeln über ihr Gesicht, ehe ihre Miene wieder die konzentrierte Ruhe der Schlafenden annahm. Ihre geliebten, wunderschönen Kinder … Aber solche Tage waren selten. Die meisten endeten im oft hitzigen Gefecht, den Kindern Abendessen vorzusetzen und sie zu baden.
Manchmal kochte Archie zu Abend, während Clary Fahnen las. Bisweilen kamen ihr Vater Rupert und Zoë zum Essen und brachten Köstlichkeiten wie geräucherten Lachs und Minztäfelchen mit. Rupert und Archie waren seit ihrer Studentenzeit an der Slade befreundet – das war lang vor dem Krieg gewesen –, und aus Clarys ausgeprägter Abneigung gegen ihre hübsche Stiefmutter hatte sich langsam eine Freundschaft entwickelt. Ihre Jungen, Georgie und Bertie, waren beide sieben, und trotz ihrer unterschiedlichen Interessen – Georgies Zoo und Berties Museum – verbrachten sie während der Ferien in Home Place schöne Tage miteinander. Ein Segen war das Haus gewesen! Die Duchy und Rachel hatten sich immer so gefreut, sie zu sehen. Als also Archie an dem Vormittag das Haus verlassen hatte, um seinen Grandseigneur aus der City zu malen, während sie die Kleidung der Kinder für die kommende Woche in Frankreich heraussuchte, waren Zoës Anruf und ihre Nachricht vom Tod der Duchy ein Schock. Die Familie hatte gewusst, dass sie krank war, aber bei jedem Anruf hatte Rachel dieselbe stoische Auskunft gegeben: »Es geht ihr gut«, »Ich glaube, sie ist auf dem Wege der Besserung« und Ähnliches mehr. Sie hatte ihnen keine Sorgen bereiten wollen, habe Rupert laut Zoë gemeint.
Ja, dachte Clary, das würde Tante Rachel sagen. Es war seltsam, dass Menschen, wenn sie andere nicht belasten wollten, genau das Gegenteil bewirkten. Die arme Tante Rachel! Sie tat ihr mehr leid als die Duchy, die ein langes, glückliches Leben gehabt hatte und zu Hause mit ihrer Tochter an ihrer Seite gestorben war. Aber ich bin auch traurig wegen der alten Dame. Oder vielleicht bin ich auch nur meinetwegen traurig, weil sie mein Leben lang da war und sie mir fehlen wird. Clary saß am Küchentisch und vergoss ein paar Tränen. Dann rief sie bei Polly an.
»Ich weiß. Onkel Rupert hat es Gerald gesagt.«
»Weißt du, wann die Beerdigung sein soll?«
»Ich vermute, dass sie das am Wochenende organisieren werden.« Polly wirkte etwas schockiert.
»Ich weiß, es klingt hässlich, aber wir wollten nach Frankreich fahren, doch wenn wir dann die Beerdigung verpassen, fahren wir natürlich nicht. Ich habe bloß gedacht …« Clary ließ den Satz unbeendet.
»Na ja, dann könnt ihr doch danach fahren, oder? Es tut mir leid, Clary, aber ich muss jetzt Schluss machen. Andrew ist außer Rand und Band. Heute ist einer der Tage, an denen er nichts anziehen will. Gerald ist unterwegs, er fährt die Mädchen zur Schule und anschließend Nan zum Zahnarzt, weil ihr ein Zahn gezogen werden muss. Bis bald.« Und sie legte auf.
Clary blieb sitzen und schaute auf das Telefon. Sie wollte mit Archie reden, aber er mochte es gar nicht, gestört zu werden, wenn er jemanden malte. Schuldgefühle überkamen sie. Ein Mensch, den sie geliebt hatte, war gestorben, und sie machte sich Gedanken wegen ihres Urlaubs und der finanziellen Folgen. Den Wohnwagen und die Fähre hatte Archie sicher schon bezahlt. Ein zweites Mal konnten sie sich das bestimmt nicht leisten. Und die Besuche in Home Place würden ein Ende haben: Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Tante Rachel allein dort wohnen bleiben würde … Es kam ihr lästerlich und habgierig vor, in einem solchen Moment an Geld zu denken. Früher hatte sie sich nie Gedanken über Geld gemacht, aber jetzt ständig. Tränen traten ihr in die Augen, und sie weinte wieder, jetzt wegen ihres verdorbenen Charakters.
Als sie sich wieder der Kleidung der Kinder zuwandte, stellte sie fest, dass in Berties Strandschuhen dort, wo sein großer Zeh war, ein Loch klaffte, was wohl bedeutete, dass er ein größeres Paar seiner anderen – teureren – Schuhe brauchte. Schon wieder das leidige Thema. Schuhe kosteten Geld. Alles kostete Geld. Sie putzte sich die Nase und beschloss, den Kindern zum Tee Fischklopse vorzusetzen. Laut Rezept brauchte man dafür eine Dose Lachs, aber sie hatte nur eine Dose Sardinen. Wenn sie ziemlich viel Kartoffelpüree dazugab, einen Spritzer Ketchup und ein Ei, um alles zu binden, sollte das für vier ziemlich große und ungewöhnliche Fischklopse reichen. Und gleich nach ein Uhr, wenn sein fettleibiger Auftraggeber zum Mittagessen gegangen war, würde sie Archie anrufen. Der Gedanke, mit ihm zu reden, munterte sie unversehens auf.
VILLY
Und natürlich werde ich nicht zur Beerdigung gehen können, weil diese Frau da sein wird.
Solche verbitterten Gedanken schwirrten ihr in einer Endlosschleife wie aufgestörte Wespen durch den Kopf.
Neun Jahre waren vergangen, seit Edward sie verlassen hatte, und sie hatte sich eine Art eigenes Leben aufgebaut. Die Tanzschule, die sie mit Zoë gegründet hatte, war in Schwierigkeiten geraten, und schließlich hatten sie das Projekt ganz aufgegeben. Das war zu der Zeit gewesen, als Zoë schwanger wurde, sie und Rupert weit weggezogen waren und Villy keine neue Geschäftspartnerin gefunden hatte, die ihren Ansprüchen genügte.
Eine Weile hatte sie sich auf das Haus beschränken müssen, das Edward ihr gekauft hatte. Zu der Zeit besuchte Roland ein Internat, wo er verstörend glücklich gewesen war. Anfangs hatte sie erwartet (oder vielleicht sogar gehofft?), ihr kleiner Junge, der bereits seines Vaters beraubt worden war (nicht im Traum würde sie jemals zulassen, dass er dieser Frau begegnete, also sah er seinen Vater nur einmal im Trimester, wenn Edward ihn zum Mittagessen ausführte), würde sich jetzt auch ihr, seiner ihn liebenden Mutter, beraubt fühlen. Sie hatte sich Schluchzen am Telefon vorgestellt, Briefe voll Wehklagen, aber »Liebste Mum, mir ist ganz schrecklich langweilig hier. Es gibt überhaupt gar nichts zu tun« war das höchste der Gefühle gewesen. In den danach folgenden Briefen war ständig von einem Jungen namens Simpson Major die Rede gewesen und den unglaublichsten Missetaten, die er anstellte, ohne je erwischt zu werden. Allerdings wohnte Miss Milliment, die frühere Hauslehrerin der Mädchen, nach wie vor bei ihr. Als Villy erfahren hatte, dass all ihre Verwandten bereits gestorben waren, hatte sie ihr ein Zuhause bis an ihr Lebensende angeboten. Im Gegenzug dafür wurde ihr eine beständige Zuneigung entgegengebracht, die Balsam für ihr geschundenes Herz war. Miss Milliments Versuche als Köchin waren eine Katastrophe, da sie sehr schlecht sah und seit dem Tod ihres Vaters, der einige Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs gestorben war, nicht mehr in der Küche gestanden hatte. Ihre Hilfe beschränkte sich folglich vorwiegend darauf, die Vögel zu füttern und bisweilen auch die drei Schildkröten und, wenn Villy etwas vergessen hatte, zum Lebensmittelladen an der Ecke zu gehen. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, ein philosophisches Werk zu lektorieren, das ein ehemaliger Schüler geschrieben hatte. Abends lasen sie sich gegenseitig KriegundFrieden vor. Als Villy dann eine schlecht bezahlte und langweilige Stelle bei einer Wohlfahrtsorganisation annahm, zu der eine reiche Verwandte ihrer Mutter sie überredete, fand sie es tröstlich, nicht in ein leeres Haus zurückkommen zu müssen.
Auch die Familie war gut zu ihr gewesen. Hugh und seine nette junge Frau Jemima luden sie manchmal zum Abendessen ein, Rachel besuchte sie bei jedem ihrer Aufenthalte in London, und die Duchy fragte sie meist, ob sie nicht außerhalb der Ferien einmal Lust habe, nach Home Place zu kommen. Teddy schaute etwa einmal im Monat vorbei. Er arbeitete in der Firma, fand Gespräche darüber aber heikel, weil er es nur mit Mühe schaffte, nicht laufend seinen Vater zu erwähnen, der, wie er rasch herausgefunden hatte, ein rotes Tuch war. Das Problem bei fast all dem bestand darin, dass sie den Eindruck hatte, alle würden sich nur aus Mitleid um sie bemühen. Wie die meisten Menschen, die sich selbst bedauerten, war sie der Ansicht, dass dies einzig und allein ihr zustand. Sie nannte es Stolz.
Nein. Wen sie liebte, waren Roland (wie konnte sie sich je überlegt haben, ihn nicht zu bekommen?) und die wunderbare Miss Milliment – die gern Eleanor genannt werden wollte, aber das hatte Villy nur ein einziges Mal über die Lippen gebracht, gleich nachdem sie darüber gesprochen hatten.
Sie musste Rachel schreiben, die ihren beiden Eltern eine großartige Tochter gewesen war – im Gegensatz zu meinen, dachte sie. Louise besuchte sie pflichtschuldig, wenn sie krank war – bereitete notfalls das Abendessen zu und plauderte mit ihr, schwieg sich aber aus, was sie selbst betraf, und schwankte zwischen Ausflüchten und gelegentlichen Versuchen zu schockieren. Und das gelang ihr auch. Als Louise unvermittelt gesagt hatte: »Aber im Moment habe ich einen reichen Liebhaber, also brauchst du dir um mich wirklich keine Sorgen zu machen«, hatte ein erstarrtes Schweigen eingesetzt, bis Villy so ruhig wie möglich gefragt hatte: »Ist das klug?« Woraufhin Louise erwidert hatte, natürlich sei es nicht klug, aber sie solle sich keine Gedanken machen, sie würde sich nicht von ihm aushalten lassen. Das alles ging in Villys Zimmer vor sich, außer Hörweite von Miss Milliment. »Bitte sprich nicht in Gegenwart von Miss M. darüber«, hatte sie inständig gebeten, und Louise hatte erwidert, sie würde nicht im Traum daran denken.
Ihre Hoffnungen auf eine Bühnenkarriere hatten sich zerschlagen, aber sie war groß und schlank, hatte eine Fülle rötlichblonder Haare und ein zweifellos schönes Gesicht – hohe Wangenknochen, weit auseinanderliegende braune Augen und einen Mund, der Villy unangenehm an die sinnlichen Darstellungen erinnerte, für die die Präraffaeliten eine Vorliebe gehabt hatten. Sie war schon seit Langem von Michael Hadleigh geschieden, der sofort wieder geheiratet hatte, und zwar seine frühere Geliebte. Louise hatte alle Unterhaltszahlungen abgelehnt und schlug sich durch; sie wohnte mit ihrer Freundin Stella, die ein richtiger Blaustrumpf war, in einer kleinen Maisonettewohnung über einem Lebensmittelladen. Villy hatte sie nur einmal gesehen, als sie hereingeschneit war. Es hatte in der Wohnung nach toten Vögeln gerochen (die Lebensmittelhändler verkauften auch Geflügel) sowie nach Feuchtigkeit. Jede der beiden hatte zwei kleine Zimmer, das dritte Stockwerk beherbergte eine Küche und ein Esszimmer, in einem wenig vertrauenerweckenden Anbau war ein sehr beengtes Bad mit Toilette untergebracht. Am Tag ihres Besuchs hatten im Esszimmer auf einem Teller Makrelen mit unverkennbarem Hautgout gelegen. »Die wollt ihr doch nicht essen, oder?«
»Um Himmels willen, natürlich nicht! Jemand, den wir kennen, malt gerade ein Stillleben und möchte, dass sie so bleiben, bis er fertig ist.«
»So, jetzt hast du alles gesehen.« Dann kannst du ja wieder gehen. Das wurde zwar nicht laut ausgesprochen, dennoch konnte sie es aus den Worten heraushören.
»Was ist mit der Miete?«
»Die teilen wir uns. Es ist nicht viel – hundertfünfzig Pfund im Jahr.«
An dem Punkt wurde Villy klar, dass sie keine Ahnung hatte, womit ihre Tochter eigentlich ihren Lebensunterhalt verdiente. Allerdings hatte sie das elende Gefühl, für dieses Mal schon genügend Neugier an den Tag gelegt zu haben. Auf der Busfahrt nach Hause wurde ihr wieder einmal bewusst, wie entsetzlich einsam sie war. Wäre nur Edward da, mit dem sie darüber sprechen könnte! Vielleicht bezahlte ja er ihr die Miete, das wäre nur richtig. Mit Miss Milliment konnte sie sich unmöglich darüber unterhalten – nach dem ganze Gerede über Liebhaber und Sex stand das völlig außer Frage.
Doch wie der Zufall es wollte, beförderte eben Miss Milliment die Einzelheiten ans Licht.
»Und was machst du dieser Tage, Louise, meine Liebe?«, hatte sie sich erkundigt, als Louise ein paar Wochen später zum Tee gekommen war.
»Ich modele, Miss Milliment.«
»Wie interessant! Mit Ton? Oder vielleicht behaust du gar Stein? Ich dachte mir immer, dass Letzteres für eine Frau doch schwere Arbeit sein müsste.«
»Nein, Miss Milliment. Ich arbeite als Fotomodell – für Zeitschriften. Sie wissen schon, wie die Vogue.« Und Miss Milliment, die der Ansicht war, Zeitschriften (abgesehen von denjenigen der Royal Geographic Society) wären etwas für Menschen mit Leseschwäche, murmelte, das müsse ja hochinteressant sein.
»Wirst du dafür bezahlt?«, hatte Villy gefragt, und Louise hatte fast barsch geantwortet: »Natürlich. Drei Guineen am Tag. Aber wenn man das freiberuflich macht, weiß man nie, wie viel Arbeit man bekommt. Und jetzt muss ich leider los. Dad hat mich eingeladen, mit ihnen nach Frankreich zu fahren. Zwei Wochen, und er bezahlt alles. Er hat eine Villa in der Nähe von Ventimiglia gemietet, direkt am Strand.«
Ein kleiner Seitenhieb zum Abschied. Sie kann gar nicht wissen, wie sehr mich das trifft, dachte Villy, als sie bis spät in die Nacht schlaflos im Bett lag und mit ihrer Verbitterung und Wut haderte. Sie hatten ihre Flitterwochen in Cassis verbracht, an derselben Küste etwas weiter westlich, in jenen längst vergangenen Tagen nach dem ersten und vor dem zweiten Krieg.
Abgesehen von dem Problem mit dem vielen Sex, den sie weder wollte noch verstand, waren es herrliche Tage gewesen. Danach hatte es die Ski- und Segelurlaube mit verschiedenen Familienmitgliedern und Freunden gegeben. Sie hatte sich als gute Seglerin erwiesen und auf Skiern eine exzellente Figur gemacht. Zu der Zeit hatte sie schon herausgefunden, dass es besser war, beim Sex so zu tun, als ob – hatte immer gesagt, es sei schön gewesen –, und er hatte ihr offenbar gern geglaubt, ohne weiter nachzufragen. Außerdem hatten die Schwangerschaften eine willkommene Auszeit geboten. Dann die eintönigen, angstvollen, endlosen Kriegsjahre, als sie in Sussex festgesessen und er die Verteidigung des Flugplatzes in Hendon organisiert hatte, bis er wegen der immensen Nachfrage nach Bauholz wieder in die Firma zurückgekehrt war. Er hatte sie überzeugt, dass ihr Haus in London, das sie so geliebt hatte, verkauft werden müsse. Und nach dem Krieg, als sie geglaubt hatte, endlich werde das schöne, normale Leben mit ihm wieder weitergehen, hatte er sie gedrängt, etwas weniger Großes zu suchen, und sie hatte sich für dieses merkwürdige kleine Haus entschieden, das nur zwei Stockwerke und eine Nord-Süd-Ausrichtung hatte, sodass lediglich drei Zimmer Sonne bekamen … und dann hatte er sie verlassen. Monatelang, jahrelang war die Sache mit dieser Frau schon gegangen. Darauf war die Scheidung gefolgt, etwas, was ihre Mutter für undenkbar gehalten hätte. Und Louise hatte davon gewusst und nichts gesagt. Als sie Roly, dem Schatz, davon erzählt hatte, hatte er ihr geschworen, er werde sie nie verlassen; Tränen waren ihm übers Gesicht gelaufen. Auch Teddy und Lydia waren schockiert gewesen, sie waren ebenso wenig an der Verschwörung beteiligt gewesen. Doch Teddy sah sie nur selten und Lydia so gut wie nie; sie hatte eine Schauspielschule besucht und war jetzt bei einem Theater in den Midlands engagiert. Das Programm wechselte wöchentlich, was bedeutete, wie Lydia ihr in einem ihrer seltenen langatmigen Briefe erklärte, dass man in einem Stück auftrat, während man Stück Nummer zwei vormittags probte und den Text für Stück Nummer drei spätabends im Bett lernte. Es sei harte Arbeit, mache ihr aber großen Spaß, und nein, sie habe nicht die geringste Ahnung, wann sie Urlaub bekommen werde oder ob überhaupt. Dieser Tochter schickte Villy zum Geburtstag und zu Weihnachten regelmäßig zehn Pfund. Sie war dankbar, eine natürliche, unbelastete Liebe für sie empfinden zu können.
Nach Zoës Anruf wegen der Duchy ging sie zu Miss Milliment, um es ihr zu sagen. Sie saß im sonnigen Wohnzimmer in ihrem üblichen Sessel neben der geöffneten Terrassentür mit Blick auf den Garten. Hier las sie jeden Vormittag die Times und machte das Kreuzworträtsel, das sie in weniger als einer halben Stunde löste. Meistens verdarb sie Villy die Lektüre der Zeitung, indem sie ihr von den Meldungen erzählte, die sie am meisten beschäftigten. An diesem Morgen beschränkte sie sich allerdings auf die unglückselige Ruth Ellis, die im vergangenen Jahr wegen Mordes an ihrem Geliebten verurteilt worden war. »Viola, ich glaube wirklich, dass ein Mensch nicht hingerichtet werden sollte, was immer er auch getan haben mag. Das ist eines unserer unzivilisiertesten Gesetze, meinen Sie nicht auch?«