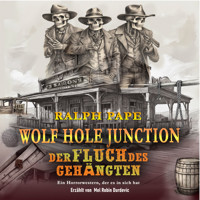5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der wahre Westen – erzählt von denen, die ihn lebten Dieses Buch ist keine bloße Nacherzählung – es ist eine erzählerische Dokumentation über den wilden Westen und die Entstehung der Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert. In kraftvollen Episoden kommen auch Menschen zu Wort, die jene Zeit geprägt haben könnten: Siedler und Indianer, Cowboys und Kavalleristen, Richter und Revolverhelden, Frauen am Rande der Gesellschaft und Männer in staubigen Stiefeln und schwerem Schicksalen. Aus persönlicher Sicht, mit historischem Fundament und erzählerischer Tiefe schildert das Buch die gewaltige Umwälzung eines Kontinents – von den Anfängen der Pionierzeit über den Bürgerkrieg bis zur Industrialisierung. Es ist die Geschichte eines Landes – roh, widersprüchlich, erbarmungslos – und doch voller Hoffnung. Kommen sie mit auf diese spannende Reise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1.Kapitel Prolog
Kein Lied von Freiheit
Wenn wir heute vom „Wilden Westen“ sprechen, dann meinen wir oft etwas, das es so nie gegeben hat. Wir sehen Männer mit breitem Hut, die lässig im Sattel sitzen, Pfeife rauchen, Whisky trinken und mit einem knappen Spruch ins Duell reiten. Wir sehen Frauen, die zwischen Saloons und Kirchentürmen wandeln, Indianer, die aus dem Nichts angreifen, und Gesetzeshüter, die mit einem einzigen Schuss für Ordnung sorgen. Aber die Wahrheit sieht anders aus.
Der Westen war wild, ja. Aber nicht wie im Film. Er war hart, voller Staub, Mangel, Hoffnung – und oft auch Verzweiflung. Er war kein Ort der Freiheit, sondern ein Ort der Arbeit. Wer hier lebte, musste kämpfen: gegen das Wetter, gegen Hunger, gegen Einsamkeit, gegen Vorurteile und gegen sich selbst.
Ich habe mich seit meiner Jugend für die Geschichten des Westens interessiert und später Western Romane geschrieben. Fiktive, aber so gut wie möglich mit historischen Hintergründen Und je länger ich mich mit dieser Epoche beschäftige, desto mehr wächst in mir das Bedürfnis, nicht nur Geschichten zu erzählen – sondern auch Wahrheit. Dieses Buch ist kein Geschichtsbuch im klassischen Sinne. Es ist auch kein Roman. Es ist ein Ritt durch das wirkliche Leben im Westen – von den ersten Siedlern bis zur Gegenwart. Ich zeige, wie es wirklich war: wie Cowboys lebten, wie Frauen durchhielten, wie das Gesetz kam, wie der Mythos entstand – und warum er bis heute weiterlebt. Der Westen war keine Bühne. Er war ein Arbeitsplatz. Ein gefährlicher. Ein einsamer. Und manchmal ein sehr stolzer.
Komm mit mir. Ich zeige dir, wie es wirklich war.
Mit persönlichen Eindrücken einiger Personen, die den Westen noch erlebt haben.
2.Kapitel Der Aufstand gegen die Krone
Die Vereinigten Staaten würde es nicht geben, wenn es die Geschehnisse von 1773 nicht gegeben hätte.
George Washington spricht zum Kongress
Philadelphia, Pennsylvania – Saal des Kontinentalkongresses Juni 1775
„Meine Herren,
ich nehme die große Last, die Sie mir übertragen haben, nicht mit Stolz, sondern mit Sorge an.
Ich bin kein Feldherr von Geblüt, kein Mann des Glanzes, sondern ein einfacher Pflanzer aus Virginia. Ich bin kein Redner, der mit feurigen Worten Männer zu Taten treibt. Aber ich glaube an Pflicht – und ich glaube an das Recht der freien Völker, ihre Geschicke selbst zu bestimmen.
Unsere Kolonien sind nicht aus Trotz zu den Waffen geeilt. Wir wollen keinen Krieg. Doch wenn uns kein Friede gewährt wird, ohne dass wir in Ketten gelegt werden – dann ist Widerstand kein Verbrechen, sondern eine Notwendigkeit.
Ich bitte den Allmächtigen um Weisheit. Ich hoffe auf den Beistand des Kongresses. Und ich vertraue auf den Mut jener einfachen Männer, die jetzt auf den Feldern von Massachusetts stehen – ungeübt, oft barfuß, doch bereit, für die Freiheit zu kämpfen.
Wenn ich scheitere, dann allein mit mir. Wenn wir siegen, dann im Namen eines neuen, freien Landes.
Ich danke Ihnen für das Vertrauen. Möge Gott uns führen.“
Für einen Moment herrscht Schweigen. Dann erheben sich einige Abgeordnete. Der Applaus ist leise, zurückhaltend – wie es die Stunde gebietet. Doch in vielen Augen steht etwas, das man vorher nicht sah: Hoffnung.Und Entschlossenheit.
Als im Jahr 1773 hölzerne Kisten voll Tee in den Hafen von Boston flogen, war dies kein launischer Akt wütender Händler. Es war der Vorbote eines Flächenbrandes. Die „Boston Tea Party“ – von radikalen Kolonisten als Protest gegen britische Steuern inszeniert – war nicht mehr nur Aufbegehren. Es war der erste Schlag gegen eine Ordnung, die viele als nicht hinnehmbar empfanden.
Die dreizehn Kolonien an der Ostküste Nordamerikas lebten seit Jahrzehnten unter britischer Herrschaft. Sie wurden verwaltet, besteuert und reguliert – doch ohne ein Mitspracherecht in London. „No taxation without representation“ (Keine Besteuerung ohne Vertretung) lautete der Ruf, der bald durch jede Siedlung, jede Kneipe und jede Dorfkirche hallte. Die Menschen fühlten sich nicht länger als Untertanen, sondern als Bürger. Und Bürger wollten gehört werden.
Die Spannungen eskalierten. 1770 kam es zum sogenannten „Boston-Massaker“, bei dem britische Soldaten auf protestierende Kolonisten schossen. Drei Jahre später landeten als Reaktion auf neue Einfuhrzölle verkleidete Männer auf britischen Handelsschiffen und warfen 342 Teekisten ins Meer. Die Antwort der Krone war hart – der Hafen von Boston wurde blockiert, neue Gesetze verhängt, Truppen in die Städte verlegt.
Am 19. April 1775 fielen in Lexington und Concord die ersten Schüsse. Es waren keine Zufälle, keine Missverständnisse. Es war Krieg.
Washingtons Antrittsrede als Oberbefehlshaber (1775 in Philadelphia)
„Ich verlasse mich ganz auf die Unterstützung des Kongresses und das Vertrauen meiner Mitbürger. Ich bin mir meiner eigenen Unzulänglichkeit bewusst und nehme dieses Kommando nicht der Ehre wegen an, sondern im Dienste einer gerechten Sache.“
Ein Jahr später, am 4. Juli 1776, erklärten sich die Kolonien in Philadelphia für unabhängig. Thomas Jefferson, ein junger Jurist aus Virginia, verfasste im Auftrag des Kontinentalkongresses ein Dokument, das in feierlicher Sprache die Rechte der Menschen und die Untaten des Königs aufzählte. „Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind“, hieß es. Worte, die sich unauslöschlich ins Gedächtnis der Welt brannten – obwohl sie in Wirklichkeit nur für einen Teil der Menschen galten.
Der Unabhängigkeitskrieg selbst war kein glorreicher Marsch. Er war hart, verlustreich und lang. George Washington, Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee, kämpfte nicht nur gegen die britischen Truppen, sondern gegen Hunger, Kälte und Desorganisation. Die Winter von Morristown und Valley Forge ließen Soldaten erfrieren, Desertion war an der Tagesordnung. Und doch hielt die Armee stand.
Saratoga brachte 1777 den ersten großen Sieg – und mit ihm Frankreich als Verbündeten. Schließlich, 1781, kapitulierte General Cornwallis in Yorktown. Zwei Jahre später, im Frieden von Paris, erkannte Großbritannien die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten an.
Doch die Revolution war mehr als ein militärischer Sieg. Sie war ein geistiger Bruch mit der alten Welt. Monarchie, Erbadel, ständische Ordnung – all das wurde verworfen zugunsten einer Idee: dass das Volk die Macht ausübt. Die erste Verfassung, die „Articles of Confederation“, hielt das neue Staatsgebilde locker zusammen. Doch bald zeigte sich: Man brauchte mehr Ordnung. 1787 wurde in Philadelphia die heute noch gültige Verfassung verabschiedet, die Gewaltenteilung, föderalen Aufbau und Freiheitsrechte garantierte.
Aber nicht alle profitierten davon. Die Sklaverei blieb bestehen. Frauen waren weiterhin ausgeschlossen. Und für die Ureinwohner begann eine Zeit des Verlustes und der Verdrängung, die in ihrer Härte kaum zu beschreiben ist.
Die Revolution hatte die Tür geöffnet. Doch was dahinter lag, war kein Paradies. Es war ein neues Land. Eines, das seine Freiheit gerade erst errungen hatte – und nun einen langen Weg vor sich hatte, um ihr gerecht zu werden.
3.Kapitel Der Blick vom Ufer
Ein alter Mann erzählt – ein Anishinabe, viele Jahre später. Ich war noch ein Kind, als wir das erste Mal Rauch am Horizont sahen. Nicht den Rauch, den der Himmel manchmal bringt, wenn Blitze das trockene Gras entzünden. Nein – dies war dichter, runder, fremder. Wie aus einem Loch in der Welt, das sich langsam näherte.
Mein Vater stand neben mir am Ufer. Er sprach kein Wort. Doch ich spürte seine Spannung, wie die gespannte Sehne eines Bogens. Die Männer unserer Sippe holten die Bögen, nicht aus Wut, sondern aus Vorsicht.
Wir hatten Geschichten gehört, alte Lieder, die gewarnt hatten vor Kanus mit Flügeln. Manche nannten sie Geisterboote. Andere sagten, sie brächten das Ende des Kreises. Aber es waren Menschen. Blass, bärtig, in Eisen und Leder gehüllt. Ihre Augen wanderten unaufhörlich – sie suchten.
Sie kamen mit glänzenden Dingen: Kupferkessel, Spiegel, Eisenäxte. Und mit schwarzen Stöcken, die Feuer spien. Sie brachten Tücher mit Zeichen, die keiner von uns lesen konnte, und Sprache, die wie abgebrochene Steine klang. Einige von uns tauschten Pelze gegen Perlen. Andere gaben ihnen Mais, getrocknetes Fleisch, Kräuter. Wir dachten: Vielleicht sind sie hungrig, wie wir es manchmal sind. Vielleicht sind sie auf einer langen Reise, wie wir es waren, als unsere Väter uns hierher führten.
Doch ihre Reise war anders. Sie suchten nicht Heimat – sie suchten Besitz. Ich erinnere mich an das Jahr, in dem der erste Baum fiel, nicht für Feuerholz, sondern für Bretter, für Dächer, für Zäune. Ich erinnere mich an das Geräusch der Säge – fremd, schneidend, unaufhaltsam.
Dann kamen mehr. Mit Wagen, mit Pferden, mit ihren Göttern aus Papier.
Die Tiere flohen, die Flüsse wurden trüb. Das Wild wurde selten. Man begann, uns zu sagen, wo wir wohnen sollten. Man zeigte mit Karten auf unser Land, als wäre es leer, obwohl unsere Toten unter jedem Hügel schliefen. Ich wurde ein Mann, während meine Welt kleiner wurde. Manche unserer Jungen gingen zu ihnen, nahmen ihre Namen, trugen ihre Kleider. Manche wollten Brücken bauen. Manche wollten kämpfen. Ich blieb. Ich lernte, zu schweigen. Ich hörte zu, als die Bäume nicht mehr sangen, weil man sie gefällt hatte. Ich hörte das Land weinen, wenn der Regen kam, aber die Büffel nicht mehr liefen.
Heute nennen sie diesen Teil des Landes «den Westen». Für uns war es einfach unser Zuhause.
Und nun erzählen sie Geschichten davon.
Geschichten von Cowboys, von Gold, von Ruhm.
Aber wenn ich an den Westen denke, sehe ich zuerst Rauch. Und Stille. Und dann – das Ende einer Zeit.
4.Kapitel Frühjahr 1820
Es roch nach Pferd, Schweiß und Hoffnung.
Robert stand neben dem Planwagen und spannte die Leinen nach, während seine Frau Anna den Jungen in die Decke wickelte. Der Kleine hatte in der Nacht gehustet. Nicht schlimm – aber in der Prärie konnte selbst ein Husten gefährlich werden. Um sie herum: Menschen wie sie. Familien mit schweren Augen und dünnem Gepäck. Ein Dutzend Wagen, dreißig Seelen – und alle wollten nach Westen. Robert war zweiunddreißig. Geboren im Königreich Württemberg Dort war er Schreiner gewesen, wie sein Vater. Aber der Boden war arm, das Brot knapp, die Zukunft schmal. Also war er mit Anna nach Amerika gekommen – fünf Jahre war das jetzt her. Zuerst Ohio, dann Illinois. Und jetzt: Missouri. St. Louis war die letzte große Stadt. Dahinter begann das, was sie „Grenze“ nannten.
Es war keine Grenze aus Stein. Kein Schlagbaum. Keine Soldaten. Nur eine Linie auf einer Karte – und die Ahnung, dass jenseits davon ein anderes Leben wartete. „Sind die Räder fest?“, rief der alte Treckführer, ein bärtiger strenger Mann, der die Route kannte. Robert nickte. Anna kletterte auf den Kutschbock. Der Junge schlief. Das Mädchen – fünf Jahre alt – hielt die Puppe aus Stoff, die Robert ihr vor zwei Wintern geschnitzt hatte.
Sie fuhren los.
Langsam, rumpelnd, knarrend.
Ein Wagenrad wackelte. Die Ochsen ächzten.
Vor ihnen lag Wald, Flussland, Prärie – und kein Versprechen außer dem, das sie sich selbst gaben: Wir werden es schaffen.
Robert sah nicht zurück.
Er war kein Held, kein Pionier. Er war ein Vater, ein Mann mit Schwielen in den Händen und Sehnsucht im Herzen. Und er wusste: Wenn das Land ihnen gnädig war – dann würde seine Tochter eines Tages sagen können: Mein Vater war einer von denen, die den Westen bauten.
Und das allein war Grund genug.
Aber der Westen war kein leeres Blatt.
Er wusste, was sie erwartete:
Die Flüsse konnten tückisch sein, reißend nach Regen. Manch ein Wagen war schon gekentert, Kinder waren ertrunken.
Präriebrände zogen wie ein Höllenschlund über das Land, entfacht von Blitz oder Unachtsamkeit.
Räuberbanden – Weiße, nicht nur Indianer – jagten Trecks, raubten Vieh, erschlugen Männer im Schlaf.
Und Krankheiten: Ruhr, Pocken, Lungenfieber. Man brauchte keinen Krieg – ein verschmutzter Wasserkrug reichte, um eine Familie auszulöschen. Und doch fuhren sie weiter.
Weil Hoffnung stärker war als Angst.
Weil es schlimmer war, stehenzubleiben.
Der fünfte Morgen war klamm und grau. Nebel hing über den offenen Ebenen wie ein feuchtes Tuch, und der Wind wehte vom Missouri her so scharf, dass selbst die Ochsen die Köpfe senkten.
Robert reckte sich. Sein Rücken schmerzte. Die Nacht war kurz gewesen. Anna hatte kaum geschlafen, der Junge hatte Fieber bekommen. Sie hatten nicht genug Wasser, um die Tücher zu kühlen, und das Wenige musste für alle reichen. Der Weg war morastig, die Wagenräder sanken bei jedem Meter tiefer ein. Einer der Männer, ein Ire mit hängenden Schultern und wettergegerbtem Gesicht, fluchte halblaut, als ihm ein Ochse stürzte und das Tier sich nicht mehr aufrichten wollte. Es war das zweite Tier, das sie verloren. Und sie waren erst am Anfang. „Der verdammte Boden frisst uns auf“, murmelte der alte Treckführer, während er mit einem Stecken die Tiefe einer Pfütze prüfte. „Wenn’s die Prärie nicht ist, dann der Regen.“ Sie spannten ab, schoben, zogen, fluchten. Hände wurden wund, ein Rad brach. Zwei Männer reparierten es mit einem Stück Eiche, das sie aus einem abgestorbenen Baum schlugen. Währenddessen hielt Anna die Kinder nahe am Feuer, das kaum mehr als ein glimmender Rest war.
Später, als sie endlich weiterzogen, sprach keiner mehr ein Wort. Der Regen hatte nachgelassen, aber die Stille war schwer. Wie ein Schleier lag sie über dem Treck – als hätte jeder seinen eigenen Zweifel geschluckt.
Robert blickte nach Westen, wo der Himmel heller wurde. Dort, irgendwo jenseits dieser nassen Weiten, sollte das Land liegen, das sie suchten. Doch heute – heute war es nur ein ferner Gedanke.
5.Kapitel Ein Trail voller Gefahren
Die Männer des Trecks trugen Waffen – nicht aus Abenteuerlust, sondern aus Notwendigkeit. Meist waren es alte Steinschlossgewehre, lang und schwer, mit glattem Lauf oder gezogenem Zug. Die „Kentucky Rifle“ war unter den deutschen Auswanderern beliebt, weil sie präzise war, wenn man damit umzugehen wusste. Andere führten Flinten, manche umgebaut aus Jagdwaffen ihrer alten Heimat. Ein paar der erfahreneren Männer, Trapper oder ehemalige Soldaten, hatten modernere Stücke – seltene Perkussionsgewehre oder einschüssige Pistolen mit Zündhütchen. Solche Waffen galten als Zuverlässiger bei Regen, doch die meisten im Treck konnten sich so etwas nicht leisten.
Auch Robert hatte seine Flinte mitgeführt. Eine alte Steinschlossbüchse, sorgfältig gepflegt, mit dunklem Schaft und Messingbeschlägen. Sie hatte schon seinem Großvater gehört, der noch gegen die Franzosen gekämpft hatte. Robert traute ihr – und doch wusste er, wie schnell sie bei Nässe versagen konnte. Das Schwarzpulver war empfindlich, der Zündstein musste scharf sein, und der Wind durfte nicht falsch stehen. Im Wagen lagen außerdem eine Pistole, ein Ladestock, Kugeln aus Blei, ein Pulverhorn und eine Dose mit Feuerstein. Anna hatte alles säuberlich in ein Tuch gewickelt. Es war nicht viel – aber es war das, was sie hatten, falls Wölfe, Hunger oder Menschen kamen, die ihnen nicht wohlgesonnen waren.
Missouri, nahe dem Gasconade River – später Nachmittag Der Wind hatte aufgefrischt, und der Himmel über den Eichen war bleigrau. Der Treck lagerte in einer Senke, geschützt vor der Prärie, während die Frauen Feuer machten und die Männer die Tiere versorgten. Robert hockte bei seinem Wagen und schabte den Zündstein an einem Stück grobem Stahl. Die Flinte lag zerlegt neben ihm – Lauf, Schloss, Schaft. Alles musste trocken und sauber bleiben. Schwarzpulver verzieh keine Nachlässigkeit.
Plötzlich bellte ein Hund – erst warnend, dann schrill. Stimmen wurden laut. "Da kommen Reiter!", rief jemand von der Anhöhe. Robert sprang auf. Anna zog instinktiv die Kinder an sich. In der Ferne näherten sich drei Männer auf Pferden, langsam, ohne Hast – aber mit der Ruhe von Leuten, die wussten, dass man sie zu beachten hatte.
Sie trugen Hüte mit breiter Krempe, ihre Westen waren verstaubt, und mindestens einer hatte ein Gewehr quer vor dem Sattel. Fremde. Und nicht die Sorte, die grüßt und weiterreitet.
Der Treckführer trat nach vorn, die Flinte locker in der Armbeuge. Neben ihm standen zwei andere Männer, ebenfalls bewaffnet – alte Musketen, eine Perkussionsbüchse. Robert schob die Ladepfanne seiner Flinte zu, spannte den Hahn. Seine Finger zitterten nicht, aber er spürte das Zittern in den Knien.
Die Reiter hielten an, vielleicht zwanzig Schritt entfernt. Der vorderste – ein drahtiger Kerl mit wettergegerbtem Gesicht – rieb sich den Bart und sprach mit schleppender Stimme. "Abend, Leute. Wir haben da draußen ’n gerissenen Ochsen gefunden. Dachten, ihr habt vielleicht einen verloren."
Niemand antwortete.
"Wir helfen gern beim Suchen – gegen ein Stück Brot. Oder Whisky, wenn einer von euch was hat."
Robert trat neben den Wagen. Seine Flinte hielt er tief, aber schussbereit. Er sagte nichts. Die Spannung war greifbar wie ein gestraffter Bogen. Der Treckführer hob die Stimme: "Wir kommen allein klar. Zieht weiter." Einen Moment lang regte sich nichts. Dann spuckte einer der Reiter aus, drehte sein Pferd. "Feiner Empfang", murmelte er. Die anderen folgten. Langsam, gemächlich. Erst als sie außer Sicht waren, ließ Robert die Waffe sinken. Der Schweiß klebte ihm am Rücken. Anna trat neben ihn.
"Hättest du geschossen?", fragte sie leise. Robert antwortete nicht. Er blickte auf den Zündhütchenlauf seiner alten Flinte – und dachte an seine Tochter, die hinter der Plane saß, mit der Puppe auf dem Schoß.
Das Land war unruhig – aufgeworfen wie ein zerknittertes Leintuch, durchzogen von Bachläufen, Morast und dichtem Unterholz. Kein offenes Grasmeer, wie man es aus Erzählungen kannte. Stattdessen: schmale Pfade, in die sich kaum zwei Wagen nebeneinander quetschen konnten, hohes Farnkraut, das gegen die Achsen schlug, und Bäume, die so eng standen, dass man sie nur mit der Axt zur Vernunft bringen konnte. Einmal blieb ein Wagen in einem Graben stecken, kippte zur Seite, der Inhalt kullerte in den Matsch – ein Fass Mehl platzte auf, wurde zur nassen Masse. Zwei Männer fluchten, ein Kind weinte, der Treckführer scheuchte die Männer wieder auf die Beine. Zeit war hier kein Freund, sondern ein Gegner.
Am Abend lagerten sie an einem Seitenarm des Marais des Cygnes River. Die Pferde standen schnaubend am Ufer, der Boden war weich, aber nicht gefährlich. Robert schichtete Holz auf, das mehr Qualm als Flamme gab. Es roch nach feuchter Rinde und verbranntem Haar.
Ein Schuss hallte durch das Tal – einer der Jäger hatte ein Reh erlegt. Wieder ein Tag überstanden.
Doch es wurde kalt in der Nacht. Alle froren erbärmlich und aus dem Dickicht hörte man das Heulen – langgezogen, klagend. Wölfe, wahrscheinlich. Vielleicht auch nur ein Cojote.Aber in dunklen Nächten wurde jedes Geräusch größer. Anna lag mit den Kindern unter Decken, während Robert mit zwei anderen Wache hielt. Das Gewehr auf den Knien.
Hinter ihnen lag Missouri. Vor ihnen: die offene Prärie, das weite Land. Aber noch war das hier Wildnis – eine Zone zwischen den Welten. Kein Gesetz, keine Zäune, keine Hilfe. Nur Wälder. Flüsse. Und Männer mit Schwielen an den Händen.
Zwei Tage später, nahe der Osage Hills
Der Himmel hing grau über dem Lager, und es roch nach feuchter Erde und kalter Asche. Einer der Jungen aus Wagen Nummer drei war in der Nacht gestorben. Elf Jahre alt. Fieber. Erst Schweiß, dann Kälte. Dann gar nichts mehr. Es ging schnell – wie so oft.
Sie begruben ihn am frühen Morgen, am Fuß eines großen, borkigen Baums, den sie später auf keiner Karte finden würden. Der Treckführer sprach ein paar Worte, der Vater stand reglos daneben, den Hut in der Hand. Die Mutter weinte nicht. Sie hatte in dieser Woche schon alles geweint, was sie hatte.
Robert hob mit zwei anderen Männern das Grab aus. Nicht tief – der Boden war durchzogen von Wurzeln, hart wie Stein. Sie legten schwere Äste und Steine darüber. Zum Schutz. Nicht als Denkmal.
Seine Tochter hielt sich an Annas Rockzipfel fest und fragte leise, ob der Junge jetzt beim lieben Gott sei. Anna nickte. „Ja“, sagte sie. „Aber Gott ist hier draußen weit weg.“ Später, als sie weiterzogen, drehte sich keiner mehr um. Man konnte nicht. Wer zu oft zurückschaute, verlor den Blick nach vorn – und der Westen verzieh das nicht.
Drei Wochen später – Somewhere am Big Blue River Der Fluss war trügerisch. Breit, dunkel, träge an der Oberfläche – aber darunter zog er mit Kraft, wild und unbarmherzig. Regenfälle weiter nördlich hatten ihn anschwellen lassen. Das Wasser reichte den Männern bis an die Hüften, den Ochsen bis an die Brust. „Wir müssen durch“, sagte der Treckführer. „Heute noch. Oder wir verlieren zwei Tage.“ Zwei Tage. In der Prärie bedeutete das: zwei Tage weniger Vorräte, zwei Tage näher am Schnee, zwei Tage länger in Gefahr.
Sie bereiteten die Wagen vor. Alles, was schwer war, wurde gesichert. Fässer, Kisten, Gewehre, Mehl. Die Kinder wurden auf die Ladeflächen gesetzt, ganz oben – falls der Wagen zu kippen drohte. Die Frauen banden ihre Röcke hoch. Männer legten die Gewehre ab, rollten die Hosenbeine hoch, banden Seile an die Achsen. Robert spannte die Leinen, murmelte ein kurzes Gebet, das nicht aus dem Buch kam, sondern aus dem Bauch. Anna hielt das Mädchen fest an sich gedrückt, der Junge zitterte trotz der Decke.
Dann traten sie ein.