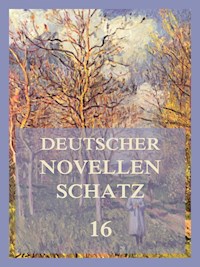2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: stimm-los
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Novelle spielt in Papenburg zur Zeit der napoleonischen Besatzung im Emsland Anfang des 19. Jahrhunderts. Die nicht unvermögende Familie Wilms handelt mit geschmuggelten Kaffeebohnen, als ein alter holländischer Bekannter die verwitwete Mutter aufsucht. Er komme im Auftrage des holländischen Prinzen von Oranien, der auf der Flucht vor den Franzosen sei und dringend Geld benötige, um seine Stellung in Holland wieder zu erlangen. (Geschichtlicher Hintergrund: der Prinz von Oranien, der spätere holländische König Wilhelm IV., war vor den Franzosen nach England geflohen.). Mutter, Tochter Angela und Sohn Sievert nehmen die Geschichte für wahr an. Schließlich erscheint sogar ein zweiter Mann, der sich als Prinz von Oranien ausgibt und von der Familie Wilms im eigenen Haus versteckt wird. Doch Angela und ihr Verlobter Wendel - Mutter Wilms ist gegen die Verbindung ihrer Tochter mit dem mittellosen Wendel - werden misstrauisch. Als große Geldmengen im Haus der Wilms gestohlen werden, überführen Angela und Wendel die beiden Männer als Täter. Wendel geht nach Amerika und kommt als reicher Mann zurück. Damit wird auch schließlich die Hochzeit von Angela und Wendel von der Mutter akzeptiert. Basis dieser Ausgabe ist die Novelle „Angela Wilms und der Prinz von Oranien“, die Emmy von Dincklage in ihrem Buch Neue Novellen I. Band, Geborgenes Strandgut, Seiten 1 - 68, im Verlag Bernhard Schlicke, Leipzig, 1871 veröffentlichte. Da die Werke zur damaligen Zeit in Fraktur gedruckt wurden, erfolgte zur besseren Lesbarkeit eine buchstabengetreue Transkription des Werkes in die heutige Antiqua-Schrift. Originalrechtschreibung, Interpunktion, Grammatik und Satzaufbau wurden beibehalten; Anführungszeichen der wörtlichen Rede sind den heutigen Regeln angepasst; offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Dadurch ist es möglich, dass der Leser nicht nur über die Inhalte, sondern auch über den Textaufbau in die damaligen gesellschaftlichen Gegebenheiten tief eintauchen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Transkription
Wiedergefundene Perlen der Literatur Nr. 87
1. Auflage, 2022
stimm-los
Dr. Hungeling Verlagsbuchhandlung und Antiquariat
Gänseblümchenweg 5
16303 Schwedt/Oder
www.stimm-los.de
Vorwort zur stimm-los Ausgabe
Dieses Werk ist Teil der Buchreihe »Wiedergefundene Perlen der Literatur«. Der Verlag stimm-los veröffentlicht in dieser Buchreihe Werke aus vielen Jahrhunderten. Mit dieser Buchreihe verfolgt stimm-los das Ziel, Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen als Buch einem breiten Leserkreis wieder zugänglich zu machen. Förderung der Kultur und Erhaltung der Literatur stehen dabei im Vordergrund. So trägt stimm-los dazu bei, dass viele Werke nicht in Vergessenheit geraten. Die Autoren dieser Werke erhalten wieder eine Stimme; sie sind nicht stimm-los.
Bei dieser Ausgabe handelt es sich um eine wörtliche Wiedergabe der Novelle
Titel:
Angela Wilms und der Prinz von Oranien
Autorin:
Emmy von Dincklage
Erschienen in:
Emmy von Dincklage, Novellen 1. Band, Geborgenes Strandgut, Seiten 1 - 68, Verlag Bernhard Schlicke, Leipzig, 1871
Die Transkription »Fraktur nach Antiqua« erfolgte verlagsintern. Originalrechtschreibung, Grammatik und Satzbildung wurden beibehalten. Offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert.
Angela Wilms und der Prinz von Oranien.
Angela Wilms war in ihrer Jugend — zu Anfang dieses Jahrhunderts — ein blühend hübsches Mädchen; auch hatte sie sich über keinerlei Verkennung in dieser Hinsicht zu beklagen. Sie hieß in ihrem Heimathorte, der Colonie Papenburg an der Ems, nur: dat moje Wigd (das schöne Mädchen). Ja, sie ward unter dieser Bezeichnung angerufen und vervollständigte sie gegen Fremde höchstens durch die Erklärung: »Ich schreibe mich Angela Wilms!« Daß sie sich so schrieb, war allerdings eine zweite Berechtigung zu erhöhtem Selbstbewußtsein; denn ihr verstorbener Vater, der Schiffbauer Lambert Wilms, war einer der »Dicksten«, d. h. Vermögendsten, der Colonie.
Angela oder Engel Wilms, wie man dort zu Lande sagt, zeigte eine sehr glückliche Mischung der Typen zweier, wenngleich benachbarter, doch sehr verschiedener Racen. Des Vaters altsächsisches Erbtheil war das blonde Haar und die Fülle der Lippen nebst einer freundlichen Weichheit des Gesichtsausdruckes, welche durch die Rundung der Wangen erhöht ward. Die holländische Mutter gab ihr dagegen zwei rehbraune, manchmal fast schwermüthige Augen, einen feinen Gliederbau und jenen gemalten Teint, den die batavische Frau ihrem feuchten Vaterlande dankt, die bilderhaft abgezirkelten Rosentinten der Wangen, die das niederländische Lärvchen beinahe puppenartig erscheinen lassen. Das eigentliche holländische Patrizierkennzeichen, die schmale scharf gebogene Nase, fehlte auch Angela nicht; aber der nationale hartköpfige und zähe Eindruck derselben war in dieser lächelnden und naturfrischen Umgebung verwischt.
Das »neerlandske« Gesicht, wie es sich in den bessern Schichten der Bevölkerung bewahrt hat, nähert sich in seinem Zuschnitt viel eher den südeuropäischen Physiognomien, als den flachen, ramassirten und bäuerischen Nachbarn in den Haiden und auf den Marschen Norddeutschlands. Der brünette Ausdruck scheint sogar schärfer markirt, da kein inneres Feuer, keine südliche Lebendigkeit ihn durchleuchtet und vertieft. Jede Linie und Furche gräbt sich ungestört und unverändert ein; ja sie zieht sich mit derselben Stetigkeit durch Generationen, womit diese, unbeirrt, ihre Stellung und ihre Habe überwachen und mehren. Die Väter dieses batavischen Stammes mußten die Ausdauer haben, dem Meere ein ganzes Land, Zoll für Zoll, abzukämpfen! — Dennoch erhielten nur gewisse Kasten den National-Typus unverändert. Die Masse des Volkes konnte nicht wohl ihre Ursprünglichkeit in dem Grade schützen, denn sie mußte, und muß noch heute, fremde Arbeitskräfte um schweres Geld in’s Land ziehen. Deutsche bauen die Häuser und Schiffe der Holländer, beackern ihr Land, mähen ihre Wiesen, sind überall unentbehrlich; es ist fast ein Wunder, daß noch so viel nationales Gepräge dieser unausgesetzten Reibung Stand hielt.
Angela Wilms war weit entfernt, sich Rechenschaft über die Art ihrer Schönheit zu geben; sie war kaum eitel. Ihren Landsleuten klebt in jedem Urtheil eine kernige Aufrichtigkeit an, welche selbst jetzt noch überraschend nachwirkt, wo schon alle möglichen Speculationen, Dampfschiffe und Eisenbahnen, nivellirend über solche Eigenthümlichkeiten dahinzogen. Man spricht seine Ansicht über schön und häßlich aus, wie wir über groß und klein, alt oder jung. Eben so stoisch, als sich Angela schön nennen hörte, vernahm sie, daß man aussprach: »Engel is wat dumm!« Ja, vielleicht gab sie dem letzten Ausspruche von »etwas Dummheit« innerlich Recht. Sie fühlte sich anders, als ihre Gespielinnen.
Angela’s Vaterhaus ist äußerlich, wie innerlich, mit einem großen Aufwande von gelber und grüner Oelfarbe decorirt, in welche nur hier und da ein gefälliges Braunroth erfrischend eingreift; es duckt sich, wie eine Henne mit ausgebreiteten Flügeln, spitzgiebelig und weit deckend, in breitester Basis auf die Scholle Muttererde nieder, die es trägt. Diese Scholle ist kaum »Erde« zu nennen, sondern vielmehr eine Anhäufung mooriger und elastischer Urfasern, die sich lange Jahre jeder Zersetzung weigern und eine besondere, dem Festlande unvertraute Art der Vegetation begünstigen.
Auf der Schwelle dieses Vaterhauses finden wir Angela. Sie trägt eine bis an die Kniee reichende, dunkele Wolljacke, darunter einen Rock von feuerfarbener Boje und auf dem blonden, etwas welligen, schräg gelegten Scheitel eine puffige Haube — dort Kappe genannt — von dunkelrothem Cattun, ganz wie einst Rothkäppchen vor dem ominösen Mißverständnisse mit dem Wolfe. Die Stellung des jungen Mädchens ist ungekünstelt naiv: sie stemmt beide Hände in die Taille und blickt den Fahrweg hinauf und hinab. Dieser Weg läuft den Canal entlang, der den, eine halbe deutsche Meile langen Ort durchzieht, und ist die einzige Straße desselben.
Angela’s Blicke streifen auch wohl zuweilen flüchtig das dunkelbraune, träge Wasser und haften prüfend an den Häuserreihen jenseits, die in oder neben ihren Gärtchen mit Oelfarbe übergossen daliegen; indeß kehren sichtbar ihre Gedanken stets in die unmittelbare Nähe, auf die jetzt verödete Werft ihres Vaters zurück. Dort ward sonst unter dröhnenden Hammerschlägen mancher gute Kauffahrer zusammen gefugt; manchmal sammelte sich die Menge, Kopf an Kopf, um das vollendete Fahrzeug vom Stapel laufen zu sehen.
Da der Canal nicht sehr breit ist, muß das Schiff eine sehr scharfe Wendung machen, und die Zuschauer ermessen, prüfenden Blicks, alle erdenklichen Vor- oder Nachtheile der kleinsten Bewegung des Colosses. Daher eine bange Stille, nur unterbrochen durch den Refrain der Arbeiter an der Winde, welcher in tiefen Tonlagen ihre Schritte mißt und ihre Bewegungen einigt. Bei jeder Runde springen oder treten die baumstarken Zimmerleute über die mächtigen Taue, die ächzend und straff das Schiff langsam bewegen. Dasselbe liegt auf Schienen, die mit grüner Seife sorgsam bestrichen sind. Auf dem Deck des neuen Seehelden aber sind eine Menge kleiner und großer Menschenhelden, die mit freudigem Herzklopfen den großen »Plumps« in’s Wasser erwarten.
Unter ihnen war, ach wie oft! der blonde, kindliche Kopf Angela’s zu schauen: ihr Haar flatterte im Winde — denn die Sitte verlangt erst von dem erwachsenen Mädchen, dasselbe zu bedecken — und sie schien sich eine Königin, die eben so gut direct hätte in die Wolken steigen können, als hinabschwanken in die moorigen, und vor Schreck rings das Ufer überfluthenden Wellen.