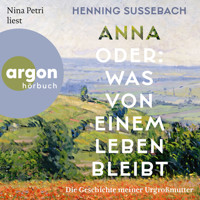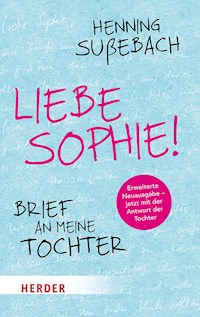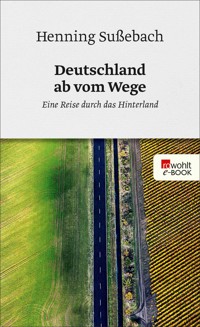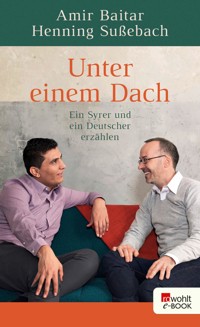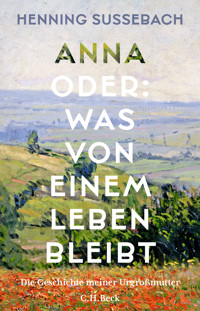
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag C.H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1887, tief im Sauerland. Eine junge Frau kommt den Weg hinauf ins Dorf Cobbenrode. Dort soll Anna Kalthoff die neue Lehrerin werden. Doch sie wird es nicht bleiben. Denn Anna widersetzt sich bald den Erwartungen des Ortes und den Regeln ihrer Zeit. Sie entscheidet selbst, was sie zu tun und zu lassen hat, wie sie leben und wen sie lieben will. Zwei Jahrhunderte später rekonstruiert der Urenkel Annas inspirierendes Leben und rettet so die Geschichte einer selbstbewussten Frau vor dem Vergessen. Sein Buch ist eine zauberhafte Annäherung an die Vorfahren, ohne deren Entscheidungen und Mut es uns nicht gäbe.
Einige Fotos, Poesiealben, Postkarten, ein Kaffeeservice, ein Verlobungsring: Viel mehr stand Henning Sußebach nicht zur Verfügung, als er sich auf die Spuren seiner Urgroßmutter Anna begab. Nach einem Jahr der Suche fügte sich ein Bild: Da hat eine scheinbar gewöhnliche Frau ein außergewöhnliches Leben geführt, gegen allerlei Widerstände. Anna nahm sich, was sie vom Leben wollte. Männer, Arbeit, Freiheit! Diesem Willen hat der Autor seine Existenz zu verdanken. Sein Buch ermuntert uns alle, nach den Annas zu suchen, die es in jeder Familiengeschichte gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Henning Sußebach
Anna oder: Was von einem Leben bleibt
Die Geschichte meiner Urgroßmutter
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Dank
Bildnachweis
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Für meine Mutter
Jeder Mensch stirbt zweimal.
Sein erster Tod ist biologisch und der, den wir meinen, wenn wir vom Sterben sprechen. An einem bestimmten Tag, zu einer festen Stunde, fehlt dem Herz die Kraft für einen nächsten Schlag, versiegen die Hirnströme, stellt ein Arzt einen Totenschein aus und bestätigt damit amtlich ein Ende, das insofern keins ist, weil in genau diesem Moment das zweite Sterben beginnt: Der Mensch wird vergessen.
Der zweite Tod, nennen wir ihn den sozialen, vollzieht sich anfangs fast unmerklich. Beim Begräbnis reden noch alle über die verstorbene Person, auch in den Wochen danach ist sie in den Gedanken der Hinterbliebenen fast so präsent wie zu Lebzeiten, sodass kaum auffällt, dass einige sich eher an ein Gesicht erinnern und andere an eine Stimme, an eine Geste oder einen Geruch, an ein Gelingen oder an ein Missgeschick, an einen Alltagsmoment beim Abendbrot oder an ein gemeinsam durchgestandenes Abenteuer, an einen Augenblick des Glücks oder der Furcht, an ein Lob oder an eine Ohrfeige. Das Bild des verstorbenen Menschen besteht nur noch aus Bruchstücken, die von Tag zu Tag mehr mit den Gefühlen der Nachfahren zu tun haben und immer weniger mit dessen eigenem Wesen. Bald gefriert die Mimik, verklingt das Lachen, braucht es zum Gedenken einen Jahrestag oder ein Erbstück wie eine Zuckerdose, die dann bei einem Umzug zerbricht oder verloren geht. Schon für die folgende Generation bleiben oft nur Fakten, eine biografische Hülle ohne Wesenskern, hohl und hart wie der Panzer eines Insekts: Name, Wohnort, Beruf, Krankheiten, die großen Schicksalsschläge. Mit Glück ein Tagebuch, Briefe oder Fotos, auf denen ein nun schon fremder Mensch zu sehen ist, von dem sich glauben ließe, er habe nie eine Existenz außerhalb der Bilder geführt.
Das Individuum mutiert zum Irgendjemand, zum auswechselbaren Vertreter einer vergangenen Epoche. Zum Tagelöhner mit Heugabel, zur Mutter mit fünf Kindern am Rockzipfel, zum Weltkriegssoldaten in Uniform, zu historischem Hintergrundpersonal ohne eigene Identität. Der zweite Tod erwischt zuerst jene, die wir Normalbürger nennen. Unsere Erinnerung liebt die Extreme, sie ist kriegslüstern, sensationsgierig und königstreu. Feldherren, Massenmörder und Cäsaren lässt sie länger leben.
Meine Urgroßmutter Anna Kalthoff starb 1932, ein Jahr, bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Annas Erstarren zu einer Figur auf alten Fotos, ihr Versinken in der Vergangenheit, ist weit fortgeschritten, was in ihrem Fall auch daran liegt, dass all die Verbrechen, die von 1933 an folgten, den Blick auf das Davor, auf Millionen Menschen und deren Biografien, noch schneller und umfassender verstellten.
Anna lebte in heute schwer fassbaren, unübersichtlichen Zeiten, womöglich zu wirr und widersprüchlich für ein klares Bild, das die Jahre überdauert. Sie war Bürgerin von vier Staaten. Königreich Preußen, Norddeutscher Bund, Deutsches Kaiserreich, Weimarer Republik. Sie durchlebte Währungsreformen, Börsencrashs und Inflation. Sie war Zeugin, als ein großer Krieg den Kontinent verheerte, als Monarchien stürzten und eine junge Demokratie um ihre Existenz kämpfte. Sie erlebte mit, wie die Industrialisierung einigen Wohlstand brachte und andere ins Elend rutschen ließ. Sie las von Männern, die sich in wackligen Fluggeräten an die Eroberung des Himmels machten. Sie sah die ersten Autos fahren. Sie hörte, wie plötzlich Stimmen von Radiowellen übertragen wurden.
Anna war dabei, als die Welt sich weitete, die Räume für eine Frau wie sie aber eng blieben.
In meiner Familie gibt es niemanden mehr, der Anna noch persönlich begegnet wäre. Anders als berühmte Zeitgenossen hat sie kein Tagebuch hinterlassen und wohl auch keins geführt, weder aus Selbstbesoffenheit, noch um Gedanken für literarische Großwerke zu sammeln oder gar, um irgendein Bild zu beeinflussen, das sich die Nachwelt von ihr machen würde. Sie kam auf die Welt und verließ sie wieder. Ihr Nachlass ist winzig. Nur einige Fotos, zwei Poesiealben aus ihrer Jugend, einige Notizbücher, wenige Briefe und Dokumente, ein Kaffeeservice, ein Sticktuch und ein Verlobungsring haben es in die Gegenwart geschafft. Dazu eine Legende, die längst voller Lücken ist. Anna, die nach den üblichen Maßstäben der Geschichtsschreibung zu den gewöhnlichen Menschen zählt, soll ein eher ungewöhnliches Leben gelebt haben. Ein Leben voller Schicksalsschläge und jäher Wendungen. Geprägt von einer großen Liebe, die lange im Verborgenen bleiben musste, und von einem steten Kampf um einen Platz in der Arbeitswelt. Anna, so erzählen es die Ältesten in meiner Familie, verstieß früh gegen Konventionen und verließ alle Pfade, die für sie vorgezeichnet waren. Sie ergriff Chancen, die sie nicht hatte, und behauptete sich so in einer Epoche, in der eigentlich die Männer den Frauen die Plätze zuwiesen.
Sie wird nicht die einzige gewesen sein. Wir unterschätzen so viele gelebte Leben. Nahezu jeder Mensch wird dem Treiben der Geschichte einmal die Stirn geboten haben. In jeder Biografie spiegelt sich Weltgeschehen, und jeder unserer Vorfahren hat dieses Weltgeschehen mitgeprägt, ob durch Anpassung oder Auflehnung, bremsend oder beschleunigend.
Irgendwann fragen sich die meisten Menschen, wer vor ihnen war, in welche Kette gelebter Leben sie sich einreihen. Wir haben fast alle ein genaues Bild unserer eigenen Eltern, auch nach deren Tod. Die meisten von uns können sich auch noch die Großeltern in lebendiger Erinnerung vor Augen führen. Doch wie sieht es nur eine Generation früher aus? Unsere Urgroßeltern erscheinen bereits unendlich weit weg, sind nahezu verschwunden hinter einer Bruchkante in ein dunkles Nichts. Obwohl ihre Zeit erst ein Jahrhundert zurückliegt, kennen wir kaum mehr ihre Namen, und bestenfalls sind einige Erbstücke geblieben, Postkarten, Porzellan oder Schmuck, für den wir im Alltag keine Verwendung haben. So schnell schrumpft ein Leben auf einige zufällig bewahrte Gegenstände zusammen. So schnell ist vergessen, wer sich vor nicht allzu langer Zeit durch seine ruppige Gegenwart schlug und dabei für uns heute in Vorleistung ging.
Dieses Buch ist der Versuch, eine Erinnerung zu retten. Einen jener Menschen wieder ins Licht zu ziehen, der in unruhigen Zeiten lebte, die unseren heute nicht ganz unähnlich sind. Von Anna ist gerade genug geblieben, um ausgehend von spärlichen Anhaltspunkten nach mehr zu suchen und so wenigstens etwas von dieser Frau aus der Vergangenheit zurückzuholen. Die Lücken in ihrer Lebensgeschichte habe ich nicht schließen können, aber so viel gefunden, dass ich hoffe, ihr gerecht werden zu können.
• • •
1887, tief im Sauerland, Westfalen. Endlich weicht der Winter, schmilzt der Schnee, kehrt das Licht zurück in die Talgründe. Es muss ein Tag im März sein, vielleicht schon im April, da kommt eine junge Frau eine schottrige Straße hinauf ins Dorf Cobbenrode, durch einen Wald aus alten Eichen und neu gepflanzten Fichten, dem Gurgeln eines Baches entgegen. Um diese Jahreszeit ist der Boden schlammig und schwer, die Straße nicht leicht zu begehen. Hoffentlich hat Anna genug Geld, um einen Platz in der Postkutsche zu bezahlen. Denn es geht stetig bergauf, und nach allem, was bekannt ist, hat die junge Frau viel Gepäck dabei. Anna ist 20 Jahre alt und soll die neue Dorfschullehrerin werden.
Sehen wir sie uns an, auf einem Foto aus jener Zeit: Eine Studioaufnahme, Portrait im Halbprofil. Anna blickt aus dem Bild heraus wie auf ein unsichtbares Ziel. Große, klare Augen. Eher schmale Lippen. Sollte der Fotograf Anna darum gebeten haben, ein wenig zu lächeln, ist ihr das gelungen, mit einem Zug ins Spöttische statt ins Unterwürfige. Ihre dunklen Haare sind mittig gescheitelt, straff nach hinten gekämmt und zu einem Nackenknoten gebunden. Ihre Ohren liegen frei, ihre Stirn, ihr gesamtes Gesicht, was Anna schutzlos wirken lassen könnte, ihr aber eine eher angriffslustige Ausstrahlung verleiht. Kein Schmuck ist zu entdecken, vom aufwendig genähten Kleid einmal abgesehen. Von einem sittsam hochgeschlossenen Kragen aus fällt es über breit ausstaffierte Schultern wie ein Wasserfall in Kaskaden an Annas Oberkörper herab, grob gewebter Stoff, gewellt, gerafft, mit Zackenlitzen verziert, äußerst kleinteilig gestaltet. Vermutlich hat Anna für den Besuch beim Fotografen ihr bestes Kleidungsstück ausgewählt – in seiner Opulenz steht es in scharfem Kontrast zu ihrem aufgeräumten Gesicht. Etwa ab Brusthöhe, am unteren Bildrand, verblasst das Kleid im Weichzeichner, in der Unschärfe ist eine eng geschnürte Taille zu erahnen, deren Anblick noch mir den Atem nimmt.
Das Foto ist zu einem Zeitpunkt entstanden, der näher an der Französischen Revolution liegt als am Jetzt. Nur vier Generationen rückwärts durch die Geschichte, und man findet sich inmitten von Schulstoffvergangenheit wieder. Als Anna zum Fotografen geht, ist der Revolutionsrausch allerdings wieder verflogen, auch in der Mode ist eine kurze Phase der Freiheit vorbei, des Klassizismus, der fließenden Kleider nach antikem Vorbild. Alles strafft sich wieder, Hierarchien, Normen, Kleidung. Frauen zurren sich in Form.
Die Aufmachung lässt Anna aus heutiger Sicht älter erscheinen, als sie damals ist. Wieviel jünger sie wirken würde, wenn sie einen hellen Kapuzenpullover trüge! Schaut da nicht ein Teenager aus dem Bild?
Schwarzweiß versteift, scheint Anna gängigen Attributen wie «jung» oder «alt», «sympathisch» oder «unsympathisch» und «schön» oder «unattraktiv» weitgehend enthoben. Auch das Rätsel, ob das Portrait eher Annas Wesen widerspiegelt oder die Bildsprache des Fotografen, ist nicht mehr zu lösen. Die Kameralinse muss etwas unterhalb ihrer Augen platziert gewesen sein, was uns zu ihr aufblicken lässt und ihr etwas Energisches verleiht. Ich will glauben, dass diese Inszenierung etwas Vorhandenes verstärkt.
Sicher steigt Anna in Cobbenrode nicht in diesem Kleid und auch nicht mit ihrem spöttischen Lächeln aus der Kutsche, falls sie sich die Kutschfahrt überhaupt leisten konnte. Aber meiner Phantasie steht nur diese eine, aus dem einzigen verbliebenen Jugendbild zum Leben erweckte Figur zur Verfügung. Die Vorstellung, die wir von vergangenen Generationen haben, ist immer abhängig von den Speichermedien, die ihnen zur Verfügung standen. Anna gehört zu den ersten Menschen, deren Dasein auf Fotografien konserviert wurde. Aber ich habe keine Augenfarbe für sie, keine Bewegung, keinen Ton.
Im Dorf angekommen, werden die schwitzenden, keuchenden Kutschpferde vor dem Gasthof zur Post abgespannt. Schon auf den ersten Blick hebt sich das Haus von der Umgebung ab. Aus dunklem Backstein gemauert, überragt es wie ein dunkler Klotz die Fachwerkhöfe ringsum. Im Giebel, hoch über einer doppelflügeligen Pforte, prangt in fast mannshohen Ziffern die Zahl 1885. Ein neuer, stolzer Bau.
Das Dorf, die Kulisse, die Anna betritt: In einer Festschrift ist von 83 Häusern und 507 Einwohnern die Rede. Ein Straßenplan stiftet eher Verwirrung, da ist kein Kern, kein Ring, kein Wall, keine leicht zu lesende Struktur. Nicht menschliche Logik hat den Ort geformt, die Topografie hat Cobbenrode in ein Tal gezwängt. Im dunklen Grund liegt das Unterdorf, die ältesten und kleinsten Häuser, am Bach die Mühle, daneben das Backhaus der Gemeinde. Dachfirste in verschachtelten Winkeln und ohne erkennbaren Bezug zueinander. Jedes Haus dort gebaut, wo das Gelände es zuließ, dazwischen Treppen, Stiegen und Hohlwege, deren Gefälle der zweidimensionale Ortsplan verschweigt.
Oberhalb des Tales, an einem Hang zur Sonne hin, das Oberdorf. Neuere, größere Höfe entlang einer Hauptstraße. Der Kutschhalt, die Kirche, das Pfarrhaus, die Schule. Das muss Annas Weg sein, vorbei an Scheunen, Zäunen und Gärten, in denen kein Zentimeter Boden ungenutzt bleibt. Die Grundstücke sind von Obstbäumen bestanden, so früh im Jahr noch schwarze Skelette. Die Erde liegt offen, nichts ist Zierde, alles ist Beet. Ins Gebälk der Häuser sind Inschriften gemeißelt, sie preisen Gott und sind Ausdruck uralten Schutzverlangens. Behüte! Bewahre! Begleite! Immer wieder verzehren Feuer Existenzen. Wer kann, deckt sein Dach mit Schiefer statt Stroh. Wer nicht kann, läuft Gefahr, durch eine vergessene Kerze oder einen einzigen Funken zum Habenichts zu werden.
Der Schmied Liese schürt die Glut.
Der Stellmacher Struwe biegt Holz zu Wagenrädern.
Der Müller Willmes mahlt das Korn zu Mehl.
In meiner Vorstellung läuft Anna an lauter gebeugten Männern vorbei, ist die Vergangenheit von graubärtigen Greisen bevölkert, dabei können der Schmied Liese, der Stellmacher Struwe und der Müller Willmes so alt nicht sein. Zu ihrer Zeit beträgt die Lebenserwartung etwa 45 Jahre. Das junge Deutsche Reich hat knapp 48 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Nur etwa fünf Prozent der Bevölkerung sind älter als sechzig.
Anna wird aus Türen und Fenstern energische Stimmen hören. Aus den Schornsteinen steigen Rauchfahnen auf. Wahrscheinlich riecht es aus vielen Häusern nach Kohlsuppe. Schwalben schießen aus Dachluken. Hunde springen an den Zäunen hoch. Aus den Ställen dringt das Grunzen von Schweinen. Vielleicht ist es um die Jahreszeit schon warm genug, dass sich bekittelte Frauen durch die Beete buckeln, um altes Laub wegzurechen und Zwiebeln zu setzen. Dann zögen auch die Männer los auf die Äcker, einen schnaufenden Ochsen unter ein hölzernes Joch geschirrt.
Überall im Ort müssen Kinder sein und die unbekannte Frau beäugen, die selbst noch so jung ist. Nach geltendem Recht ist Anna nicht einmal volljährig.
Deutsches Reichsgesetzblatt, Band 1875, Nummer 8, Seite 71:
«Gesetz, betreffend das Alter der Großjährigkeit
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:
§ 1 Das Alter der Großjährigkeit beginnt im ganzen Umfange des Deutschen Reichs mit dem vollendeten einundzwanzigsten Lebensjahre.»
Damit ist Anna eine rechtlose Autorität – Lehrerin, aber als juristische Person nicht erwachsen. Mir scheint, dass ihre Situation sogar der eines Schulkindes ähnelt, das nach einem Umzug in eine fremde Klasse versetzt wird und nicht viel mehr weiß, als dass es sich fortan in diesem Gefüge zurechtfinden muss. Anna ahnt, dass das Dorf ihr seine Geschichte einschreiben wird und sie dem Dorf vielleicht ihre. Sie kann davon ausgehen, dass sich Freundschaften und Feindschaften bilden, Allianzen und Abneigungen wachsen werden. Doch wer dabei welche Rolle spielen könnte, kann sie aus den neuen Gesichtern um sie herum noch nicht ablesen.
Hat Anna bei ihrer Ankunft den schönen Sohn der Postfamilie bemerkt, vor deren Haus die Kutsche hält?
Ist ihr oben am Hang der entlegene Hof aufgefallen, den sich eine Familie dort bauen musste aus dem wenigen, das übrigblieb, nachdem ein Brand ihr Haus im Ortskern verwüstet hatte?
Schätzt sie die Kinder in den Gassen schon auf ihren Fleiß, ihre Pünktlichkeit, ihren Gehorsam als Schülerinnen und Schüler ein?
Sieht sie, dass vielen Jungen und Mädchen die Zehennägel fehlen, weil sie nachmittags das Vieh hüten und die Tiere ihnen auf die Füße treten?
1887
Das Jahr von Annas Ankunft – davon ist in der Rückschau, über ein Jahrhundert lang nach Kriterien wie Relevanz und Ruhm, nach Wirkmächtigkeit und Superlativen gefiltert, vor allem dies geblieben:
In Mailand wird die Oper Otello des Komponisten Giuseppe Verdi uraufgeführt.
In Kiel legt Kaiser Wilhelm I. den Grundstein für einen Kanal, der Nord- und Ostsee verbinden soll.
In Paris wächst ein eisernes Monstrum über den Himmel der Stadt.
Ein holländischer Maler fasst den Plan, nach Südfrankreich zu ziehen.
In den Vereinigten Staaten von Amerika meldet ein Einwanderer namens Emil Berliner ein Gerät zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Tönen zum Patent an und nennt es Grammophon.
Ein deutsches Reichsgesetz schreibt für Kunstbutter den Namen «Margarine» vor.
In der Schweiz entwirft der Unternehmer Julius Maggi eine Flasche für industriell gefertigte Suppenwürze.
Das Ruhrgebiet dampft und glüht und qualmt, aus immer tieferen Lagen fördern die Zechen Kohle, in immer gewaltigeren Hochöfen schmilzt Eisen. Industriebarone sind in den Rang von Feudalherren getreten, von der neuprächtigen Villa Hügel in Essen aus hat Alfred Krupp vor einer Weile die «Stahlzeit» ausgerufen.
England entscheidet, sich vor Industrieprodukten aus Deutschland dadurch zu schützen, dass ihnen die Warnung Made in Germany eingeprägt werden muss.
In Cobbenrode stehen jeden Tag gegen zwei Uhr morgens mehrere Familienväter auf und ziehen im Lichtschein ihrer Rapsöllampen auf Bergmannspfaden über die Felder zu zwei Bergwerken einige Hügelketten weiter. Sie gehen drei Stunden, bis sie die Eingänge der Anlagen «Sicilia» und «Siegena» erreichen. Namen, als handele es sich um paradiesische Orte oder um Wesen, mit denen man eine romantische Beziehung führt. In den Schächten graben die Männer in Zehn-Stunden-Schichten nach Schwefelkies. Während der Arbeit ist jeder Wortwechsel verboten. Wer seinem Vorgesetzten widerspricht, zahlt den gesamten Schichtlohn als Strafe. Ohnehin vom Lohn abgezogen werden die Kosten für Dynamit und «Geleucht».
Aus dem Schwefelkies wird in fernen Fabriken Schwefelsäure gewonnen, ohne die sich kein Dünger und kein Sprengstoff herstellen ließe. Weil es in den Bergwerken bei Cobbenrode keine Waschkauen gibt und ein Bett im Schlaflager nur gegen viel Geld zu mieten wäre, wandern die Männer abends verdreckt und erschöpft wieder nach Hause. Im Sommer helfen sie im letzten Tageslicht ihren Frauen bei der Ernte und schlafen in regenfreien Nächten auf den Feldern, um keine Zeit zu vergeuden.
Diese Bergleute brechen morgens nicht auf mit dem Willen, eine neue Epoche einzuläuten, die künftige Historiker «Moderne» oder «Industrialisierung» nennen werden. Sie graben sich nicht durch Gestein, damit andernorts Stahl geschmolzen, Kanonen gegossen, Schienen verlegt, Brücken gespannt und Schiffsrümpfe genietet werden können. Sie tun es, um zu überleben.
Der Anstieg nach Cobbenrode hat Anna in ein Dorf auf 400 Metern Höhe geführt, unter Menschen, deren Ahnen in den Tälern keinen Platz mehr fanden. Die steilen Hänge sind schwer zu bearbeiten. Die Vegetationsphase ist kurz. Die Böden sind mager und von splittrigem Schiefer durchsetzt. Viele Steine, wenig Brot. Um während der Sommer genügend Roggen und Kartoffeln für die Winter zusammenzubekommen, dazu ausreichend Heu und Rüben für die Tiere, haben die Menschen die Wälder bis hinauf zu den Kuppen gerodet; eine strittige Theorie leitet daraus den Ortsnamen ihres Dorfes her.
Das Sauerland ist noch nicht die Weihnachtsbaumplantage der Nation, viele Landschaften sind noch nicht arbeitsteilig gegliedert in Schweinegürtel, Tomaten-Anbaugebiete, Kiefermonokulturen und Ebenen voller Mais. Landwirtschaft ist Selbstversorgung, ist kleinteilig, ist in Cobbenrode Überlebenskampf über die Ränder der Äcker hinaus. Die Kinder werden losgeschickt, um in den verbliebenen Wäldern Brennholz zu sammeln. Auf der Suche nach Blaubeeren streichen sie mit Handrechen durchs Unterholz. Die Frauen stechen Huflattich fürs Vieh und tragen das Grün in Tragelaken heim. Wer Bergmann ist, hält zusätzlich mindestens eine Kuh. Auch der Pastor hält Schweine.
Was in den Städten bereits Spezialisierung heißt, ist auf dem Land noch Nebenerwerb. Was in Fabriken schon Massenware wird, bleibt im Dorf über Generationen begehrter Besitz.
Eine Annonce aus der Zeitung:
«Dienstag den 25. d. Mts., morgens um 9 Uhr anfangend, soll der Nachlaß des verstorbenen Küsters Junker in Cobbenrode im Sterbehause daselbst öffentlich meistbietend gegen Credit verkauft werden, nämlich:
1 Nähmaschine (fast neu, 1 Jahr gebraucht), 1 Kleiderschrank, 2 Bettstellen mit vollständigen Federbetten, 3 Herren-Anzüge, 3 Tische, 3 Stühle, 1 Bank, 1 Ofen, 10 Ctr. Roggenstroh und mehrere Hausgeräthe.»
Mag sein, dass in Kiel auf Geheiß des Kaisers Land zerschnitten wird. Dass Besitzer eines Grammophons Musik hören können, ganz ohne Musiker. Dass auf der Schwäbischen Alb Dampfmaschinen Webstühle antreiben. Dass in Berlin der Bakteriologe Robert Koch den Erreger der Tuberkulose entdeckt hat und zu «Desinfectionen» forscht. Dass für die Stadt Heilbronn ein Elektrizitätsnetz in Planung ist. Strom, Wasser, Medizin? Bis ins Gebirge hinauf hat es die Moderne noch nicht geschafft, zumindest die Errungenschaften nicht. Für das Jahr 1887 sind im Sterbebuch der Kirche 20 Todesfälle aufgelistet, darunter 14 Kinder.
Maria, 15 Jahre
Joseph, 11 Jahre
Friedrich, 8 Jahre
Maria, 5 Jahre
Franz, 1 Jahr
Maria, 1 Jahr
August, 9 Monate
Anna, 8 Monate
Maria, 1 Monat
Anna, 12 Tage
Elisabeth, ½ Minute
Franzisca, erstickt bei Geburt
Franzisca, bei Geburt
Anton, k.A.
Das Ehepaar Nöker verliert innerhalb zweier Monate zwei Söhne.
Die Schule ist ein neues, strahlend weiß getünchtes Haus direkt neben der Kirche. Viele Jahre wurden die Dorfkinder im Küsterhaus unterrichtet, und das nur während der Winter. Später wurde ein kleines Schullokal gebaut, das dermaßen schnell verfiel, lese ich in der Schulchronik, «daß der Aufenthalt in demselben lebensgefährlich wurde». Annas Arbeitsplatz wurde erst vor wenigen Jahren errichtet und ist trotzdem ein Ärgernis. Der Zimmermann hat die «Aborte» für die Kinder vergessen. Grundrisse zeigen im Erdgeschoss zwei Klassenräume, mit Tannenholz beplankt, daneben eine Küche, eine Vorratskammer, ein Wohn- und ein Schlafzimmer – die Unterkunft des ersten Lehrers vor Ort, ein Franz Luhmann, der Annas Vorgesetzter sein wird. Seine bisherige Kollegin, kaum älter als Anna, hat die Schule nach drei Jahren wieder verlassen. In der Schulchronik ist von einer «Versetzung» die Rede, ein Grund wird nicht genannt.
Jetzt steht im Obergeschoss, unter schweren Dachbalken, eine Lehrerinnenwohnung leer. Küche, Schlaf- und Wohnzimmer.
Ich sehe Anna am Tag ihrer Ankunft über den Schulhof gehen, offener, abschüssiger Boden. Ich sehe sie die Treppe zum Portal hinaufsteigen, sieben Stufen. Höre sie klopfen. Lasse sie warten, in ihrem Kleid, mit ihrem festen Blick, ehe der Lehrer Luhmann die Tür öffnet. Ein bärtiger, rundlicher Mann mittleren Alters. Im besten Fall hat er Anna etwas von seinen Essensvorräten hingestellt, eine Kanne Milch, ein Stück Butter, Brot und Brennholz. Mit ein wenig Glück lodert ein Feuer im Ofen und Kerzen für den Abend liegen bereit.
Was mag Anna in der Dachkammer ansonsten vorfinden? Gibt es Geschirr? Ist da ein Tisch, ein Stuhl, ein gemachtes Bett, von ihrer Vorgängerin überlassen oder aus dem Nachlass eines Toten gekauft? Sind die beiden Fenster, die der Zimmermann in den Bauplänen eingezeichnet hat, dicht? Hat jemand geputzt oder läuft Anna durch Spinnweben? Welchen Geruch verströmt das Haus? Welche Geräusche gibt es von sich, als es Nacht wird? Was wird der nächste Morgen bringen?
Annas Kopf muss voller Fragen sein. Und im Dorf werden Fragen zu Anna kursieren: Wer ist sie? Woher kommt sie? Wird sie eine von uns werden?
• • •
Anna Kalthoff, 20 Jahre alt, Lehrerin.
Das Kopfkino schlägt vor: Tochter aus besserem Hause, begütert und belesen. Eine lichte Wohnung in einem guten Viertel der aufstrebenden Städte, Fischgrätparkett unter Stuckdecken, Porzellan in Vitrinen, sogar ein eigenes Badezimmer statt einer Toilette auf halber Treppe. Im Salon Vorhänge mit Borten, zweiflügelige Fenster, davor ein Balkon. Ein Farbwechsel von Cobbenroder Erdtönen hin zu Pastell, zu Weiß. Ein anderer Sound auch, statt der Stille der Provinz die Hektik einer Metropole. Rufe von Zeitungsjungen auf der Straße, Hufgetrappel auf Pflasterstein, das Schrammen von Straßenbahnen. Der Vater ist Ministerialbeamter oder Bergassessor, niemand, der sich selbst die Hände schmutzig oder den Rücken krumm machen muss. Er sitzt und schreibt und liest. Die Mutter spielt Harfe, Anna übt Klavier. Sich ein Cello zwischen die Beine zu klemmen, wäre für ein Mädchen unschicklich. Regelmäßig geht die Familie in die Oper, besucht das Theater. Der Vater verlässt das Haus in Anzug und Weste, Mutter und Tochter ins Korsett geschnürt, ein Tournüren-Polster unter dem Rock betont ihre Rundungen. Zu Hause eine Bücherwand, Goethe und Schiller. Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg, preußisches Kernland, Pflichtlektüre. Womöglich auch Heine, falls nicht zu jung und zu wild.