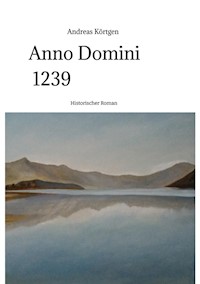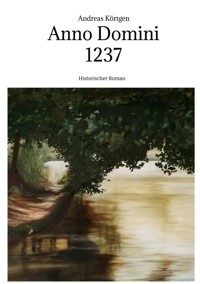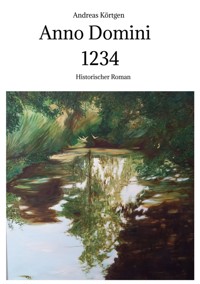
9,99 €
Mehr erfahren.
Historischer Roman um die Kinder des genialen Stauferkaisers Friedrich II, der aus seinen drei Ehen vier legitime und mit mindestens acht weiteren Frauen noch dreizehn außereheiche Nachkommen hatte. Band 1 der Reihe Kinder des Staunens
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Andreas Körtgen – Anno Domini 1234
Die Kinder des Staunens, Teil 1
Andreas Körtgen
Anno Domini 1234
Die Kinder des Staunens
Band 1
© 2022 Andreas Körtgen
2. Auflage, Vorgängerausgabe 2021
ISBN Softcover: 978-3-347-75771-4
ISBN E-Book: 978-3-347-75772-1
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
„Töricht ist es, ein allem zugrundeliegendes Gesetz zu suchen, und törichter noch, eines zu finden.
Irgendein niederträchtiger Wicht beschließt, dass sich der ganze Gang der Menschheitsgeschichte aus den hinterhältigen Revolutionen der Tierkreiszeichen oder aus dem Kampf zwischen einem leeren und einem vollen Bauch erklären lasse; er dingt einen pedantischen Spießer, Clios Sekretär zu machen, und beginnt einen Großhandel mit Epochen und Massen… zum Glück gibt es kein Gesetz dieser Art:
Zahnschmerzen kosten eine Schlacht, ein Nieselregen annulliert einen Aufstand. Alles ist im Fluss, alles hängt am Zufall… eine Frucht von Schlaflosigkeit und Migräne.
Es bereitet ein prickelndes Vergnügen, Rückschau zu halten auf die Vergangenheit und sich zu fragen: „Was wäre gewesen, wenn…“, dabei ein zufälliges Geschehnis durch ein anderes zu ersetzen und zu verfolgen, wie aus einem grauen, öden, langweiligen Moment des eigenen Lebens ein wunderbares rosiges Ereignis ersprießt, das in der Wirklichkeit zu blühen versäumte.
Sie ist etwas Geheimnisvolles, diese sich verzweigende Struktur des Lebens: In jedem vergangenen Augenblick erahnt man eine Weggabelung, ein „So“ und ein „Anders“ mit unzähligen blendenden Zickzacklinien, die sich vor dem dunklen Hintergrund der Vergangenheit doppelt und dreifach teilen.“
Vladimir Nabokov, Der Späher, 1930.
Erzähler im Jahre 1234
und andere Personen dieser Geschichte:
Kehla, 15, ein sehr ihre Freiheit liebendes jüdisches
Mädchen
Zeta, 17, ihre erstaunliche Cousine und
Gefährtin
Joshe ben Nathan, 20, Kehlas Bruder,
gemeinsam mit
Avram, 24, seinem Vetter, ausgesandt von
ihrer Gemeinde
Nazrael ben Joel, 42, ein wandernder Arzt
Tom, 15 Jahre, Lehrling beim Schuster Steffen
Cara, 16, des Schusters Tochter
Odo, 19, einer der unehelichen Söhne des
erstaunlichen Kaisers Friedrich II. und Erbe
einer kleinen Herrschaft im Norden Italiens
Hildebrandt von der Elle, 52, Waffenmeister
am Hofe des Kaisers
Gina, 17, dessen eigenwillige Tochter
Mahmoud bin Abdallah, 26, Soldat und Unterführer
der arabischen Leibwache des Kaisers, ein
Freund Odos und Briefeschreiber
Rochus von Richleben, 20, noch ein Freund
Odos und Gefährte
Riccardo, Graf von Monteleone, 56, ein befreundeter
Nachbar
Artemisia, 24, seine kluge, dunkle Tochter,
Bianca, 20, seine blasse und traumatisierte
Tochter, und
Cordelia, 15, seine wilde und goldene Tochter
Griselda, 33, Riccardos engste Gefährtin,
ehemals nur Dienerin
Wolf Graf von Terrasecca, 62, ein anderer
Nachbar, der Eberkopf
Eberhard von Terrasecca, 28, sein Sohn
Maria Christina, 19, Eberhards dritte,
geplagte Ehefrau
Gilfredo Herr von Rocassa, 25, noch ein
zweifelhafter Nachbar
Helena von Rocassa, 20, dessen bezaubernde
Schwester
Bruder Magnus, 22, ein Mönch und bemühter
Chronist in Odos Auftrag
Vater Gandolfo, 48, Abt des Klosters vom
Heiligen Ambrosius
Luca, 14, Junge aus dem Dorf Peio
Zacco, 14, sein bester Kumpel
Laia, 13, Mädchen aus dem Dorf Peio
Toni (Antonio), 22, deren gelähmter Bruder,
Schnitzer
Kapitel 1
Kehla
Aus dem Abstand einiger Jahre betrachtet, war unser Ausbruch nicht nur notwendig, sondern auch halsbrecherisch und gefährlich.
Ich wollte weg, nur weg, weil es zuhause einfach nicht länger auszuhalten war: Diese abstrusen Vorschriften für Alles und Jedes, die eisenstrengen Sitten und das ehrwürdige, unantastbare Herkommen, die uralten Lügenmärchen und keine Luft zum Atmen. Diese ganze wohlmeinende verlogene Bande, die immer weiß, was das einzig Beste ist für ein jüdisches Mädchen – Herr verzeih mir!
Ich wollte kein Mädchen mehr sein, und ich wollte kein jüdisches Mädchen sein, das vor allem. Ich musste da weg, raus aus der düsteren, furchtbar engen Judengasse, weg von dieser bedrückenden Stadt mit ihren stinkenden Gassen voller Dreck und den vollgepissten Winkeln, wo wir auch noch ein gelbes Band um den Arm tragen mussten, damit jeder rechtschaffene Christ wusste, wen er ungestraft beschimpfen und betrügen und treten konnte.
Die Zeiten waren gefährlich für mein Volk, ich wusste es, und es würde noch gefährlicher werden, fürchteten mein Vater und die Ältesten. Aber was taten sie? Jammern und klagen und beten und kuschen.
Was war größer, ihre Angst oder ihre Feigheit? Am allergrößten war ihre Erbärmlichkeit!
Und heiraten würde ich nie, das hatte ich ihnen schon gesagt, meinem gestrengen Herrn Vater und meiner lieben, lieben, treusorgenden und hilflosen Mutter, die sicher immer nur das Beste für mich wollte in ihrer Blindheit – zum Beispiel meinen Vetter Avram als Ehegatten! Diesen braven, langweiligen, dicken, käseblassen alten Mann von über zwanzig Jahren, der schon anfing zu schwitzen, wenn er meinen Namen hörte, und die feuchte Unterlippe verlegen hängen ließ, sprachlos wenn er mich sah! Die anderen Jünglinge in der Gemeinde ware nicht viel anders, eine Reihe kümmerlicher Gestalten, blass und krumm wie die armen Pflanzen in unseren Hinterhöfen, die immer zu wenig Licht bekamen, von heller Sonne ganz zu schweigen.
Ich war da schon fünfzehn und hatte vielleicht noch ein, zwei Jahre vor mir bis sie mich verkuppeln würden. Aber erstmal wollten sie meine Kusine Zeta an den Mann bringen.
Sie ist zwei Jahre älter, und fast einen ganzen Kopf größer als ich, dünn und drahtig, aber mit kräftigen Armen und Muskeln – und feuerroten Locken – wahrscheinlich traute sich deshalb keiner fürchteten mein Vater und die Ältesten. Aber was von den Wichten, ihr den Hof zu machen. Seit ihre Eltern vor sechs Jahren nicht weit von der Stadt totgeschlagen wurden, lebte sie bei uns. Sie war mein einziger Trost, sie verstand mich und wir hielten zusammen, egal was kommen wollte – und wenn ich abhaute, ginge sie mit, das war klar.
Zeta ist wirklich unglaublich. Meine Eltern waren auch nicht so streng mit ihr. Zuerst hat sie unseren engen Hof zwischen den feuchten Mauern hinter dem Haus in ein kleines Paradies verwandelt, mit Töpfen und aufgehängten Kästen die ganze schiefe Wand zum Nachbarhaus hinauf: Kräuter für die Küche, Beerensträucher, Erbsen und Bohnen, sogar einen kleinen Kirschbaum hatte sie in der Ecke in Gang gekriegt. Das hat sich dann herumgesprochen, Leute wollten sich unseren Hof ansehen und haben gestaunt – und dann wurde sie von zwei Familien in der Stadt als Gärtnerin angestellt. Bei den Christen! Beim Schultheiß war sie fast fertig mit der Anlage eines großen Gartens, und für den Kaufmann neben der Schmiede am Westtor war sie noch am Anfang bei den Erdarbeiten. Ganz alleine musste sie Steine wegschaffen und Erde bewegen. Ich konnte sehen, was sie für Muskeln gekriegt hatte davon, wenn wir vor dem Sabbat gemeinsam badeten.
Ich musste einfach abhauen, raus aus diesem Loch, aus dieser finsteren Judengasse, die auch noch jeden Abend zugesperrt wurde, ´nur zu unserem Schutz` sagten sie – lachhaft. Angst hatten sie alle – wir Juden mal sowieso, aber die Christen draußen in der Stadt vor uns auch. Angst und Misstrauen werden irgendwann zu Hass und Gewalt. Vater befürchtete, dass es bald wieder so weit sein würde.
Nun hatten also die Ältesten beschlossen, Boten auszusenden, über die Berge nach Italien, um zu hören, ob andere Gemeinden uns aufnehmen könnten, wenn die Gefahr zuhause zu groß würde. Dort im Süden sollte es besser sein, noch. Das war sicher ein kluger Plan und vorausschauend – und kleinmütig und ängstlich zugleich. Mein Bruder Joshe sollte als Kundschafter auf diese Reise gehen und mit ihm ausgerechnet Avram. Unglaublich. Joshe ist klug und zäh, wie ich – aber der dicke, schlappe Vetter Avram? Welch ein Kandidat für einen künftigen Helden und Retter der Kinder Israels!
Sie wollten einen Esel besorgen, der ihnen die Reisebündel tragen sollte, und in zwei Tagen schon würde es losgehen, gleich morgens, ehe die Sonne hinter dem Zwieselberg emporstieg und die elende Enge unserer Gassen mit ihren fröhlichen Strahlen erreichte. Bevor die Stadt aus dem dunstigen Mief der Nacht erwachte, würden diese zwei kleinen Juden die Mauern hinter sich lassen und die zaghaften Hoffnungen ihrer Gemeinde in eine ungewisse Zukunft tragen – während ich weiterhin mit Nähen Putzen Waschen in einem dunklen Loch zwischen verschissenen Gassen eingesperrt bleiben sollte und schön brav sein und warten, dass irgendetwas passiert. Oder ich nähme es selbst in die Hand, mein kleines, zitterndes Herz, und bräche auf – und aus! Und wäre auch weg und schneller davon als sie mir hinterherschauen könnten.
Ich musste mich beeilen und alles besorgen, was wir brauchen würden. Unauffällige Kleidung vor allem, wie für zwei Bauernburschen, die vom Markt zurück in ihr Dorf wandern. Bei mir würde das einfach gehen, ich bin klein und war da noch recht flach gebaut. Bei Zeta würde das schwieriger, ihren ziemlich fertigen Frauenleib zu verbergen, und ihre rote Mähne – es musste uns etwas Wirksames einfallen.
Seit Wochen hatte ich alles Münzgeld was ich erwischen konnte verschwinden lassen, das ging nicht anders, und versteckt gehortet ohne aufzufallen. Da war nicht so viel zusammengekommen, in einem ordentlichen Haushalt bleibt selten etwas herumliegen. Aber Zeta hatte einiges verdient mit ihrer Arbeit in den Gärten draußen. Wo aber blieb sie bloß? Sie wusste noch gar nichts von unserem bevorstehenden Aufbruch, und dass es nun bald losgehen sollte.
Später dann, als ich sie gefunden hatte, erzählte sie mir die ganze Sache. Ich war entsetzt, das ist ja klar.
Weil wir dann aber eben abwarten mussten, bis Zeta soweit war und wieder auf den Beinen, dass wir auch los konnten, Joshe und Avram hinterher, da habe ich also aufgeschrieben, was Zeta zu erzählen hatte. Hier folgt das nun, genau in ihren Worten, wie es geschehen ist:
Kapitel 2
Zeta
Na, Kehla, das kam ja plötzlich: Nun soll es also losgehen, schnellstens, ich bin dabei – wenn ich erst wieder auf den Füßen bin einigermaßen.
In jedem Garten weiß ich genau, was zusammenpasst, dass es gedeihen kann, und was ich besser versetzen muss, weil es sich sonst nicht vertragen will. Auch Pflanzen sind unglücklich und verkümmern an einem Platz, der für sie unerträglich ist. Dann ist die ganze Sache nüchtern und realistisch zu sehen, und es muss etwas geändert werden, bald und grundlegend.
Es hat gar keinen Sinn zu jammern, auch wenn es weh tut. Und ja, es hat weh getan, gestern. Das hat es.
Ich war da so bei der Arbeit in diesem Garten, den ich neu anlegen sollte, bei dem Kaufmann neben der Schmiede. Und da mische ich also Erde und Pferdemist und verteile das überall. Ich mache das immer ganz alleine von Grund auf, damit ich ein Gefühl dafür kriege, was wohin gehört.
Und ich habe also meinen Rock ausgezogen, der wird ja nur dreckig sonst, bin ja auch ganz allein, und es sieht mich keiner in dem Winkel, denke ich. Und auch das Hemd habe ich über die Knie hochgebunden deswegen.
Wie ich gerade ein Bündel alte Zweige wegnehme, kommt da eine dicke Ratte vorgeschossen und quiekt auf mich los – also ich hasse diese Viecher wie die Pest! Und ich habe auch gleich mein Messer zu packen und schmeiße das los auf diese Ratte hin. Natürlich geht das daneben, aber nur knapp. Die Ratte ist schon weg, und das Messer steckt bis zum Heft irgendwo im Mist – und hinter mir lacht einer.
Ich fahre herum, und über dem Bretterzaun zur Schmiede nebenan grinst ein schwarzer Lockenkopf auf mich runter:
„Die wollte dir an die Wäsche, was? – Kann ich gut verstehen übrigens, ganz lecker was man so sehen kann…“
Ich gucke wohl ziemlich blöde und überrascht, bis ich erst kapiere, dass er mir so von oben ziemlich weit in mein lose geöffnetes Hemd blicken kann. Ich komme aus der Hocke hoch und richte mich kerzengerade auf, vorerst noch ohne Worte über diese Frechheit.
„Und dann so was von daneben, dein Messerwurf, da musst du aber noch viel üben!“
„Mach`s doch besser, du Klugscheißer“, sage ich und hole erstmal das Messer zurück aus dem Mistkloben, in dem es steckt.
„Na, mit so einem leichten Küchenmesserchen kannste ja auch nix treffen – da musste was Schwereres nehmen, am besten eben ein richtiges Wurfmeser, mit einer langen Dreikantklinge und ´nem kurzen Griff.“
„Ach nee, was du alles weißt…“
„Ich bin ein guter Schmied und kenne mich halt aus. Ich kann dir eins machen, das fliegt von selber ins Ziel, da staunste nur so!“
„Na mach mal, du Angeber, mach mal – werden wir ja sehen, was du zustande bringst. Bis dahin lass mich in Ruhe, ich habe zu arbeiten, du Fischkopf!“
Und so lasse ich ihn stehen und verschwinde hinter der Schuppenecke, mein Hemd in Ordnung zu bringen und warte, dass mein Herzklopfen nachlässt. Als ich wieder zurückgehe, ist er weg und ich sehe nichts mehr von dem Flegel, fast eine Woche lang.
Dann aber, ich stelle gerade die Kästen auf, die der Tischler geliefert hat, und will schon die ersten Setzlinge einbringen – da hängt er auf einmal oben halb über dem Zaun und lässt ein Stück dunkles Eisen in der Hand wirbeln:
„Da, schau dir das mal an!“
Ich geh also zögernd zu ihm hin – wenigstens habe ich diesmal den Rock noch an… aber ehe ich zugreifen kann, zieht er sich zurück.
„Das kannste dir gerne mal ansehen – wenn du mich auch was mehr sehen lässt, da von dir!“
„Was …, was denn…?“, frage ich.
„Aber alles am besten!“ , er lacht. „Alles was du da so in deinem Hemd hast… und unter deinem Rock auch… alles will ich mal sehen. Dann zeige ich dir auch, wie dieses Messer fliegen kann und wie es perfekt trifft. Los, zieh dich aus und lass mal sehen jetzt!“
So einer, denke ich noch.
Und was soll`s, ansehen tut nicht weh. Ich weiß auch nicht. – Das Messer, es lockt mich echt…
Ich löse also das Band am Kragen, mache den Hemdbund am Hals weit und lasse es über die Schultern gleiten, und weiter die Arme herab. An den Brustspitzen hängt es kurz, und ich schüttle es mit einem Zucken hinunter. Und da stehe ich mit bloßem Oberkörper im Sonnenlicht des leeren Gartens, und sehe ihn abwartend an.
Was ist schon dabei.
Der Kerl glotzt mit runden Augen unter seinem dunklen Haarschopf hervor. Er schluckt langsam und mühevoll. Dann hebt er den Arm mit dem Messer und läßt es mit einer schnellen Bewegung losfliegen, ohne groß zu zielen anscheinend, zur Seite weg, bis es neben ihm mit einem harten, dumpfen Schlag in die Bretterwand des Schuppens rummst.
„Jetzt aber noch alles runter los, und raus aus dem Rock auch“, keucht er.
Und ich tu`s.
Und ich gehe dann, ganz nackig jetzt, mit kleinen Schritten auf den Zaun zwischen uns zu: „Jetzt hol das Messer wieder her und zeig mir das!“
Mit einem Sprung ist er an der Schuppenwand, reißt das Ding aus dem Holz ohne hinzusehen und ist gleich wieder zurück am Zaun und hält das Eisen hoch über seinem Kopf am gestreckten Arm in die Höhe: „Da kannste dir`s ansehen… oder hol dir´s doch!“
Na was sonst. Ich steige also auf ein paar Kisten, die am Zaun gestapelt sind. Direkt bei ihm lange ich in die Höhe und hole mir das Messer richtig aus seiner Faust. Ein gerades Eisen, fast zwei Handspannen lang, mit einer geschärften, dreikantigen Spitze, ziemlich schwer – das hätte ich mir nicht so vorgestellt – faszinierend…
Doch wie ich das Messer besehe, packt mich der Bursche mit seinen Schmiedepranken unter dem Hintern – und reißt mich in die Höhe und wirbelt mich über die Zaunkante auf seine Seite herüber. An sich gepresst lässt er mich herunterrutschen und schnappt dabei wie ein wilder kleiner Hund mit Maul und Zähnen nach mir – ist der Kerl völlig verrückt? Oder bin ich es? Ich will mich loswinden, aber er hält mich fest, seine Hände sind überall auf meinem Leib. Und eine ist plötzlich zwischen meine Beine geraten! Da drücke ich ihm das kantige Messer an die Backe:
„Ich will das jetzt ausprobieren, lass mich!“
„Und dann lässt du mich auch was ausprobieren?“
Ich verstehe nicht, was er meint.
Doch er gibt mich frei. Ich stelle mich hin, fixiere einen Balken am Schuppen, hole aus – und lasse das Messer losfliegen: Schwer und gerade blitzt es los und rammt sich mit Wucht ins Holz. Ich springe hin und reiße es heraus, laufe zurück und lasse es wieder fliegen… und wieder und wieder.
Ich bin im Rausch, bin eine Kriegerin, eine Amazone im Kampf gegen das Böse ! So geht es vielleicht ein Dutzend Mal.
Den Burschen, der dabei an einem großen Fass lehnt und mit Vergnügen dieses nackt vor ihm herumspringende Mädchen beobachtet, habe ich fast vergessen.
Bis er plötzlich hinter mir auftaucht, als ich wieder zum Wurf aushole – und das Messer wegschnappt, dabei mich fest gepackt hält mit seinen Schmiedepranken und sich an mich presst. Er drängt mich zu dem Fass an der Schuppenwand, drückt mich da gewaltsam nach vorn, und zwingt mich über die weite Öffnung, in der eine ölige Flüssigkeit schwappt.
„Sei still, wenn die vorne uns hören, kannstes vergessen, dein schönes Wurfmesser… und jetzt will ich mal was ausprobieren.“
Er grunzt mir ins Genick und fingert an mir herum. Ohne mich loszulassen ist er fix aus seiner Hose raus und schiebt mir sein hartes, heißes Ding von hinten zwischen die Beine. Ich strample herum, will mich befreien und versuche, ihn mit dem Ellbogen zu treffen. Doch er reißt mich mit brutalem Griff in die Haare weiter nach vorne und drückt mir den Kopf hinunter in das Fass. Ich muss mich mit den Händen am Rand abstützen und kralle mich an dem eisernen Ring der Öffnung fest. Dann tut es bald gemein weh… und ich beiße die Zähne zusammen. Er rammelt hektisch gegen meinen Hintern an, und meine Oberschenkel schlagen gegen den harten Rand, und unter mir schwappt das ölige Zeug klatschend in dem Fass hin und her.
Dann keucht er endlich auf, ist fertig und lässt los. Es ist vorbei.
Und mir läuft`s klebrig die Schenkel hinunter… Blut und sein Zeug. Und das war also mein erstes Mal, na toll.
Er gibt mich frei und tritt schwankend zurück, und während er sich noch die Hose hochholt, geht er schon mit großen Schritten nach vorne der Schmiede zu.
„Heh, du Mistkerl…“, rufe ich ihm nach, „ich kann da noch drei von den Messern brauchen mindestens… aber besser kleinere, nicht ganz so groß…“
Er wendet sich zu mir um und mustert mich drei Herzschläge lang, wie ich dastehe, mit der Hüfte an das Fass gelehnt.
„Gut, wie du willst, wir treffen uns wieder, Mädchen. In vier oder fünf Tagen vielleicht… bis dann also.“ Und schon ist er um die Ecke.
Ich sehe zu, dass ich über den Zaun zurückkomme und meine Kleider aufsammel. Mit dem Wasser aus der Gießkanne wasche ich mich so gut es geht. Ganz wund und empfindlich alles, und geschwollen… aber das wird schon wieder, denke ich, halb so schlimm.
Da fällt mir ein, dass ich das Messer habe liegen lassen. Ich muss also noch mal rüber und es holen, ich blödes Huhn.
Es dauert aber fast eine Woche, bis sich der schwarze Stefan wieder am Zaun blicken lässt. So nennen sie ihn, hab ich erfahren. Ich hatte es mit meiner Arbeit schon langsamer gehen lassen, um nicht zu früh fertig zu werden.
Da taucht er also wieder auf mit seinem dreckigen Grinsen und hält die neuen Wurfeisen in die Höhe. Und lässt sie auch gleich mit einem sauberen Zischen ins Holz der Schuppenwand fliegen.
„Komm rüber, Mädchen, und hol sie dir!“
Na, ich weiß ja, wie`s läuft, denke ich. Steige hinüber und versuche noch, ein bisschen freundlich zu blicken, dass es nicht wieder so ein gewaltsamer Murks werden soll.
Geht doch vielleicht auch anders, denke ich mir, ich blöde Gans.
Kapitel 3
Kehla
Zwei Tage blieb Zeta verschwunden. Ich machte mir Sorgen allmählich.
Keinem sonst schien es aufzufallen, dass sie wegblieb. Einen großen Wirbel veranstalteten sie gerade um den Aufbruch von Joshe und Avram. Stundenlang wurden Sachen zusammengetragen, Proviant vorbereitet und eingepackt – und wieder ausgepackt, der Esel probeweise beladen und wieder umgeladen. Geduldig und stumm stand der da, kaute langsam und gründlich an seinen trockenen Gräsern herum und schloss die Augen vor dem hektischen Treiben der Menschen, als drohe ihm sonst schwindelig zu werden.
Aber Zeta war fort und kam nicht wieder zurück – wo blieb sie bloß?
Es war schon vorgekommen, dass sie mal eine Nacht an ihrer Arbeitsstelle geschlafen hatte, weil es zu spät wurde für die Rückkehr und das Tor zur Judengasse schon geschlossen war. Sie sei im Gartenschuppen geblieben und habe sich ein Lager aus Laub, Stroh und Sackleinen gemacht, erzählte sie dann ganz vergnügt, als meine Mutter sie am nächsten Tag sorgenvoll in Empfang nahm – kein Grund, sich Gedanken zu machen, nichts passiert. Und beim zweiten Mal war es dann schon ein alter Hut, wir wussten Bescheid und was wir denken sollten, kein Problem.
Aber jetzt war sie bereits zwei Nächte hintereinander weg, und keinem fiel es auf in diesem Aufbruch-Abschieds-Theater.
Ich machte mich auf die Suche nach ihr, hin zu dem Garten, den sie für diesen Kaufmann anlegen sollte, neben der Schmiede am Tor. Vorne an der Straße war alles still, das Haus verschlossen. Die Rückseite des Gartens war gar nicht so einfach zufinden in diesem Labyrinth von Hinterhofgassen und engen Durchgängen zwischen den alten Bürgerhäusern. Hier war ich auch noch nie gewesen.
Aber endlich fand ich hin, wo ich dachte, dass hinter einer Ziegelmauer dieser Garten sein musste. Und richtig, da gab es eine Brettertür, die war nicht einmal verschlossen.
Wie ich vorsichtig vier Schritte hinein bin und leise nach ihr rufe, höre ich ein Stöhnen – und zwei Ecken weiter liegt sie dann, zitternd und blutig, mit zerrissenem Kleid auf einem Haufen Lumpen und kann erst überhaupt nicht aufstehen. Bis ich sie hochziehe und stützen muss. Eigentlich ist sie ja fast einen Kopf größer als ich und zwei Jahre älter auch und hat sonst viel mehr Kraft in den langen Gliedern.
„Na“, sagt sie leise, „da siehst du mal das ganze Elend…“
Und wie wir erst ein paar Schritte weiter sind in der Gasse, krallt sie sich am Türbalken fest und schickt mich mit einem wilden Blick zurück, ihr die Eisen zu holen, die da unter den Säcken versteckt sind, wo sie drauf gelegen hat. Vier kleine und ein großes, schwer sind die und scharf, und ich habe keine Ahnung, wofür die sein sollen.
Aber wie sie die Dinger in der Faust hat, richtet sie sich auf und atmet durch, und sieht geradeaus, und ist so fast wieder meine alte Zeta.
„Was ist passiert?“, frage ich.
Aber sie schüttelt nur den Kopf mit den roten Haaren und beißt die Lippen zusammen, nichts ist aus ihr herauszubringen.
Ein kurzes Stück weiter in dem Gang zwischen den Hinterhöfen muss sie wieder stehen bleiben, sich an der Wand abstützen, und sie übergibt sich in langen Krämpfen.
„Was ist mit dir? Was ist geschehen? Hat dir einer was getan?“, ich höre selbst die Panik in meiner Stimme.
„Einer…?“, kam es leise von ihr zurück.
Und als sie achtlos ihren Rock zu Hilfe nimmt, um sich den verschmierten Mund abzuwischen, sehe ich all das Blut ihre Beine runterlaufen.
„Vier Mistkerle waren das… willst du gar nicht mehr von wissen. Hilf mir nach Hause… und dass mich keiner sieht, bis ich in der Kammer bin.“
Es ging nur langsam mit ihr, aber wir hatten Glück.
Als wir endlich ankamen und ich vorsichtig um die Ecke in unsere Straße spähte, standen sie da alle, Familie, Freunde und Nachbarn, vor dem Haus auf der Gasse um den hochbeladenen Esel herum, und nahmen Abschied von Joshe und Avram, die gerade zu ihrer Reise aufbrechen wollten. So kamen wir ungesehen durch den Kücheneingang hinein und die Treppen hinauf in unsere Kammer.
Zeta legte sich ins Bett und zog die Decke über den Kopf, die Hände fest um die Messer geschlossen.
Ich schaffte es noch, einen Bottich warmes Wasser aus der Küche hoch zu holen, ehe die ganze Meute wieder zurück ins Haus kam. Sie waren in aufgeregten Gesprächen über die Abreise der beiden Reisenden und ihrengefährlichen Weg in denfernen Süden. Für mich eine gute Gelegenheit, kurz zur Mutter zu springen und recht nebenbei mitzuteilen, dass übrigens auch Zeta wieder da war.
Dann kümmerte ich mich weiter um sie, so gut es ging. Ich wusch ihr Dreck und Blut von Leib und Gliedern und versuchte, eine Art von Verband zustande zu bringen. Zwischen ihren Beinen war das unbedingt nötig – und es passte ja auch gut zu der einzigen Ausrede, die mir einfallen wollte für beiläufige und neugierige Fragen, die sicher bald kommen würden, wo Zeta denn stecke:
„Na, Frauensachen halt, diesmal wohl besonders schlimm.“
Und wie zu erwarten war, reagierten die Frauen darauf verständnisvoll und mitfühlend – die männlichen Teile der Familie zuckten peinlich berührt zurück, guckten blöd aus der Wäsche und fragten nicht weiter.
Es dauerte drei Tage, bis Zeta wieder auf die Beine kam. Ich bewunderte ihre Stärke und Zähigkeit, mit der sie sich schließlich wieder hochkämpfte.
Und wir hatten es doch so eilig! Unser Plan war, Joshe und Avram so schnell wie möglich einzuholen, um mit ihnen dann gemeinsam weiter zu ziehen. Jetzt aber hatten sie doch einen größeren Vorsprung. Es würde länger dauern, bis wir sie erreichten.
Konnte aber auch wieder ein Vorteil sein. Je weiter von zuhause entfernt wir zusammenträfen, um so schwieriger würde es für sie werden, uns wieder zurück zu schicken.
Kapitel 4
Tom
Also Leute, ich traf sie vor dem Haus des Meisters. An dem Tag, wo meine Mutter mich hinbringt, dass ich da meine Lehre beginne.
Sie kommt grad aus der Tür, ihre Zöpfe fliegen, wie sie sich zu mir umdreht, und sie lacht mich an… hell leuchtend wie die Sonne.: So'n breiter Mund, blitzende Augen in 'nem schmalen Gesicht, überall voller Sommersprossen… und sie hüpft dicht an mir vorbei, dreht sich nochmal um – nach mir? Und ist auch schon um die Ecke der Gasse verschwunden.
„Wer war das, Mutter?“
„Mach den Mund zu, Tom“, sagt sie, „war das ja wohl die Tochter vom Meister Steffen.“
Da bin ich stille. Und zum ersten Mal einverstanden mit meinem Schicksal, mit Mutters Plan, mich beim Schuster in die Lehre zu schicken.
Die Werkstatt des Schusters Steffen wurde meine neue Bleibe. Nur einen großen Raum gab's da, zu ebener Erde, mit einer Tür und einem Fenster zur Gasse hin, und gegenüber zum Hof hinter dem Haus auch so.
Mein Schlafplatz war da in der Werkstatt, gleich unter der hölzernen Treppe, die da nach oben zur Wohnung der Familie führte. Ein Sack mit gutem Stroh, eine Decke – nicht übel so, weil trocken und erheblich weniger Gestank, wie im Stall vorher bei den Schweinen von meinem Onkel, nur eben nicht so schön warm.
Gegessen wurde in der Küche, drüben übern Hof. Cara besorgte den ganzen Haushalt. Die Meisterin war krank und lag zu Bett, in ihrer Kammer oben.
Am schönsten war`s morgens, bevor der Meister runter kam. Ich mach man fixe mit dem Waschen, am Zuber draußen im Hof, und setz mich in einen Winkel in der Küche, und schau zu, wie die Cara den Frühstücksbrei macht. Sie war immer in Eile und achtete gar nicht auf mich und was es da so für einen zu sehen gibt.
Sie hat immer nur ihr Hemd an, wie sie so aus'm Bett kommt, die Haare ganz zerstrubbelt, und ein Wolltuch nur um die Schultern, was sie anfangs, solange es noch kalt ist in der Küche, mit einer Hand festhält, ein Knoten hält nie lange.
Wie das Feuer richtig brennt, und es inner Küche wärmer wird, wirft sie das Tuch fort, meist auf die Bank in der Ecke, wo ich stille sitz, und flitzt nur noch so in ihrem Hemd in der Küche rum. Sie hat zwei Hemden, wo sie abwechselnd trägt. Ein neues helles und das alte Hemd, das vom vielen Waschen ganz grau und fadenscheinig geworden is' und was sie schon als Kind getragen hat. Das neue ist recht weit und lang bis zur Wade ruter, und das flattert nur so an ihr rum, wenn sie vom Herd zum Tisch, und zum Bord an der Wand rennt, und wieder zurück. Am Hals ist das mit so 'nem Band zusammengezogen und gebunden. Da passiert nicht so viel, vielleicht dass ihr das mal vonner Schulter rutscht – is' ja auch niedlich. Nur, wenn sie da vor der Feuerstelle mal stille steht, kann ich was mehr von ihr sehen… so den einen oder anderen Umriss von ihrem schmalen Leib, nur so als 'ne Schattenlinie durch den Stoff scheinen.
Viel lieber ist mir aber ihr altes Hemdchen, das wo ihr eng und kurz geworden war. So kurz, dass es schon eine schöne Handbreit über dem Knie aufhört und das Spiel von ihren Muskeln und Sehnen sehen lässt, wenn sie vor dem Herd das Bein wechselt. Und noch'n ganzes Stück glatte Haut mehr, wenn sie sich endlich mal auf den Schemel setzt.
In dem Moment hat sie mich schonmal erwischt, mit einem Lachen, und 'nem spöttischen Blick und so 'ner Bemerkung wie „Heh jetzt, Tom… wach auf und klapp deinen Mund zu, ich fall da gleich rein!“
Und ich beeile mich dann, für den Moment anderswo hin zusehen… und hab den Kopf voller brummender Bilder und ganz ohne einen brauchbaren Gedanken.
Sonst bin ich schon nicht blöd, das könnt ihr mir glauben. Und ich kann auch meinen Namen schreiben, und was es so abzuzählen gibt bei der Schusterei, hab ich auch schnell drauf gehabt. Ein zufriedenes Knurren gab es vom Meister dann, wenn ich richtig lag, mehr kam nichtvon dem. Doch es machte mich froh, denn sonst war ihm kaum etwas recht zu machen. Wehe, irgendein Haken, eine Nadel oder ein Pfriem war nach Gebrauch nich' sofort wieder an seinem verfluchten heiligen Platz!
Ein besonderer Tag im Einerlei der Woche war immer der Waschtag am Dienstag. Wenn dann zwei stämmige Waschweiber zum Helfen ins Haus kommen.
Ich muß dann mindestens ein dutzend mal mit den Eimern los, vom Brunnen das ganze Wasser holen, und die gleich an der Küchentür abstellen. Die Küche ist voll von Dampf und Hitze, und es ist wenig zu erkennen.
Und bald hängen die ersten Leinen mit Wäsche voll zum Trocknen, von Wand zu Wand im Hof. Und alles weiter läuft ab wie hinter geschlossenen Vorhängen.
Aber einmal, seht ihr, da kommt die dicke Grete alleine dienstags, und die andere Wäscherin ist zu ihrer Tochter, die wo ein Kind kriegen soll.
Und ich werde diesmal nicht nur zum Wasserholen gebraucht, sondern auch in der Waschküche bei der ganzen Plackerei. Das ist nämlich harte Arbeit mit sauschweren Kupferkesseln und dicken Zubern aus Holz, voll mit heißer Lauge. Und ganze Berge von nassem Tuch müssen bewegt werden, gestampft und gerührt, und herausgehoben und ausgewrungen, endlich hinausgetragen in den Hof und über die gespannten Leinen geworfen werden, alles schön ordentlich zum Trocknen. Eine endlose Höllenplage is` das Ganze, echt.
Aber für mich wird das an dem Tag wie ein himmlisches Fest, und überhaupt jede Mühe wert!
Cara hat da am Waschtag natürlich immer`s alte Hemd an, das wo ihr so eng sitzt und kurz geworden ist – hab ich das schon erzählt? Ja, und schnell sind wir dann alle patschnass, vom Dampf schon allein und vom Hantieren mit den triefenden Lappen. Und da stehe ich dann so hinter ihr und halte den Korb bereit für sie. Und Cara beugt sich also über den großen Zuber vor und fischt die nassen Wäscheteile raus und wirft sie nacheinander in meinen Korb.
Erst geht das rasch voran, dann braucht sie schon länger, um in der trüben Brühe die letzten Stücke zu angeln und beugt sich dafür weit vor über den Rand von dem Bottich. Ja, und bei jedem Vorbeugen spannt sich der Stoff über ihrem schmalen Hintern, und rutscht auch, jedes Mal ein Stückchen höher, und bleibt da dann an der feuchten Haut wieder wo kleben. Und noch einmal richtet sie sich auf, und holt tief Luft, und wischt sich mit einem Schnauben die nassen Haare ausm Gesicht, und reckt sich da nochmal weiter über den Bottich vor.
Und der Saum von dem Hemd macht noch einen kleinen Sprung hinauf, wie die höhere Spannung ihn von seinem feuchten Untergrund reißt – und ich kann nirgendwo anders hinsehen, als auf diese unglaubliche Landschaft, wo die Rückseite ihrer Schenkel die sanfte Biegung, oder die sachte Wölbung, oder Krümmung wechselt von innen nach außen und… und etwas nach hinten schon, wisst ihr, und weiter oben dann wieder nach innen … und das… ist dann schon richtig ihr Po?
„Los, Tom, träum nich' rum… wir tragen den Korb zusammen in den Hof, auswringen und aufhängen, vorwärts los!“
Cara und ich packen jeder einen der gegenüberliegenden Griffe. Der Korb ist nun echt sauschwer mit nassem Zeug gefüllt. Wir beide sind so ziemlich gleich groß und kriegen das Biest, mit gestreckten Armen und nach hinten gereckt, und fast auf den Zehenspitzen, so gerade vom Boden hoch.
Cara trippelt mit kleinen Schritten rückwärts auf die Tür zum Hof zu.
Und ich habe einige Augenblicke, zu beobachten, wie durch den seitlichen Druck ihrer angelegten Oberarme unter dem nassen Stoff ihre kleinen Brüste ganz zu neuen Formen kommen, so ein von gesammelter Kraft gerahmtes V… das meinen Blick zwingt und festhält.
Und als sie die Stufen zum Hof hinauf muss, und sich dazu noch weiter zurücklehnt, und kurz den Griff wechselt, lassen sich endlich auch ihre spitzen Nippel sehen, genau da, wo sie sein müssen… und alles perfekt machen, und… was für ein Anblick! Ja nun, was will ich machen, ihr kennt das ja alle.
Ein harter Ast ist mir gewachsen und drückt sich schmerzhaft und lustvoll an das rauhe Korbgeflecht vor meinem Bauch.
Unter den Leinen im Hof setzen wir den Wäschekorb ab, und mein doofer Prügel springt vor unter dem dünnen Stoff der Hose – wie der mit den verbundenen Augen beim Blinde-Kuh-Spiel.
Cara sieht das man nicht, sie wringt die Teile aus, Stück für Stück, und wirft die dann über die Leine. Ich stehe ihr schwer atmend genüber und mache dann auch mit, langsamer nur, weil ich meine Augen nicht lange von ihrem Anblick abwenden kann.
Es geht zu schnell, hin und her, für meinen hungrigen Blick. Sie beugt sich runter in den Korb, und ich schaue über ihren zarten Nacken und die rasch arbeitenden Muskeln und Grate des Rückens hinab zu diesem runden, ruhigeren Ende… dann schnellt sie wieder empor, kurz sehe ich ihr erhitztes Gesicht, bis es gleich hinter dem Tuch wieder verschwindet, wie ihre ganze Gestalt, bis auf ein paar undeutliche Schatten vielleicht.
Oder aber es drückt sich noch was weiter vor von ihr, in die nass hängende Wand, na, was an ihr halt so voranstehen mag, wenn sie sich hochreckt zur Leine, um etwas zu richten… und wieder ist das viel zu schnell für mich vorbei. Spannender wird es wieder bei den kleineren Wäschestücken, so sonderbaren Lappen sind das, mit so angenähten Bändern, die entwirrt und geordnet auf die hohe Leine gebracht werden müssen, weil sie dann damit zu tun hat, und das Bild für mich länger bleibt. Während ich also ohne drauf zu schauen meine Finger mit Zupfen und Ziehen an diesen verknoteten Bändseln beschäftigt halte, habe ich gute Gelegenheit zu beobachten, wie Cara auf Zehenspitzen den Leib zur Leine streckt und das kurze Hemd noch kürzer wird…
„Heh, Mädchen, jetzt pass mal auf, dass der dich nicht aufspießt mit seiner Lanze, dieser nasse Lümmel!“ Die dicke Grete ist unbemerkt aus der Tür getreten und hat mich voll erwischt.
„Was? - Oh …“, Cara kichert los.
Ich wende mich ab, so schnell ich meinen Schreck überwinden kann. Aber von der Seite sieht das hervorragende Teil in meiner Hose so sicher noch viel grotesker aus, Mann!
„Aber Tom tut mir doch nichts mit seiner… Lanze!“ Sie grinst mich breit an.
„Na, dann ist er wohl dein dienender Ritter! Seht an, Lancelot mit der langen Lanze, der hervorragende Recke ohne Furcht und Tadel, mit seinem fürchterlichen Spieß zu jedem harten Dienst bereit!“
Die Dicke hat ihr Thema gefunden und hört gar nicht mehr auf.
Cara lacht lauthals los, und ich stehe blöde da, was soll ich machen? Sie wissen ja nun, wie es um mich steht.
Den Rest vom Tag machen sie ihre Witze weiter. Die dicke Grete tänzelt geziert herum, lässt ihre Massen wackeln und hüpfen, und singt schlüpfrige Liedchen ohne Ende. Über Fräuleins und ihre dienenden Liebhaber, und deren munteres Treiben miteinander. Cara singt mit manchmal, was sie so kennt.
Wir arbeiten natürlich weiter zusammen, und sie hat auch weiter keine Scheu und keine Bedenken, sich zu bewegen, wie sie will und muss, und dabei zu zeigen, was sich halt sehen lässt – und macht sich anscheinend nichts draus, was das wieder bei mir bewirkt.
Aber ab und zu sieht sie mich für einen Moment länger an und lächelt so, und geht vielleicht auch näher an mir vorüber, als es nötig wäre. Und es kann geschehen, dass sie mich streift, nur ganz zufällig, und auch dort mal, wo ich jetzt besonders sperrig bin. Und einmal geht sie, mit abgewandtem Blick aber, ganz dicht vor mir vorbei, hält da kurz inne, und streicht wahrhaftig mit dem Rücken ihrer Hand zögernd, langsam, längs an meiner ganzen Aufgeregtheit entlang – dass ich sterben könnte.
Gegen Ende von dem Waschtag, die Plackerei ist fast geschafft, treibt die Dicke ihren lüsternen Übermut noch einmal auf die Spitze.
„Und was kriegt unser strammer Recke am Ende noch für einen Lohn für seine stetigen Dienste?“
Mit lauernden Schritten kommt sie auf Cara zu, drängelt und treibt sie vor sich her um die Bottiche und Eimer, quer durch die Waschküche in eine Ecke, wo sie sie zu packen kriegt, herumwirbelt und mit ihrem Rücken an sich presst, und in die Höhe reißt.
Cara quiekt und strampelt, mit den nackten Beinen hoch in der Luft. Und das kurze Hemd rutscht ihr noch weiter hoch, ganz über die Hüften hinauf.
„Ja, so ist's richtig“, ruft die Dicke, „zeig's ihm… zeig ihm alles was er will… zeig ihm dein heißes Paradiesgärtlein… da will er doch hin, dein junger Held… das wird sein Lohn am Ende sein… und das ist sein schönstes Ziel!“
Mit diesem Geschrei und der wild zappelnden Cara vor ihrem mächtigen Leib kommt sie auf mich zu, wie ich dastehe und wie gebannt glotze…
Und was soll ich sagen, sie hat so Recht!
Direkt vor mir setzt sie Cara ab, auf den Boden, und hält sie aber noch fest, nicht mal das Hemd lässt sie sich wieder runterziehen.
Cara atmet schnell und sieht mir fest in die Augen – und gibt mir einen kurzen, schnellen Kuss , fast als wolle sie sich entschuldigen – und duckt sich weg und ist davon.
Der Rest des Tages ist nur noch ein wabernder Nebel in meiner Erinnerung. Dann ist der Waschküchen-Spuk vorbei und der Alltag zieht wieder ein in der Schusterei.
Kapitel 5
Odo
Manchmal ist mir alles schwer.
Eine entsetzliche Last liegt auf allem, was zu tun wäre – wenn ich die Kraft fände, es zu beginnen – so aussichtslos von vorne herein.
Vielleicht hilft es aufzuschreiben. Ich bin heute früh aufgestanden und habe mich mit Griffel, Tinte und einem Heft von diesem neuartigen Papier in den Erker ans Fenster gesetzt und will sehen, ob es helfen kann. Aber erst muss ich zum Abort und mich erleichtern.
Der ist auch wirklich prachtvoll geworden. Mein Vater ließ ihn an die Außenwand des Kastells bauen in luftiger Höhe, mit kleinen Fensteröffnungen nach beiden Seiten und einem Sitz aus grauem Marmor. Kein modriger Balken mehr in einem stinkigen Verschlag auf dem Hof.
Wirklich ein Fortschritt – auch so ein Lieblingswort meines Vaters. Ich denke, es geht ihm manchmal ähnlich wie mir, wenn er sich in offensichtlich düsterer Stimmung zurückzieht, und niemand mehr zu ihm gelassen wird. Dann heißt es oft, er schreibe an seinem Falken-Buch. Vielleicht hater das Schreiben auch für sich entdeckt als Therapie gegen die Schwermut.
(Ein blödes Wort: „schwer“ – na sicher , aber „Mut“? Kaum was von zu spüren. Ein treffenderes Wort bleibt erst noch zu finden.)
Jetzt aber scheint es mir doch schon besser zu gehen. Ich will in die Küche hinunter und etwas zu essen suchen. Auch ein gutes Zeichen.
Mein hoher Vater, der Kaiser Friedrich, zweiter diesen Namens, fand meine Mutter – so wurde es mir jedenfalls erzählt (erst viel später tauchten Fragen auf, als ich begriff, dass das so nicht ganz stimmen konnte) – er fand meine Mutter auf der Rückreise von Deutschland, als sein Gefolge für einige Tage am Südhang der Alpen rastete. In der kleinen Herrschaft eines treuen Gefolgsmannes, des Herrn von Peio, der nicht ahnen konnte, dass seine einzige Tochter, nach zwei Tagen Bekanntschaft nur, diesem jungen Kaiser folgen würde auf Gedeih und Verderb, ohne Rücksicht auf ihr bisheriges Leben und ihre Familie.
Ich habe kaum eine Erinnerung an sie, die früh verstarb. Nur eine unklare Vorstellung ihres Gesichts, Zielpunkt all meiner kindlichen Wünsche, immer zu weit weg und nie recht zu erlangen, nie genug zu erreichen.
Ich wuchs auf an diesem fortwährend umherziehenden Hof des Kaisers, in seiner bunten, lärmenden Haushaltung. Zusammen mit allen anderen seiner Kinder, den älteren, Federico, Enzio und Katharina, und später mit den jüngeren, Salvazza, Friedrich, Riccardo, Bianca, Margherita und Costanza und einigen mehr, die ihm seine häufigen Liebschaften beschert hatten.
Wir wurden alle gleich behandelt. Von Vater nur gelegentlich beachtet und gemeinsam, Mädchen und Jungen, von denselben Lehrern unterwiesen in allem, was es zu wissen gab: Sprachen und Geschichte, im Rechnen mit den neuen arabischen Zahlen, und geübt in einigen Künsten, die man für uns nötig fand. Erst in den letzten Jahren meiner Kindheit hatten wir das Glück, im Umkreis der einzig Geliebten und Herzensfreundin des Kaisers, der freundlichen Bianca Lancia, mehr Beständigkeit und Ruhe zu finden, so wie es für heranwachsende Kinder wertvoll sein mag.
So wurde ich groß, in dieser ganzen Horde am Hofe. Zwischen Hunden, Rittern, Frauen und Falken, Gesandten aus fremden Ländern und anderen Exoten, Beamten, Gelehrten und Phantasten. Bei Wein, Wasser, Braten, Brot und oft zu wenig Schlaf. Der ganze chaotische Wanderzirkus meines kaiserlichen Vaters zog ständig quer durch die Weltgeschichte, man vergaß jedes Maß, suchte stets Geld, war voller Ideen, und immer hinter neuen Zielen her, ohne Plan vor lauter großen Plänen.
Aber ich zog mich oft zurück aus diesem verstörenden Wirbel, und hielt mich dann für eine Weile unauffindbar versteckt vor den anderen, die aber auch nicht lange nach mir suchten. Ich war wohl beliebt, aber nicht unentbehrlich. In den letzten Jahren habe ich Ausritte gemacht mit meinem Freund Mahmoud dem Sarazenen, oft über Tage ins Land hinaus, als wollte ich so den Weg finden, der mir bestimmt sei.
An manchem anderen Tag verbarg ich mich wieder ganz, ohne einen wirklichen Grund zu wissen, auf irgendeinem Speicher, im Dunkeln auf vergessenen Säcken und muffigem Stroh, und träumte lieber, als herumzutoben mit den anderen.
Am liebsten waren mir noch die anstrengenden Stunden bei Hildebrand, dem Waffenmeister, im Übungsgraben oder zu Pferde. Oder auch bei den Beamten in der Kanzlei, wo die Vielfalt der Welt zu Zahlen geronnen und in Faszikel gebunden, fasslich und gleichfalls distanziert, für den verarbeitenden Verstand bestens präpariert vor mir lag.
Beim Waffenmeister auch habe ich Gina getroffen, dieses Mädchen, seine Tochter…
Und nun regnet es wieder. Schon die ganze Nacht eigentlich. Nach ein paar übel schwülen Tagen hat sich Dauerregen auf das Land gelegt.
Ich bin nur, was man so einen Bastard nennt, aber zum Kaiser darf ich sagen „Vater“.
Alle seine Kinder sind wir gründlich verschieden voneinander, jedes ist eine Welt für sich. Hinter den Augenlöchern ziehen eigene Sterne ihre Bahn.
Mich nennen sie einen Träumer, aber ich bin wach und schlafe nicht. Was ich sehe, ist nicht immer deutlich – eher selten – , aber es hat so eine Kraft, dass ich nicht ablassen kann. Ich halte dem stand und bleibe offen für den Fluss von… ich kann nicht sagen, was das ist. Aber ich weiß, auf der weiten Spanne zwischen Zufall und Notwendigkeit liegt es nicht so weit von dem Ort eurer täglichen Wirklichkeit entfernt.
Manchmal reicht eine kritische Bemerkung, ein schräges, ungeklärtes Wort, um mich in einen Abgrund zu reißen. Es ist als ob ein Ballon platzt, eben noch unbemerkt, aber zum Bersten voll und ein geringes Anecken reißt ihn in Stücke, und Wut und Trauer legen sich über alles.
(Ballon ist so ein sonderbar fremdes Wort, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Das passiert mir manchmal, es taucht ein Begriff in meinen Gedanken auf, den ich selbst nicht kenne – ich habe dabei ein Gefühl als schaute ich weit in eine unbekannte Ferne, ohne recht zu erkennen, was es da zu sehen gibt. Dieses Mal hatte ich etwas wie solch eine mit Luft aufgeblasene Schweinsblase im Sinn, mit der wir als Knaben unsere Spiele trieben …)
Aber heute ist ein neutraler Tag, ein offener Morgen, und früh erwacht scheint alles leicht. Die Gedanken fließen, keine wirren Träume mit unerhörten Begriffen, deren ahnungsvoller Sinn anderen kaum zu erklären wäre. Heute Morgen herrscht die Realität, klar und glänzend.
Ich hatte ein langes Gespräch mit meinem Vater, dem Kaiser.
Seit ich vor einer Woche erfuhr, dass mir diese kleine Herrschaft zufallen soll, im Norden am Fuß der Berge, weil ein Onkel verstorben ist, von dem ich bisher nichts wusste – seitdem treiben mich Visionen um und Ideen verdichten sich.
Ich habe versucht, Vater davon zu erzählen – und er hat sehr aufmerksam und geduldig zugehört. So wenig und so viel zugleich es bisher ist, was sich in Worte fassen lässt. Er schien ernst und auch fasziniert, und fasste es in dem Auftrag an mich zusammen, ich solle nur in dem kleinen Kreis meines Erbes das Experiment versuchen, wovon er später vielleicht auch, im Großen und Ganzen seines Heiligen Reiches profitieren könne, und wenn nur als einem Beispiel.
Und mit diesem so plötzlich und so weit aufgespanntem Bogen seiner Weltgedanken brachte er mich nun wieder zum Staunen – wie es für seine Gestalt und Wirkung unter den Freunden ja schon zum Sprichwort geworden ist: als stupor mundi, also ein Staunen für die Welt.
Außerdem gefällt ihm die Vorstellung sehr, mit meiner Grafschaft einen verlässlichen Stützpunkt am Eingang der Alpenpässe zu gewinnen. Vor wenigen Jahren noch haben ihm die feindlich gesinnten Veronesen diese derart gesperrt und abgeriegelt, dass die vom Norden, aus dem deutschen Reich heranziehenden Fürsten und Lehensmänner, darunter auch sein ältester Sohn Heinrich, wieder umkehren mussten, anstatt ihn wie geplant und befohlen auf einem Reichstag in Cremona aufsuchen zu können und gemeinsam den anstehenden Kreuzzug ins Heilige Land zu beraten.
So ist er also sogar bereit, mir für meinen Versuch eines großen Wurfes im Kleinen einige bis dahin noch nie sonst dagewesene kaiserliche Privilegien zu gewähren, deren Notwendigkeit sein klarer Blick für die großen Zusammenhänge sofort sah, noch ehe ich alle Worte zusammen fand, um darzustellen was mir ungefähr vorschwebt.
Das Geringste davon ist noch in meinen Augen, dass mein kleines Erbe zu einer Markgrafschaft von Enna und Peio erhoben wird. Er bestand darauf, um schon im Titel das Ungewöhnliche und Außerordentliche einer Stellung außerhalb des Hergebrachten, des in den Jahrhunderten gewachsenen Gefüges der Herrschaften, Länder und Republiken im Norden Italiens deutlich vor alle Augen zu stellen.
So soll es also sein.
Ich werde nur mit einigen wenigen Gefährten aufbrechen, mein Erbe anzutreten, das in einem traurigen Zustand sein soll, ganz verarmt und nahezu entvölkert auch durch die willkürliche und schändliche Regierung meines kürzlich verstorbenen Onkels.
Wir werden also ganz unten beginnen, bei „Null“ , wie das zu nennen unser Lehrer für die Rechenkünste, Meister Leonardo aus Pisa, uns beigebracht hat.
Der Hof wird langsam wach. Füße tappsen die Treppe hinunter, die Mägde holen Feuerholz und das erste Wasser vom Brunnen, und die Köchin jagt die Hunde aus der Küche.
Schritt für Schritt beginnt das Neue.
Kapitel 6
Riccardo
Ich, Riccardo von Monteleone, beginne hier diese Aufzeichnungen für meine Kinder und, so Gott will, die weiteren Generationen meines Geschlechts.
Ich verfasse diese Schrift, um meine Sicht dieser Welt darzulegen, jedenfalls unseren kleinen Winkel derselben – und wie es dazu kam, dass sich so vieles veränderte. Es fällt mir schwer, man sieht es, die rechten Worte zu finden. Bin es nicht gewohnt, Gedanken in Worten niederzulegen – auch bin ich schon alt, schwerfällig und mit der Zeit etwas gebrechlich geworden. Manchmal schon fühle ich mich dem Grabe nahe, doch mein Verstand ist klar und nüchtern, und auch immer noch voll des Staunens.
Möge es der Herr geben, dass es so noch ein paar Jahre bleiben könne.
Wo fange ich nun an?
Meine größte Sorge sind meine Töchter, aber nicht nur Sorge, sondern auch die größte Freude: Artemisia ist die älteste der drei, sie ist groß gewachsen und von wahrlich edler Gestalt. Sie hat meine dunklen, fast schwarzen Haare geerbt, und erstaunliche Kräfte für eine Frau, auch meinen starken Willen und eine klare Sicht auf die Dinge. Bald ist sie schon fünfundzwanzig Jahre alt, und doch unverheiratet geblieben. Alle Bewerber um ihre Hand hat sie abgewiesen.
Verständlich, auch ich hätte nur sehr ungern einen von ihnen als Schwiegersohn und Nachfolger in der Grafschaft akzeptiert. Zu deutlich war bei ihnen allen, früher oder später, zu erkennen, dass sie hinter dem Erbe her waren. Nur recht oberflächlich waren sie bemüht zu gefallen. Nach drei Bechern unseres schweren Weines fing die Prahlerei meist schon an, und schnell ging es nur noch darum, was sie aus unserem Land und Besitz noch machen, wieweit sie es damit bringen würden. Geschmacklose Krämerseelen, einer wie der andere.
Obwohl, es gab auch da noch eine Steigerung: Der stramme Eberhard, ältester Sohn meines nächsten Nachbarn, des Grafen Wolf von Terrasecca, brachte es fertig, meiner Tochter Artemisia, an meinem Tisch, beim Willkommensmahl, als Gast unseres Hauses, in plumpester Dreistigkeit an die Brust zu langen, quer über den Tisch, vor meinen Augen! Nicht, dass es hinter meinem Rücken schicklicher gewesen wäre.
Aber ehe ich in meinem aufflammenden Zorn noch zu Worten der Empörung und Zurechtweisung fand, hatte sie, meine Artemisia, ihm schon die noch halbvolle Kanne Roten über den dampfenden Schädel geleert und – kurz und hart – den Schemel unter dem breiten Hintern weg getreten, sodass er unter den Tisch sackte, dabei mit dem Kinn auf dem Tisch aufschlug und sich die Zunge halb durchbiss.
Das ist mein Prachtmädchen!
Er nun, er lispelt seitdem sonderbar. Hat auch schon in den fünf Jahren seitdem zwei Ehefrauen unter die Erde gebracht und kürzlich eine dritte gefreit, das arme Ding. Aber mit uns spricht er nun ohnehin nicht mehr. Kein Verlust.
Bianca, meine zweite Tochter, ist wohl so etwas wie mein Sorgenkind. Sie zählt jetzt auch bereits einundzwanzig Jahre und ist so ebenfalls über das übliche Heiratsalter längst hinaus. Sie ist ein stilles, scheues und eher verschlossenes Wesen, aus ihren grauen Augen die Welt scharf beobachtend. Mitunter scheinbar gedankenverloren abwesend, aber dann plötzlich mit einer glasklaren, harten Bemerkung den Punkt treffend, dass es mich staunen macht. Sie reitet wie der sprichwörtliche Wirbelwind, und ist mit ihrer kleinen, grauen Stute oft allein unterwegs in den Wäldern und auf den Hängen an den Bergen meiner Grafschaft. Ich sehe das nicht gern und halte es für gefährlich, aber sie lässt es sich nicht nehmen.
Seit ihrem Unfall vor drei Jahren hat sie das Bogenschießen für sich entdeckt und ist nach unentwegtem, schon geradezu verbissenem Üben mit dem kurzen Reiterbogen, wie ihn die Mongolen oder Sarazenen gebrauchen, zu einer wirklich bemerkenswerten Schützin geworden. Jeden Morgen steht sie früh im ersten Licht in der taufeuchten Senke des alten Burggrabens, den selbstgefertigten ledernen Brustlatz zum Schutz vor den Mantel geschnallt, und lässt die Pfeile fliegen, auf kurze und weite Ziele, nach ruhig besonnenem Zielen oder auch in schneller Folge. Morgens ist sie alleine so zugange, aber abends übt sie mit ihrer jüngeren Schwester und ihren anderen Schützlingen gemeinsam – eine sonderbare Truppe. Wäre es ihr nicht so unabdingbar ernst, müsste man lächeln über die oft noch ungelenken Bemühungen dieser eifrigen Amazonen.
Und dann ist da noch mein Augenstern, Cordelia, die jüngste meiner Töchter. Mit ihren erst sechzehn Jahren jetzt ist sie zwar auch schon im besten Heiratsalter nach den Gepflogenheiten der adeligen Gesellschaft. Aber sie ist noch so sehr kindlich und ein lebhafter Wildfang (so hätte meine Mutter sie genannt), mit ihren strahlenden braunen Augen und fliegenden goldenen Locken.
Aber was soll aus meinen Mädchen werden in dieser mitleidlosen, grausamen Welt? Ich weiß es wirklich nicht. Ich bringe es nicht über das Herz, sie zu „passenden” Ehen zu überreden, wie es überall geschieht.
Ich selbst durfte die Liebe erfahren, Glück meines Lebens – der Herrgott in seiner Güte möge es richten, was aus meinen Töchtern werden soll. Ich kann sie nur beschützen solange ich noch am Leben bin, nach meinem Tode werden die Freier wie gierige Wölfe über sie und ihr Erbe herfallen.
Der Kaiser ist mein Lehnsherr und wäre dann der Vormund meiner Töchter. Doch auch von ihm ist nichts anderes zu erwarten, als eine zügige Verheiratung an treue Gefolgsmänner seiner herrscherlichen Wahl, die zur Belohnung anstehen mögen. Meine Kinder wird niemand dazu fragen, und das Problem ist für den Kaiser nützlich und elegant vom Tisch.
Wenn sich kein Ausweg finden will bis dahin, bleibt mir nur der schwache Trost, nicht durch eigenes Handeln am Schicksal meiner Töchter schuldig geworden zu sein.
Kapitel 7
Tom
Der armen Frau des Meisters geht das immer schlechter und an einem Morgen ist es aus und vorbei mit ihr. Sie hat ihr Bett nicht mehr verlassen, seit ich da mit meiner Lehre angefangen hab, und so seh ich sie das erste Mal überhaupt auf ihrm Totenbett. Sie wird zu Grabe getragen, das ist der Lauf der Dinge. Und an unserm Leben hat sich dadurch nichts geändert weiter.
Aber schon paar Tage nach dem Begräbnis weckt mich so ein Geräusch und Unruhe von da oben über mir. Mitten in der Nacht ein Gepolter und Streit. Und ein halblauter Schrei lässt mich hochfahren von meinem Strohsack. Aber als ich am Fuß der Treppe steh, ist doch nur noch Geraschel von den Betten zu hören und bald ein komisches Schnaufen. Und bald kehrt dann auch wieder Ruhe ein, und ich traue mich natürlich nicht rauf, so ohne Grund weiter.
Später dann, gerade bin ich wieder eingeschlafen, tappen bloße Füße die Leiter über mir runter. Und dann steht im Dunkeln eine Gestalt vor meinem Lager, und Caras Stimme fragt flüsternd: „Lässt du mich bei dir liegen?“
Mein Herz macht da einen großen Satz, das glaubt ihr wohl – und ehe ich überhaupt zu Worten finde, ist sie schon zu mir unter die Decke geschlüpft. Und gleich drückt sie mir ihren mageren Rücken an meinen Bauch und zittert nur. Ich versuche, ihr bloß sanft den Kopf zu streicheln und weiß nicht, was sagen oder sonst tun.
Aber sie, sie nimmt sich meine Hand mit unter die Decke, und legt sich die zwischen die Brüste, und presst sie dort fest an sich.
Blitz und Donner, ich spüre mein Herz im Halse schlagen – und im selben Augenblick ist mein Stängel schon hart wie der Pilgerstab eines Wandermönchs. Gerade, dass es mir noch gelingt, den mit den Oberschenkeln einzufangen und zugekniffen festzuhalten, oh Mann!
Ich will für Cara jetzt nur ein Tröster und Beschützer sein – wie sehr und heiß auch alles in mir drängt und pulst. Und ich schaff es doch, den Atem zu kontrollieren, und ganz ruhig und still nur den Hintergrund zu geben, an den sie sich anschmiegen kann. Wird schon gehn, bin ja nicht blöd und verjag sie wieder.
Irgendwann scheint sie auch zu schlafen dann, mit leichten und ruhigen Atemzügen. Aber ich bleibe wach und gespannt und aufmerksam. Und jeden Augenblick sammle ich ein, im Dunkeln, Perle für Perle, ein Schatz fürs Leben.
Dann bin ich wohl doch weg gepennt.
Am Morgen ist Cara nämlich fort. Und ich liege allein und mit einem feuchten Schmierfleck vor dem Bauch auf meinem Strohsack.
Und sie kommt auch nicht wieder. Kein Frühstück wird gemacht. Der Meister kommt nur irgendwann schnaufend die Treppe herunter und ist vielleicht besonders mürrisch heute, kann sein. Und wir müssen uns die Sachen selber zusammen suchen und sehn wie wir klarkommen. Alle Fröhlichkeit ist aus dem Haus und fort.
Einige Tage hör und seh ich nichts von Cara.
Der Meister brummt mir alle Arbeiten auf, die sie vorher gemacht hat, wo ich doch keine Ahnung von habe: Kochen und Putzen und Einkaufen auf dem Markt und – naja, bei der Wäsche war ich ja schon dabei.
Und wie die dicke Grete wieder fürs Waschen kommt, hat sie auch eine Nachricht von Cara an mich – aber ich soll dem Meister nichts davon verraten: Cara ist jetzt bei einem Kaufmann am Obermarkt in den Dienst gegangen, als Hausmagd. Und es ist alles in Ordnung und es geht ihr gut, soll sie mir sagen.
Aber warum glaube ich das nicht wirklich ?
Und ich soll erstmal nicht zu ihr hin und nicht nach ihr suchen. Und vor allem, kein Wort von alldem zum Meister.
Na gut. Ich lasse also ganz allein für mich den Kopf hängen.
Aber seit sie weg ist, träume ich nur noch von ihr. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann erst recht. Und, ja nun, ihr könnt euch denken, wie es mit mir geht. Auch wenn`s eben eine Sünde sein soll, wie sie immer predigen, die schlauen Pfaffen. Kann dann halt nicht anders, es zerreißt mich sonst vollständig.
Ach Mädchen, wie schön war das, dich frühmorgens in der Küche herumwerkeln zu sehen, mit deinen bloßen Beinen und fliegenden Zöpfen, mit flinken Schritten und Hantierungen, bald am Herd, bald bei mir am Tisch – ohne einen Gedanken, welchen Aufruhr du in meinem Leib herauf beschworen hast!
So leicht und froh kann es nie wieder sein.
Kapitel 8
Odo
Es war nicht so einfach, den alten Hildebrand zu überreden mitzukommen. Er ist Waffenmeister am Hofe und hält sich für absolut unentbehrlich für die Ausbildung „der jungen Herrschaften“ – und mir ist er das auch. Ich weiß sehr gut, dass ich jemand brauche, an dem ich mich festhalten kann, wenn der Boden unter mir nachgibt und alles weitere im Nebel versinken will. Ich weiß nur nicht, ob er schon versteht, was mit mir manchmal los ist. Er sagt dann nicht viel, schickt mich in eine Ecke und gibt mir eine blöde, simple Aufgabe, und hält alle anderen von mir fern. Sieht vielleicht einmal nach mir, eine Weile später, knurrt noch eine Anweisung, die mich trifft wie ein Stoß in den Rücken – und irgendwann geht’s wieder mit mir und ich komme aus dem Loch heraus. Bis zum nächsten Mal.
Erst wollte er nicht mit, wie gesagt, auf meine „verrückte Expedition“, wie er es nennt. Ich habe ihm gesagt, dass ich es ohne ihn nicht schaffe, er wollte das gar nicht hören. Erst als ich ihm in einem meiner beredteren Momente vor Augen führen konnte, wie sein Leben am Hofe als Ausbilder von immer neuen Scharen von frechen Nichtswissern wie uns weitergehen werde, Jahr für Jahr, sah er mich einen Augenblick mit geweiteten Augen an, und fuhr sich dann mit einer Hand durch die eisengrauen Stoppeln auf seinem runden Schädel.
Er brummte dabei etwas wie „allmählich zu alt für diesen Flohzirkus im Heuhaufen“. Nickte dann und gab mir einen überraschend zarten Stoß mit der linken Faust. Und ließ mich dann stehen, mit einem heiseren „Junge, in Teufels Namen denn, bin dabei“, und ihm nachblicken, wie er kehrtmachte und kopfschüttelnd verschwand zwischen Knappenstall und dem Schuppen für die Übungswaffen.
Er kommt also mit. Und ich bin darüber heilfroh.
Seine Tochter Gina zurück zu lassen am Hofe, macht ihm anscheinend keine Sorgen. Sicher ist sie hier gut aufgehoben, und es wäre natürlich völlig unmöglich, sie auf unserem gefahrvollen Weg mitzunehmen.
Nur mein Herz wird sie vermissen.
Kapitel 9
Kehla
In der Nacht dann ging es also endlich los. Alles war still, alles schlief.