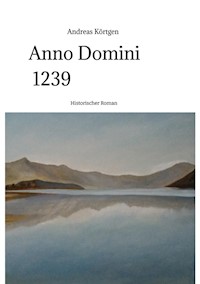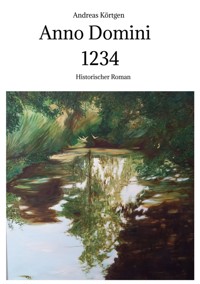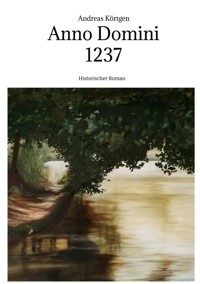
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Erotik
- Serie: Kinder des Staunens
- Sprache: Deutsch
Ein unehelicher Sohn des genialen Kaisers Friedrich II. versucht in seiner kleinen geerbten Grafschaft benachteiligten und verfolgten Menschen unterschiedlichster Herkunft und Religion Schutz und eine neue Heimat zu bieten. Mit anfangs schwachen Mitteln und gegen große Gefahren und Anfeindungen müssen alle lernen, sich gemeinsam zur Wehr zu setzen - nicht zuletzt, um jedem Einzelnen ein Leben in Freiheit und bestmögliche Entwicklung seiner Fähigkeiten zu ermöglichen. Hier, in einer kleinen Welt, haben die weit vorausgreifenden Ideen jenes Kaisers bessere Chance zu bestehen, als in den harten Auseinandersetzungen der großen Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Andreas Körtgen - Anno Domini 1239
Die Kinder des Staunens, Band 2
Andreas Körtgen
Anno Domini 1237
Die Kinder des Staunens
Band 2
Were diu werlt alle min
von dem mere unze an den Rin,
des wolt ih mih darben,
daz diu chünegin von Engellant
lege an minen armen .
(Carmina Burana, 145a)
(Wäre die Welt alles mein
von dem Meere bis an den Rhein,
dessen wollte ich entbehren,
dass die Königin von England
läge in meinen Armen.)
„Er war rotblond und kurzsichtig,
wäre er ein Sklave gewesen, hätte er nicht einmal zehn Darahim gebracht.“
(Sibt ibn al-Gauzi, Chronist, gest. 1257,
über Kaiser Friedrich II.)
Erzähler im Jahre 1237
und andere Personen dieser Geschichte:
Tom, inzwischen 18 Jahre, ehemals Schusterlehrling
Cara, 19, Ziel seiner Sehnsucht
Luca, 17, Junge aus dem Dorf Peio
Zacco, 17, sein bester Kumpel
Laia, 16, Mädchen aus dem Dorf Peio
Odo, 22, einer der unehelichen Söhne des Kaisers Friedrich II., von diesem zum Markgrafen von Peio und Enna ernannt
Gina, 20, seine ehemalige Liebste
Hildebrandt von der Elle, 55, deren Vater, Waffenmeister
Rochus von Richleben, 23, ein Freund Odos
Helena von Rocassa, 20, eine bezaubernde Nachbarin Odos
Mahmoud bin Abdallah, 29, Freund Odos, Sarazene und Soldat, Briefeschreiber
Fatma, 19, seine Schwester
Aliya, 15, Sarazenin, auch in der Miliz
Riccardo, Graf von Monteleone, 59,
ein befreundeter Nachbar
Artemisia, 27, seine kluge Tochter,
Bianca, 23, Riccardos traumatisierte Tochter
Cordelia, 17, seine wilde und goldene Tochter
Griselda, 33, seine engste Gefährtin, ehemals nur Dienerin
Kehla, 18, eine sehr ihre Freiheit liebende Jüdin
Zeta, 20, ihre Cousine, Capitana der Miliz
Joshe ben Nathan, 23, Kehlas Bruder
Nathan ben Joshe, 45, Vater von Kehla und Joshe, Kaufmann, und Rebecca, seine Frau
Hiram ben Joshe, 42, sein Bruder, Händler, und Lea, seine Frau
Rahel, 15, deren Tochter, Kehlas kleine Schwester
Aaron ben Levi, 52, Rabbi und Vorsteher der jüdischen Gemeinde
Joel ben Avram, 49 und seine Frau Esther
Nazrael ben Joel, 55, Arzt
Maria Christina, 22, leidgeprüfte Ehefrau des dicken Eberhard, Grafen von Terrasecca
Bruder Magnus, 25, Mönch und Chronist
Frater Carlo, 32, Franziskaner (OFM), ein Geheimagent der Kirche
Historisch belegte Personen:
(Soweit sie hier auftreten oder erwähnt werden)
Heinrich von Taufers, ca. 64, Bischof von Brixen
Pater Egno von Eppan, ca. 33, rechte Hand desselben
und Archidiakon
Albert (III.) (von Eurasburg), 57, Graf von Tirol
Adelheid („Delia“), 19, dessen ältere Tochter
Elisabeth, 17, dessen jüngere Tochter
Friedrich II. von Staufen, 43, Römischer Kaiser, König von Sizilien und Jerusalem, Herzog von Schwaben, etc.
Heinrich (VII.) von Staufen, 27, sein erstgeborener ehelicher Sohn, als deutscher König vom Vater 1235 abgesetzt und seitdem in strengem Arrest gehalten
Federico (von Pettorano), 25, des Kaisers ältester unehelicher Sohn
Enzio, 22, sein zweiter unehelicher und Lieblings-Sohn
Ezzelino (III.) da Romano, 43, Graf von Bassano,
Herr von Verona und Padua
Thomas (I.) von Aquino, 53, Graf von Acera, Generalcapitän von Sizilien (! Nicht mit dem Heiligen, seinem Neffen, zu verwechseln !)
Gebhard von Arnstein, 57, Graf von Ruppin, General
Giordano (II.) Filanghieri, 42, Herr von Candia, General
Konrad (II.) von Urslingen, 39 und sein Bruder
Berthold (I.) von Urslingen, 37
gemeinsame Herzöge von Spoleto
Was bisher geschah:
(Kurzer Rückblick auf den 1.Teil der Geschichte der Kinder des Staunens)
Der Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen (1194–1250) wurde schon von Zeitgenossen „Staunen der Welt“ (stupor mundi) genannt – wegen seiner alle Maßstäbe jener Zeit sprengenden, ungeheuerlich „modernen“ Unternehmungen und Projekte, Methoden und Ideen.
Eines seiner zahlreichen außerehelichen Kinder ist Odo, der ihm nicht nur äußerlich sehr ähnlich ist. Dieser macht sich mit einigen wenigen Gefährten auf den Weg, sein Erbe in Besitz zu nehmen: eine kleine, bedeutungslose und heruntergewirtschaftete Graf-schaft im Norden Italiens, am Fuße der Berge: Peio.
Sein Freund Rochus, der alte Waffenmeister Hilde-brandt und dessen Tochter Gina ziehen mit Odo in dieses Abenteuer, und auch der Sarazene Mahmoud, der vom Kanzler des Kaisers den Auftrag hat, über diese Unternehmung und alles Weitere zu berichten. Eine Station des Weges ist das Kloster des Heiligen Ambrosius, wo sich Odo vom Abt den Mönch Bruder Magnus als Schreiber einer gewissenhaften Chronik der zukünftigen Ereignisse ausbittet.
Gleichzeitig flieht der Schusterlehrling Tom aus seiner Heimatstadt, gemeinsam mit seiner großen Liebe Cara, die nur mit knapper Not und böse verletzt aus den Mühlen der Inquisition entkommen ist. Diese beiden treffen unterwegs auf eine Gruppe reisender Juden: Joshe und Avram wurden von ihren Familien ausgeschickt, um eine Zuflucht und neue Bleibe für ihre von aufgehetzten Christen bedrohte jüdische Gemeinde zu finden. Eingeholt wurden diese beiden Boten von den Ausreißerinnen Kehla und Zeta, die vor einem ihnen bestimmten Leben als brave, jüdische Ehefrauen und Mütter davongelaufen sind.
Nachdem Cara und Tom zur Burg Monteleone gebracht wurden, wo eine Tochter des Grafen Riccardo verfolgten Frauen ein Asyl bietet – wird die Gruppe der Juden von Wegelagerern überfallen.
Kehla, von den Räubern losgeschickt um Lösegeld beizubringen, holt Hilfe in Monteleone, wo in-zwischen auch Odo und seine Gefährten eingetroffen sind. Dieser bietet den Juden an, sich in seiner Herrschaft Peio unter seinem Schutz anzusiedeln.
Auf dem letzten Stück ihres gemeinsamen Weges dorthin begegnet ihnen der dicke Graf Eberhard von Terrasecca, dessen Versuch, das lange herrenlose Peio auszuplündern, vereitelt wird – man hat sich einen Feind geschaffen.
Es gelingt Odo, sein Erbe in Besitz zu nehmen und ein erstes Vertrauen seiner wenigen, verstörten Untertanen zu gewinnen. Ein erster Gerichtstag wird abgehalten, und Vorkehrungen für den kommenden Winter sind zu treffen.
Kapitel 1
Frater Carlo
(Abschrift der geheimen Aufzeichnungen des Carlo Andrea Balbi, OFM (ordo fratrum minorum).
Weitgehend verblasste Tinte auf gelblichem Papyrus, Spiegelschrift)
Ad me ipsum. (für mich selbst)
Diese Aufzeichnungen seien einzig und allein zu meinem persönlichen Gebrauch verfasst. Nur als Stütze meiner Erinnerung, und keinesfalls, um als ein Beleg oder Argument zu dienen in irgendwelcher Auseinandersetzung oder Streit oder zur Rechtfertigung von Ereignissen zukünftiger Art gegenüber wem, welcher Person oder Stelle einer weltlichen oder kirchlichen Institution auch immer. Amen.
Im März AD 1236 ließ mich der Bischof von Brixen, Seine Gnaden Heinrich von Taufers, zu sich rufen, welchem ich bis dahin in Person noch nicht begegnet war.
Es seien ihm meine Dienste empfohlen und ausgewählt quasi von dem Archidiakon, seiner rechten Hand (so des Bischofs Worte), von Pater Egno, des Bischofs Bevollmächtigter in allen Dingen (so nun wieder dessen eigene, einigermaßen selbstgefällige Formulierung), welcher auch zugegen war bei meiner Audienz im bischöflichen Palast.
Der Bischof selber mochte sich nicht lange aufhalten mit meiner geringen Person. Gerade dass er noch die Zugehörigkeit zu meinem Orden sowie meine Herkunft wohlwollend zur Kenntnis nahm: „Soso, ein Minderbruder… aus der bekannten Familie der Balbi… aus Genua also.“ Da dürfe er wohl auf meinen Glaubenseifer bauen und meiner Treue zu unserer Mutter Kirche sicher sein.
Und schon war ich von ihm entlassen, seine fahle Greisenhand mit müder Geste zum Kuss mir hinreichend; zu allem Weiteren werde mich Pater Egno instruieren.
Dieser nahm mich im Vorzimmer zur Seite.
Es sei dies, so Frater Egno, keine leichte Aufgabe für mich, sondern eine solche, die Vorsicht und Behutsamkeit, und vor allem besondere Geheimhaltung erfordere. Auch sei überhaupt diese `größte Vorsicht` in meinem eigensten Interesse. Denn, obgleich ich gewisslich unter dem weitreichenden Schutze unserer streitbaren Mutter Kirche mit allen ihren Institutionen stehe und bleiben werde, so sei es doch schon vorgekommen, dass ein entdeckter Spion, ohne eine auffindbare Spur zu hinterlassen, in den abgründigen Schluchten einsamer Alpentäler verschwunden sei, noch dass irgendein Zeuge davon habe berichten können im Nachhinein, früher oder später. Also habe er mir äußerste Vorsicht (so also zum dritten Male) angeraten haben wollen, usw.
Mein eigentlicher Auftrag sei es, die außergewöhnlichen Zustände in der Grafschaft Peio zu erhellen. So unbedeutend diese Herrschaft zwar an sich sei, so alarmierend hingegen die Gerüchte, welche man habe vernehmen müssen.
Nicht allein, dass sich dort einige heidnische Sarazenen mit ihren ganzen Familien angesiedelt hätten, wie es hieß, Mitglieder der Leibgarde dieses derzeitigen, leider wenig christlichen Kaisers, dessen Treue zum Papst und der Kirche unseres Herrn usw. mehr als zweifelhaft bleibe, auch wenn er sich durch geschickte Winkelzüge dem Bann des Heiligen Vaters erfolgreich entzogen habe.
(Pater Egno geriet einige Weile in frommes Geifern, das weiter aufzuzeichnen, ich hier nicht auf mich nehmen mag. Allerdings ließ seine Suada durchaus auf ein leidenschaftliches und wenig duldsames Temperament schließen. Ob sich dieses kriegerische Naturell auf seine künftige Karriere in der Hierarchie unserer allein seligmachenden Organisation hinderlich oder womöglich gar förderlich auswirken mag, lasse ich dahingestellt.)
Außer jenen (gemeint waren immer noch die Sarazenen) seien aber auch mehrere „Sippen schmutziger Juden“ (so Egno) auf ihrer ewig verfluchten Wanderschaft dorthin nach Peio gelangt, und daselbst, so heiße es, mit Sack und Pack, Kind und Kegel ansässig geworden. Dieses auch – horribile dictu – mit der Duldung, wenn nicht gar – was mir nun nach Möglichkeit zu überprüfen obliege – auf Einladung jenes Grafen, welchen dann allerdings als vollends verrückt einzuschätzen nicht mehr zu vermeiden sein dürfte, usw.
Solcher Graf Odo von Peio sei zudem – was die Dinge nun gar nicht besser, sondern gewiss nur skandalöser – und für meinen geheimen Auftrag und Person womöglich hochgefährlich mache – jener Herr Odo sei zudem noch einer der zahlreichen Bastardsöhne des derzeitigen Kaisers Friedrich.
Sollte ich nun aber mit meiner Mission eine Bestätigung all dieser vorläufig gesammelten Berichte erbringen, so werde die von allen besorgt bangenden Seelen herbeigesehnte, reinigende Reaktion einer streitbaren Kirche um einiges wahrscheinlicher – und mein Schade solle das gewiss nicht sein…
Ob ich meinen Auftrag soweit verstanden habe, wollte der mich kritisch und streng musternde Pater abschließend von mir wissen. Es sei wohl offensichtlich, dass er mir diesen nur mündlich habe erteilen können – wie auch ich keinerlei Schriftliches als Nachricht oder Bericht zu verfassen gehalten sei.
Sollte ich mich aber irgendwann oder -wo im Laufe meiner Mission auffällig machen und der Gegenseite zu peinlicher Untersuchung, oder gar Nachforschung Anlass geben, werde er, Pater Egno, unbedingt jegliche Verbindung zu meiner Person abstreiten müssen, notfalls mit allen heiligen Schwüren und Eiden. Diese Unterredung habe es nie gegeben. Und er werde also in einer solchen, hoffentlich niemals eintretenden, bedauerlichen Lage für meine Rettung gar nichts unternehmen können – außer gewisslich in seinen heißen Gebeten an die nothelfenden Heiligen etc.
Er entließ mich mit ernstem Blick und seinem väterlichen Segen, wandte die Augen himmelwärts und eilte sodann davon, zurück zu seinen bedeutenden Aufgaben in die Gemächer des ehrwürdigen Bischofs.
Ich aber mache mich auf den Weg, welchen mir dieser zwiespältige Auftrag weist. Der Herr in all seiner Weisheit und Gnade verzeihe mir meine Bedenken!
Zunächst allerdings werde ich meine Schritte lenken zu einem Kloster meines Ordens, welches dem heiligen Romedio geweiht, zwar nicht ganz in der Richtung auf Peio zu gelegen ist. Doch in seiner versteckten Lage, in einem Seitentale des Gebirges, weit ab von allen häufig begangenen Straßen, besorgt und geborgen durch die Brüder meines Ordens, scheint es mir der einzig geeignete Ort, diese brisanten, geheimen und mir geradezu ja auch verbotenen Aufzeichnungen niederzulegen.
Mögen künftige, vielleicht weisere Zeiten ihr Urteil fällen über die milden Hirtensorgen des Bischofs Heinrich, das engagierte Ansinnen des eifrigen Paters Egno und, ja, auch meine gehorsamen, wenn auch verständlicherweise zögerlichen Schritte in dieser Geschichte.
Kapitel 2
Tom
Der erste Winter auf Peio war verdammt lang. Wir waren das ja nicht gewohnt, in so`ner Menge von Leuten zusammenzuleben, zu arbeiten und zu wohnen. Wie eine riesige Familie kam uns das vor, also mir jedenfalls, nur aber nochmal viel mehr Menschen als auf dem größten Bauernhof. Zwar kleiner als eine ganze Stadt, aber dafür enger beieinander, und alle waren auch mehr aufeinander angewiesen. So dass der eine für den anderen was tun musste, versteht ihr, und zu sorgen hatte auch für die anderen, und alle so zusammen gearbeitet haben.
Aber das, ohne bezahlt zu werden dafür, das nicht, nur dass jeder seines bekam, was er brauchte so, und was für ihn nötig war.
Essen, das vor allem. Wir aßen ja meist alle gemeinsam an der langen Tafel im Saal der Burg. Fast wie ein großes Fest war das da, jeden Tag, mit viel Spaß und Fröhlichkeit und Freude.
Was noch? Naja, einen eigenen Platz zum Schlafen hatte jeder da in der Burg für sich, das war alles eingeteilt, und jedem zugewiesen und in guter Ordnung so. Viel besser als die meisten das jemals zuvor gekannt hatten, ich jedenfalls nicht.
Und ich war bei Cara und sie bei mir – noch lange jedenfalls. Wir hatten eine gute, kleine Kammer mit einem Fenster nach hinten raus zum Wald.
Unten war nebenan gleich die Werkstatt, wo Toni, der Schnitzer, seine Holzarbeiten machte, und wo ich mich auf der anderen Seite des Raumes einrichten konnte. Mit dem was ich so zu schustern hatte, naja… allerlei Ledersachen zu flicken halt, Schuhe und Zaumzeug, Gurte und Riemen, was nötig war und was halt so ging, da kann ich ja doch schon einiges. So konnte ich mich also bald auch nützlich machen für das Großeganze, wie das genannt wurde von Herrn Odo.
Aber das Beste war, dass ich mit Cara zusammen sein konnte, und dass sie hier war und bei mir und in Sicherheit. Und langsam dann auch gesund wurde und wieder zu Kräften kam.
Zuerst, ja, da musste halt ihr Bein nochmal gründlich behandelt werden – operiert, so nannte der Arzt Nazarel das. Sollte heißen, geschnitten und genäht, und unbedingt besser verpackt der Stumpf, das blanke Ende von dem Knochen ganz in Fleisch und Haut, damit das zuheilen konnte.
Das war wieder eine schwer üble Prozedur für die Arme, grausam und schrecklich.
Und für uns alle anderen mal auch, die wir dabei waren und geholfen haben.
Aber es musste ja doch sein. Und sie, Cara selber, sie war die erste, die das so wollte und darauf drängte, dass es auch bald geschah.
Immerhin konnten wir das hoffen, dass Herr Nazoral schon wusste, was er da tat und tun musste. Diese ganze Viecherei lief ab hoch oben auf der obersten Ebene des großen Turmes der Burg, unter freiem Himmel, um gutes, schönes Licht zu haben für seine Arbeit – so sagte der Arzt.
Cara lag da erstmal, in Decken gepackt noch, auf so einem schmalen Holztisch, den wir extra für sie hinaufgeschafft hatten.
Der Arzt gab ihr dann aus einem kleinen, braunen Fläschchen eine ölige, dunkle Sache zu trinken…
„Nu, dass das liebe Kind was schläft besser, womöglich…“, murmelte er dabei.
Ja, und tatsächlich, Cara drehte die Augen hoch und fast nach innen rein, und war gleich schon völlig weg, praktisch mal sofort.
Puh, da war ich aber froh, dass die jetzt nichts mehr sah und merkte davon.
Denn gleich packte der Arzt seine ganzen Werkzeuge aus. Die waren vorher noch mit einem Tuch abgedeckt gewesen und hatten da bereit gelegen: Allerlei Spitzes und scharf metallisch Blitzendes – und eine stabile kleine Säge war auch dabei… da konnte sich einem der Magen drehen, vom Ansehen alleine.
Dann mussten wir die Cara ganz ausziehen, denn die bloßen Glieder lassen sich ja viel besser festhalten, wenn sie denn doch anfängt sich zu wehren und zu strampeln. Außerdem wurde sie auch mit breiten Ledergurten und Schnallen da fest-gemacht an dem Tisch. Hatten wir ja beim ersten Mal, da am Bach damals, gesehen, welche Kräfte aus diesem schmalen Mädchenleib freigesetzt werden konnten, ja.
Und dann aber legte der alte Jude los, da konntet ihr nur staunen!
Mit einem Wahnsinns-Affenzahn ließ er seine Messerchen wirbeln, man fixe rauf und runter und ringsherum ums Bein – das liebe rote Blut floss und spritzte, dass mein bisschen Verstand schon längst nicht mehr mitkam.
Die Zeta saß dabei mit auf dem Tisch, hatte ihre Beine über Caras Leib geschlagen, und hielt ihr das Knie in die Höhe, und so fest sie konnte, dass der Arzt überall leichter hinkam, wo er es wollte.
„Erstmal alles fein sauber machen, erst“, meinte er dabei – und trennte so einiges ab, was auch wirklich nicht gut aussah, da an Caras armem Bein.
Ach Gott war das grausig…
Und schließlich griff der Arzt zu seiner kleinen Säge – ich hatte das ja kommen sehen… und nein, das wurde jetzt wirklich grässlich! Und da sah ich dann auch gar nicht mehr hin.
Dabei wird Cara jetzt doch noch wach, und sie fängt an, den Kopf herumzuwerfen. Den sollte ich zwar festhalten, das war ja meine Aufgabe bei dem Ganzen. Und sie brüllt laut was los, und mit allen Kräften – ja, ich versuche auch, ihr dieses Beißholz zwischen die Zähne zu schieben, wie ich das soll, hatten sie mir gesagt, dass sie sich nichts tut weiter – aber mach das mal! Und damit hab ich jetzt also wirklich genug zu tun, dass ich weiter nichts davon mitkriege, was an ihrem anderen Ende läuft… und das is` mir auch lieber so, und besser, wie gesagt.
Wie dieser jüdische Schlachter da endlich aufhört mit seinem ekligen, endlosen Sägen, ist es auch mit Cara vorbei. Will sagen, sie verliert das Bewusstsein und ist total weg und ganz still.
Ich atme auf. Und kann zuschauen, wie liebevoll und sorgfältig der gute Herr Nazarael mit Nadel und Faden das Fleisch und die Haut über den frischen Knochenstumpf herlegt und mit tausend Stichen und Knoten verhäkelt und zurecht zupft und alles abdeckt, dass man wirklich am Ende glauben könnte, das wird wohl was werden so.
Schließlich noch ein dicker Verband und Cara wird losgebunden. Und ich wickle sie warm in die Decken ein. Und alle gehen dann weg und brauchen was zur Erholung. Aber wir lassen Cara noch da, oben an der frischen Luft auf dem Turm, das soll ihr jetzt gut tun, meint der Arzt.
Das ist bei denen nicht so wie sonst bei uns, wo alle Kranken immer luftdicht eingepackt werden und versteckt sozusagen, und sie im stickigen Krankenzimmer bleiben müssen, vor lauter Angst, dass was Böses reinkommt und so was passiert. Ich kann bei meiner Cara bleiben und bei ihr warten, und hab sie wieder ganz für mich allein.
Später dann helfen mir die Jungs aus dem Dorf, das sind Luca und Zacco, sie wieder runter und zu unserem Zimmer zu tragen. Das ist ja wirklich nett von denen, und sie sind ganz vorsichtig dabei. Aber ich passe auch schwer auf, wie und wo sie mein Mädchen so anfassen. Schließlich weiß ich ja Bescheid, was so läuft manchmal – ich meine, ihr wisst schon – zwischen Jungs und Mädels so, und wann und wo sowas spannend wird – na, also, wo mal anzulangen das schon aufregend sein kann, wenn man so mal näher rankommt ans andere…
Aber eigentlich, das wusste ich auch inzwischen, sind sie beide mehr auf die kleine Laia scharf, das ist die Schwester von dem Toni, dem gelähmten Holzschnitzer aus dem Dorf. Kann ich verstehen, die ist ja auch schon ganz niedlich und munter – aber auch so ein kleines Mädchen noch eben. So dünn und platt und eckig nur… da soll noch mal was draus werden erst aus der – gar kein Vergleich mit meiner großartigen Cara.
Wenn sie mir nur wieder richtig gesund wird!
Und wie meist, kam das dann ganz anders als gedacht.
Cara ist schon in wenigen Wochen wieder ganz gut bei Kräften. Soweit jedenfalls, dass sie aufstehen kann und, mit hart zusammengebissenen Zähnen zwar, aber mit neuer Energie ihre Krücken schwingt.
Der Stumpf am verkürzten linken Bein wird wohl noch lange sehr empfindlich bleiben. Und so muss der, nach hinten abgewinkelt, besser hoch gebunden werden, damit er nicht so leicht wieder irgendwo anstößt. Und logisch, sie will so schnell wie möglich mit allen anderen in die Übungen einsteigen, in die Ausbildung zu der neuen Miliz. Auch wenn sie nie wieder laufen wird wie ein ganzer Mensch.
Aber reiten muss sie deshalb auch schnellstens lernen, meint sie. Dass sie dann, als Botenreiterin oder sowas, dabei sein und sich nützlich machen kann. Auch wenn das gefährlich wird vielleicht. Dabei ist sie völlig Feuer und Flamme, wie man so sagt, und sie liegt den Fräuleins, Bianca und Gina, ständig in den Ohren. Weil die jetzt das Kommando haben dabei, also für die Reiterei und das Training dafür, meine ich.
Übrigens aber, meine Sache wird das niemals werden, mit den Pferden, das ist ja wohl geklärt. Schrecklich hoch sind die, und an allen Seiten abgeschrägt, diese Viecher, und wollen einfach nie ruhig stehen bleiben und stille halten, na!
Nur Cara sieht das eben völlig anders, naja, muss sie wissen.
Aber auch dafür ist es noch sehr früh, ihr Bein schmerzt tüchtig bei den ersten Versuchen auf dem Pferderücken, das ist kein Pappenstiel. Und nicht auszudenken, wenn sie davon runterfliegt und am Ende genau auf den gerade erst verheilenden Stumpf!
Also wollte ich dringend versuchen, ihr lieber was anderes zu verschaffen, für ihren wilden Eifer. Ich rede mit Toni dem Schnitzer über meine Vorstellungen und Pläne. Wir teilen uns ja jetzt eine Werkstatt im Hof der Burg. Und wir tüfteln da was aus. Weil, das mühselige Rumgehumpel mit einer Krücke hat ja gar keine Zukunft für eine so voller Tatendrang wie meine Cara.
Die Idee war, ihr verkürztes Bein mit einer neuen Verlängerung zu versehen. Damit das dadurch wieder dieselbe, ursprüngliche Länge hat wie das andere, und dass sie dann wieder so ziemlich gerade stehen kann. Vielleicht auch wieder besser geradeaus laufen damit.
Toni macht also ein gerades Stützstück aus Holz, stabil genug, aber so leicht wie möglich. Erstmal etwas länger noch, als es wahrscheinlich nötig ist. Kann man dann immer noch was kürzen später, wie`s genau muss, kein Problem.
Und ich schustere dazu aus einem dicken Leder einen Trichter oder Kragen, der mit Schnallen zu verstellen geht. Und den ich mit guten Doppelnähten um einen rings laufenden Wulst an dem Stützholz von Toni befestige. Da in den Trichter soll das Ende von dem verkürzten Bein dann rein, also der Stumpf, wo der Fuß nun fehlt. Ja.
Das ist schwieriger als ich dachte, denn es kommt sehr darauf an, dass das genau passen muss, und nicht drückt. Schon gar nicht da, wo das so gemein empfindlich ist noch.
Nun, also eigentlich sollte dieses Ding, das Ergänzungsstück, eine Überraschung für Cara werden. Hatte ich mir so vorgestellt, dass ich damit also plötzlich bei ihr aufkreuze und mächtig Punkte mache – nur, so wird`s eben nicht klappen. Geht nicht anders, als dass sie es anprobieren muss, ob das nun so passt, und uns dann sagt, ob`s so gehen kann, wie ich mir das denke, oder eben, wieviel da noch ab von muss, von der Länge von dem Holz etwa, oder aber von der Weite von dem Kragen – oder was weiß ich sonst noch.
So haben wir das dann auch versucht mit ihr. War aber nix zu wollen, weil das Ende, also da, wo ihr Bein jetzt aufhört, da war das noch immer erst am Heilen, und noch längst nicht richtig so gut und fest wieder – hab ich ja schon gesagt. Und deshalb ging das noch gar nicht mit meiner Ledermanschette da drum als Halt, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte.
Haben wir also gemeinsam weiter überlegt, Cara und ich und der Toni. Und noch viel ausprobiert mit verschiedenen Holzteilen und Lederstreifen zum Festmachen. Jedenfalls ist dann rausgekommen, dass sie sich ganz gut und besser abstützen kann mit ihrem Knie. Also, wenn sie das Bein ganz zusammenklappt, und den wunden Stumpf hinten nur hochhält und so ganz schützt. Und das Knie, das ja fest und normal ist und in Ordnung, sich mit dem dann also auf so eine kleine gepolsterte Platte stützt, die das obere Ende von dem Ersatzbein bildet und am Knie festgebunden wird. Versteht ihr – wie ein einbeiniger Schemel vielleicht, so könnt ihr euch das vorstellen.
Na siehste, so wurde das jetzt also was: Dieser Lederkragen, oder wie man das nennen soll, der musste also weiter sein, dass das ganze zusammengeklappte Knie reinpasste. Und der Kragen musste auch weiter hoch reichen am Oberschenkel, dass er gut hält. Und ein Riemen mit einem zweiten Polster hinten kam auch noch dran, der den verkürzten Unterschenkel gleich mit hochhält, dann wird das für Cara nicht so anstrengend.
Gut. So hatten wir das auch bald fertig soweit, nach vielem Rumprobieren und Verbessern.
Also, naja, es war schon längst spätes Frühjahr inzwischen, bis wir damit soweit waren.
Und so ist Cara damit los und mit Feuereifer gleich stundenlang damit rumgeturnt. War auch nicht so einfach für sie, das Gleichgewicht zu halten am Anfang. Aber bald lief es gut und besser, und sie konnte gar kein Ende finden.
Am ersten Abend war sie fix und fertig, und ganz blass um die Nase und völlig erschöpft. Und das neue Holzbein war schon gesplittert und gesprungen, dass Toni gleich ein neues machen musste. Er wusste ja jetzt, wie das sein sollte und welche Länge.
Aber wie er da so am Schnitzen war, sagte er, er hat da eine Idee. Und so nahm das Verhängnis seinen Lauf.
Er ging also – also das ist natürlich Quatsch: Gehen kann man da nicht zu sagen, kann er ja nicht mehr, der Toni – nur mit diesem komischen Rollwägelchen, das er sich gemacht hatte, ließ er sich rüber schieben von Laia, die wo seine Schwester ist. Er fuhr also mit dem neuen Holzbein nämlich, als er das schon fast wieder fertig hatte, über den Hof zu der neuen Schmiede, die vor paar Wochen da eingerichtet worden war.
Unser Herr Odo hatte, wie schon am Anfang vom ersten Winter, den Zimmermann Hans und seine beiden Söhne in Dienst gestellt, dann auch bald einen Schmied. Der sollte allerlei Gerät und Werkzeug anfertigen, und Waffen auch vor allem, was halt so fehlte und nötig war. Und der hatte dazu auf der anderen Seite vom Burghof, gegenüber von uns, wie gesagt, der hatte da in einem der leerstehenden Nebengebäude seine Schmiede eingerichtet.
Dieser Schmied ist ein dicker Kerl, Jan geheißen, mit schwarzen Locken und reichlich Bart. Überhaupt, wie er es gerne sehen lässt, wenn er so am heißen Feuer nur mit kurzen Hosen und einem spack sitzenden Lederschurz bekleidet, vor sich hin werkelt und den Hammer schwingt – der ist an allen Gliedern mit einem dichten, schwarzen Haarpelz voll bewachsen, wie ein Tier, wie ein schwarzer Bär, garstig und rauh, und immer etwas unheimlich, bei aller scheinbaren Freundlichkeit. Aber er ist auch immer zu allerlei sonderbaren Späßen aufgelegt und führt so komische Reden, dass du nicht weißt, sollst du jetzt echt drüber nachdenken oder bloß lachen besser.
Mit dem also beriet sich der Toni wegen Caras Holzbein. Und sie kam auch bald selber dazu und steckte in der Schmiede den ganzen Tag mit diesem Jan, diesem halbnackten Klotz, die Köpfe zusammen.
Am Ende hat ihr Stelzfuß dann also eine kantige, eiserne Spitze bekommen. Das machte das Ding zwar um einiges schwerer als zuvor, vor allem aber für jeden Einsatz hart und widerstandsfähig genug.
Damit ging Cara nun jeden Tag von früh bis spät über Stock und Stein. Solange wie es ihre jetzt endlich wieder wachsenden Kräfte zuließen – und oft noch um manches darüber raus. Mit heißem Eifer arbeitete sie daran, genauso schnell und wendig unterwegs sein zu können, wie wir anderen, mit unseren zwei original gesunden Füßen.
Ja, sie wurde langsam stärker und ausdauernder, da konntest du zusehen. Und sie bekam auch wieder Muskeln auf die Knochen – was ihre liebliche Gestalt in meinen sehnsüchtigen Augen noch reizender werden ließ, naja.
Ich freute mich ja für sie, na klar. Endlich ging das vorwärts mit ihr und hatte ihr großer, starker Wille wieder ein echtes Ziel. Und manchmal konnte sie, trotz aller Erschöpfung, schon wieder ihr altes, strahlendes Lächeln zeigen.
Auch kein Wunder, dass sie so alle Blicke auf sich zog. Aber am liebsten hätte ich sie doch vor allen anderen versteckt und wieder ganz alleine für mich behalten. Wahrscheinlich ahnte ich schon was, oder?
Nun, wir hatten unser gemeinsames Zuhause, unser Zimmerchen oben in der Burg. Wo wir zusammen in einem Bett schliefen meist, ganz brav, so wie Bruder und Schwester. Nur wenn Cara gar keine Ruhe finden konnte, oder ihr Bein wieder arg schmerzte, schob sie mich weg von sich und wollte alleine liegen. Dann legte ich mich mit einer Decke auf den Boden vors Bett und musste da auch zufrieden sein.
Tagsüber blieb ich ebenfalls in ihrer Nähe, so weit ich konnte und wie es bei meiner Arbeit passte. Schließlich hatte ich allerhand Aufgaben zu erledigen, in der Werkstatt meistens, oder auch anderswo schon mal, wenn ich irgendwo bei Sachen mit anpacken sollte.
Mir war auch dieser ganze militärische Ausbildungskram nicht so wichtig, wie Cara und den meisten anderen hier. All diese Waffenübungen und so, nur mühsam alles und endlose Wiederholungen, und wozu überhaupt. Als wenn aus uns und den Dorfleutchen, Kindern und Alten, irgendwie plötzlich eine schlagkräftige Soldatentruppe werden würde. Das wollte mir lange nicht in den Kopf, nee. Nur später aber, haben wir ja gesehen, was wir dann doch plötzlich bringen mussten, als es weiß Gott darauf ankam, nicht wahr?
Aber am Anfang? Nee, aus einem Ochsen machst du kein Reitpferd für `ne Dame – oder ein feuriges Schlachtross für den Kampf, hätt ich jetzt besser sagen sollen. Und aus Gänsehirten und Handwerksburschen und anderen krummen Duckmäusern mehr – und Mädchen auch noch! – da machst du kein standhaftes Fähnlein von Soldaten draus, was nicht beim ersten Trommelwirbel des anrückenden Feindes die Hosen voll hat bis zum Bund hinauf.
Hätte ich nie geglaubt. Und wer was vom Soldatenberuf versteht, erst recht nicht. Der alte Hildebrand zum Beispiel. Als ich ihn später mal gefragt habe, sagt er mir, heulen hätte er können vor Verzweiflung über seine Milizschüler, wäre es nicht auch so komisch gewesen, unseren ersten kriegerischen Bemühungen zuzusehen. Siehst du, eben.
Doch unser Herr Odo ließ ernsthaft nicht locker und hielt uns bei der Stange, wie man so sagt. Und seine Leute ließen auch nicht nach, uns weiter und weiter zu triezen und anzuleiten und voranzutreiben – aber auch allen ein Vorbild zu sein.
Und klar, wenn du so von Fräulein Bianca das Bogenschießen gezeigt kriegst – na, vor der hatten wir alle, auch die schlimmsten Rabauken sonst, da hatten wir alle einen seltsam scheuen Respekt vor der, irgendwie. Also, wenn die dir ganz leise, und stur und ernsthaft, und immer wieder von vorne notfalls, nur das zeigt woraufs ankommt, und dich zum Nachmachen zwingt, solange, bis du selber merkst, dass du doch mal Fortschritte machst, ja da wunderst du dich.
Oder, wenn du eben auch der roten, der Zeta, zusehen kannst, und aus der Nähe möglichst, wie sie loslegt mit all ihren Sachen, und dabei in feurige Hitze gerät und so? Also, da kannst du gar nicht anders, als auch Feuer fangen, in kürzester Zeit, und alles versuchen, was sie von dir will. Erst mal nur, um es ihr recht zu machen, und um ein Lob oder ein Lächeln von ihr zu ernten, ja gut. Also besonders diese, die hatte uns alle nämlich spielend im Griff.
Nun, wie gesagt, so fing das damals im ersten Jahr an mit unserer Truppe, der neuen, allgemeinen Miliz von Peio. Und bald konnte man nach und nach sehen, wofür einer oder eine von uns so seine besonderen Talente hatte, auf dem breiten Felde der militärischen Tätigkeiten und mörderischen Auf-gaben, sagen wir mal.
Die Mädchen zum Beispiel, die Kehla und die kleine Laia aus dem Dorf unten, und meine Cara natürlich auch, die waren alle begeisterte Reiter und wurden bald auch ziemlich gut dabei, und waren ganz fix unterwegs mit diesen Biestern, die mir andererseits noch lange reichlich unheimlich blieben. Aber lernen mussten wir das alle, damit umzugehen. Soweit wenigstens, dass wir mit denen klar kamen für`s Nötigste, also etwa einen Pferdewagen zu lenken einigermaßen.
Einen Basis-Standard nannte der Waffen-meister Hildebrand das. Er wollte halt, dass wir alle darin eine Grundlage bekamen. Und das auch eben in anderen Sachen, bei allen möglichen Waffen zum Beispiel. Da mussten wir schön lernen, wie man sie hält und benutzt im Prinzip, um einen Kerl trefflich und fachmännisch damit umzulegen. Mit einem herzhaften Stoß in Richtung Eingeweide zum Exempel. Auch mit dem Langschwert eines Ritters sollten wir das ruhig versuchen wenigstens, was aber doch für uns alle viel zu schwer war. Sowas eben.
Aber wir alle wurden außerdem noch mit der kurzen Lanze gedrillt. Das war lange Zeit vor allem anderen das Wichtigste. Neben dem allgemeinen stärker und fitter werden, mit Laufen und Klettern, und im Sommer dann auch schwimmen – aber davon erzähle ich später noch was.
Cara jedenfalls wurde bald schon immer besser auf dem Pferderücken.
Ich hatte für sie den einen Steigbügel soweit verändert, oder vielmehr umgebaut, dass sie sich mit ihrer eisernen Stelze gut drin abstützen konnte. Aber nun stand dies Teil ziemlich weit seitlich ab von so einem runden Pferdebauch. Das war nicht so wirklich praktisch, besonders wenn es über enge Pfade durch Wald und Gebüsch ging. Und sie konnte sich mit dem halben Bein auf dieser Seite auch nicht so gut festhalten, gerade wenn`s um die Ecke ging mit dem Pferd. So sagte sie jedenfalls.
Verstand ich erstmal gar nicht. Aber, so wurde mir dann erklärt, es braucht der Reiter seine Unterschenkel, um sich am Pferdebauch seitlich festzuklammern, irgendwie. Sogar können manche ihr ganzes Ross nur mit den Füßen lenken: Nach links, nach rechts, wo`s eben langgehen soll. Praktisch, nicht?
Aber ziemlich unglaublich für mich, der froh war, wenn er es schaffen konnte, oben sitzen zu bleiben, überhaupt. Oder, dass er dann am Ende geordnet wieder runter kam, ohne schmerzhafte Überraschungen und Abkürzungen.
Nun ja, da sollte uns vielleicht noch was zu einfallen. Haben wir also, Toni und ich, erst versucht, so eine Art Gelenk zu bauen, dass Caras unteres Ende nicht so weit abstand seitlich. Aber das ging nicht wirklich gut damit, und zum Festklammern taugte das auch noch wenig.
Ziemlich blöd habe ich wohl geguckt, als dann auf einmal der dicke Jan, dieser Schleimer, der Schmied halt, da mit so einem schmalen, gebogenen Eisen ankam.
Cara machte ganz große Augen, und dann kam ihr herzerweichendes großes Lächeln zutage, und sie sprang dem fetten Kerl geradezu um den kohleschwarzen, speckigen Hals.
Blöd wie ich war, redete ich mir ein, das habe weiter nichts zu bedeuten.
Und das sollte also nun die Lösung sein?
Wir haben dann dieses Eisen also an Caras Stelzfuß befestigt, mit einem anderen speziell gefertigten Holzteil von Toni, und den entsprechenden Ledergurten und Schnüren von mir.
Ja, damit ging es wohl besser zu reiten, meinte Cara. Aber wenn sie abstieg, hatte sie diesen ganzen, ziemlich schweren und sperrigen Apparat am Bein mitzuschleppen überallhin. Das war einfach blöd und kein Fortschritt so, im Ganzen gesehen.
Es war dann doch meine Idee, nicht wahr, dieses federnde Teil nicht an Caras Fußersatzpfosten selber festzumachen, sondern an dem Riemen des Steigbügels – und so am Pferd, vielmehr am Sattel halt und nicht an der Reiterin, versteht ihr?
So ging es dann auch besser, bald hatten wir`s raus – und Cara war glücklich. Was wollte ich mehr!
Doch, wollte ich schon, wenn ich ehrlich war. Könnt ihr euch auch denken, oder?
Kapitel 3
Odo
Wieder beginnt mir ein schwerer Tag, beengt und voller Vorahnungen.
Oder, wenn ich besseres Glück habe, nur ein schwerer Morgen.
Gina fehlt mir, ich muss es mir eingestehen. So sehr ich enttäuscht bin, und verletzt von ihrer Treulosigkeit – und irritiert, verwundert von meiner eigenen auch, zur selben Zeit.
Seit der Entdeckung hält sie sich fern von mir. Da war nichts mehr zu heilen zwischen uns, alles mit einem mal zu Ende. Ich glaube jetzt fast, sie will weg von hier, irgendwo anders hin, weil sie es auch nicht mehr aushält, wie es steht mit uns.
Aber sie fehlt mir, das ist wahr. Wo sich längst Aufruhr und Zorn gelegt haben, bleibt die Traurigkeit. Und an manchen Tagen besonders, wie heute.
Vielleicht hilft das Aufschreiben wieder, wie ich es so manches Mal erlebt habe. Doch ich will auch hier nicht schwatzen.
Es passiert vieles jetzt, und das ist gut und wichtig, damit es vorangeht, ja.
Inzwischen ist es unser dritter Winter nun schon, hier in Peio.
Draußen liegt Schnee, er ist noch einmal zurückgekommen, als wir schon auf den Frühling zu hoffen begannen. Das Feuer im großen Kamin der Halle muss weiter fortwährend brennen. Wer dort vorbeikommt, auf den Wegen seines Tagewerkes, bleibt gern für eine Weile, sich aufzuwärmen, die Scheite enger zusammenzuschieben oder einen neuen aufzulegen. Man trifft sich da und redet ein paar Worte miteinander, ohne förmliche Begrüßung oder einen Abschied, wenn man dann wieder auseinander geht.
Jetzt sitze ich hier abseits, im Licht eines Fenstererkers, aber ich könnte jederzeit hinüber gehen zum Feuer, ohne die Gruppe oder den Kreis der dort Versammelten aufzuscheuchen, oder sie auch nur zu stören. Das freut mich sehr, sodass ich es mir schon angewöhnt habe, mehrmals am Tage dort für ein paar Augenblicke vorbeizuschauen. Ich bin dann einfach nur einer unter anderen, nicht der hochmögende Herr von Land und Burg. Mir gefällt das so, und es tut mir gut. Und auch die vielen neuen Leute gewöhnen sich dadurch besser an mich. Mir näher zu kommen, mich anzusprechen mit ihren Fragen, Sorgen und Gedanken, oder mir auch kurzweg und freimütig eine Antwort zu geben, wenn ich mich an sie wende.
Wer schon länger hier ist, weiß das. Es hat ja tatsächlich nun schon unser viertes Jahr auf Peio begonnen, manchmal muss ich mir das selber klarmachen. Alle später angekommenen Menschen haben es erkennen und lernen dürfen, wie wir hier miteinander umgehen und leben. War aber nicht immer einfach.
Naja, jeder tut seines dazu. Wir haben alle voneinander gelernt und sind noch jeden Tag dabei. Aber es haben sich eben einige Gewohnheiten eingebürgert, die uns dabei helfen. Damals in unserem ersten gemeinsamen Winter, in Notdurft und Gefahr, haben wir alle eng zusammen auf der Burg gelebt und gearbeitet. Oft sogar gemeinsam entschieden, was und welcher Schritt als nächster zu tun wäre.
Nicht zuletzt auch die gemeinsam bestandenen Gefahren, die bösartigen Angriffe von außen, haben meine Leute gegenseitiges Vertrauen und einen Stolz gelehrt auf die vereinten Kräfte. Ja, ich glaube schon.
Jetzt aber liegen Gerüchte von drohenden Kriegsgefahren in der Luft: Verschwörung und Aufruhr in der Lombardei. Die reichen Stadt-republiken, mit Mailand an der Spitze, haben einen Bund geschlossen und lehnen sich wieder auf gegen die kaiserliche Macht, wie schon vor siebzig Jahren zu Barbarossas Zeiten.
Das wird er nicht dulden, mein Vater – drüben in seinen deutschen Landen werden schon Ritter zusammengerufen, so wurde erzählt, und auch unten in Sizilien werden Soldaten ausgerüstet. Wer mag wissen, ob wir uns hier in Peio von solch verderblichen Gefahren werden fernhalten können.
Kapitel 4
Kehla
Nun gut. Wo wir hier nun alle auf dieser Rumpelkiste von Wagen zusammenhocken, und das wahrscheinlich noch für einige Tage, habe ich reichlich Zeit, den Mädchen von den alten Zeiten zu erzählen – die doch wirklich noch gar nicht so alt sind…
Ich musste es ihnen versprechen, sie geben ja keine Ruhe sonst:
„Na gut. Ich soll euch also erzählen, was damals, was am Anfang hier auf und um Peio geschehen ist. Klar, ihr seid noch nicht so lange dabei und wundert euch. Erst langsam kapiert ihr, dass hier bei uns ziemlich alles anders läuft als ihr´s kennt und es gewöhnlich sonstwo so ist.
Der erste Winter damals, vor jetzt drei Jahren, war lang, bei uns oben in den Bergen von Peio. Besonders mein Bruder Joshe wurde allmählich unruhig. Gut, dass es so vieles zu tun gab, was ihn tagsüber beschäftigt hielt. Noch besser wäre es vielleicht, er würde endlich eine Frau finden, dachte ich, oder? Aber da war noch nichts im Busch, was man so beobachtete.
Und ist es jetzt immer noch nicht. Obwohl die Schar der möglichen Kandidatinnen von Jahr zu Jahr größer wurde seitdem, denn es haben sich immer mehr Menschen hier bei uns angesiedelt. Bald waren noch einige jüdische Familien dazugekommen, nachdem es sich herumgesprochen hatte, dass Herr Odo es wirklich ernst meinte mit seinem Angebot, den Leuten unseres Glaubens eine sichere Zuflucht zu bieten. Und noch die Freiheit obendrein, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen – ohne sich nach all den willkürlichen Beschränkungen und den erniedrigenden Zwängen richten zu müssen, mit denen unser Volk von den Vorurteilen und Ängsten der Christenmenschen sonst überall geplagt wird. Aber der Reihe nach, ich will nicht vorgreifen.
So eine Burg ist wie ein riesiger Haushalt. Wenn`s klappt, wirkt alles irgendwie geordnet zusammen – nun, sollte es jedenfalls – und alles hat seinen Sinn und Zweck, wie im kleinen Kreis einer Familie. Aber das Große und Ganze, was da so alles abläuft zur gleichen Zeit, ist in jedem Augenblick doch völlig unübersichtlich und bietet den Anblick eines Hühnerhofs in chaotischer Aufregung. Dabei läuft tatsächlich das meiste doch einigermaßen nach Plan.
Abends nach dem Essen saßen die Häupter meist zusammen und beratschlagten, was geschafft war und was noch musste als nächstes. Herr Odo steckte immer voller Ideen. Manchmal ging es schlicht um was Praktisches, wie einen neuen Ofen für das Brotbacken vielleicht. Doch dann gab er dem Planen eine Drehung ins Neue, hattest du nie was von gehört! Wie, dass dieser Ofen dann erst für was Anderes gebraucht werden sollte, fürs Ziegelbrennen sagte er zum Beispiel, und später, wenn er schon abkühlt, also der Ofen natürlich, dann noch für das Brot, weil dafür dürfte es auch noch allemal reichen. So spart man dann Holz, meinte er. Klar, wenn`s klappt, wär das prima.
Dabei hatten wir das nun echt reichlich ringsum, also Bäume und Wald. Aber zu Brennholz wird das erst durch viel Schweiß und Arbeit. Fällen, sägen, spalten und rumschleppen – stimmte ja. Das ist die typische Arbeit in jedem Winter, nach wie vor. Soll heißen, wenn sonst nix mehr geht draußen wegen Frost und Schnee, dann können die Männer immer noch raus zum Holz machen, soviel sie wollen. Das geht immer noch, bis es dunkel wird, oder sie eben nicht mehr können. Ja also, das mit dem Ofen war nur so ein Beispiel für seine neuartigen Ideen.
Aber er wollte auch, dass alle Kinder was lernen, das ist ihm sehr wichtig, und richtig zur Schule gehen. Lesen und Schreiben, und bisschen wenigstens was auch Rechnen lernen – wie bei uns Juden ja schon immer die Kinder was lernen müssen.
Wie gesagt, viel Zeit hatte man in der Winterzeit, und außer Rumsitzen war sonst wenig zu tun. Haben wir uns also drangemacht und versucht, den Dorfkindern was beizubringen. Die sind ja auch nicht nur blöd von Natur aus. Und sie hatten gleich Spaß dran, war was Neues eben.
Gina und Fräulein Bianca und ich haben uns abgewechselt, auch Joshe manchmal. Und der Bruder Mönch hat auch noch einiges Lateinische dazugetan – da hatten die Kinder aber weniger Lust zu. Der war ihnen halt zu streng und kam auch gleich mit `nem Stock an und hat damit im Takt auf den Tisch gekloppt zu seinem ewigen sum, es, est, sumus, estis… – und so weiter. Nein, das kam nicht so gut an. Sonderbare Methoden haben die Klosterbrüder da so. Ist kein Wunder, dass danach so viele Duckmäuser rumschleichen bei denen.
Nur Zeta hat anfangs noch nicht viel mitgemacht bei unserer Winterschule. Sie war oft draußen unterwegs, wann immer es ging. Alleine, und auch mit Herrn Odo, oder dem Mahmoud. Sie wollten die Umgebung auskundschaften, hieß es, keine Ahnung, sie hat ja ihren eigenen Kopf immer. Und bald später hat sie damals, im ersten Jahr hier, gemeinsam mit dem Sarazenen ja auch angefangen, die größeren Jungs und auch die Mädels im Kämpfen zu üben, tatsächlich.
Da waren sie dann mit allem Eifer im Hof oder im Burggraben zugange: Bogenschießen und Messer werfen. Und mit langen Knüppeln, die kurze Lanzen darstellen sollten, wurden Griffe und Bewegungen und Schritte trainiert, und bald so auf Strohsäcke eingedroschen, dass die Halme tanzten und Wolken von Strohstaub zum Himmel stiegen. Später mussten alle aber auch noch gegeneinander antreten, mit diesen derben Stöckern, dass es manche schöne blaue Flecke gab und einiges Geschrei. Mit der Zeit hatte Zeta uns alle soweit, es wenigstens mal zu versuchen, um zu sehen, „wo denn die jeweiligen Talente verborgen liegen“, wie es der Waffenmeister Hildebrand nannte.
Ich habe denn auch regelmäßig mitgemacht. Das war sowieso allemal besser, als immer nur rumhängen und ins Kaminfeuer glotzen und Fett ansetzen. Schließlich war und ist es auch entscheidend, sich wehren zu können. Jeder einzelne für sich schon, im Falle eines Falles, und wir alle zusammen erst recht. Auch um dieses neue Zuhause dort zu verteidigen, unser Peio, und damit die versprochene, zukünftige Zuflucht meines Volkes.
Hat sich dann ja schon bald gezeigt, wie nötig das war.
Aber wie und wann das kommen sollte und könnte, das war am Anfang doch noch vollkommen ungeklärt. Klar hätten wir, mein Bruder Joshe und ich, uns bald schon wieder auf den Weg machen können, zurück zu unserer alten Wohnstätte und unseren Familien, um die zu bereden, sich auf den Weg hierher zu machen. Alles weitere hätte sich finden müssen, so dachte ich damals und war voller Zuversicht. Wir würden uns schon durchschlagen dann hierher irgendwie.
Und vielleicht wäre Zeta auch mitgekommen, hoffte ich. Sie sagte zwar erst, sie wolle da auf keinen Fall weg, wo gerade alles anfing und sie mittendrin war und so dringend gebraucht wurde eben. Aber es musste uns doch zuerst um unsere Leute und Verwandte gehen. Und ich hätte mich mit ihr an der Seite auf alle Fälle ein Stück wohler gefühlt, und auch sicherer inzwischen.
Aber was für eine Reise ins Ungewisse wäre das gewesen, trotzdem noch. Auch der ganze Weg dann von dort wieder zurück, mit Mann und Maus, Kleinkindern und Großmüttern, beladen mit allen zusammengepackten Kostbarkeiten. Der ganze Zug jener verfolgten Kinder Israels über Tage und Wochen mitten querdurch zwischen scheeläugiger, feindseliger Landbevölkerung, aufgehetzt von heißen Predigten gegen Ketzer und Heidenvolk. Und durchs Gebirge, wo hinter jedem Felsen Räuberbanden und raffgierige Strauchritter lauern könnten, die gerade auf solche hilflose, fette Beute wie uns warteten – das hatten wir doch alles eben grade gehabt! Da hätte auch Zeta mit ihren paar Messern im Ärmel allein keinen wirklichen Schutz bieten können.
Es wäre ein riskanter Versuch geworden, sich aus diesen Gefahren zu einer Rettung durch-zuschlagen. Und nur dann auch, konnte ich mir vorstellen, vielleicht nur in letzter Verzweiflung und Angst würden sich meine Leute entschließen können, solch eine gefährliche Reise zu wagen.
Aber Herr Odo hatte anderes vor.
Wir hatten schon darüber gesprochen, seine Vorstellungen und Pläne für uns und alle seine Untertanen waren so viel umfassender und umwälzend neuer, als du dir vorstellen konntest. Er brachte einen echt zum Staunen – es klang in meinen Ohren wie ein Traum. Zum Beispiel wollte er unsere Leute hier auf Peio nicht nur notdürftig irgendwo unterbringen für ein paar Wochen, solange sie in Gefahr wären, und dann wieder ab und adio mit uns. Nein, er wollte eigene Häuser für die Juden bauen, mittendrin in seinem Dorf, das damals ja auch noch erst repariert und wieder aufgebaut werden musste größtenteils. Und diese Unterkünfte sollten auch nicht zusammengepfercht und von allen Seiten aufs Engste bedrängt sein, wie in unserer elenden Judengasse da, so, wie es eben fast überall sonst in den Städten uns aufgezwungen wurde, und immer noch wird – sondern einfach frei und mitten zwischen seinen Bauern. Und noch jede Wohnung mit einem Stück Land für einen Garten darum zu! Da wurde dann auch Zeta ganz hellhörig, denn das ist ja wieder ihr Ding überhaupt, Gärten anlegen und Grünzeug und Gemüse ranziehen und so weiter.
Herr Odo wollte uns außerdem nicht mehr einschränken auf wenige, schlecht angesehene Berufe und Gewerbe, und uns alles andere verbieten, wie überall sonstwo. Sondern es sollte uns im Prinzip alles möglich werden: Zu arbeiten und zu unter-nehmen, was ein jeder am besten kann und will, oder halt noch lernen möchte und müsste. Das klang also wirklich geradezu paradiesisch, zu schön um wahr zu werden.
Aber es bedurfte natürlich einiger Vorbereitungen, das brauchte Zeit und viele Leute, die dazu anpackten. Wo es damals doch an allen Ecken fehlte in Peio und überall erst das Nötigste noch geschafft werden musste. War ja offensichtlich, verstand man ja, mussten wir halt noch warten besser und nicht gleich losrennen wie die Gänse, wenn einer das Gatter offen gelassen hat.
Herr Odo wollte sogar, wenn in Peio erstmal alles so lief und auf dem Wege wäre und die Lage gesichert, dann wollte er selber mit uns zu unseren Familien reiten, wenn das ginge. Und dann mit den Häuptern unserer Gemeinde reden, was er ihnen hier auf seinem Land anzubieten hatte, für eine gesicherte Zukunft auf Dauer gar, als gleiche berechtigte Mitbürger. Ja, so hat er das genannt, allen Ernstes. Und guckte dabei so prüfend vor sich hin, als ob er in sich hineinhorchen müsste, was ihm die innere Stimme so vorsagte. Ein sonderbarer Mensch ist das schon wirklich. Aber er meint es völlig ernst – und im nächsten Augenblick strahlt er einen so an, dass man ihm einfach alles glauben muss und ihn nur abknutschen möchte dafür.
Ja, und so langsam kannte man ihn ja auch schon was besser. Mal sprühte er voll solcher Ideen, dass man nicht mitkommen konnte beim besten Willen, mit seiner Begeisterung, und er hatte neue Pläne schon wieder für alles Mögliche – da hattest du nie drüber nachgedacht bisher. Viel, viel mehr als jemals zu schaffen wäre, genug für Jahre und wenn wir fünfmal soviele Leute gewesen wären zum Anpacken. Keiner konnte ihn da bremsen und mit den Füßen auf die Erde stellen wieder…
Außer Fräulein Artemisia manchmal, auf die hörte er schon, meistens.
Aber oft wollte man das auch gar nicht. Es war so ein schöner Rausch, ihm zuzuhören, wie er drauflos fantasierte von einer Welt der Zukunft in der alles gut sein würde, und gerecht zuginge, und schön wäre und perfekt eben.
So zog er uns alle leicht in seinen Bann, und man fing an nachzudenken, ob das nun wirklich so bleiben musste überhaupt, wie man`s halt kannte, oder was anders werden könnte tatsächlich, wenn wir nur wollten und aufeinander achteten und hörten, und so weiter…
Man sah es, wie sie alle dasaßen und grübelten und in ihren Köpfen herumprobierten. Sogar den alten Hildebrand habe ich da ganz still und leise vor sich hinlächeln sehen, erstaunlich.
Aber dieses Tempo kann eben keiner auf Dauer durchhalten, so einen Ideengalopp, jeder muss da mal runterkommen wieder und die Gedanken verschnaufen lassen irgendwann. So ist es eben kein Wunder, dass auch unser Herr Odo seine Zeiten hat, wo er ganz stille ist und einem wie leergelaufen vorkommt. So als müsste er sich von einer Krankheit erholen, und besser ganz vorsichtig sein, was er sich nachdem schon wieder zumuten könnte, und mit seinen geschwächten Kräften haushalten.
Dann wollte er in Ruhe gelassen werden, klar, und man konnte nicht mehr viel von ihm wollen. Musste ihn wohl auch zweimal fragen, bis eine leise Antwort kam, zögernd und eher ausweichend oft, sodass man schließlich besser selber überlegte, wie man`s machen wollte, oder wen anderes man besser fragte.
Das konnte was dauern so mit ihm. Oder auch soweit kommen, dass er ganz verschwand aus dem Betrieb für eine Weile und sich in seinem Turmzimmer über dem Tor verkroch und keinen zu sich ließ oder sehen wollte. Nur einer von den Jungs aus dem Dorf, der Zacco, oder unser Tom, die durften dann wohl mal zu ihm rein und was zu essen bringen und nach ihm sehen. Aber die sagten kein Wort, wie es um Herrn Odo stand. Und man machte sich so seine Sorgen und hoffte, dass er bald wieder hervorkommen würde und der alte wär und uns mit seinen Einfällen herumjagt. Aber das konnte dauern in solchen Fällen. Man wünschte sich nur, man könnte ihm irgendwie helfen.
Anfangs war ja die Gina immer in seiner Nähe und hat sich gekümmert. Alle wussten, die beiden waren ein Paar, und sie schienen so glücklich miteinander. Doch jetzt ist das lange schon total vorbei, und sie meiden sich nur, schon so lange. Die kann ihm wohl nicht mehr helfen.
Auch sonst sind wir ja drei Jahre weiter inzwischen. Aber was rede ich lang, das seht ihr ja selbst. Das Wichtigste ist, dass ihr hier dabei seid und alle mitmachen könnt, dass eure Eltern und Familien euch auch überhaupt bei uns mitmachen lassen in unserem Miliz-Programm und dem allem. Denn das zeigt, dass die auch schon langsam etwas zu begreifen beginnen – allem althergebrachten, trübseligen Stillstand zum Trotz.
Wir bauen etwas Neues, Großes, eine Freiheit für uns – für euch alle – und dafür… das ist es wert, dafür auch viel zu tun, zu kämpfen auch, notfalls. Das zu verteidigen und dafür einzustehen – wie soll ich sagen… und ihr habt´s ja erlebt, einfach ist das nicht. Ich will gar nicht davon reden, wie die Alten maulen und die Mütter zetern…“
„Na, meine ist jedesmal sauer, wenn ich zur Waffenausbildung gehe – sie redet dann gleich drei Tage nicht mehr mit mir!“
„Da hast du´s ja noch gut, Rahel: Wenn ich losgehe zum Training, rennt meine Mutter durch das halbe Dorf zeternd neben mir her, bis sie keine Luft mehr hat und stehen bleiben muss… meist ist das soweit dann erst am Bach hinter dem Backhaus, und ab da hab ich dann meine Ruhe.“
„Ja, so oder so… ihr kennt das. Ist für jeden nicht einfach, wirklich was Neues geschehen zu lassen… besonders aber für die Alten. Und dann sogar dabei noch mit anzupacken. Wer hatte von euch denn bisher schon mal einen Pfeil geschossen, oder vielleicht auf einem Pferd gesessen, oder gar ein Messer geworfen, oder mit der Stocklanze herumhantiert? Und das ist alles nicht so leicht zu lernen, sondern anstrengend und strapaziös, was? Aber nur so geht es, voranzukommen und seine Kräfte zu entwickeln, und seine Fähigkeiten, und wach zu werden bis in die letzte Ecke des eigenen schläfrigen Körpers – na, was red ich, ihr seht es ja selber und erfahrt es am eigenen Leibe jetzt, nach den paar Wochen schon…“
„Kehla, du wolltest uns doch erzählen, was damals…“
„Ja, richtig, entschuldigt – ich glaube ich schwafele schon wieder zu viel. Ich wollte euch erzählen, wie das zuerst alles anfing damals. Das heißt, so lange ist das auch noch gar nicht her, gerade mal wenige Jahre, drei genau genommen – denk mal einer an.
Also dann: Vor drei Jahren, nach der Zählung der Christen im Jahre 1235 – und somit in der jüdischen Zählung im Jahre 4996 nach der Erschaffung der Welt – oder auch eben im 631ten nach der Hidschra des Propheten – da sind wir also zum ersten Male losgezogen, um eine jüdische Gemeinde zu uns her nach Peio zu holen. Nämlich zunächst unsere eigene, also die, wo Joshe und ich herkamen und groß wurden, wie man das so nennt. Das war aber eine verflucht gefährliche Sache damals. Noch weitaus mehr als heute inzwischen. Und es bleibt immer noch nicht ohne, habt ihr selbst erlebt gerade erst, letztes Mal. Das kann alles immer noch schnell gewaltig schief gehen… ja. Also damals… wo soll ich nun anfangen?“
„Ihr wart doch vorher von eurer Familie und Heimatgemeinde ausgeschickt worden, um Peio zu suchen – oder nicht?“
„Ja – und nein. Ganz kann man das so nicht sagen… also Joshe, mein Bruder, und Avram, das war unser Vetter, die sind ausgesandt worden, das ist richtig. Um zu suchen und zu erforschen, wohin die jüdischen Familien aus unserer alten Stadt gehen könnten, wo es sicherer wäre… oder wo es auch überhaupt möglich wäre, zukünftig zu leben. Und Zeta und ich…“
„Zeta? Die Capitana?“
„Ja klar, Zeta, die jetzt die Capitana unserer gesamten Miliz ist – das ist ja meine Cousine. Also, sie und ich, wir sind den beiden Männern dann aber auf eigene Faust hinterher…“
„Ha, ausgerissen seid ihr also einfach…“
„… ja nun – ohne dass einer davon was wusste zuhause, schon richtig. So sind wir halt losgezogen. Und wir hatten Joshe und Avram nach einigen Wochen dann auch eingeholt, mit viel Glück allerdings nur. Danach sind wir zusammen weiter…“
„Und stimmt das, ihr seid von weit überlegenen Feinden überfallen worden… und Zeta allein hat die mit ihren bloßen Händen, und den Messern, in die Flucht geschlagen und euch alle gerettet?“
„Na, wer erzählt denn solch einen großartigen Blödsinn…“
„… und sie war dabei völlig nackt und ohne Kleider am Leib…“
„… aber dazu hatte sie sich von Kopf bis Fuß mit schwarzem Schlamm eingeschmiert…“
„… damit sie keiner sehen konnte in der Nacht?“
„Ja – ja – und ja! Aber wie soll ich euch das erzählen, wenn ihr mich jetzt ständig unterbrecht? Also richtig: Wir sind überfallen worden. Von etwa einem Dutzend gewöhnlicher Straßenräuber allerdings, finstere, mörderische, zu allem entschlossene Gesellen, das kann ich euch sagen. Und dabei ist der arme Avram zu Tode gekommen. Erschlagen worden am Wegesrand von diesen Schweinehunden.“
„Aber Zeta hat doch…“
„Jaja, der Reihe nach. Du musst nicht alles glauben, Rahel, was so an Heldengeschichten umgeht, nicht mal über unsere große Zeta. Die nackte Wahrheit ist schon erstaunlich genug. Ihr habt sie ja inzwischen selber in Aktion erlebt. Nun, jedenfalls, nach dem ersten Winter auf Peio damals, wo alles eng zusammen rückte auf der Burg und von den gemeinsamen Vorräten lebte und wirtschaftete…“
„Das musst du uns auch unbedingt noch erzählen, wie das damals gemacht wurde… dieser erste gemeinsame Winter auf der Burg ist ja auch schon eine Legende.“
„Ja, es gibt so viele Geschichten, Fatma. So vieles, was man vorher noch nie gesehen hatte: Christen und Juden, die zusammen leben und arbeiten… und bald noch muslimische Familien dazu. Und überhaupt, dass alle Menschen an diesem Ort gemeinsam alles das taten, was gerade am nötigsten war: Holz schlagen im Wald, und es zurichten für den Wiederaufbau der Hütten des Dorfes. Und für neue Häuser, nicht zuletzt auch für unsere jüdischen Familien, die wir dann im folgenden Frühling oder Sommer holen wollten. Auch wenn wir da vorerst noch keinen Plan hatten ‚wie das nun gehen sollte.“
„Und dann kam ja auch noch plötzlich der Überfall dazwischen, als der mit dem Eberkopf…“
„Ja sicher, das auch noch. Aber wenn du schon so gut Bescheid weißt, dann erzähl du doch weiter.“
„Ja – nee. Ich hab nur davon gehört: Da war da doch auf einmal dieser fette Schweineteufel mit seinen Knechten da, und stand vor der Burg und hat euch belagert mit Feuer und Schwert, und fast wäre alles verloren und hin gewesen, und aus und vorbei mit dem schönen Peio, und…“
„…hätte nicht doch noch im letzten Augenblick der eiserne Arm der sarazenischen Garde diese Hunde verjagt und aus dem Tal vertrieben!“
„Jaa, sehr schön hast du das gesagt, Aliya. Wenn es auch ein wenig übertrieben ist und ziemlich nebulös klingt in meinen Ohren – und auch tatsächlich etwas anders doch abgelaufen ist. Ich fürchte, wenn ich euch schlicht und nüchtern erzähle, wie es wirklich gewesen ist, werdet ihr eher enttäuscht sein…“
„Wieso – war es denn nicht so? Ohne unsere Sarazenen wäret ihr doch da niemals mit heiler Haut herausgekommen…“
„Ja, Aliya, das stimmt schon. Aber… also soll ich das jetzt der Reihe nach erzählen oder doch nicht?“
Meine drei Kriegerinnen nicken eifrig. Also gut.
„Na, dann hört zu und unterbrecht mich nicht ständig, bitte. Also das sind zwei verschiedene Geschichten, die allerdings ungefähr gleichzeitig damals passiert sind. Einmal zogen wir los, um… nein, stimmt ja gar nicht – jetzt bin ich selber durcheinander, soweit habt ihr mich gekriegt mit eurem ewigen Dazwischenreden! Wollt ihr also still sein jetzt bitte – Aliya und Rahel? – Und zuhören, was ich zu erzählen habe, ja?“
Die beiden Feuerköpfe nicken eifrig und hängen mit glänzenden Augen an meinen Lippen, wie man so sagt. Fatma hält sich im Hintergrund und zieht nur mit amüsiertem Zweifel die Stirne in Falten.
„Ja, also tatsächlich erschien damals, zeitig im ersten Frühjahr des Jahres 1235, jener böse Nachbar, der Graf von Terrasecca mit dem schwarzen Eberkopf im Wappen, der stand plötzlich mit mehr als fünfzig von seinen Kriegsknechten und reichlich feindlichen Absichten vor der Burg Peio.
Wir waren völlig überrascht. Es war zwar gelegentlich die Rede davon gewesen, man müsste den alten Wachtturm in der Schlucht besetzen und dort eine ständige Ausschau halten, um genau solche Überraschungen zu vermeiden – oder zumindest rechtzeitig gewarnt zu sein…“