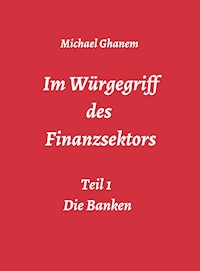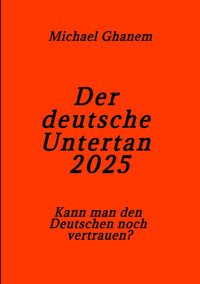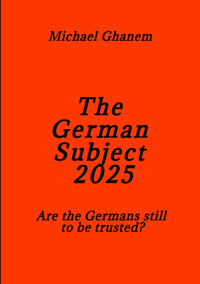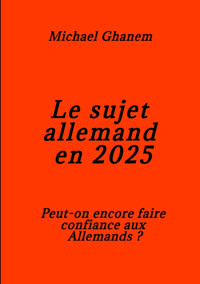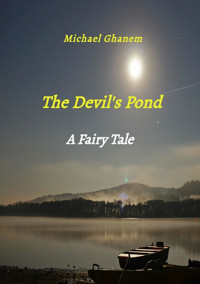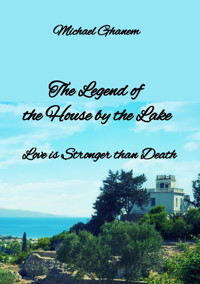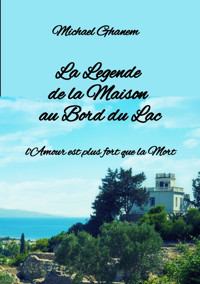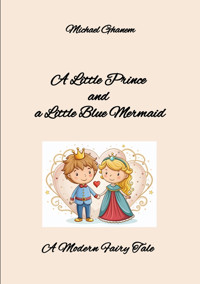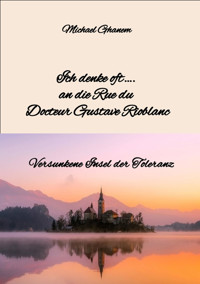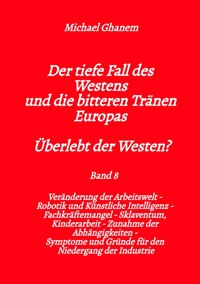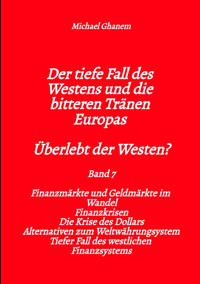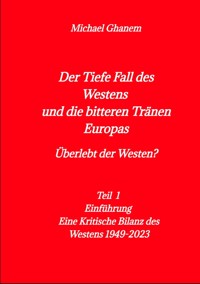8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Digitalisierung, Elektromobilität, Gentechnologie, Industrie 4.0 und andere technische Revolutionen werden sich in allen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft vollziehen und stellen uns vor gewaltige Herausforderungen. Am stärksten wird die menschliche Arbeit davon betroffen sein, die nicht mehr so sein wird wie zuvor. Mit der heute vorherrschenden neoliberalen Ausrichtung der Wirtschaft und der Finanzwelt wird diese Entwicklung nicht zu bewältigen sein. Wenn keine grundlegenden Änderungen eintreten, werden breite Teile der Gesellschaft verarmen, die Spaltung der Gesellschaft in arm und reich wird weiter zunehmen. Damit verbunden droht die Zunahme von nationalistischen, politisch-xenophoben Bewegungen in Deutschland und in Europa, die unser politisches System der Demokratie in Frage stellen. Mit einer Ökonomie der Antifragilität können diese drohenden Konsequenzen gemildert werden. Sie sieht den Menschen als Kern des Wirtschaftsgeschehens und nicht das Kapital.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dieses Buch ist allen Mahnern, Ökonomen, Soziologen, Philosophen und einsamen Rufern gewidmet, denen das Wohlergehen unserer Gesellschaft am Herzen liegt. Jeder kritische Geist ist einsam und gehört zu einer Minderheit. Die Minderheit von heute kann jedoch die Mehrheit von morgen sein. Dieses Buch ist auch ein Appell an die Anhänger der Neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sowie an die Anhänger der Globalisierung, dass sie die Zerbrechlichen in unserer Gesellschaft nicht aus den Augen verlieren.
Dieses Buch ist auch meiner Frau Marlene gewidmet für ihre kritischen und klugen Ratschläge die mich mein Leben begleitet haben und die stets eine gute Ratgeberin war.
Eine besondere Widmung gilt meinen Lehrern:
Prof Dr. Schmölders, Prof. Dr. H.K. Schneider, Prof. Dr. Christian Watrin,
Prof. Dr. Rolf Rettig, Prof. Dr. Wessels, Prof. Dr. Klaus Mackscheidt, Prof.
Dr. Karl Kayser, Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz, Prof. Dr. Rene König, Prof.
Dr. Erwin K. Scheuch,
Prof. Dr. Wolfgang Köhler, Prof. Dr. Theodor W.(Wiesengrund) Adorno und Prof. Dr. Jürgen Habermas.
Bonn, im März 2018
Michael Ghanem
Ansätze zu einer
Antifragilitäts-Ökonomie
© 2018 Michael Ghanem
2. überarbeitete Auflage März 2018
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7469-1742-9 (Paperback)
978-3-7469-1743-6 (Hardcover)
978-3-7469-1744-3 (e-Book))
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die verwendete Abbildung ist bei Fotolia lizensiert.
https://de.fotolia.com/
Fotolia_178504050_L
Über den Autor
Michael Ghanem
Jahrgang 1949, Studium zum Wirtschaftsingenieur, Studium der Volkswirtschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, Philosophie und Ethik, arbeitete jahrelang bei einer internationalen Organisation, davon 5 Jahre weltweit in Wasserprojekten, sowie in einer europäischen Organisation und in mehreren internationalen Beratungsunternehmen.
Autor von mehreren Werken, u.a.
“Abenteuer Deutschland – Bekenntnisse zu diesem Land”
“Ich denke oft…. an die Rue du Docteur Gustave Rioblanc – Versunkene Insel der Toleranz” ”
„Deutsche Identität: Quo vadis?“
„Danke Gertrud – oder das Schicksal einer stolzen vertriebenen Oberschlesischen Bauerntochter“
„2005-2017 Deutschlands Verlorene 13 Jahre Teil 1 oder Angela Merkel, Die falsche Frau an der falschen Stelle zum falschen Zeitpunkt und am falschen Ort“
„2005-2017 Deutschlands Verlorene 13 Jahre Teil 2 oder Sie schlafen den Schlaf der Gerechten“
und verschiedene Beiträge in Fachzeitschriften
Bonn, im März 2018
Inhaltsverzeichnis
1 Vorwort
2 Ausgangslage
2.1 Gibt es überhaupt noch einen Markt?
2.2 Sind alle Marktteilnehmer gleichrangig und gleich mächtig?
2.3 Entscheidet der Mensch wirklich nach Ratio?
2.4 Sind die mathematischen Modelle ohne weiteres auf das Verhalten von Wirtschaftssubjekten anwendbar?
2.5 Ist das Verhalten eines Menschen überhaupt vorhersehbar?
2.6 Gibt es psychologisch-mathematische Modelle, die das Verhalten von Menschen vorhersehbar machen?
2.7 Kann ein angebotstheoretischer Ansatz ohne einen nachfrageorientierten Ansatz überhaupt lebensfähig sein?
2.8 Wenn der Markt Zentrum des Wirtschaftssystems ist, welche Rolle spielt der Mensch? Ist der Mensch nicht die Grundlage des Marktes?
2.9 Ist der neoliberale Ansatz nicht eine Ursache des Zerbröselns der Demokratie?
2.10 Ist der neoliberale Ansatz nicht eine Ursache für die Finanzkrise?
3 Neoliberaler Ansatz - nein danke!
3.1 Vorbemerkung
3.2 Neoliberalismus vs. Postkeynesianismus
3.2.1 Vorbemerkung
3.2.2 Wer war Milton Friedman und welchen Einfluss hatte er?
3.2.3 Wer waren die „Chicago Boys“?
3.2.4 Einflussnahme der „Chicago Boys“ in Lateinamerika und weltweit
3.2.5 Zur Bewertung von Milton Friedman und den „Chicago Boys“
3.2.6 Wer war Keynes und welchen Einfluss hatte er?
3.2.7 Die Entwicklung in den 1970er Jahren
3.2.8 Mittlerweile ist eine Mischform hoch im Kurs
3.2.9 Fazit
3.3 Die Globalisierung
3.3.1 Vorbemerkung
3.3.2 Globaler Kapitalismus – was nun?
3.3.3 Chancen und Gefahren der Globalisierung
3.3.4 Anforderungen an die Bekenner der Globalisierung
3.3.5 Die Globalisierungsfalle
3.3.6 Der Niedergang des Westens
3.3.7 Fazit
3.3.8 Ausblick
3.4 Ungezügelte neoliberale Globalisierung - nein danke!
3.4.1 Vorbemerkung
3.4.2 Korrektive Maßnahmen der neoliberalen Globalisierung
3.4.3 Schlussfolgerung
3.5 Arbeitswelt im Rahmen der technischen Revolutionen
3.5.1 Vorbemerkung
3.5.2 Szenario für Arbeitsweltveränderungen im Rahmen von technischen Revolutionen
3.6 Volkswirtschaftslehre - Quo vadis?
3.6.1 Vorbemerkung
3.6.2 Die Mängel der Volkswirtschaftslehre
3.6.3 Vermögensverteilung (Fuest versus Piketty)
3.7 Postkapitalismus - was nun?
4 Armut und Reichtum in der Welt und in Deutschland und die Probleme der Neoliberalen Wirtschaftsordnung
4.1 Vorbemerkung
4.2 Grundsätzliches
4.2.1 Ungleichheit als Entscheidungsgrundlage?
4.2.2 Kapital versus Humankapital
4.2.3 Welche Art des Kapitalismus haben wir: Einen Schein-Kapitalismus?
4.2.4 Gibt es Chancengleichheit unter nationalen Vorzeichen?
4.2.5 Die Rolle des Steuersystems bei der Bereicherung durch Eliten
4.2.6 Die Farce des Freihandels
4.2.7 Wie geistiges Eigentum die Ungleichheit verschärft
4.2.8 Die Ungleichheit verhindert die Entwicklung von Ländern
4.2.9 Benachteiligungen durch den neoliberalen Ansatz
4.3 Über die Armut in der Welt
4.3.1 Vorbemerkung
4.3.2 Armut in der Welt
4.3.3 Kinderarbeit in der Welt
4.3.4 Sklaven in Deutschland und in der Welt
4.4 Armut in Deutschland
4.4.1 Vorbemerkung
4.4.2 Falsche Angaben zur Arbeitslosigkeit
4.4.3 Soziales
4.4.4 Armut in der Bevölkerung
4.4.5 Investitionsbedarf bei Pflegeheimen
4.4.6 Renten und Rentenentwicklung
4.4.7 Armut und Prekarität sind erheblich angestiegen
4.4.8 Versagen in der Rentenproblematik
4.4.9 Versagen in der Gesundheitspolitik
4.4.10 Kinderarbeit in Deutschland
4.4.11 Das Analphabetentum
4.4.12 Die Obdachlosigkeit
4.4.13 Die private Überschuldung
4.4.14 Erziehung, Bildung und Ausbildungschancen
4.5 Preis der Ungleichheit und Vernichtung der Mittelschicht
4.6 Reichtum
4.6.1 Reichtum der privaten Personen
4.6.2 Exportüberschüsse
4.7 Beispiele von Skandalen als Ergebnis der Neoliberalen Wirtschaftspolitik
4.7.1 Skandale
4.7.2 Bankenkrise
4.7.3 Automobilindustrie
4.7.4 Lebensmittelindustrie
4.7.5 Pharma- und Chemieskandale
4.8 Rüstungsausgaben, Rüstungsindustrie, Beschäftigte in der Rüstung
5 Europa Quo vadis?
5.1 Vorbemerkung
5.2 Die Globalisierung als Hauptursache für den Zerfall der EU
5.2.1 England
5.2.2 Frankreich
5.2.3 Italien
5.2.4. Spanien
5.2.5 Portugal
5.2.6 Restliche Länder
5.3 Sind die Deutschen europafähig?
5.4 Netto Vermögen in Europa
5.5 Europa als Absatzmarkt
5.6 Nicht geschlossene formale Friedensverträge
5.7 Entwicklungen in Europa
5.7.1 Die Teilung Europas in zwei Einflusszonen
5.7.2 Die Staatsverschuldung und das Verhalten Deutschlands
5.7.3 Der Brexit und seine Folgen:
5.8 Fazit
6 Zustand der deutschen Wirtschaft Februar
6.1 Vorbemerkung
6.2 Ausgewählte Wirtschaftszweige
6.2.1 Die Automobilindustrie
6.2.2 Die Bauwirtschaft
6.2.3 Die Pharmaindustrie
6.2.4 Die Gesundheitsindustrie
6.2.5 Der Werkzeug- und Maschinenbau/ Anlagenbau und Engineering
6.2.6 Die Energiewirtschaft
6.2.7 Die Kreditwirtschaft
6.2.8 Die Versicherungswirtschaft
6.2.9 Die Logistik
6.2.10 Die Kultur
6.2.11 Der Pflegebereich
6.2.12 Zusammenfassung und Schlussbemerkung
6.3 Innovation in der deutschen Wirtschaft
6.4 Informationsgesellschaft, Digitale Revolution und Technische Revolutionen
6.5 Neoliberale Philosophie gegen den Staat
6.6 Die Bewertungsproblematik der deutschen Staatsverschuldung
6.7 Die Fehler der Vergangenheit
6.8 Haben wir daraus gelernt?
6.9 Internationales Steuerdumping
6.9.1 Vorbemerkung
6.9.2 Steuerdumping und seine Folgen
6.9.3 Steuerdumping in Europa
6.9.4 Steuerdumping in den USA
6.9.5 Steuerdumping in der Welt
6.9.6 Konsequenzen des Steuerdumpings
6.9.7 Mögliche Lösungsansätze
6.10 Der Fachkräftemängel als Überlebensfrage für Deutschland und Europa
6.10.1 Vorbemerkung
6.10.2 Der Fachkräftemangel in Deutschland
6.10.3 Die gescheiterte Bevölkerungspolitik
6.10.4 Eine nicht vorhandene Einwanderungspolitik
6.10.5 Eine aus dem letzten Jahrhundert beibehaltene starre Lebensarbeitszeit
6.10.6 Die ausgesprochen familienfeindliche Behandlung von Familien und Kindern durch Wirtschaft und Politik
6.10.7 Die mangelnde Gestaltung zukünftiger Ausbildungsberufe
6.10.8 Die nicht vorhandene Organisationsentwicklung vieler Unternehmen und Konzerne
6.10.9 Betroffene Wirtschaftszweige
6.10.10 Gründe für den Fachkräftemangel
6.11 Die Forschung im Dienste der Wirtschaft
6.11.1 Vorbemerkung
6.11.2 Direkte Aufträge
6.11.3 Mischfinanzierung der Forschung
6.11.4 Schuldfrage Politik?
6.11.5 Wirtschaftsgelder für die Bildung?
6.11.6 Subtile und Indirekte Einflussnahmen
6.12 Die Bestechung in der Wissenschaft und in der Forschung
6.12.1 Vorbemerkung
6.12.2 Wann fängt Bestechung in der Wissenschaft an?
6.12.3 Wann fängt Bestechung in der Forschung an?
6.12.4 Welche Art der Bestechung gibt es?
6.12.5 Die Konsequenzen
6.13 Die Öffentliche Hand: größter Arbeitgeber auf Zeit
6.13.1 Vorbemerkung
6.13.2 Zeitarbeit für Flexibilität?
6.13.3 Zeitverträge als Heilmittel?
6.13.4 Öffentliche Arbeitgeber als größte Arbeitgeber auf Zeit
6.13.5 Informationsgesellschaft und Zeitverträge
6.13.6 Die Konsequenzen
6.14 Strategische Fehler der deutschen Wirtschaft in den letzten 13 Jahren
6.14.1 Vorbemerkung
6.14.2 Zehn Strategische Fehler der Deutschen Wirtschaft
6.14.3 Die Konsequenzen
6.15 Dreizehn Jahre verloren?
6.16 Mögliche Risiken (Stand Februar2018)
6.16.1 Vorbemerkung
6.16.2 Politische Instabilität
6.16.3 Nicht durchgeführte Politik
6.16.4 Falsche Wirtschafts- und Finanzpolitik
6.16.5 Europa und Geopolitische Entwicklungen
6.16.6 Nationalistische Entwicklungen
6.16.7 Migration und Afrikapolitik
7 Wie wir 2030 arbeiten werden
7.1 Vorbemerkung
7.2 Produktives Arbeiten
7.3 Zukünftige Arbeitsweisen
7.4 Konsequenzen der technischen Revolutionen
7.5 Betroffene Wirtschaftszweige
7.5.1 Automobilindustrie und Verkehr
7.5.2 Werkzeug- und Maschinenbau
7.5.3 Chemie- und Pharmaindustrie
7.5.4 Schiffbau
7.5.5 Gesundheitswesen
7.5.6 Kreditwirtschaft
7.5.7 Versicherungswirtschaft
7.5.8 Betreuung von Alten
7.5.9 Bildung und Forschung
7.5.10 Innere Sicherheit
7.5.11 Justiz
7.5.12 Äußere Sicherheit
7.5.13 Handwerk
7.5.14 Tourismus
7.5.15 Kultur
7.5.16 Umweltschutz
7.5.17 Informationstechnologie und Kommunikationsindustrie
7.5.18 Aufhebung der Netzneutralität und die Konsequenzen
7.5.19 Regierung und Öffentliche Verwaltung
7.5.20 Landwirtschaft
7.5.21 Ernährungswirtschaft
7.5.22 Fazit
7.6 Transformation Deutschlands vom „Hardware-Hersteller“ zu einem „Softwareentwickler“ und zu einer Informationsgesellschaft
7.6.1 Allgemeines
7.6.2 Deutschland im Transformationsprozess zu einer Informationsgesellschaft
8 Antifragilitätsökonomie
8.1 Vorbemerkung
8.2 Die Notwendigkeit einer Antifragilitätsökonomie
8.3Was ist eine Antifragilitätsökonomie?
8.3.1 Menschlichkeit
8.3.2 Verantwortung
8.3.3 Krisenfestigkeit
8.3.4 Nachfrage-orientierte soziale Marktwirtschaft
8.3.5 Fairness
8.3.6 Wirtschaftlichkeit
8.4 Ziele einer Antifragilitätsökonomie
8.5 Rolle der Gemeinwohlwirtschaft in der Antifragilitätsökonomie
8.6 Notwendigkeit für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens
8.7 Antifragilitätsökonomie in Bezug auf den Arbeitsmarkt
8.8 Antifragilitätsökonomie in Bezug auf den Wettbewerb
8.9 Antifragilitätsökonomie in Bezug auf den Rohstoffeinsatz
8.10 Antifragilitätsökonomie in Bezug auf den Außenhandel und die EU
8.11 Antifragilitätsökonomie in Bezug auf die Entwicklungshilfe
8.12 Antifragilitätsökonomie in Bezug auf den Umweltschutz
8.13 Antifragilitätsökonomie in Bezug auf die Finanzpolitik
8.14 Antifragilitätsökonomie in Bezug auf die Staatsfinanzierung
8.15 Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der Altersabsicherung
8.16 Notwendigkeit der Wiederherstellung und Stärkung der primären staatlichen Aufgaben
8.17 Notwendigkeit einer Neuorganisation und Umfinanzierung des Gesundheitswesens
8.18 Notwendigkeit der Umstrukturierung der Bildung und der Forschung
8.19 Notwendigkeit der Umstrukturierung der Justiz und der Inneren Sicherheit
8.20 Notwendigkeit einer Maschinenbesteuerung
8.21 Notwendigkeit der Neuordnung in der Finanzwelt
8.22 Notwendigkeit der Kontrolle des Wassers und sonstiger strategischer Güter
8.23 Notwendigkeit der Besteuerung multinational agierender Unternehmen
8.24 Notwendigkeit für die Neuordnung des Welthandels
8.25 Die Chance der Antifragilitätsökonomie auf dem Weg zu einer Solidarwirtschaft
8.26 Wirtschaftsethik als ein Element zur Bewertung der Manager
8.27 Antifragilitäts-Ökonomie in Bezug auf Europa
8.28 Antifragilitätsökonomie in Bezug auf Frankreich
8.29 Machbarkeit einer Antifragilitätsökonomie
8.30 Falsche Verheißungen?
8.31 Chancen und Risiken der Durchsetzung einer Antifragilitätsökonomie
8.32 Neben Rechten gibt es auch Pflichten
9 Notwendigkeit der Sanierung des Rechtssystems
9.1 Vorbemerkung
9.2 Die Rechtsgebiete
9.3 Die Prozessordnung
9.4 Die Verfassung
9.5 Die Anforderungen der neuen Technologien
9.6 Gesetze auf Zeit?
9.7 Fazit
10 Gesamtfazit
11 Epilog
12 Literaturverzeichnis
12.1 Wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Literatur
12.2 Bankenskandale
12.3 Privatisierung des Wassers
12.4 Technische Revolutionen
12.5 Mangel an Fachkräften
12.6 Gesundheit und Pflege
12.7 Steuer Dumping
12.8 Forschung und Wirtschaft –Forschung und Korruption
12.9 Risiko
12.10 Bildung
12.11 Quellen zu verfälschten Arbeitslosenzahlen
1 Vorwort
Der Autor wurde mit Beginn seines Studiums in Deutschland im Jahr 1966 mit den sozial-ökonomischen Problemen der damaligen Gesellschaften konfrontiert. Diese Probleme wurden ihm während seiner berufsbedingten Aufenthalte in Afrika noch deutlicher sichtbar. Bereits mit Beginn seines Studiums wurde er Zeitzeuge des wissenschaftlichen Streits zwischen der neoliberalen und der keynesianischen Wirtschaftspolitik, der die damaligen Diskussionen an den Universitäten bestimmte.
Ab der Mitte der 70er Jahre haben die neoliberale Wirtschaftspolitik und die zunehmende Globalisierung die gesamte Wirtschaft und den Finanzsektor sowie die Lehre an den Universitäten geprägt.
Hier ist die Rolle der „Chicago Boys“ sowie von Milton Friedmann und Friedrich A. Hayek bei der Konterrevolution in Chile in 1973 zu erwähnen. Diese hatten eine entscheidende Wirkung auf die deutsche und die weltweite Wirtschaftspolitik, sodass sogar die Deutsche Bundesbank als einzige Zentralbank der Welt sich die Lehre des Milton Friedmann zu Eigen gemacht hat. Damit hatte die Zentralbank als einzige Aufgabe nur noch die Geldwertstabilität.
Hier muss festgestellt werden, dass in der deutschen Bevölkerung eine latente Angst vor Inflation herrschte und herrscht. Diese wurde über den falsch hergestellten Zusammenhang zwischen der Inflation von 1923 und der Massenarbeitslosigkeit von 1929-1932 und dem darauf folgenden Aufstieg von Hitler verstärkt. Hier ist festzustellen, dass von 1924 – 1929 de facto in Deutschland, in Europa und in der Welt ein Wirtschaftsboom vorhanden war und dass durch eine falsche Währungspolitik, Spekulation an der Börse und durch Deflation und Isolationismus die USA, Europa und Deutschland in eine Wirtschaftskrise gestürzt wurden. Es ist auch festzustellen, dass während der Boom-Jahre ein kleiner Teil der Bevölkerung sehr reich geworden war und ein großer Teil der Bevölkerung verarmte. Dies hat wiederum soziale Unruhen hervorgerufen und den Weg für Hitler vorbereitet.
Hitler hat mit seinem Autobahnbau und der Produktion von Kriegswaffen nichts anderes als das keynesianische Modell in der ersten Phase umgesetzt und damit die Arbeitslosigkeit in sehr kurzer Zeit stark reduziert. Dass seine Programme automatisch zum Krieg führen würden, war manchen kritischen Denkern der damaligen Zeit bewusst geworden.
Der neo-liberale Ansatz, der sehr stark auf der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik beruht, hat verknüpft mit dem Irrglauben an eine zügellose Globalisierung (hier möchte der Autor klarstellen, dass er kein ausgesprochener Gegner der Globalisierung ist, sich diese aber mit fairen Mitteln und mit strengen Auflagen versehen wünscht) dazu geführt, dass die Volatilität des Kapitals in inflationärem Maß zugenommen hat und ein Nomadentum hinsichtlich der Produktionsstandorte und der neue Sport der Steuervermeidung entstanden sind.
Bedenkt man, dass die Philosophie des Friedrich A. Hayek, der als einer der Väter des Neoliberalismus gilt, besagt, dass jegliche staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft den „Weg zur Knechtschaft“ bedeuten, so darf man sich nicht wundern, dass seine geistigen Kinder stets den „schlanken Staat“ predigen. Wenn jedoch ein schlanker Staat gewünscht wird und damit primäre staatliche Aufgaben privatisiert werden – sei es in der Bildung (wie in USA und Chile u.a.) oder in der Inneren Sicherheit mit dem Aufkommen von Bürgerwehren und Bodyguards, oder im Gesundheitswesen, in dem die Reichen die beste und die Ärmeren kaum eine Versorgung erhalten – dann ist die logische Folge, dass man weniger Steuern zu zahlen hat. Es ist jedoch zu bedenken, dass der reiche Teil der Bevölkerung den größten Anteil an der Einkommenssteuer entrichtet. Daher dürfte vor allem die Steuerlast der Reichen und Mächtigen reduziert werden.
Damit verbunden ist aber auch, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vergrößert – und dies ist in den letzten 35 Jahren in den USA, in Europa und in Deutschland eingetreten. Einen weiteren Punkt stellt in diesem Zusammenhang die Weigerung von multinationalen Konzernen dar, Steuern zu entrichten. Ihre besteuerbaren Hauptsitze werden neuerdings in sogenannte „Steuerparadiese“ verschoben. Diese Konzerne nutzen nicht nur die Infrastrukturen, die der Rest der Steuerzahler finanziert, sondern sie werden auch noch immer mächtiger, sodass ihre Macht für die meisten Staaten bedrohlich werden kann.
Vor diesem Hintergrund finden vier technische Revolutionen statt, die sowohl die Arbeitswelt als auch die Denkstrukturen der Bevölkerung, die staatlichen Strukturen und die Finanzierungsmöglichkeiten des Staates, die Altersversorgung der Bevölkerung, das Gesundheitswesen und die Umwelt in erheblichem Maß verändern werden. Diese Revolutionen finden bereits statt, ihre Konsequenzen sind aber noch nicht deutlich spürbar. Die deutsche, die europäische und der größte Teil der US-Bevölkerung sind nicht vorbereitet. Dafür trägt die mittelmäßige politische Elite einen großen Teil der Schuld.
Zu dieser Thematik hat der Autor, basierend auf tiefgreifenden Untersuchungen und Recherchen über die aktuell stattfindenden Entwicklungen der Philosophie, der Ethik, der Technik und der Wirtschaft Ansätze zu einer möglichen Veränderung des jetzigen Zustandes der Gesellschaft als eine „Anti-Fragilitäts-Ökonomie“ formuliert, die zur Diskussion steht und deren Weiterentwicklung mögliche Lösungen aufzeigen könnte. Der Autor beansprucht nicht, mit diesem Ansatz zukünftig aufkommende Herausforderungen zu meistern, vielmehr geht es ihm darum, mit seinem Beitrag Diskussionen anzustoßen und dazu beizutragen, dass zu der jetzt vorherrschenden neoliberalen Wirtschaftspolitik Alternativen entstehen - sofern man nicht in Dogmen denkt und handelt.
Der Autor hat sich in diesem Buch nicht auf Informationen bezogen, die er in seinen früheren beruflichen Tätigkeiten erworben hat, sondern ausschließlich auf frei zugängliche Informationen.
2 Ausgangslage
Jetzt, zum Beginn des Jahres 2018, muss man feststellen, dass die Situation der Weltwirtschaft durch einen ungebremsten Kapitalismus in einer neoliberalen Globalisierungsorgie gekennzeichnet ist. Seit dem Aufstieg des Neoliberalismus mit dem Ansatz, dass der Einzelne besser wirtschaftet als der Staat und dass daher nur ein schwacher Staat ein guter Staat ist, muss man feststellen, dass die Verarmung der Bevölkerung inflationäre Ausmaße angenommen hat.
Betrachtet man die neoliberale Sicht der Wirtschaft und damit der Gesellschaft genau, so muss man feststellen, dass diese Schmalspurökonomie, die uns die letzten 70 Jahre gelehrt wurde, auf fundamentalen Lebenslügen basiert: Der Markt ist das Maß aller Dinge und der Markt regelt alle Ungleichgewichte, eine konsequente angebotsorientierte Wirtschaftspolitik löst alle Probleme, der freie Zugang zu allen Weltmärkten stellt die oberste Priorität dar, die Ausbeutung der rohstoffreichen Länder ist vor allem die vornehme Pflicht der reichen Länder und der Mensch verhält sich bei seinen Entscheidungen stets nach seiner Ratio, als der homo oeconomicus. Was hat diese Sicht des Menschen für die Wirtschaftspolitik gebracht?
Folgende Fragen müssen gestellt werden.
1. Gibt es überhaupt einen Markt?
2 Sind alle Marktteilnehmer gleichrangig und gleich mächtig?
3. Entscheidet der Mensch wirklich nach Ratio?
4. Sind die mathematischen Modelle ohne weiteres auf das Verhalten von Wirtschaftssubjekten anwendbar?
5. Ist das Verhalten eines Menschen überhaupt vorhersehbar?
6. Gibt es psychologisch-mathematische Modelle, die das Verhalten von Menschen vorhersehbar machen können?
7. Kann ein angebotstheoretischer Ansatz ohne den Ansatz der nachfrageorientierten Ökonomie überhaupt lebensfähig sein?
8. Wenn der Markt Zentrum des Wirtschaftssystems ist, welche Rolle spielt der Mensch? Ist der Mensch nicht die Grundlage des Marktes?
9. Ist der neoliberale Ansatz nicht eine Ursache für das Zerbröseln der Demokratie?
10. Ist der neoliberale Ansatz nicht eine Ursache für die Finanzkrise?
11. Welche Rolle spielt der post-keynesianische Ansatz heute noch?
13. Welche Rolle spielt der verhaltensorientierte Ansatz?
2.1 Gibt es überhaupt noch einen Markt?
Nach Ansicht des Autors haben sich die Marktwirtschaft und die soziale Marktwirtschaft sehr weit vom ihrem Ursprung entfernt. Nach Meinung von führenden Ökonomen ist ein Markt, in dem alle Marktteilnehmer gleich stark sind, zur gleichen Zeit dieselben Informationen haben und unter gleichen Bedingungen arbeiten können, kaum noch vorhanden. Vielmehr ist der Markt durch äußert große Oligopole und Monopole gekennzeichnet. Sie können privat als auch staatlich organisiert sein. Ein realer Wettbewerb zwischen den einzelnen Marktteilnehmern ist nicht mehr vorhanden, man kann die Entwicklung der Marktwirtschaft zu einer Machtwirtschaft sogar spüren.
Diese Machtwirtschaft ist durch die verheerende Einflussnahme von bestimmten Sektoren der Wirtschaft, wie zum Beispiel der Finanzwirtschaft, oder durch übermächtig agierende Konzerne wie Google, Facebook, der amerikanischen IT Unternehmen oder der mächtigen Marktteilnehmer, wie der Autoindustrie, gekennzeichnet. Dadurch können sich keine Preise basierend auf dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage entwickeln, denn die großen Konzerne diktieren den kleinen Unternehmen die Preise und Konditionen. Im Umkehrschluss können Monopole Produktionsabläufe in strukturierten, kleinen Unternehmen stilllegen und zerstören.
Die Regeln des Marktes sind ausgehebelt, wenn der Wettbewerb nicht funktioniert. Dies gilt auch für den Fall der globalisierten Welt. So beklagen sich zunehmend Staaten über den „unfairen“ Wettbewerb anderer Staaten, insbesondere von Deutschland und China. Der Einfluss des chinesischen Staates auf die Gestaltung der Preise für Exportgüter zeigt in einer verheerenden Art, wie leicht die Marktmechanismen auszuhebeln sind. Es kann daher nicht sein, dass immer noch geglaubt wird und insbesondere an der Universität gelehrt wird, dass der Markt die Grundlage jeglichen wirtschaftlichen Handelns ist.
Die Glaubwürdigkeit der Ökonomen nimmt durch ihr Festhalten an einer Grundlage, die möglicherweise Anfang des 20. Jahrhunderts noch Gültigkeit hatte, ständig ab. Dies gilt insbesondere für die theoretischen Ansätze über den Markt. Das Festhalten an diesen Markttheorien führen angesichts der Globalisierung dazu, dass viele Staaten sich auf nationale Grenzen zurück besinnen, sogar mit autokratischen Tendenzen. Der Homo Oeconomicus ist entsprechend vieler psychologischer Ansätze nur ein Wunschtraum, denn nach der Überzeugung der Verhaltenstheoretiker und auch des Autors wird der größte Teil der Entscheidungen in Wirtschaftsprozessen nicht nach rationalen, sondern nach emotionalen Gesichtspunkten getroffen. Lediglich die Begründung der Entscheidung wird rational dargestellt.
Die Erwiderung der Neoliberalen gegenüber ihren Kritikern, dass der Wettbewerb durch Behörden (Kartellämter) geregelt wird, ist scheinheilig und trifft auf die Probleme des mangelnden Wettbewerbs nicht zu. Insoweit muss man davon ausgehen, dass die Einbindung von subjektiven Kriterien in der Wirtschaftstheorie stärker berücksichtigt werden muss.
2.2 Sind alle Marktteilnehmer gleichrangig und gleich mächtig?
Betrachtet man den Markt in Deutschland, in Europa und weltweit, so muss man feststellen, dass je nach Wirtschaftszweig verschiedene Strukturen vorhanden sind. Bei der Energiewirtschaft zum Beispiel ist der Markt weltweit nur in Form von Oligopolen organisiert, die sich teilweise in staatlichem Besitz befinden. Betrachtet man den Automarkt, so muss man feststellen dass sich dieser in ca. 15 Unternehmen aufteilt, somit kann von einem normalen Markt nicht die Rede sein. Bei der Zuliefererindustrie muss man feststellen, dass für bestimmte Teilprodukte des Autos, wie zum Beispiel den Airbag, weltweit drei Produzenten tätig sind.
Angesichts der Machtposition der Automobilindustrie weltweit muss man feststellen, dass von einem normalen Markt keine Rede sein kann, denn wenn auch das Endprodukt einem gewissen Wettbewerb unterliegt, so sind die Zulieferer auf Gedeih und Verderb von den großen Autoherstellern abhängig.
Ein weiteres Beispiel stellt die IT Industrie dar. Bedenkt man, dass im Bereich von Software und Netzwerken quasi ein Monopol der amerikanischen Industrie vorhanden ist, so muss man sich fragen, wie ein Markt funktionieren soll. Ähnliche Beispiele finden sich in der Medizintechnik, der Pharmaindustrie, der Nahrungsmittelindustrie, der industriellen Landwirtschaft usw. Insoweit kann eine Kontrollfunktion einer Wettbewerbsbehörde lediglich ein Feigenblatt sein.
2.3 Entscheidet der Mensch wirklich nach Ratio?
Die Aussage und das Prinzip, dass der Mensch aufgrund seines Egoismus lediglich nach objektiven und rationalen Gesichtspunkten entscheidet, war zwar eine Erkenntnis von Adam Smith, der zu seiner Zeit an die Ratio des Menschen geglaubt hat, entspricht jedoch nach genauen Untersuchungen in heutigen Zeiten keinesfalls der Realität. Laut den meisten Psychologen entstehen Kaufentscheidungen des Wirtschaftssubjekts aus Emotion. Die Werbepsychologie versucht mit aller Macht, nur an die Gefühle des Menschen zu appellieren. Wenn der Mensch nur rational denken würde, dann würden diese dreistelligen Milliardenausgaben weltweit wirkungslos sein. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Das beste Beispiel stellt die Werbung der Automobilindustrie dar, die nur an die Gefühle des Käufers appellieren will.
Würde der Mensch wirklich rational entscheiden, so hätte die böse Kraft von 1930 beziehungsweise 1933 nicht vorkommen dürfen, denn die „panischen Ängste“ trieben die bösen Teilnehmer zu irrationalen Handlungen. Im Übrigen funktioniert die Börse auch heute noch nach demselben Prinzip. Handlungen wie von „Schafherden“ sagen nichts anderes, als dass der Mensch nicht vom Kopf gesteuert wird, sondern von Emotionen.
2.4 Sind die mathematischen Modelle ohne weiteres auf das Verhalten von Wirtschaftssubjekten anwendbar?
In der Schule der Ökonomen verweist der Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler Frank Riedel darauf, dass Wirtschaftswissenschaft ohne Mathematik nicht funktionieren kann, aber Mathematik ohne Wirtschaft und Geisteswissenschaften gefährlich ist. In den letzten Jahrhunderten sind Durchbrüche in der Finanzmathematik analog den Durchbrüchen der Physik zu Anfang des 20 Jahrhunderts zu verzeichnen. Dennoch sind diese revolutionären Erkenntnisse der Physik, die das Atomzeitalter ermöglicht haben, in der Finanzmathematik zu gefährlich. So hat die Finanzmathematik in Kombination mit dem Fehlverhalten von Staaten ermöglicht, die gleiche Wirkung wie Massenvernichtungswaffen haben zu können. Insbesondere die Grenzen der Finanzmathematik wurde vor der Finanzkrise durch Banken und ihre sogenannten Wundermitarbeiter nicht erkannt und dies aufgrund von mangelnder ökonomischen, sozialökonomischer und sozial-ethischer Urteilskraft und Urteilsvermögen. Insbesondere haben fehlende wirtschaftliche und soziale gesellschaftliche Spielregeln, die gegebenenfalls staatlich verordnet werden müssen, die Krise noch verschärft.1
2.5 Ist das Verhalten eines Menschen überhaupt vorhersehbar?
Manche Ökonomen, Psychologen, neoliberalen Wirtschaftspolitiker, Mitarbeiter der Finanzwirtschaft und Politologen sind der festen Überzeugung, dass das Verhalten eines Menschen durchaus vorhersehbar und kalkulierbar ist. Der Autor teilt diese Meinung nur in geringstem Ausmaß, denn für ihn stellt sich die Frage: Wenn die Reaktionen der Menschen vorhersehbar sind, wieso sind Wirtschaftskrisen nicht frühzeitig erkennbar? Wieso sind Tendenzen von autokratischen Bewegungen nicht frühzeitig erkennbar? Wieso ist das Neuaufkommen von Nationalismus, Rassismus, Fehlentscheidungen und Fehlverhalten (insbesondere beim Aufkommen der Informationsgesellschaft) nicht erkennbar? Das Lesen der Gedanken eines Menschen ist nur äußert bedingt oder nur in groben Zügen möglich. So ist das Verhalten des Menschen kaum vorhersehbar oder nur in Fällen einer sehr starken psychologischen Beeinflussung („Gehirnwäsche“) vorhersehbar.
2.6 Gibt es psychologisch-mathematische Modelle, die das Verhalten von Menschen vorhersehbar machen?
Nach Ansicht der Verhaltenstheoretiker und einer großen Anzahl von Psychologen gibt es dafür kein real anwendbares theoretisches Modell (außer in der klinischen Psychologie). Auch die Unterscheidung nach dem Charakter der einzelnen Individuen trifft nach Ansicht des Autors nicht zu, denn die einzelnen Charaktere haben zwar Persönlichkeitsmerkmale, aber diese Merkmale kann man nicht in eine mathematische Formel einbauen, um das Verhalten des Individuums relativ genau vorherzusehen. So hilft die Wahrscheinlichkeitstheorie mögliche Verhaltensmuster grob zu erkennen, dies kann jedoch nicht das genaue Verhalten des Einzelnen vorherbestimmen. Insbesondere gilt dies in Ausnahme- und Gefahrensituationen.
2.7 Kann ein angebotstheoretischer Ansatz ohne einen nachfrageorientierten Ansatz überhaupt lebensfähig sein?
Damit wird die Grundfrage der Auseinandersetzung zwischen den Keynesianern und den Neoliberalen wie Friedrich A. Hayek oder Milton Friedman mit ihrem unerschütterlichen Glauben, dass der Markt und seine freien Kräfte jegliche Ungleichgewichte beseitigen, beschrieben. Dieser sogenannte angebotsorientierte Ansatz, das heißt das Produkt soll einen gerechten Preis auf dem Markt erwirken, oder der Preis des Gutes muss so niedrig werden, bis er eine gewisse Nachfrage findet, ist für den Autor schlicht ein alter, überholter Ansatz, denn denkt man diesen zu Ende, so dürfte bei einer Null-Euro-Lohnfindung null Arbeitslosigkeit herrschen. Stellt sich die Frage: Wer soll dann die Güter nachfragen? Insoweit ist ein nachfrageorientierter Ansatz eine unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren eines Marktes.
Ein nachfrageorientierter Ansatz ist nichts anderes als die Frage der gerechten Lohnfindung.
Die Wirtschaftskrisen der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre hatten zwei wesentliche Ursachen. Die erste Ursache war, dass ein Teil der Industrie Güter produzierte, die kein Mensch wollte. Die zweite Ursache war die ungerechte Besteuerung des Humankapitals (Arbeit). Die Belastung des Arbeitnehmers und Arbeitgebers für das Humankapital war eine der Hauptursachen für die Rationalisierungswelle und die Verlagerung von Unternehmen in Niedriglohnländer. Hauptursache jedoch für die ungleiche Besteuerung des Humankapitals war die Unfähigkeit von Generationen an politischen Klassen, wirtschaftliche Zusammenhänge genau zu erkennen. So erwies sich insbesondere der den neoliberalen Ansätzen zugrundeliegende Glaube, wonach die Produktion kontinuierlich günstiger werden müsse, sei es durch den Einsatz von neuen Technologien, neuem Wissen oder durch Steigerung der Produktivität des Humankapitals und dass dies automatisch zu höherer Nachfrage nach dem Produkt führt, als Trugschluss. Das beste Beispiel stellen die langen Dezennien von Deflation in Japan dar.
Die reale Lohnfindung (Lohn ohne Besteuerung des Humankapitals und Sozialabgaben) kann nicht nach dem Marktmechanismus bestimmt werden, denn die steuerlich ungleiche Behandlung des Humankapitals und des Kapitals sind schlichtweg nicht zu vertreten, weil die drei Komponenten der Ökonomie gleich behandelt werden müssen: Arbeit (=Humankapital) und Boden (Standort von Rohstoffen) werden versteuert, aber das eingesetzte Kapital sowie Maschinen und sonstiges werden nicht besteuert. Insoweit müsste bei einem neuen Ansatz der Ökonomie die gleichwertige Besteuerung des Kapitals erfolgen.
2.8 Wenn der Markt Zentrum des Wirtschaftssystems ist, welche Rolle spielt der Mensch? Ist der Mensch nicht die Grundlage des Marktes?
Bei jeder Studieneinführung wird einem Studenten der Wirtschaftswissenschaften indoktriniert, dass der Markt das Maß aller Dinge ist. Dies beruht sehr oft auf der angebotsorientierten und neoliberalen Sicht auf die Gesellschaft. Der Mensch ist lediglich ein Marktteilnehmer und wird als Konsument wahrgenommen, beziehungsweise spielt er eine Rolle als Konsument; Kapital und Boden spielen die wesentliche Rolle. Dies kann entgegen den Behauptungen von Friedrich Hayek kein humanistischer Ansatz sein. Zudem erweisen sich diese Annahmen als falsch, wenn man den Gedanken zu Ende denkt. Die Marktteilnehmer sind nun mal Menschen, sei es in der Rolle des Konsumenten oder in der Rolle des Anbieters. Unternehmen und Firmen stellen lediglich die Verpackung für die Rolle des Menschen dar. Daher ist ein Markt ohne Menschen nicht vorstellbar. Wenn der Markt ohne den Mensch nicht vorstellbar ist, heißt das, dass das gesamte Wirtschaftssystem auf dem Menschen basiert.
Daher muss ein neuer Ansatz der Ökonomie gefunden werden, um den Großteil der Belange des Menschen zu berücksichtigen. Da der Mensch jedoch nicht frei von Fehlverhalten ist, bedarf es korrektiver Maßnahmen des Staates. Um jedoch korrektive Maßnahmen des Staates zu ermöglichen, braucht der Staat analog wie der Mensch Einnahmen. Zudem kann nur der Staat gewisse Güter anbieten und produzieren. Der Irrglauben der Neoliberalen und der Monetaristen, dass die Mitwirkung des Staats der Weg zur Knechtschaft darstellt, erklärt sich aus der Zeitgeschichte.
Zeitgeschichtlich darf nie vergessen werden, dass das Erwachen der Monetaristen und Neoliberalen in den 30er und 40er Jahren zum Zeitpunkt der Auseinandersetzungen zwischen liberalen Gesellschaften und kommunistisch orientierten Gesellschaften (Planwirtschaft) stattfand. Es wurde jedoch grundsätzlich ein Denkfehler begangen, denn der tatsächlich gelebte Kommunismus wich erheblich von der Idealvorstellung ab und stellte nichts anderes als das monopolistische Wirken des Staates in Diktaturen dar. Diktaturen unterscheiden sich jedoch grundsätzlich von Demokratien. Dadurch ist jeglicher Vergleich zum Wirken des Staates in kommunistischen Systemen abwegig.
2.9 Ist der neoliberale Ansatz nicht eine Ursache des Zerbröselns der Demokratie?
Der neoliberale Ansatz stellt die Freiheit über alles, zeigt jedoch nicht den Weg zur Freiheit. Der neoliberale Ansatz ohne wirtschaftliche Freiheiten stellt eine leere Hülse dar, denn die Machtposition der einzelnen Marktteilnehmer wird vernachlässigt. Wenn man das Beispiel der Postzusteller genauer anschaut, ist festzustellen, dass diese selbstverständlich in ihrem Handeln theoretisch frei sind; da sie jedoch nur einen Auftraggeber haben, sind sie gezwungen, auf die Konditionen des Auftraggebers ohne die Berücksichtigung ihrer eigenen Interessen einzugehen. Dasselbe gilt für viele Autozulieferer. Sie sind auf einen Autohersteller angewiesen und müssen zwangsweise die Konditionen ihrer Partner annehmen. Wie können solche Leute beziehungsweise Firmen frei sein?
Da sich jedoch in den letzten 40 Jahren die neoliberalen Ansätze in allen westlichen Ländern durchgesetzt haben und eine Globalisierung ohne jegliche Regeln propagiert und durchgeführt wurde, haben große Teile der Bevölkerungen weltweit diese neoliberale Philosophie als Bedrohung empfunden und erfahren. Dieser neoliberale Ansatz der Globalisierung hat weltweit bis auf zwei Länder (Deutschland und China) alle als Verlierer zurückgelassen. Viele dieser Verlierer haben sich inzwischen in autokratischen Bewegungen zusammengeschlossen und sogar Wahlen gewonnen.
In den USA fängt die Regierung an, den Zugang zum Markt einzuschränken, der Brexit in England stellt nichts anderes dar. Die autokratischen Bewegungen mit Front National in Frankreich, Gerd Wilders in den Niederlanden, die PIS in Polen, die Regierungen in Tschechien, Slowenien, Slowakei, Dänemark, Norwegen und Schweden, Podemos in Spanien - sie alle stellen eine Gefahr für die Demokratie dar. Der Irrglauben des neoliberalen Ansatzes, dass Bildungswesen, Sport und Fitness, soziale Netzwerke, Gesundheitswesen und Sicherheit ohne staatlichen Eingriff das wahre Glück bringen, bedeutet für die Gesellschaft und den Einzelnen nichts anderes als Elend und Unterwerfung.
2.10 Ist der neoliberale Ansatz nicht eine Ursache für die Finanzkrise?
Betrachtet man die Ursachen der Finanzkrise mit Blick auf die derzeitige geopolitische und wirtschaftspolitische Lage mit dem stark vorherrschenden Neoliberalismus, so muss festgestellt werden, dass die folgenden Gesichtspunkte maßgeblich zu den Entwicklungen beigetragen haben, die die Finanzkrise ausgelöst haben.
1.Der scheinbar zügellose Glauben an die Erträge der Börsen
2.Die ungezügelte Gier des Menschen, reich zu werden ohne ein Risiko einzugehen und ohne dafür zu arbeiten
3.Die maßlosen Angriffe der Finanzwirtschaft auf die reale Wirtschaft ohne Rücksichtnahme auf Unternehmen, Produkte, Kunden und Mitarbeiter
4.Ein exzessives Angebot theoretischer Ansätze in der Wirtschaftspolitik, ohne für die nötige Nachfrage Sorge zu tragen
5.Die unrealistischen Ziele für die Renditen-Zielsetzung der Unternehmen, ohne Rücksichtnahme auf ihre Umsetzbarkeit
6.Der Versuch, staatliche Strukturen zu schwächen, indem primäre staatliche Aufgaben privatisiert wurden, ohne jedoch den gewünschten Rationalisierungseffekt zu erzielen
7.Durch die Globalisierung wurde die Volatilität des Kapitals in starkem Maße erhöht
8.Das Nomadentum von Unternehmen bei ihrer Standortwahl
9.Das Ranking der Länder bezieht sich nicht mehr auf die reale Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch auf die Besteuerung im jeweiligen Land. Damit verbunden ist der Versuch großer Unternehmen, keine Steuern mehr zu bezahlen.
10.Die Fehlleistung der Investmentbanker, indem sie künstliche Produkte angeboten haben, die sie selber nicht verstanden haben.
Alle diese oben genannten Punkte sind einzeln oder gleichzeitig aufgetreten und dadurch produzierten sie einen Hype der Konsumenten um Finanzdienstleistungsprodukte, die keinerlei Grundlage - sei es in der realen Wirtschaft, sei es in der Finanzwirtschaft - haben.
Dazu haben die Banken in ihrer Gier sowohl in nationalen als auch in internationalen Feldern erhebliche kriminelle Energien entwickelt, um vermeintliche kurzfristige Gewinne zu erzielen. Die Finanzkrise hat jedoch gezeigt, dass dieses Kartenhaus beim kleinsten Unwetter in sich zusammenfällt.
3 Neoliberaler Ansatz - nein danke!
3.1 Vorbemerkung
Geburtsstunde des Neoliberalismus war die Weltwirtschaftskrise 1932/33. Er wurde durch Maßnahmen von Keynes und durch den Keynesianismus zunächst in seine Schranken verwiesen, da bei der Weltwirtschaftskrise eine nachfragebezogene Krise im Vordergrund stand. Das heißt, dass große Teile der Bevölkerung nicht mehr in der Lage waren Güter zu erwerben, denn sie waren zum größten Teil arbeitslos, ihre Ersparnisse wurden durch eine gigantische Inflation aufgefressen und soziale Systeme existierten nur bedingt. Insoweit galt es, durch eine erhöhte Nachfrage des Staates die Arbeitslosigkeit zu vermindern, indem man öffentliche Projekte im Straßen- oder Wohnungsbau, im Bereich der Kriegsmaschinerie oder der Aufrüstung (Einstellungen bei der Armee und den Sicherheitskräften) oder im Aufbau von Gesundheitssystemen (Errichtung von Krankenhäusern) durchführte und mit Hilfe der Zentralbanken oder öffentliche Anleihen diese Projekte finanzierte. Dies war der erste Teil des Keynesianismus.
Der zweite Teil, den alle politischen Klassen vergessen haben, besagt, dass das gesteigerte Einkommen der Arbeiter und die vermehrte Gewinnerzielung der Unternehmen automatisch mehr Steuereinnahmen zur Folge haben. Dadurch wäre der Staat in der Lage die aufgenommenen Schulden zurück zu zahlen. Dies wurde leider in Folge vergessen, denn alle politischen Parteien der freien Welt sahen sich berufen „Wohltaten“ zu vollbringen, die sie nicht besaßen. Dadurch haben sich die Schulden kaum verringert.
Dem gegenüber entstand eine andere Theorie, die sogenannte angebotsorientierte Theorie. Diese besagt, dass das Individuum stets logische Entscheidung trifft und nach dem Prinzip des Homo-Oeconomicus handelt. Der Neoliberalismus ist nichts anderes als ein neuer Liberalismus, der darin besteht, dass Wohlfahrtsstaaten in all ihren Erscheinungsformen abgelehnt werden. Dazu kommen die Ablehnung einer Intervention des Staates in wirtschaftliche Zusammenhänge und der Glaube, dass de facto der Markt den Preis durch Angebot und Nachfrage regelt. Die Anhänger der radikalsten Form des Neoliberalismus waren unter anderem Friedrich A. Hayek und in den 1970er Jahren Milton Friedman mit den sogenannten „Chicago-Boys“.
In den letzten 13 Jahren wurde in Deutschland nach dem Prinzip der neoliberalen Politik erhebliche Armut erzeugt, trotz einer sogenannten Vollbeschäftigung und trotz sogenannter sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze. Die politische Klasse in Deutschland und insbesondere die Kanzlerin Angela Merkel als Vertreterin der neoliberalen Wirtschaftsordnung und ihr Finanzminister Schäuble sind die personifizierten Verfechter dieses Wirtschaftsansatzes. Dabei vergessen sie, dass sich über 3,5 Millionen Mehrfach-Beschäftigte (zwei bis drei Tätigkeiten am Tag) ohne staatliche finanzielle Unterstützung entwickelt haben. Problematisch ist diese Entwicklung dahingehend, dass dieser Teil der Bevölkerung zukünftig in der Altersarmut enden wird. Bedenkt man, dass zusätzlich dazu fast vier Millionen Beschäftigte ihr Einkommen über Hartz IV aufstocken, so muss man davon ausgehen, dass auch diese vier Millionen Menschen in der Altersarmut enden werden.
Bedenkt man, dass zusätzlich sechs Millionen Deutsche im Niedriglohnsektor arbeiten, so muss man davon ausgehen, dass auch diese Mitbürger in der Altersarmut enden werden. Dies bedeutet, dass mindestens 15 Millionen Menschen in Deutschland in die Altersarmut entlassen werden. Wenn die Politik sich gleichzeitig für einen Wirtschaftsboom feiern lässt, so muss man sich fragen, wer die Gewinner der letzten 13 Jahre sind. Bedenkt man, dass sich die Anzahl der deutschen Milliardäre in den letzten 13 Jahren vervierfacht hat und die Zahl der Hartz IV Empfänger (das heißt Sozialhilfeempfänger) sich versechsfacht hat, muss man feststellen, dass die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich stark vorangeschritten ist.
Bedenkt man, dass in den letzten 13 Jahren eine staatlich verordnete Sparpolitik ohne Sinn und Verstand durchgeführt wurde, so muss man feststellen, dass die gesamte technische Infrastruktur des Landes - sei es im Straßenwesen, im Bereich der Wasser- und Luftwege, im Gesundheitswesen, in der inneren und äußeren Sicherheit - einen erheblichen Nachholbedarf an Investitionen hat.
Bedenkt man, dass parallel dazu Sparmaßnahmen bei Forschung und Lehre erfolgt sind, so muss man feststellen, dass die Anzahl deutscher Patente und sonstiger strategischer Forschungen seit dem Zweiten Weltkrieg auf ein Minimum zurückgefallen sind.
Bedenkt man, dass gleichzeitig von der Politik keine Ansätze für eine Bevölkerungspolitik vorgeschlagen werden, muss man die Verschärfung der Konsequenzen für eine alternde Gesellschaft hinnehmen. Auch hier hat die politische Klasse, insbesondere die der Ära Merkel, eine negative Bilanz aufzuweisen.
Bedenkt man, dass der Banken- und Finanzsektor Deutschlands an einer noch nicht ausgestandenen Finanzkrise leidet, so wurden in den letzten 13 Jahren keine wirksamen Mittel zur Verstärkung der Kapitalstrukturen dieser Institute vorgenommen.
Bedenkt man, dass in den letzten 13 Jahren keinerlei Vorbereitung der Gesellschaft auf die technische Revolution der Digitalisierung vorgenommen wurde, so muss man sich fragen wie zukünftige Regierungen in der Lage sein werden, die daraus entstehende massenhafte Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.
Bedenkt man, dass Merkel und ihre Regierung eine Mindestbesteuerung ausländischer und inländischer Weltkonzerne verhindert haben, so haben sie sich an entgangenen Steuermitteln mitschuldig gemacht. Diese Mittel wären wichtig, um notwendige Investitionen zur Vorbereitung einer postindustriellen Gesellschaft vorzunehmen.
Bedenkt man, dass hinsichtlich der Rentengestaltung in den letzten 13 Jahren die notwendigen radikalen Rentenreformen nicht durchgeführt wurden, muss man feststellen, dass die Regierung Merkel Armut im Alter begünstigt hat.
Bedenkt man, dass der Auftritt Merkels in der EU in den letzten 13 Jahren das Gefühl einer deutschen Hegemonie in Europa hervorgerufen hat, darf man sich nicht wundern, dass sich eine erhebliche Anzahl europäischer Länder, die unter dem deutschen Exportüberschuss leiden, nach Alternativen sehnt. Damit verbunden ist ein Auseinanderbrechen der EU. Damit ist Merkels Europapolitik gescheitert und durch ihr Verhalten hat sie vielmehr dazu beigetragen, dass nationalistische Anti-System Bewegungen in fast allen europäischen Ländern entstanden sind.
3.2 Neoliberalismus vs. Postkeynesianismus
3.2.1 Vorbemerkung
Wie oben beschrieben, basiert der Neoliberalismus auf einer sogenannten neuen liberalen Sicht des Menschen, die eigentlich bereits in den Jahren 1932/33 entstand. Als neoliberales Leitbild der Gesellschaft nennt Christoph Butterwegge die Eindämmung des Staates, die Eingrenzung der Demokratie und die Diskreditierung der sozialen Gerechtigkeit. Als wesentliche Vertreter dieser Sicht gelten Friedrich A. Hayek und sein Mitstreiter Milton Friedman. Friedman wurde sogar deutlicher „Indem er die Organisation der marktwirtschaftlichen Aktivitäten den politischen Instanzen entzieht und eliminiert und den Markt als Quelle der Macht ansieht.“2 Hayek bezeichnet die „Entkrönung der Politik“ als Kernanliegen des Neoliberalismus.
3.2.2 Wer war Milton Friedman und welchen Einfluss hatte er?
Milton Friedman (1913 in New York-2006 in San Francisco) wurde 1913 in New York als Sohn jüdischer Einwanderer aus Österreich-Ungarn geboren. Sein Vater war Geschäftsmann, seine Mutter Näherin. Friedman war in seiner Generation von Akademikern und Intellektuellen ein Außenseiter, denn er vertrat den Kapitalismus sowie eine uneingeschränkte Identifikation mit der Geschichte der USA. Antikommunistisch ließ er sich während des Zweiten Weltkriegs zu einem gemäßigten Keynesianismus verführen. Mit seinem Eintritt in die Chicagoer Schule unter dem Ökonomen Frank Night und seiner Laissez-faire Tradition wurde er zu einem der größten Verfechter des Kapitalismus. Kritik von der Linken und der amerikanischen Gesellschaft waren ihm zuwider, denn er sah sich zur der Rehabilitation des Kapitalismus berufen. Er selbst definierte sich als klassischer Liberaler. Mit der Mont-Pelerin-Society (MPS) in der Schweiz nahm er an einem internationalen Netzwerk liberaler Ökonomen und Intellektueller teil, die sich der Verteidigung des Prinzips der Freiheit verschrieben hatten.
Freihandel und internationale Arbeitsteilung sind nach Friedmans Überzeugung Voraussetzungen für den Reichtum. Wirtschaftsnationalismus war ihm ein Gräuel. Er war einer der Hauptgegner jeder Art von Protektionismus. Friedman dachte global und sorgte dafür, dass seine politischen Ideen und Ziele weltweit großen Anklang fanden. Er war Bewunderer der deutschen sozialen Marktwirtschaft, aber gleichzeitig ein Verfechter von Wirtschafts-Honkong und den Tiger-Staaten. Sein Verhältnis zu dem Österreicher Friedrich A. Hayek, dem anderen großen Liberal-Ökonomen, war so eng wie nur möglich. Friedman bewunderte den Österreicher als liberal-sozialen Philosophen, hielt von seiner Geld- und Konjunkturtheorie jedoch nur wenig. Die beiden Männer vermieden jedoch den offenen Bruch. Zu erwähnen ist, dass Hayek mit seinem Vortrag anlässlich der Verleihung des Nobelpreises im Jahr 1974 eine Grundsatzkritik an methodischen Positionen präsentierte, denen Friedman sich verbunden fühlte. Die wirtschaftstheoretischen Ansätze trennten die beiden Männer, ihre liberalen Überzeugungen machten sie jedoch zu glühenden Vertretern der individuellen Freiheit.
Der Name Friedmans ist sehr eng mit der „Chicago School“ verknüpft, die man zeitweise als Rom der Wirtschaftswissenschaften bezeichnet hat und die mehrere Wirtschaftsnobelpreisträger hervorbrachte. Diese Bewegung entstand nach dem Zweiten Weltkrieg und wurde mit dem Widerstand gegen den Keynesianismus verknüpft. Friedman lehrte in den 1950er Jahren vor allem die Preistheorie und in den 1960er Jahren die Geldtheorie. Mit seinem Buch „Monetary History of the United States“ erlangte Friedman weltweite Bekanntheit, sogar keynesianische Ökonomen wie James Tobin verfassten Vorworte in seinen Werken. Dieses Buch wurde als eines der einflussreichsten ökonomischen Bücher des 20. Jahrhunderts bewertet. Friedman wurde 1969 13. Nobelpreisträger in den Wirtschaftswissenschaften. Als Begründung galten seine wissenschaftlichen Leistungen im Bereich der Konsumfunktion, Geldgeschichte, Geldtheorie sowie sein Beitrag zur Stabilitätspolitik. Milton Friedman war neben John Maynard Keynes einer der einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Seine Anhänger waren Ronald Reagan, Englands Premierministerin Margaret Thatcher, die deutsche Bundesbank, die Militärdiktatur in Chile, die Reformkommunisten Chinas sowie die „Chicago Boys“ unter Boris Jelzin in Russland.
3.2.3 Wer waren die „Chicago Boys“?
Ursprünglich waren die „Chicago Boys“ eine Gruppe chilenischer Wirtschaftswissenschaftler, die von 1956 bis 1970 an der Universität Chicago studierten und sich als „geistige Söhne“ von Friedrich August von Hayek (die Österreicher Schule) und Milton Friedman sahen. Mit dem Putsch von Augusto Pinochet in Chile wurden sie sehr einflussreich. Maxime dieser Ökonomen war es, die Privatisierung staatlicher Organisation voranzutreiben, um jegliches staatliches Eigentum zu deregulieren. Kritische Betrachter sahen die in Chile durchgeführten Reformen als ein wichtiges Experiment unter realen Bedingungen, um damit Aufschlüsse über wirtschaftsliberale (neoliberale) und monetaristische Ansätze zu erhalten und wesentliche Aussagen machen zu können. Der Einfluss der „Chicago Boys“ war enorm, da kurzfristige Erfolge sichtbar waren. Von 1956 bis 1964 durchliefen zunächst 26 chilenische Wirtschaftswissenschaftler die Ausbildung an der Universität von Chicago. Später stieg ihre Zahl auf 100 Personen an. Diese Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern wurde 1970 unter dem Begriff der „neuen Rechten“ zu einer politischen Kraft.
Sie waren zudem eine wesentliche Kraft, um gegen Salvador Allende zu wirken. Nach nicht offiziell bestätigten Informationen betrieben die „Chicago Boys“ die Vorbereitungen zum Putsch durch Augusto Pinochet. Fest steht, dass zwischen 1975 und 1985 radikale Reformen in Chile durchgeführt wurden, die eine erhebliche Spaltung der Gesellschaft zur Folge hatten. Dem Ansatz Friedmans, dass die gigantische Inflation eine Schock-Behandlung erfordere, wurde zwar gefolgt, der Erfolg blieb jedoch aus. Nach Ansicht von Friedman war die Rezession von 1975, die immerhin zu einer Schrumpfung des BIP (Reichtum, den ein Land in einem Jahr produziert) um 13% führte, jedoch aufgrund der Absenkung des Wachstums der Geldmenge von einem gewissen Erfolg gekrönt.
Während die Inflation in Chile 1973 (das heißt zum Zeitpunkt des Putsches durch Pinochet) bei 518% lag (einer der wesentlichen Gründe dafür war der Wirtschaftsboykott der USA gegen Chile insbesondere für Lebensmittel und Erdöl, denn die US-Regierung befürchtete, dass Chile eine Basis für die Sowjetunion werden könnte), lag sie 1981 bei 9,5%. Dafür stieg die Armut 1981 auf 42,5% der Bevölkerung. 1973 waren 14,7% der Bevölkerung arm gewesen. Die „Chicago Boys“ standen während ihrer Tätigkeiten für Pinochet in engem Austausch mit Angehörigen der Chicagoer Schule. So statteten sie Friedman, Hayek und Arnold Hartberger (ein wesentlicher Kopf der Monetaristen) mehrere Besuche ab. Hayek wurde sogar Ehrenpräsident des „Centro de Estudios Publicos“ in Chile und Friedman hielt mehrere Vorträge im staatlichen Fernsehen. Hayek rechtfertigte bei jeder Gelegenheit die Etablierung der Diktatur zur vorübergehenden Durchsetzung wirtschaftlicher Freiheiten, die als Grundlage des Liberalismus nötig seien.
Fest steht, dass Milton Friedman zwar sehr oft mit den „Chicago Boys“ in Verbindung gebracht wird, er hat jedoch nie eine offizielle Beraterfunktion und keinen direkten Einfluss auf Pinochet gehabt. Friedman lobte die Maßnahmen der „Chicago Boys“ jedoch ausdrücklich und hob die Maßnahmen zum Rückbau der Staatsquote (Steuererhebung, Rentenreform, Gesundheitsreform) hervor. Die marktliberalen Prämissen der „Chicago Boys“ gründeten auf Milton Friedmans Lehre und insbesondere auf dem Leitspruch „Kapitalismus und Freiheit“. Während der Diktatur Pinochets mussten chilenische Ökonomen, die den „Chicago Boys“ kritisch gegenüber standen, in internationalen oder privaten Forschungsinstituten unterkommen.
3.2.4 Einflussnahme der „Chicago Boys“ in Lateinamerika und weltweit
In den 1980er und 1990er Jahren konnten Ökonomen, die in Chicago ausgebildet wurden, in lateinamerikanischen Staaten mit autoritären Regimen an Einfluss gewinnen. Unter diesen Ökonomen waren der spätere Präsident Mexikos Carlos Salinas, der die radikale Marktwirtschaft durchsetzte, oder Carlos Menem, späterer Staatspräsident Argentiniens. Nach der Wahl Ronald Reagans zum US-Präsident wurde die Philosophie der „Chicago Boys“ als neue regelorientierte Wirtschafts- und Geldpolitik maßgebend. Der Machtzuwachs Friedmans und der „Chicago Boys“ war so groß, dass die Weltbank in den 1980er Jahren Chile als Vorbild politischer und ökonomischer Reformen für Entwicklungsländer sah. Dies wurde 1998 durch den Aufstieg von Joseph Stiglitz in der Weltbank als Fehler erkannt und seither versucht man, andere Ansätze zu verfolgen.
3.2.5 Zur Bewertung von Milton Friedman und den „Chicago Boys“
Oft wurden Anfang der 1980er die „Chicago Boys“ für die Finanzkrise mitverantwortlich gemacht. Dies ist zu relativieren, denn sie haben zwar die Weichen für diese Entwicklung gestellt, aber die Krise nicht ausgelöst. Unbestritten ist der bleibende Erfolg dieser wirtschaftlichen Schule, die besagte, dass die Stabilität des Geldwertes eine Voraussetzung für das Wachstum der Wirtschaft in Chile war. Die langfristige Bilanz ist jedoch, dass das Wirtschaftswachstum Chiles zwischen 1981 und 1990 nur um die 2,7% betrug. Analoge Zahlen sind für Brasilien, Mexiko, Venezuela, Argentinien und Peru zu beobachten.
Es ist festzustellen, dass die „Chicago Boys“ während der Privatisierung zwischen 1975 und 1978 in großem Umfang Staatsunternehmen unter Wert verkauft haben. Die Teilprivatisierung des Gesundheitssystems bewirkte, dass ein großer Teil der Bevölkerung keinen Zugang mehr zur Krankenversicherung hatte. Die Zuzahlungen waren so gigantisch, dass nur wenige Menschen in der Lage waren diese Summen aufzubringen. Es ist weiterhin festzustellen, dass die Arbeitslosigkeit vor dem Putsch in Chile bei 4,7%, 1982 jedoch bei 25% lag. Folgende Zahlen sind noch ernster: Während 1969 den 20% der Armen 164$ pro Jahr für Nahrungsmittel zur Verfügung hatten, waren es 1978 nur noch 113$. Die 20% der Reichsten hatten 1969 862$, 1978 1.113$ zur Verfügung (Diese Zahlen beziehen sich auf die monatlichen Konsumausgaben).
Analoge Verhältnisse waren während des Zusammenbruchs der UdSSR zu beobachten. Die Folge war ein Verscherbeln von Staatsbetrieben weit unter Marktwert, eine Verschlechterung der Situation der ärmeren russischen Bevölkerung hinsichtlich Einkommen und Konsumausgaben sowie eine unwahrscheinliche Bereicherung durch sogenannte „Oligarchen“, die sich auf dubiose Art und in kürzester Zeit (manchmal in weniger als 6 Monaten) vollzogen hat. Analoge Vorgehensweisen wurden aber auch in Deutschland, mit der Eingliederung der früheren DDR in West-Deutschland, sichtbar. Dort hat die Treuhandanstalt (wenn auch etwas geordneter) auch die Privatisierung des Eigentums, ebenfalls oft unter Marktwert, vorangetrieben und auch dort wurden einige „Wessis“ und „Ossis“ ganz plötzlich sehr reich. Auch dort wurde eine relative Verarmung eines großen Teils der Bevölkerung in Kauf genommen.
Als wesentliche Komponente des Werkes von Milton Friedman gilt die Beschäftigung mit der Geldtheorie und der Geldpolitik, daher der Name Monetaristen. Einer der Anhänger Friedmans Geldpolitik war und ist die Deutsche Bundesbank. Friedman hat nach dem Ende des dritten Bretton-Woods-Systems die Aufnahme flexibler Kurse vorgeschlagen, um Exporte zu besteuern. Dafür erhielt er 1976 den Nobelpreis. In den 1940er Jahren entwickelte er eine geldpolitische Gegenposition zu Keynes, die nur auf der Quantitätstheorie beruhte. Man muss feststellen, dass der Monetarismus (Friedman) sich aus der Kontroverse mit Keynes entwickelt hat. In den folgenden Gesichtspunkten unterscheiden sich die Theorien grundlegend: Zunächst bezüglich der Definition von Geld und Zinsen. Während Keynes Zins als Preis des Geldes betrachtet, sah Friedman den Zins als den Preis des Kredits und die Veränderung des Preisniveaus als Preis des Geldes.
Ein weiterer Gesichtspunkt unterschied die beiden Richtungen: Während Keynes staatliche Eingriffe befürwortete, sind die Monetaristen fiskalpolitischen Eingriffen gegenüber vollkommen abgeneigt, denn sie unterstellen, dass Maßnahmen wie Konjunkturpakete im Grund eine zu vernachlässigende Wirksamkeit haben und dass im Ernstfall nur private Investitionen Konjunkturen ankurbeln könnten. Bei der Finanzierung mit Hilfe der Geldschöpfung, so Friedman und seine Schule, stünde jedoch kein fiskalpolitisches sondern ein geldpolitisches Instrument zur Verfügung.
Dem gegenüber stand John Maynard Keynes (1883-1946).
3.2.6 Wer war Keynes und welchen Einfluss hatte er?
Als Sohn eines politischen Ökonomen wurde er 1883 in Cambridge geboren. Er studierte Mathematik, Philosophie, Geschichte und Ökonomie und promovierte 1906 in der Wahrscheinlichkeitstheorie. 1909 wurde er am Kings College zum Dozenten ernannt. Keynes war liberales Mitglied der Eugenics-Society und anschließend auch Direktor der Gesellschaft. Hierfür wurde er sehr stark kritisiert, da diese Gesellschaft Einfluss auf die englische Politik nahm. Nach Beendigung seiner Tätigkeit beim „India Office“ ging er nach Cambridge zurück, wo er Volkswirtschaft lehrte. Er war äußerst skeptisch hinsichtlich neoklassischer Ökonomen, die Mathematik anwandten. Nach dem Ersten Weltkrieg war Keynes als Vertreter des britischen Schatzamtes an den Verhandlungen zum Versailler-Vertrag beteiligt, trat jedoch aus Protest kurz vor dem Ende der Verhandlungen zurück, denn er hielt die Deutschland auferlegten Vertragsbedingungen für katastrophal (die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrags von 1919). Er sagte voraus, dass sich die Wirtschaftsbeziehungen destabilisieren würden und dass der Vertrag großen sozialen Sprengstoff für Deutschland beinhalte. Sein Leben lang beriet Keynes die Politik. So war er beispielsweise britischer Chefhändler bei den Bretton-Woods Verhandlungen im Jahr 1944. Sein Ziel war es, ein Fixkurssystem zwischen den Währungen ohne direkten Bezug zum Goldstandard zu etablieren. Seine allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes (1936) veränderte die Makroökonomie grundlegend und wird als einflussreichstes Werk des 20. Jahrhunderts angesehen. Keynes versuchte in diesem Buch davon zu überzeugen, dass im Gegensatz zu der Laissez-faire Marktwirtschaft die Wirtschaftspolitik des Staates eine entscheidende Rolle spielt. Seine Ideen sind Grundsteine des heutigen Keynesianismus.
Keynes bezeichnete den Goldstandard von 1923 als „barbarisches Relikt“ und befürchtete, dass die Rückkehr zum Goldstandard Konjunktur und Arbeitsplätze bedrohen würde. Im Gegensatz zu den Neoklassikern (Neoliberalen) glaubte Keynes, dass eine Deflationspolitik der Notenbanken Preise und Löhne nicht automatisch senken, sondern Arbeitslosigkeit hervorrufen würde. Knappes Geld sei sinnvoll zur Beendigung eines Booms, dürfe aber keine Inflation hervorrufen. Die Weltwirtschaftskrise von 1931 war für Keynes die Folge falscher „makroökonomischer Steuerungen“ auf globaler Ebene. Keynes verglich sich darin mit Kassandra, da die Prophezeiung seines Essays erfolgreicher war als sein Versuch, von einer Rückkehr zum Goldstandard zu überzeugen. Keynes sah sich als Vertreter einer marktwirtschaftlichen Ordnung mit individuellen Freiheiten. Er stimmte den Thesen und der Kritik durch die Vertreter des Wirtschaftsliberalismus nicht zu. Auch war er zwar mit Hayek befreundet, aber erbitterter Gegner seiner Wirtschaftspolitik.
Die zentrale Botschaft von Keynes war, dass flexible Preise und Löhne nicht automatisch zu einer Vollbeschäftigung führen. Vielmehr kann es auch langfristig zu einer Unterbeschäftigung kommen und in diesem Fall sollten Staat und Notenbanken eingreifen, um die gesamte wirtschaftliche Nachfrage auf ein normales Niveau zurückzuführen. Wenn jedoch der Einzelne mehr spart, steigen Vermögen und Einkommen. Dies macht jedoch ohne ausreichende Investitionsnachfrage keinen Sinn, wenn Güternachfrage, Produktion und Beschäftigung und damit auch das Einkommen sinken.
3.2.7 Die Entwicklung in den 1970er Jahren
Der Monetarismus gewann vor allem in den 1970er und 1980er Jahren massiv an Einfluss, sei es bei der Weltbank, in Südamerika, in Deutschland. Denn der Keynesianismus scheiterte an der Entwicklung der Stagflation. Das heißt, dass selbst zum niedrigsten Preis keine Nachfrage mehr vorhanden ist und dass staatliche Konjunkturhilfen ins Leere laufen. 1974 begann die Deutsche Bundesbank als erste Notenbank den monetaristischen Ansatz der Geldmengensteuerung umzusetzen. Das Ziel war die Kontrolle des Preisanstiegs über die Geldmenge zu erreichen. Dahinter steht folgendes: Dem Monetarismus zufolge soll die Geldmenge so gesteuert werden, dass sie das Wachstum volkswirtschaftlicher Produktion ausweitet. So entstand die Idee, dass von geldpolitischer Seite her Finanzierungsvorgänge ermöglicht werden, die schließlich zu Wachstum führen. Die europäische Zentralbank hält immer noch an diesem monetaristischen Ansatz fest, während die USA in den letzten Jahren eher mit der keynesianischen Zinspolitik gearbeitet haben.
3.2.8 Mittlerweile ist eine Mischform hoch im Kurs
Betrachtet man die beiden wirtschaftswissenschaftlichen Ansätze so muss man feststellen, dass sie in geschlossenen Gesellschaften einen gewissen Erfolg oder Misserfolg erzielten, im Kontext der Globalisierung jedoch zum größten Teil scheitern. Betrachtet man die aufstrebenden Staaten, so muss man feststellen, dass marktwirtschaftliche Ansätze stets mit erheblichen staatlichen Interventionen verknüpft sind. Eines der besten Beispiele stellt China dar: Mit einem quasi gelenkten Wirtschaftssystem, das neben monetaristischen und keynesianischen Gesichtspunkten auch Gesichtspunkte enthält, die nicht von den beiden Theorien gedeckt werden, und zwar die politisch-strategischen Entscheidungen. Diese politisch-strategischen Gesichtspunkte, die sehr oft in geopolitischen und sozialen Umwälzungen ihren Niederschlag finden, werden bei beiden Ansätzen nicht abgedeckt. Die weltweite Vernetzung der Informationstechnologie und die weltumspannende Kommunikation erlauben es nicht mehr, monetaristische oder keynesianische Ansätze in Reinform anzuwenden. Zudem unterschätzen die beiden Ansätze die Rolle der Verhaltenstheorie bei Entscheidungen. Es ist daher notwendig, dass neue Wirtschaftsansätze entstehen, die beide Ansätze berücksichtigen, jedoch auch einen gewissen Behaviorismus enthalten. Denn ohne diesen werden Prognosen kaum noch möglich sein.
Ein weiterer Punkt ist die soziale Sensibilität der Völker. Da jede Wirtschaftsentscheidung eines Staates unmittelbare soziale Folgen hat, können politische Strömungen entstehen, die die freiheitlichen Gedanken der Neoliberalen zunichtemachen.
Wendy Brown (Professorin in Berkeley) betont sogar, dass der gesamte neoliberale Ansatz auf Dauer die Demokratie zerstört und dass er sowohl Staat als auch Menschen verändert. Es ist sehr oft zu beobachten, dass demokratische Prozesse nicht nach rationalen Gesichtspunkten entschieden werden und dass sachliche Fakten immer mehr gegenüber sogenannten Fake-News verlieren. Die Spaltung der Gesellschaft durch den monetaristischen Ansatz und die Befürwortung einer vorübergehenden Aussetzung der Demokratie, um wirtschaftliche Ziele zu erreichen - insbesondere bei der Bekämpfung der Inflation, stellt an sich einen Sprengstoff für jede moderne Gesellschaft dar.
Der Zielkonflikt zwischen Vollbeschäftigung und Inflation darf aus Sicht des Autors nicht zu Lasten der Beschäftigung gehen. Der angebotsorientierte Ansatz der Neoliberalen, das heißt dass jedes Produkt seinen Absatz findet, vorausgesetzt, dass es den nötigen niedrigen Preis erhält, kann bei stringentem Denken zum Absurdum führen. Denn wenn das Einkommen zu niedrig ist, so dass die Nachfrage nicht befriedigt werden kann, kann der Absatz nicht erfolgen. Daher ist es notwendig den neoliberalen Ansatz mit der Einbringung einer weiteren Variablen, dem Mindesteinkommen, zu korrigieren.
Weitere Probleme können die oben genannten Ansätze nicht lösen: Die massiv zu erwartende Arbeitslosigkeit sowohl in Europa als auch in den USA aufgrund der technischen und digitalen Revolution. Die digitale und die gentechnikorientierte Revolution werden dazu führen, dass sich für eine längere Zeit ein fester Satz Arbeitslosigkeit in den Entwicklungsländern verbreiten wird. Diese Arbeitslosigkeit kann nur bekämpft werden, indem man Marshall-Pläne für unterentwickelte Kontinente bereitstellt. Die Konzeption eines solchen Marshall-Plans, zum Beispiel für Afrika, stößt jedoch in der unfähigen politischen Klasse und insbesondere der Ära Merkel auf heftigen Widerstand.
Eine weitere Gefahr für den monetaristischen Ansatz besteht darin, dass der globale Finanzmarkt die Wirkung von Zentralbanken relativ beschränkt hat.
Dies ist aktuell (2016/2017) zu beobachten, denn eines steht fest: Alle Zentralbanken haben durch eine außerordentliche Verbreitung der Geldmenge die Zinsen gegen Null geführt. Dies hat nicht den gewünschten Erfolg für das reale Wachstum der Weltwirtschaft herbeigeführt – selbst Japan leidet seit über zehn Jahren unter einer Deflation und hat seit zehn Jahren eine Null-Zins-Politik. Das Bemühen der Zentralbanken, durch niedrige Zinspolitik die Währungen so schwach wie möglich zu halten, hat zur Folge, dass sich die Staaten gegenseitig blockieren. Gigantische Exportschüsse (bis auf wenige Ausnahmen) sind nicht die Regel. Weiterhin ist zu beobachten, dass die neoliberale Politik sehr oft zu einer Oligopolisierung des Marktes führt. Das heißt, dass die Anzahl kleiner und mittelständischer Unternehmen zu Gunsten größerer Konglomerate ständig abnimmt. Dies führt häufig zu einer Katastrophe.
Der neoliberale Ansatz hat spätestens beim zunehmenden Aufkommen von Autokratien seine Grenzen erreicht. Der neoliberale Ansatz hat weiterhin das ernstzunehmende Problem, dass die Spaltung zwischen Reich und Arm in allen westlichen Gesellschaften in den letzten 30 Jahren erheblich zugenommen hat. So beobachtet man in allen westlichen Ländern und selbst in China die Vermehrung von Kapital-/Eigentums-Milliardären. Demgegenüber befindet sich der größte Teil der Bevölkerung in einer zunehmenden Armut. Das Aufwachsen eines Mittelstandes wird nur noch selten beobachtet. Daher ist zu befürchten, dass langfristig der reine Ansatz des Neoliberalismus eher zu sozialen Unruhen führt und damit autokratische Wege vorzeichnet.
3.2.9 Fazit
Um wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenhänge zu verstehen, ist es sehr wichtig, die zwei grundsätzlichen Richtungen der Wirtschaftswissenschaften, die eine unmittelbare Auswirkung auf das soziale und politische Umfeld haben, klar zu beschreiben und ihre Unterschiede herauszuarbeiten. Der Autor bekennt sich dazu, ein Post-Keynesianer zu sein, jedoch in Verbindung mit Ansätzen der Verhaltenstheorie.
In der heutigen globalisierten Welt reichen die Machtbefugnisse der Zentralbanken nicht mehr aus, um geo- und wirtschaftspolitische Ziele zu steuern. Mit dem Aufstieg der BRICS Länder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) ist eine zweite Elite an Staaten herangewachsen, die zwar punktuell beide wirtschaftswissenschaftlichen Ansätze berücksichtigt, jedoch sehr oft große nationalistische und geopolitische Ziele verfolgt. Die geopolitischen Ziele können dabei durchaus Vorrang vor der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes haben. Zudem kommt in diesen Ländern der neoliberale Ansatz nicht mehr zum Tragen, denn er setzt Liberalität als einen Grundpfeiler der Gesellschaft voraus. Dazu kommt, dass die Instrumente der Zentralbanken hinsichtlich der Steuerung der Geldmengen nur bedingt einsetzbar sind, was sich an der heutigen Politik der EZB zeigt. Es muss festgestellt werden, dass die frühere Implementierung des neoliberalen Ansatzes nach Butterwegge aus vier Schritten besteht3:
1.Einer übergeordneten Ideologie und Präsentation des Neoliberalismus als Projekt der Befreiung der Moderne;
2.Dem dauerhaften „Kampf um die Köpfe“ durch permanente Propaganda für die Vorzüge einer freien Marktwirtschaft und gleichzeitige Diskreditierung der Kritiker;
3.Der systematischen Politikbeeinflussung im Sinne des neoliberalen Projekts durch staatliche wie private Bildungs-, Beratungs- und Lobbyinstitutionen (Think Tanks);
4.Der Absicherung und Dynamisierung marktwirtschaftlicher Reformen durch unterschiedliche Formen institutioneller Verankerung.
Der Neoliberalismus stellt nicht nur eine Wirtschaftsform, sondern vielmehr ein neues Denken in Bezug auf die Bestimmung des Verhältnisses von Staat, Bürgern und Wirtschaft dar. In allen Bereichen des Lebens ist eine Neuordnung des Denkens erforderlich, was wiederum mit fatalen Folgen für die Demokratie verbunden sein kann. Politik, Recht, Kultur, Bildung, Familie und Geschlechterrollen werden von diesen Ansätzen betroffen sein. Das alte und uns bekannte Ideal des „Homo Politicus“, der sich für Gemeinwesen, Kultur, usw. engagiert, wird durch den „Homo Oeconomicus“ ersetzt, der das Humankapital als eine Komponente der Wettbewerbsfähigkeit ansieht. Damit wird das Volk als Zusammenschluss von Bürgern (ohne wirtschaftliche Bewertung) und somit auch eine Grundlage der Demokratie abgeschafft. Alle Gesichtspunkte unseres Lebens werden nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit bewertet und soziales und politisches Engagement wird ad absurdum geführt.
Indem die Jungen Liberalen die Philosophie eines starken Staatswesens ablehnen, ermöglichen sie die Bildung von Oligopolen und Monopolen, die sich nur dem Kapital verpflichtet fühlen. Hier ist zu beachten, dass sich immer mehr multinationale Konzerne der Steuerpflicht entziehen und ihren Ursprungsländern die Finanzierung des Gemeinwesens vorenthalten, gleichzeitig aber dessen Infrastrukturen zu Nullkosten nutzen.
Dies zeigt, dass ein schleichender demokratischer Abbau stattfindet. Wenn sich plötzlich stark vermögende Kapitalbesitzer nur über ihre privaten Stiftungen an sozialen Aufgaben beteiligen, so muss die Machtfrage im Land gestellt werden. Die Gefahr des neoliberalen Ansatzes besteht in der Ablehnung eines starken Staates. Trotz Wirtschaftskrisen und dem Ausblenden ihrer Ursachen verstärkt sich der Trend hin zu einer schleichenden und demokratiezerstörenden Revolution. Betrachtet man die jetzigen Anti-System Bewegungen und politischen Strömungen, die möglicherweise als Reaktion der Verlierer anzusehen sind, so kann die These aufgestellt werden, dass der Neoliberalismus eine wesentliche Ursache des Demokratieabbaus darstellt.
Der Autor hat sich von Wendy Browns „Die schleichende Revolution. Wie der Neoliberalismus die Demokratie zerstört“ inspirieren lassen.
3.3 Die Globalisierung
3.3.1 Vorbemerkung
Kein anderes wirtschaftliches und politisches Thema wird so heftig und kontrovers diskutiert wie die Globalisierung. Für die Einen trägt die Globalisierung Schuld an allen wirtschaftlichen und sozialen Problemen der Welt, für die Anderen stellt sie einen Segen für die Weiterentwicklung sowie für eine zukunftsorientierte bessere Welt dar. Nach langjährigen Untersuchungen ist der Autor zu dem Schluss gekommen, dass weder die Pessimisten noch die Optimisten allein Recht haben. Allerdings ist festzustellen, dass die heutige Globalisierung ohne jegliche wirksame Kontrolle eine Verarmung des größten Teils der Weltbevölkerung zur Folge hat, was wiederum zu sozialer und politischer Instabilität führt. Die Annahme, dass die Wirtschaft die Globalisierung geboren hat, ist weit verbreitet. Es sind jedoch vielmehr politische und geopolitische Entscheidungen mehrerer Regierungen, die als Geburtshelfer der heutigen Globalisierung angesehen werden können.
Ein weiterer Irrtum besteht darin zu glauben, dass die Globalisierung eine Erscheinung der Neuzeit ist. Die Globalisierung hat eine sehr lange Geschichte, was vor allem im Hinblick auf den Handel alter Mächte und Zivilisationen deutlich wird. Schon die Perser haben Handel getrieben und Städte rund um das Mittelmeer gegründet, die Phönizier haben ebenso wie die Chinesen und Inder sowie die Griechen und Römer das gleiche getan. Weiterhin ist nicht zu vergessen, dass die Eroberung fremder Kontinente bereits durch Columbus, Vasco da Gama oder Magellan vorangetrieben wurde und dass damit internationaler Handel begann. Nicht zu vergessen sind auch Francis Drake und die englische koloniale Ausbreitung in der Welt. Die Kolonien des englischen Empire (inklusive der USA und Kanada), die französischen Kolonien in Afrika, Mittelamerika und USA und die Gründung von Kontoren in Asien oder Afrika durch die Europäer hatten entweder die Ausbeutung der Länder hinsichtlich der Rohstoffe und Menschen (Sklavenkauf in Afrika) oder den Handel und Austausch von Produkten zum Ziel. Daher kann man feststellen, dass eine Art „Globalisierung“ bereits sehr früh vorgelebt wurde.