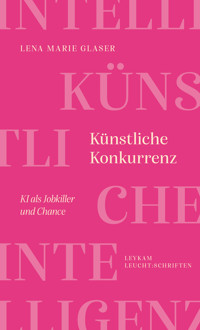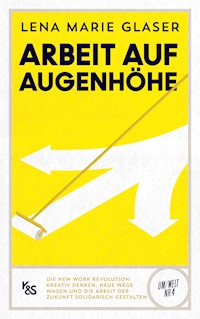
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es rumort auf dem Arbeitsmarkt. Junge Menschen fordern selbstbewusst ein wertschätzendes Betriebsklima, Teilzeitstellen und Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Auch wenn dies Vorgesetzten dreist erscheinen mag – "Sollen sie doch erst einmal etwas leisten!" –, sind die oft gescholtenen Millennials damit einer wichtigen Sache auf der Spur: dem Konzept der New Work. Aber was heißt das? Lena Marie Glaser setzt sich seit einigen Jahren mit diesem notwendigen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel auseinander: Wie wollen wir heute und in Zukunft arbeiten? Wie formen wir unsere Jobs, und nicht umgekehrt? Wann lässt uns Arbeit aufblühen – und wann verdorren unsere Fähigkeiten? Mit Herz, Verstand und Know-how tritt Glaser ein für ein Arbeitsumfeld, das Kernkompetenzen wie Empathie, Vertrauen und Offenheit fördert. Sie zeigt uns außerdem, warum eine vermeintlich perfekte Work-Life-Balance kein Allheilmittel ist, warum wir es wagen sollten, unser kreatives Potenzial voll auszuschöpfen – und warum der beste Job nichts nutzt, wenn er freudlos abgesessen wird und erschöpft. "Ich lade dazu ein, die Arbeitswelt gemeinsam so zu gestalten, wie wir sie haben wollen, mit Lebensfreude, Sinn und Leichtigkeit."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UM/WELTNR.4
LENA MARIE GLASER
ARBEIT AUF AUGENHÖHE
DIE NEW WORK REVOLUTION:
KREATIV DENKEN, NEUE WEGE WAGEN UND DIE ARBEIT DER ZUKUNFT SOLIDARISCH GESTALTEN
Für alle,
die ihre Arbeitswelt der Zukunft mitgestalten wollen
DANKE AN
meine Mama, Maria Glaser, Sozialarbeiterin und Bücherliebhaberin, die mich mit ihrem Engagement und Sinn für soziale Gerechtigkeit grundlegend geprägt hat. Sie war auch für dieses Buch meine erste Gesprächspartnerin, hat mich unaufhörlich mit allen wichtigen Büchern und vielen Artikeln versorgt und ist immer eine liebevolle Begleiterin. Das Basislager dafür sind mein Papa und mein Bruder, die immer für mich da sind, wenn ich sie brauche, und auch für dieses Buch wichtige Gesprächspartner waren. Außerdem bedanke ich mich bei meinen Freund:innen und Unterstützer:innen, die mich auf meiner Reise der letzten Jahre immer wieder ermutigt haben. Danke auch an die Expert:innen, Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen, die offen ihr Wissen mit mir teilen und diskutieren. Außerdem bedanke ich mich herzlich bei meinen Coach:innen, Berater:innen und Mentor:innen für ihre Zeit und Begleitung. Danke an alle Journalist:innen, die mir die Möglichkeit geben, mit meiner Arbeit immer mehr Menschen zu berühren und sie dafür zu begeistern, selbst diese Arbeitswelt aktiv mitzugestalten. Zum Schluss: Danke an die einzigartige Lektorin und Verlagsleiterin Stefanie Jaksch (Kremayr & Scheriau), dass du so vielen beeindruckenden Frauen die Plattform bietest, ihre wichtigen Perspektiven zu teilen. Ich bin glücklich, dass du mich eingeladen hast, dieses Buch zu schreiben. Danke für dein Vertrauen!
INHALT
1.PROLOG
2.ARBEIT AUF AUGENHÖHE?!
3.BURN-OUT UND DIE SINNKRISE
4.WIE SICH ARBEIT VERÄNDERT
5.MILLENNIALS WOLLEN ANDERS ARBEITEN
6.DIE NEW WORK REVOLUTION
7.TOOLBOX FÜR DIE PRAXIS
8.BLICK IN DIE ZUKUNFT
9.MEIN PLÄDOYER
10.LITERATUR UND LINKS
1.
PROLOG
Diesen Nachmittag werde ich nie vergessen: Ich saß im farblosen Besprechungsraum unseres Büros im Ministerium, in dem ich acht Jahre als Juristin gearbeitet habe. Meine Stimmung war wieder einmal am Tiefpunkt. Ich war nur mehr genervt, zugeschüttet mit Aufgaben, die ich nur widerwillig erledigte. In diesem Umfeld fühlte ich mich wie in einem goldenen Käfig, aus dem ich nicht ausbrechen konnte. Jeden Tag fuhr ich mit Bauchweh in die Arbeit. Ich wusste, ich will anders arbeiten, ich muss hier raus!
Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen, holte mein lang vorbereitetes Kündigungsschreiben aus der Schublade und machte mich auf den Weg zu meiner Chefin. Ich war überzeugt, heute den richtigen Schritt zu wagen. Und heute konnte mich niemand, wirklich niemand mehr davon abhalten. Ab sofort würde ich mein Leben selbst in die Hand nehmen und ganz bewusst entscheiden, wie ich arbeiten und leben würde. Ich konnte es noch nicht ahnen: Mein Leben sollte sich bald um 360 Grad drehen.
2.
ARBEIT AUF AUGENHÖHE?!
„UM EINE GERECHTERE, NACHHALTIGERE UND SOZIALERE GESELLSCHAFT ZU ENTWICKELN, BRAUCHEN WIR EINE NEUE ART DES DENKENS. DAS WIEDERUM BENÖTIGT EIN NEUES VOKABULAR, WEIL WORTE UNSERE ART ZU DENKEN FORMEN.“
RIANE EISLER1
Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel: Immer mehr Beschäftigte überlegen ihren Job zu kündigen, weil sie mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. Lieber sind sie kurzfristig ohne Job, als sich für ihre Arbeitgeber:innen abzurackern. Die Pandemie hat viele Menschen dazu gebracht, ihre Arbeitssituation kritisch zu hinterfragen: Will ich so wirklich arbeiten? Die Antwort ist ganz offensichtlich: NEIN.
Die Gründe sind vielfältig, aber einer ist sicher, dass immer mehr Beschäftigte erschöpft und leer sind. Die Zahlen zeigen: Die Pandemie hat den Druck verstärkt, und die psychischen Belastungen steigen. Das trifft auch schon junge Menschen. Ihr Blick in die Zukunft ist düster, auch das zeigen die Studien. In den USA erkranken laut einer Gallup-Studie2 bereits 76 % aller befragten Beschäftigten an Burn-out. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benennt Burn-out als ein Phänomen, das aus chronischem Stress am Arbeitsplatz erfolgt, der nicht bewältigt wird.3
Gleichzeitig können wir fast täglich in den Medien vom Arbeitskräftemangel lesen. Egal ob große oder kleine Unternehmen, sie alle klagen, keine geeigneten, motivierten Mitarbeiter:innen zu finden. Ganze Branchen suchen heute händeringend geeignete Nachwuchskräfte, auch weil verabsäumt wurde, für die anschwellende Pensionierungswelle vorzusorgen. Der demografische Wandel und die veränderten Prioritäten der jungen Generation setzen sie unter Druck. Was tun? Die Fragezeichen sind bei den Arbeitgeber:innen groß.
Deshalb wird heute von einem Machtwechsel gesprochen: Arbeitgeber:innen bewerben sich bei den Mitarbeiter:innen und diese wählen dann sehr genau aus, für wen sie arbeiten wollen. Also ganz anders als früher. Unternehmen berichten, dass sich auf ihre Stellenausschreibungen häufig niemand meldet und die Liste der Anforderungen der Bewerber:innen im Bewerbungsgespräch immer länger wird. Studien zeigen, dass die junge Generation heute nach völlig anderen Kriterien entscheidet: Sinn, Nachhaltigkeit, Wertschätzung und Mitgestaltung stehen ganz oben auf der Liste. Aber auch flexible Arbeitsmodelle und Weiterbildungsmöglichkeiten. Arbeitgeber:innen müssen handeln, um Mitarbeiter:innen zu gewinnen und zu halten.
Alte Paradigmen („Wir müssen alle schuften im Job für eine gute Pension!“) sind jedoch noch weit verbreitet, es ist auch eine Generationenkluft zu beobachten. Meine Generation (Millennials) sehe ich hier in einer Scharnierfunktion: Wir sind dazwischen, sind oft zerrissen zwischen diesen alten Paradigmen (mit denen wir sozialisiert sind) und dem Bewusstsein, dass es so nicht weitergehen kann. Wir wollen eine faire, sozial nachhaltige Arbeitswelt, die nicht krank macht, in der die Menschen wachsen können und Sinn erkennen.
Das erfordert ein Umdenken, eine Abkehr von Paradigmen und einen Kulturwandel auf allen Ebenen: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Und die Zeit drängt: Die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen verändern rasant unseren täglichen Arbeitsalltag. Der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz oder der spürbare Klimawandel gestalten die Arbeitswelt von heute grundlegend um, sodass niemand weiß, wie wir in 20 Jahren arbeiten werden. Wohin soll es also gehen? Die United Nations verpflichten sich mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs), dass in Politik und Wirtschaft auch Wohlbefinden, menschenwürdige Arbeit und Geschlechtergerechtigkeit angestrebt werden. Somit steigt auch von dieser Seite der Druck auf Arbeitgeber:innen und politische Entscheidungsträger:innen, ins Tun zu kommen.
Meine persönliche Erfahrung im Arbeitsleben hat dazu geführt, dass ich mich mit diesen Fragestellungen beschäftige. Gerechtigkeit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz sind meine Herzensthemen, für die ich mich leidenschaftlich einsetze. Das ist mein persönliches und politisches Anliegen: Acht Jahre arbeitete ich als Juristin im öffentlichen Dienst, war zunächst engagiert und bereit, mein Bestes zu geben. Ich bildete mich weiter, wollte mich weiterentwickeln und meine Arbeit mitgestalten. Doch ich stieß täglich auf unsichtbare Grenzen, die mich schließlich so erschöpften, dass ich umzudenken begann: Wie will ich eigentlich arbeiten? So begann meine Reise, die Inhalt dieses Buches ist.
Als ich lieber krank war, als ins Büro zu fahren, wusste ich, dass ich mein Leben radikal neu aufstellen musste. So entschied ich mich dazu, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und völlig neu zu starten. Mein Umfeld machte mir das nicht leicht („Du hast doch einen so tollen Job! Den kannst du doch nicht aufgeben!“) – doch 2017 war es schließlich so weit und ich hängte meinen sicheren Job an den Nagel. Ohne eine neue Stelle in Aussicht, aber mit dem Wunsch, einen Job für mich zu finden, der mich nicht krank macht. Und ich habe es seither keinen Tag bereut.
Als ich 2017 begann, das Thema „Zukunft der Arbeit“ zu erforschen, wusste ich noch nicht, dass die Covid-19-Pandemie die Transformation unserer Arbeitsbedingungen so rasant beschleunigen würde. Viel wird heute dazu diskutiert und ausprobiert, mit der Abkehr von der Präsenzkultur und der Etablierung des Homeoffice, mit unterschiedlichen Arbeitsplätzen (Homeoffice, Büro oder Co-Working-Spaces) und Online-Konferenzen. Die Vier-Tage-Woche wurde fixer Bestandteil der Diskussion. Spannend zu beobachten, wie plötzlich neue Wege möglich waren, vor denen man früher zurückgeschreckt war. Zudem wurde erstmals Arbeit als sozialer Ort richtig wahrgenommen, der uns Struktur, Halt und soziale Gemeinschaft bietet.
Bei aller Euphorie, dass endlich was passiert, gibt es aber auch die Schattenseite. Denn viele Menschen kommen da nicht mehr mit, fühlen sich abgehängt oder überfordert. Im Homeoffice musste plötzlich das Leben selbstständig neu organisiert werden. Viele verloren ihre Struktur und Orientierung. Und Mitarbeiter:innen, die sich verloren fühlen und überfordert sind, können gar nicht produktiv sein. Leider vergessen Arbeitgeber:innen oft darauf und schreiben bei ihren Reformen intransparent von oben herunter vor, ohne die Mitarbeiter:innen einzubinden.
Besonders Visionärinnen hemmt diese fehlende Arbeitskultur auf Augenhöhe. Visionärinnen – das sind jene Frauen, die ich in meiner Forschung und Praxis näher untersuche. Ich sehe sie als die zentrale Gruppe für die Mitgestaltung einer sozialen Transformation der Arbeitswelt. Dazu zählen vor allem Frauen meiner Generation, die so wie ich ihre Arbeit mitgestalten wollen – im Interesse aller. Allerdings werden sie mit ihren Ideen, Erfahrungen und Initiativen nicht gehört. Die Arbeitgeber:innen übersehen häufig dieses aktuell große Potential, denn gerade die jungen Visionärinnen sind die treibende Kraft: Sie wollen mitgestalten, sie sind engagiert und warten darauf, endlich eingebunden zu werden.
Doch stattdessen verkommen Initiativen, die dazu führen sollen, Unternehmen als moderne, attraktive Arbeitgeber:innen zu positionieren, zu einer Marketingshow, einem „Innovationstheater“: Unternehmen tun viel, um sich zu profilieren, aber es passiert keine ehrliche Veränderung. Mehr dazu später in diesem Buch. Aber eigentlich haben Arbeitgeber:innen keine Zeit mehr, denn ohne engagierte Mitarbeiter:innen können die Firmen zusperren. Sie leiden bereits unter den wirtschaftlichen Folgen wie Lieferengpässen oder Produktionsausfällen. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, was möglich ist. Diese Chance muss jetzt ergriffen werden, um in bessere Arbeitsbedingungen und eine Arbeitskultur auf Augenhöhe zu investieren.
Ich möchte mit diesem Buch zeigen, dass die New Work Revolution längst begonnen hat und jede:r selbst eine New Work Initiative starten kann. Egal ob Mitarbeiter:in, Personalmanager:in, Abteilungsleiter:in, Teamleiter:in, Geschäftsführer:in, alt oder jung, Mann oder Frau. Jede:r kann dazu beitragen, die Arbeitswelt fairer und gesünder zu machen. Was brauchen wir dazu? Nach Virginia Woolf, die forderte, jede Autorin benötige „ein Zimmer für sich allein“4, heißt das: Auszeiten, finanzielle Absicherung, Werkzeuge und eine Gemeinschaft. Denn nur gemeinsam macht es Spaß, die Welt zu retten! Aus meiner Forschung und Beratungspraxis habe ich eine Toolbox zusammengestellt. Dafür habe ich die besten Strategien und Werkzeuge ausgewählt, um New Work Initiativen erfolgreich umzusetzen, und stelle sie in diesem Buch erstmals vor.
Trotz allem höre ich leider immer noch manchmal: „Wir müssen in Zukunft alle noch mehr schuften. Die jungen Menschen irren, wenn sie glauben, sie können weniger arbeiten.“ Aber glücklicherweise beobachte ich in den Kontrollräumen von Wirtschaft und Politik (wo ich mittlerweile als Expertin Teil davon bin) auch langsam ein Umdenken. So waren etwa bei einem Termin plötzlich der Wirtschaftsvertreter, der Geschäftsführer und der Landesrat auf meiner Seite und haben mit mir gemeinsam die anderen überzeugt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, umzudenken. Meine Beratung von Vorstandsetagen, Führungskräften und Politiker:innen setzt hier an: Ich schaffe Bewusstsein, unterstütze dabei, neue Strategien und Ziele zu definieren und die Mitarbeiter:innen in die Entscheidungen einzubinden. Nur so können sie als Arbeitgeber:innen und somit das Land als Wirtschaftsstandort attraktiv sein.
Auch in Zukunft wird „New Work und die Arbeit der Zukunft“ mein Thema bleiben. In der Bearbeitung dieses Buches haben sich jedoch zwei neue Fragen eröffnet, mit denen ich mich künftig intensiv beschäftigen werde. Die erste lautet: Wie können wir den Klimawandel und die Zukunft der Arbeit zusammendenken und neue Wege gehen? Im Sommer 2022 bin ich erstmals zu dieser Frage als Expertin beim Europäischen Forum Alpbach eingeladen, eine Diskussion zum Thema „Jobmotor Klimaschutz“ zu leiten. Zu diesem Thema führe ich außerdem regelmäßig Gespräche mit Vertreter:innen aus Politik und Zivilgesellschaft.
Die zweite Frage ist zugleich persönlich und hochpolitisch: 2017 habe ich meine sichere, unbefristete Anstellung aufgegeben – und damit die rechtliche und soziale Absicherung einer Arbeitnehmerin. Als ich mich selbstständig machte, war diese plötzlich weg. Das Problem ist, dass das bestehende System nicht auf die Bedürfnisse von Gründer:innen ausgerichtet ist. Wir sind keine Großindustriellen, wir haben dieselbe Ausgangslage wie Arbeitnehmer:innen. Daher sind die aktuellen Rahmenbedingungen zu evaluieren und die Betroffenen selbst sind als Expert:innen einzubinden. Da sich immer mehr Menschen selbstständig machen und gründen, wird diese Frage in Zukunft immer drängender. Auch dazu führe ich Gespräche mit Vertreter:innen aus Politik und Zivilgesellschaft.
Eine spannende Frage der Zukunft wird auch sein: Wenn sich immer mehr Menschen selbstständig machen, brauchen wir dann überhaupt noch Arbeitgeber:innen? Arbeiten wir dann als vereinzelte Satelliten, vernetzt über digitale Plattformen der Gig-Economy oder in einem völlig neuen System?
WIEN, MEINE STADT
Bevor ich in den allgemeinen Teil des Buches einsteige, möchte ich noch lokalisieren, wo ich lebe, arbeite und dieses Buch schreibe. Ich denke, das ist wichtig, um zu verstehen, in welchem kulturellen Kontext wir uns befinden. Es macht einen Unterschied, ob ich das Buch in Berlin, New York, im Silicon Valley, in Kopenhagen oder eben in Wien schreibe. Wien ist meine Heimatstadt, in der ich sehr gerne lebe. Es ist eine europäische Stadt, die für ihre hohe Lebensqualität, gemütlichen Lebensstil, ihre Kunst und Kultur bekannt ist. Seit langem ist Wien aber auch für die soziale, geschlechtergerechte Stadtentwicklung ein weltweites Vorbild. Das Besondere an Wien ist, dass hier Vergangenheit und Zukunft so gleichzeitig spürbar sind. Die Rahmenbedingungen sind anders als im Silicon Valley. Dieser Sehnsuchtsort für Innovationsgläubige in den USA ist eine bei uns oft idealisierte Welt, geprägt von der Tech-Welt, von Selbstoptimierung, dem Streben nach dem schnellen Gewinn und Disruptionswahn. In Wien entstehen Ideen, die ein grundsätzlicher Gegenpol zur US-amerikanisch geprägten Arbeitskultur sind, die im gesamten deutschsprachigen Raum oft unreflektiert zitiert und kopiert wird. Die Zeit für Standardantworten ist vorbei. Spannender ist die Frage, wie wir eigentlich arbeiten wollen, der Austausch darüber und das Entwickeln ganz eigenständiger Lösungen.
In diesem Spannungsfeld aus Gemütlichkeit, Tradition, Kreativität und sozialer Stadtentwicklung entsteht eine besondere Wiener Melange. So wie viele bin ich fasziniert von der Wiener Moderne um 1900, der Salon- und Kaffeehauskultur, die es bis heute gibt. Hier geht es nicht darum, schnell mit einem Caffè Latte im Take-away-Becher zum nächsten Termin zu hetzen. Im Kaffeehaus lässt es sich schön entschleunigen. Hier wird dazu eingeladen, Geschichten zu erzählen, Menschen zu treffen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Ich arbeite und treffe viele meiner Termine im klassischen Wiener Kaffeehaus. Hier können wir ungestört philosophieren, trinken und essen, arbeiten und lesen. Daher arbeite ich in Wien anders, als ich es wahrscheinlich im Silicon Valley tun würde.
In Wien ist auch dieses Buch entstanden. Für mich ist es diese spezielle Reibung, die meine Arbeit hier so besonders macht: wenn ich neue Ideen, Eindrücke und Konzepte von meinen Auslandsreisen nach Wien mitbringe und sie hier im Austausch mit anderen diskutieren kann. Meine Reisen müssen nicht zwangsläufig an das andere Ende der Welt gehen. Viele Forscher:innen, Kreative oder Beschäftigte internationaler Organisationen leben zeitweise hier in Wien und lassen sich von dem Lebensgefühl anstecken. Dazu zählen berühmte Künstler:innen, wie Wes Anderson, der eine Ausstellung im Kunsthistorischen Museum konzipierte, oder Vivienne Westwood, die Kunststudierende an der Universität für angewandte Kunst unterrichtete.
So wurde Wien in den letzten Jahren trotz Nostalgie und Traditionalismus wieder zu der Metropole, die es schon einmal war. Auch viele junge Menschen, die in New York, Kopenhagen, Berlin oder Hamburg lebten, kommen nach Wien, kehren zurück in ihre Heimat und bringen ihre Erfahrungen ein. Sie stoßen auf dicke Wände und verschieben sie. Denn in meinem täglichen Umfeld kann ich beobachten, dass auch in dieser beschaulichen Stadt der Druck am Arbeitsplatz steigt. Auch die „nach unten treten, nach oben buckeln“-Mentalität ist bei uns ein weit verbreitetes Phänomen. Das bedeutet, dass Führungskräfte zu ihren Vorgesetzten übertrieben unterwürfig und zu ihren Kolleg:innen unfair und unsolidarisch sind.
Starre Hierarchien, Standesdünkel und Angst vor Veränderung sind der Alltag in vielen Unternehmen, und die Erneuerung dieser Arbeitskultur erfolgt nur zäh. Dafür ist auch ein generelles, gesellschaftliches Umdenken notwendig. Das beginnt bereits bei der Bildung der Kinder, denn das österreichische Schulsystem wurde vor mehreren Jahrhunderten erschaffen. Die Kompetenzen der Zukunft werden zu wenig unterrichtet: kritisches, vernetztes Denken oder die Fürsorge für sich und andere.
ARBEIT AUF AUGENHÖHE
Sicher ist jedenfalls, dass wirklich niemand weiß, wie wir in 20 Jahren arbeiten werden. Daher ist es wichtig, dass wir uns persönlich mit der Frage auseinandersetzen: Wie will ich eigentlich in Zukunft arbeiten? In der heutigen Arbeitswelt erleben wir starre Hierarchien, fehlende Freiräume und eine Führung von oben – ohne Mitgestaltungsmöglichkeiten. Viele Menschen sind damit sozialisiert und können nicht von heute auf morgen völlig anders arbeiten. Der Schlüssel ist daher die schrittweise Gestaltung einer Arbeitskultur auf Augenhöhe. Das heißt, Arbeitgeber:innen sind zunächst gefragt, ihren Mitarbeiter:innen zuzuhören: Ja, wir nehmen euch ernst und wollen wissen, was ihr denkt! Wir wollen eure Einwände hören und versuchen, sie umzusetzen! Wir laden euch ein, gestaltet mit und nehmt euch die Zeit, die ihr dafür benötigt. Wir als Arbeitgeber:innen werden alles tun, um euch die notwendigen Rahmenbedingungen zu geben. Euer Wohlbefinden ist unser Erfolgsfaktor, um gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft besser zu bewältigen. Das ist die „Arbeit auf Augenhöhe“, die ich im Buchtitel anspreche.
Gleichzeitig möchte ich den/die Leser:in ermutigen, sich selbst zu überlegen, wie er/sie in Zukunft arbeiten will. Mit diesem Buch gebe ich einen Überblick über die Arbeitswelt im Wandel und Handlungsfelder, die mit New Work eine nachhaltige Gestaltung der Arbeitswelt ermöglichen. Die Ideen, Konzepte, Strategien und Werkzeuge, die ich in den letzten Jahren in meinem Future Lab, auf Forschungsreisen, in den Projekten mit Schulen oder Unternehmen und in meiner Beratungspraxis entwickelt habe, stelle ich allen zur Verfügung, die selbst aktiv werden und dazu beitragen wollen, eine Arbeitswelt auf Augenhöhe zu etablieren. Hinter meinem Konzept von New Work steht die Idee, Arbeit im Einklang mit den eigenen Werten und Vorstellungen zu gestalten. In jedem Kapitel teile ich in Infoboxen Buchempfehlungen aus meiner persönlichen New Work Bibliothek, die dazu einladen, tiefer in die angesprochenen Themen einzutauchen. Ich möchte Mut machen, einfach in kleinen Schritten loszustarten und mitzumachen. Dieses Buch ist mein Plädoyer für mehr Augenhöhe in der Arbeitswelt.
3.
BURN-OUT UND DIE SINNKRISE
„INCREASINGLY – AND INCREASINGLY AMONG MILLENNIALS – BURN-OUT ISN’T JUST A TEMPORARY AFFLICTION. IT’S OUR CONTEMPORARY CONDITION.“
ANNE HELEN PETERSEN5
Lassen wir uns also jetzt auf eine Reise in die Welt der Arbeit ein. Das Thema Arbeit ist momentan allgegenwärtig – und wird es bleiben. In unserem täglichen Alltag, in unseren Träumen und Ängsten, in Gesprächen und Plänen, aber auch in Literatur, Filmen und in den Medien. Oft hören wir, die Arbeit sei im Wandel und in Zukunft werde sich alles ändern. Aber was heißt das eigentlich? Darüber nachzudenken ist wichtiger denn je, denn Expert:innen sind sich einig: Arbeit, wie wir sie kennen, wird sich in den nächsten Jahrzehnten radikal verändern. Leider haben wir kaum Zeit, uns damit zu beschäftigen.
Zu sehr sind wir im Stress und unter Druck in unseren Jobs. Viele fühlen sich überfordert. Sie spüren keine Lebensfreude mehr, fühlen sich fremdbestimmt und ohne Kontrolle über ihr eigenes Leben. Wer kennt nicht jemanden, der ein Burn-out hat oder hatte? Vielleicht sind wir selbst betroffen oder haben Angst, direkt ins Ausgebranntsein zu schlittern. Obwohl auf den Websites vieler Unternehmen mittlerweile steht, dass ein attraktives Arbeitsumfeld geboten werde, bleibt dieses Bemühen oft bloß an der Oberfläche. Der Unmut und der Wunsch nach Veränderung wachsen – gerade auch bei jungen Frauen.
Studien zeigen, dass Angehörige der jungen Generation selbstbewusst ein anderes Arbeiten einfordern. Sie hinterfragen Autoritäten, wollen kooperativer arbeiten, wünschen sich Sinn in der Arbeit, mehr Lebensqualität und ein super Arbeitsklima. Sie fordern eine ausgewogene Work-Life-Balance bereits im Bewerbungsgespräch. Es ist ein klarer Hilferuf, denn sie wollen nicht mehr täglich voller Frust die bittere Pille schlucken, die sie lähmt. Sie wissen genau, was schiefläuft und wie es besser gehen könnte. Doch sie werden nicht gehört.
Ihre Exit-Strategie: Sie ziehen sich zurück. In den USA und England hat sich für dieses Phänomen der Begriff „The Great Resignation“ etabliert. Manche vollziehen die „innere Kündigung“ und ziehen sich zurück, andere kündigen sofort und suchen bessere Arbeitgeber:innen. Eine steigende Zahl gründet ihr eigenes kleines Unternehmen und baut sich so eine Arbeitswelt, wie sie ihnen gefällt. Die Pandemie hat das beschleunigt und viele junge Menschen zum Nachdenken gebracht: Bin ich glücklich in meinem Job? Immer mehr kündigen, weil sie unzufrieden sind. So rumort es am Arbeitsmarkt.
DIE SINNKRISE
„Ein Viertel der Beschäftigten will den Job wechseln“, titelt die Arbeitsklima-Index-Studie6 der österreichischen Arbeiterkammer aus 2022. In der Pandemie haben besonders junge Arbeitskräfte ihre Arbeitssituation hinterfragt. Ein Paradigmenwechsel zeichnet sich ab: lieber ohne Job, als sich abzurackern. Der eindeutige Trend in den Zahlen: Im Jahr 2015 wollten noch 15 %, heute bereits 26 % der befragten Arbeitnehmer:innen ihren Job wechseln, da sie mit ihren Arbeit unzufrieden sind. Seit 1997 erhebt die Arbeiterkammer Daten zu Zufriedenheit und Arbeitsklima am Arbeitsplatz und misst mit dem Arbeitsklima Index, wie es den österreichischen Arbeitnehmer:innen in ihrer Arbeit geht. Der Index ist somit ein Maßstab für den wirtschaftlichen und sozialen Wandel und setzt unmittelbar beim Erleben der Erwerbstätigen an.
Die Pandemie hat das Bewusstsein von vielen noch einmal geschärft, dass unsere Arbeitskultur von überkommenen Mustern geprägt ist und es ihr an Fürsorge, Partizipation und Kreativität mangelt. Viele wollen schlechte Arbeitsbedingungen nicht mehr ertragen und daher ihren Job wechseln. Das gilt für Beschäftigte in sicheren Bürojobs und noch mehr für all jene, die in systemerhaltenden Berufen unser Leben erst ermöglichen, da sie für uns sorgen: Reinigungskräfte, Beschäftigte im Verkauf, in der Pflege, in der Bildung oder in der Kinderbetreuung. In diesen Berufen arbeiten vor allem Frauen, die ihren Job oft gerne machen und Sinn darin sehen, aber sich unter fehlender Wertschätzung, schlechter Bezahlung und fehlenden Mitgestaltungsmöglichkeiten erschöpfen. Die genannte Studie zeigt daher ganz eindeutig: Bei Beschäftigten im Unterrichtswesen (25 %), im Gesundheitsund Sozialbereich (25 %) und besonders im Tourismus (41 %) ist der Wunsch nach einem Jobwechsel stark gestiegen.
Viele meiner Gesprächspartner:innen stellen sich die Frage: Macht meine Arbeit überhaupt Sinn? Gibt mir mein Job das, was ich brauche? Überall kann ich dieses zunehmende Unbehagen spüren. Die meisten beklagen ihren Job, die Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten. Die Mehrheit ist grundsätzlich motiviert, doch lässt sie die traditionelle Arbeitskultur kraftlos zurück. Auf meiner Suche nach Literatur, die meine persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen untermauert, bin ich auf den US-amerikanischen Anthropologen David Graeber aufmerksam geworden, der oft zitiert wird. Er prägte den Begriff „Bullshit Jobs“7. Seine These besagt, dass viele Jobs völlig nutzlos sind und die Menschen in ihrer Arbeit keinen Sinn sehen. „It’s as if someone were out there making up pointless jobs just for the sake of keeping us all working“, so Graeber.
Aus meiner New Work Bibliothek:
Bullshit Jobs, David Graeber 2018
BURN-OUT
Das sind keine Einzelfälle und keine Luxusforderungen, wie manche meinen. Vielmehr fördert die Arbeitskultur, wie wir sie heute kennen, psychische Belastungen, Erschöpfung und Überforderung. Burn-out wurde so zu einem Phänomen, das besonders bei Millennials immer drängender wird. „Increasingly – and increasingly among millennials – burn-out isn’t just a temporary affliction. It’s our contemporary condition“8, schreibt die Autorin Anne Helen Petersen.
Nicht nur ein paar „verwöhnte junge Menschen“ leiden unter dieser Arbeitskultur, sondern immer mehr erkranken an Burnout, unabhängig von Geschlecht, Beruf oder Alter. Menschen sind aus verschiedenen Gründen „burned-out“, diese reichen von einem besonders großen Arbeitsumfang und dem Gefühl, nie fertig zu werden, bis zu fehlendem Raum für Kreativität und mangelndem Gemeinschaftsgefühl. Auch eine Atmosphäre, in der Menschen nicht ihre Meinung sagen können, fördert ein Umfeld, in dem Burn-out gedeiht.
ERFAHRUNGSBERICHTE AUS MEINEM FUTURE LAB
Ich untersuche für meine Forschung, wie besonders meine Generation (Millennials, auch Generation Y, ab Mitte der 1980er geboren) und die nachkommende Generation (Generation Z, ab Mitte der 1990er geboren) ihre Arbeitswelt erleben, was sie sich wünschen und welche Ideen und Vorschläge sie haben, um die Arbeitskultur auf Augenhöhe in der Praxis umzusetzen. Dabei nehme ich eine Genderperspektive ein und achte besonders darauf, wie junge Frauen arbeiten wollen. Diese Gespräche sind eine wichtige Grundlage für meine Beratung von Arbeitgeber:innen, da ich so die notwendigen Brücken baue, um Verständnis füreinander zu fördern. Die folgenden Geschichten demonstrieren sehr gut, woran (junge) Mitarbeiter:innen oft verzweifeln (Namen und Details wurden geändert):