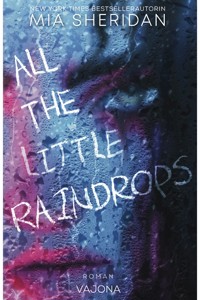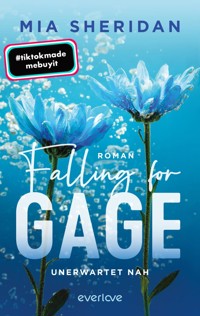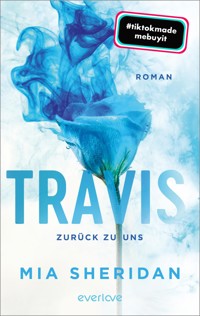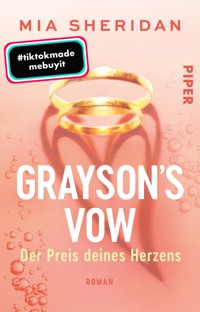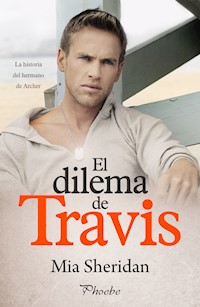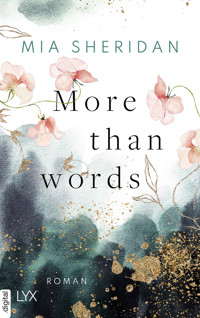5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Gefühlvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die bewegende Slow Burn Romance der Bestsellerautorin über eine große Liebe, die tiefe Wunden heilt – perfekt für Fans von Colleen Hoover und Lucy Score Ich wollte in der verschlafenen Kleinstadt Pelion in Maine in meinem Häuschen am See neu anfangen. Um alles zu vergessen, was ich hinter mir gelassen habe. Das Geräusch des Regens. Das Blut. Die Kälte der Waffe an meiner Haut. Seit sechs Monaten erinnert mich jeder Atemzug daran, dass ich überlebt habe – und mein Vater nicht. Nun bin ich fast wieder sicher. Aber als ich Archer Hale begegne, gerät meine Welt erneut ins Wanken. Und wird nie wieder dieselbe sein. Bevor ich in Archers fremdes, stilles und isoliertes Universum eingedrungen bin, sprach er mit niemandem. Und doch sehe ich in seinen whiskey-farbenen Augen, dass etwas Unbegreifliches zwischen uns passiert. Da ist so viel mehr als nur seine Schönheit, seine Ausstrahlung oder die Art, wie seine Hände mit mir sprechen. Auf mir. Diese Stadt ist voller Geheimnisse und Betrug, und Archer ist der explosive Mittelpunkt von allem. So viel Leidenschaft. Und so viel Schmerz. Nur in Archers Stille können wir vielleicht finden, was wir brauchen, um zu heilen … und zu leben. Mit exklusivem erweitertem Epilog aus Archers Perspektive.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Archer’s Voice. Die geheime Sprache der Liebe« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2016/2023
© Mia Sheridan 2014/2018
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Archer’s Voice« 2014
Die deutsche Erstausgabe erschien 2016 unter dem Titel » Die geheime Sprache der Liebe« im Piper Verlag, München
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Uta Hege
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Elizabeth Stokes
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Die Legende von Cheiron, dem Zentaur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Epilog
Auf der nächsten Seite findest Du ein neues, erweitertes Nachwort
Erweiterter Epilog
Bonuskapitel
Alternative Perspektive15
Danksagungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Meinen Söhnen Jack, Cade und Tyler.Die Welt braucht möglichst viele anständige Männer, und es macht mich stolz, dass ich sie um drei Vertreter dieser Gattung reicher machen kann.Brüder bis zum Ende.
Die Legende von Cheiron, dem Zentaur
Die Zentauren waren allgemein als Trunkenbolde, Rüpel, Aufrührer und hemmungslose Lüstlinge bekannt. Cheiron aber war nicht wie die anderen – als »Guter Zentaur« und »Heiler der Verwundeten« hob er sich durch seine Sanftmut, Weisheit und Gerechtigkeit von seinen Artgenossen ab.
Unglücklicherweise wurde er von einem Giftpfeil seines Freundes Herakles getroffen, der gegen die anderen Zentauren in den Kampf gezogen war. Da Cheiron aber nun einmal unsterblich war, fand er keine Erlösung von der schrecklichen Verwundung und brachte danach sein Leben unter grauenhaften Schmerzen zu.
Irgendwann traf Cheiron auf Prometheus, der unter genauso fürchterlicher Pein litt. Die Götter hatten ihn zu immerwährender Qual verdammt und an einen Fels gebunden, wo allmorgendlich ein Adler seine täglich nachwachsende Leber fraß.
Cheiron bot Prometheus an, sein Leben für ihn hinzugeben, um sie beide von ihren unendlichen Qualen zu befreien.
Er sank tot zu seinen Füßen nieder, und zum Lohn für seine Güte und Hilfsbereitschaft machte Zeus Cheiron zum Teil des Sternbilds Schütze, wo man seine Schönheit heute noch bewundern kann.
Cheirons Wunde steht für die transformative Kraft des Leids – dafür, wie aus körperlichem und emotionalem Schmerz moralische und spirituelle Stärke erwachsen kann.
1
Archer – sieben Jahre alt, April
»Nimm meine Hand. Ich halte dich«, flüsterte ich. Der Hubschrauber flog los, und Duke packte entschlossen Snake Eyes’ Hand. Ich versuchte, möglichst keinen Lärm zu machen, als ich spielte – meine Mama hatte nämlich wieder mal ein blaues Auge, und ich wollte sie nicht wecken, während sie in ihrem Zimmer lag und schlief. Sie hatte mir gesagt, ich könne mir bei ihr im Bett ein paar Zeichentrickfilme im Fernsehen ansehen, doch nach einer Weile, als sie eingeschlafen war, war ich wieder ins Wohnzimmer gegangen, um mit meinen G. I.-Joe-Spielsachen zu spielen.
Der Hubschrauber setzte zur Landung an, und meine Jungs sprangen von Bord und rannten schnell unter den Stuhl, weil er ein Teil der unterirdischen Festungsanlage war. Mit einem leisen Wupp, wupp, wupp hob ich den Hubschrauber wieder vom Boden auf. Ich wünschte mir, ich könnte mit den Fingern schnipsen und statt meines Spielzeugs stünde ein echter Helikopter vor der Tür. Dann könnte ich mit meiner Mama davonfliegen – von ihm, den blauen Augen und den Tränen, die sie beinahe jeden Tag vergoss. Es wäre mir total egal, wohin wir fliegen würden, Hauptsache, wir flögen weit, weit weg.
Ich krabbelte zurück in meinen Bunker, und ein paar Minuten später hörte ich, dass irgendwer die Haustür öffnete und wieder schloss und mit schweren Schritten durch den Flur direkt in meine Richtung kam. Ich lugte unter meinem Stuhl hervor, sah ein Paar blank polierter schwarzer Schuhe und den Saum einer Uniformhose.
Ich krabbelte so schnell wie möglich unter meinem Stuhl hervor, und noch während ich »Onkel Connnor!« rief, ging dieser bereits in die Knie, und ich warf mich auf der Seite, wo er nicht die Waffe und die Taschenlampe trug, an seine Brust.
»Hallo, mein kleiner Mann.« Er hielt mich fest. »Wie geht es meinem Helden?«
»Gut. Siehst du die unterirdische Festungsanlage, die ich gebaut habe?« Ich richtete mich wieder auf und zeigte ihm voll Stolz das Handtuch-Decken-Fort unter unserem Tisch, das wirklich cool geworden war.
Lächelnd schaute Onkel Connor sich die Konstruktion an. »Na klar. Das hast du wirklich super hingekriegt. Sieht uneinnehmbar aus.« Sein Lächeln wurde noch ein bisschen breiter, und er zwinkerte mir zu.
Ich grinste stolz. »Willst du mit mir spielen?«
Lächelnd fuhr er mir mit einer Hand durchs Haar. »Nicht jetzt, Kumpel. Später, ja? Wo ist deine Mama?«
Ich machte ein langes Gesicht. »Hm, sie fühlt sich nicht so gut. Sie hat sich hingelegt.« Ich sah in das Gesicht mit den goldbraunen Augen, die mit einem Mal so dunkel und so Furcht einflößend aussahen wie der Himmel kurz vor einem fürchterlichen Sturm. Ich wich ein Stück vor ihm zurück, aber genauso plötzlich waren seine Augen wieder klar, und er zog mich an seine Brust.
»Schon gut, Archer, schon gut.« Er stellte mich zurück auf meine eigenen Füße, hielt mich dann auf Armeslänge von sich und sah mir forschend ins Gesicht.
Ich lächelte ihn an, und er lächelte zurück. »Du lächelst genau wie deine Mama, weißt du das?«
Ich fing an zu strahlen, weil das Lächeln meiner Mama warm und wunderschön war und ich das Gefühl hatte, geliebt zu werden, sobald ich es sah.
»Aber ich sehe aus wie mein Daddy.« Ich blickte vor mir auf den Boden, weil die Leute immer sagten, ich sei ein echter Hale.
Er sah mich an, als wollte er mir widersprechen, meinte aber nur: »Da hast du wirklich Glück, mein Kleiner. Dein Daddy ist schließlich ein teuflisch gut aussehender Bursche.« Er lächelte mich wieder an, doch seine Augen blieben ernst.
Ich schaute Onkel Connor an und wünschte mir, ich sähe aus wie er. Denn meine Mama hatte mir einmal erzählt, in ihrem ganzen Leben hätte sie noch keinen schöneren Mann gesehen als ihn. Doch dabei hatte sie so schuldbewusst gewirkt, als hätte sie das niemals sagen sollen. Sicher weil er nicht mein Daddy war. Und außerdem war er ein Polizist, also ein Held. Wenn ich einmal groß wäre, wollte ich genauso sein wie er.
Dann stand Onkel Connor wieder auf. »Ich schau mal, ob deine Mama wach ist. Spiel du einfach weiter, bis ich wieder runterkomme, ja?«
»Okay.« Ich nickte, und er fuhr mir noch mal mit der Hand durchs Haar. Dann ging er zur Treppe. Ich wartete ein paar Minuten und schlich ihm dann lautlos hinterher. Ich hielt mich am Geländer fest und wich den Stufen, die knarzten, wenn man drauftrat, aus. Ich wusste, wie man sich geräuschlos durch das Haus bewegen konnte, weil das lebenswichtig war.
Am Kopf der Treppe angekommen, blieb ich mit gespitzten Ohren vor dem Zimmer meiner Mama stehen. Die Tür stand zwar nur einen Spaltbreit offen, doch das reichte mir.
»Wirklich, Connor, ich bin okay«, drang Mamas leise Stimme an mein Ohr.
»Du bist ganz sicher nicht okay, Alyssa«, zischte er sie an, und ängstlich hörte ich, wie seine Stimme brach. »Mein Gott. Am liebsten würde ich ihn umbringen. Ich habe endgültig genug davon, Lys. Du hast lange genug die Märtyrerin gespielt. Du denkst vielleicht, du hättest das verdient, aber Archer. Hat. Das. Nicht«, stieß er mit so gepresster Stimme hervor, dass ich wusste, dass er seine Zähne aufeinanderbiss. So wie er es immer machte, wenn mein Daddy in der Nähe war.
Dann hörte ich, dass meine Mama leise weinte, ehe Onkel Connor weitersprach. Dieses Mal jedoch klang seine Stimme völlig ausdruckslos.
»Willst du wissen, wo er gerade ist? Er hat die Bar verlassen, ist zu Patty Nelson in den Wohnwagen und vögelt sie jetzt kräftig durch. Ich bin eben dort vorbeigefahren und konnte es sogar im Auto hören.«
»Mein Gott, Connor.« Mamas Stimme klang erstickt. »Willst du es noch schlimmer machen …«
»Nein!«, schrie er sie derart wütend an, dass ich erschreckt zusammenfuhr, und sagte dann noch einmal etwas ruhiger: »Nein. Ich will nur, dass du endlich kapierst, dass es jetzt reicht. Es reicht. Falls du denkst, dass du für irgendetwas büßen müsstest, hast du das inzwischen ausreichend getan. Begreifst du nicht? Du hast nie etwas falsch gemacht, aber da ich mich nicht mit dir streiten will, nehmen wir mal an, es wäre so gewesen. Aber dafür hast du bereits einen hohen Preis bezahlt, Lys. Deine angebliche Schuld ist längst beglichen, aber trotzdem zahlen wir alle immer weiter. Himmel, willst du wissen, was für ein Gefühl es für mich war, als ich an dem Wohnwagen vorbeigefahren bin? Am liebsten wäre ich dort reingestürmt und hätte diesen Widerling durch Sonne und durch Mond geprügelt, weil er dich so mies behandelt, weil er dir nicht mal ein Mindestmaß an Respekt entgegenbringt. Obwohl ich mich im Grunde hätte freuen sollen, dass er mit einer anderen vögelt als mit der Frau, die mir so unter die Haut gegangen ist, dass nichts und niemand mich von ihr trennen könnte. Stattdessen haben die Geräusche aus dem Wohnwagen mich einfach krank gemacht. Krank, Lys. Es hat mich mal wieder einfach krank gemacht, dass er dich derart schlecht behandelt, obwohl es bedeuten würde, dass ich selbst dich niemals wieder haben könnte, ginge er urplötzlich besser mit dir um.«
Es wurde still im Schlafzimmer, aber ich wagte nicht, verstohlen durch den Spalt zu sehen. Alles, was ich hörte, waren das leise Schluchzen meiner Mama und ein leises Rascheln.
Dann fuhr Onkel Connor, jetzt mit ruhiger, sanfter Stimme fort: »Lass uns von hier verschwinden, Baby. Bitte, Lys. Erlaub mir endlich, dich und Archer zu beschützen. Bitte.« Ich hätte das Gefühl in seiner Stimme nicht benennen können, doch ich hielt gespannt den Atem an. Würde Onkel Connor uns tatsächlich von hier wegbringen?
»Und was ist mit Tori?«, fragte meine Mama leise, und es dauerte ein paar Sekunden, bis Onkel Connor antwortete.
»Ich werde ihr sagen, dass ich sie verlasse. Es wird sie nicht überraschen. Schließlich ist die Ehe, die wir beide führen, schon seit Jahren eine Farce. Sie muss verstehen, dass ich so nicht weiterleben kann und will.«
»Aber sie wird es nicht verstehen, Connor«, widersprach ihm meine Mama ängstlich. »Und vor allem wird sie es bestimmt nicht klaglos akzeptieren. Sie wird sich an uns rächen. Denn sie hat mich immer schon gehasst.«
»Wir sind keine Kinder mehr, Alyssa. Das hier ist kein dämlicher Wettkampf, sondern das wahre Leben. Es geht darum, dass wir zwei uns lieben und das Recht haben, uns zusammen ein neues Leben aufzubauen. Du und ich und Archer.«
»Und was soll aus Travis werden?«, fragte meine Mama.
Wieder gab es eine kurze Pause, dann sagte er: »Das werde ich mit Tori klären. Keine Angst.«
Abermals dauerte es einen Augenblick, bis meine Mama wieder sprach. »Dein Job, die Stadt …«
»Alyssa«, meinte Onkel Connor sanft, »das alles ist mir vollkommen egal, weil ohne dich nichts wirklich eine Rolle für mich spielt. Ist dir das immer noch nicht klar? Ich werde meinen Job hier kündigen, das Grundstück verkaufen, und dann bauen wir uns irgendwo ein neues Leben auf. Dann werden wir zusammen glücklich sein. Weit weg von hier – weit weg von diesem Ort. An einem neuen Ort, der uns gehört. Willst du das nicht auch? Sag, dass du das auch willst.«
Plötzlich klang es so, als ob die zwei sich küssten. Die Geräusche hatte ich schon mal gehört, als ich spioniert hatte, so wie jetzt. Ich wusste, das war falsch – Mamas sollten keine Männer küssen, die nicht mit ihnen verheiratet waren. Aber ich wusste auch, dass Daddys nicht ständig betrunken heimkommen und ihre Frauen schlagen sollten und dass Mamas nicht so zärtlich lächeln sollten, wie es meine Mama immer tat, wenn Onkel Connor zu uns kam. Es war alles fürchterlich verwirrend, und da ich nicht wusste, was das alles zu bedeuten hatte, spionierte ich den beiden in dem Wunsch hinterher, das fürchterliche Durcheinander zu begreifen.
Nach einer langen Zeit flüsterte meine Mama derart leise, dass ich sie fast nicht verstehen konnte: »Ja, Connor, das will ich auch. Bitte bring uns weg. Bring uns weit, weit weg von hier. Wir drei, ich und du und Archer. Lass uns ein kleines bisschen Glück finden. Das wünsche ich mir mehr als alles andere. Ich will mir dir zusammen sein. Ich wollte niemals einen anderen als dich.«
»Lys … Lys … meine Lys.«
Heimlich schlich ich mich wieder nach unten, wich den Holzstufen, die knarzten, aus und machte auf dem Weg zurück zu meiner Festung nicht einmal das leiseste Geräusch.
2
Bree
Ich schwang meinen Rucksack über die Schulter, nahm die kleine Hundetrage vom Beifahrersitz und schlug die Wagentür hinter mir zu. Dann blieb ich reglos stehen, lauschte dem morgendlichen Zirpen der Grillen und genoss die milde Brise, die das Laub der Bäume leise rascheln ließ. Der Himmel über mir war strahlend blau, und durch einen Spalt zwischen den kleinen Häusern fiel mein Blick auf den im Sonnenlicht glitzernden See. Mit zusammengekniffenen Augen sah ich auf das kleine weiße Haus, in dessen Fenster immer noch das kleine Schild mit der Aufschrift Zu vermieten hing. Obwohl das Häuschen alt und leicht verwahrlost war, hatte es einen ganz eigenen Charme, der mich sofort angezogen hatte. Ich sah mich bereits abends auf der winzigen Veranda sitzen, während hinter mir über dem See der Mond aufging, die Bäume, die das Haus umgaben, sachte im warmen Wind schwankten und mich der Duft von Pinien und von Seewasser umhüllte. Ich lächelte und hoffte, dass das Innere des Häuschens ebenfalls einen gewissen Charme versprühte und zumindest ansatzweise sauber war.
»Was meinst du, Phoebs?«, fragte ich leise, und mein Hündchen stieß ein zustimmendes Schnauben aus.
»Ja, finde ich auch.«
Eine betagte Limousine parkte neben meinem kleinen VW-Käfer, und ein ebenfalls älterer, fast kahler Mann stieg aus und trat lächelnd auf mich zu.
»Bree Prescott?«
»Genau die bin ich«, lächelte ich und reichte ihm die Hand. »Danke, dass Sie so kurzfristig Zeit für mich gefunden haben, Mr Connick.«
»Bitte nennen Sie mich George.« Er erwiderte mein Lächeln, und gemeinsam gingen wir zum Haus und wirbelten mit jedem unserer Schritte Staub und Piniennadeln auf. »Kein Problem. Ich bin inzwischen pensioniert, habe also jede Menge Zeit.« Wir gingen die drei Stufen hoch auf die Veranda, wo er einen Schlüsselring aus seiner Tasche zog und nach dem passenden Schlüssel suchte.
»Da ist er ja«, sagte er schließlich, schob den Schlüssel in das Schloss und stieß die Haustür auf. Als wir über die Schwelle traten, schlug uns der Geruch von Staub und Moder entgegen.
»Meine Frau versucht, so oft wie möglich herzukommen und ein bisschen Staub zu wischen und die Räume durchzuputzen, aber wie Sie sehen können, täte eine ordentliche Grundreinigung dem Häuschen durchaus gut. Mit ihrer Arthritis kann sich Norma nicht mehr ganz so gut bewegen. Außerdem stand das Häuschen den ganzen Sommer über leer.«
»Kein Problem.« Lächelnd stellte ich den Hundekorb neben die Tür, um mir erst mal die Küche anzusehen. Die würde ich erst mal gründlich schrubben müssen, ehe ich dort etwas kochen könnte. Aber trotzdem war ich hin und weg, weil sie wie der Rest des Häuschens einfach urgemütlich war. Die mit Laken abgedeckten Möbel waren alt, aber durchaus geschmackvoll, der mit breiten Holzdielen belegte Boden wirkte herrlich rustikal, und die Wände waren in Pastelltönen gestrichen, die ich angenehm beruhigend fand.
Die Ausstattung der Küche war nicht unbedingt modern, doch da ich womöglich sowieso nie wieder kochen würde, störte mich das nicht.
»Schlaf- und Badezimmer gehen nach hinten raus …«, setzte Mr Connick an.
»Ich nehme es«, fiel ich dem Mann ins Wort und schüttelte, verblüfft von meiner Spontaneität, den Kopf. »Ich meine, falls das Haus noch zu vermieten ist und Sie es mir vermieten wollen.«
Er sah mich schmunzelnd an. »Tja, nun, sehr gern. Dann hole ich noch schnell den Mietvertrag aus meinem Wagen, und wir gehen ihn zusammen durch. Ich hätte gern eine Kaution, aber falls Ihnen das Schwierigkeiten macht, finden wir ganz sicher einen Weg.«
Ich schüttelte den Kopf. »Kein Problem. Das ist okay für mich.«
»Dann bin ich sofort wieder da«, erklärte er und ging zur Tür.
Während er zu seinem Wagen lief, ging ich den kurzen Flur hinab und sah mir noch das Schlaf- und Badezimmer an. Die beiden Räume waren ziemlich klein, doch das hatte ich nicht anders erwartet, und für mich alleine reichten sie auf alle Fälle aus. Was mich besonders begeisterte, war das große Schlafzimmerfenster, das einen wunderbaren Blick über den See bot. Lächelnd sah ich auf den kleinen Steg hinaus, auf das glasklare, leuchtend blaue Wasser, das im hellen Licht der Morgensonne schimmerte wie ein Juwel, und die beiden weit entfernten kleinen Punkte, die wahrscheinlich Boote waren.
Als ich auf das Wasser blickte, füllten meine Augen sich seltsamerweise mit Tränen – nicht der Trauer, sondern des Glücks. Doch sofort verflog dieses Gefühl, und ich verspürte ein Heimweh, das ich mindestens genauso unerklärlich fand.
»Hier bin ich wieder.« Mr Connick zog die Tür hinter sich zu, und ich kehrte ins Wohnzimmer zurück, um den Mietvertrag für die bescheidene Unterkunft zu unterschreiben, die während der nächsten Wochen mein Zuhause sein würde und in der ich vielleicht endlich etwas Ruhe finden würde. Auch wenn das eher unwahrscheinlich war …
Norma Connick hatte alle Reinigungsprodukte dagelassen, und nachdem ich meinen Koffer aus dem Wagen in das Schlafzimmer gebracht hatte, machte ich mich umgehend ans Werk.
Drei Stunden später schob ich eine feuchte Haarsträhne aus meiner Stirn, trat einen Schritt zurück und bewunderte mein Werk. Der Holzboden war blank geschrubbt, die Möbel waren nicht mehr unter Bettlaken versteckt, und nirgends lag auch noch das allerkleinste Körnchen Staub. Dazu hatte ich in einem Schrank im Flur Bettwäsche und Handtücher entdeckt und sofort in die Waschmaschine und dann in den Trockner in dem kleinen, an die Küche angrenzenden Raum gesteckt und schließlich das Bett frisch bezogen. Die Küche und das Bad waren blank geputzt, und durch die offenen Fenster drang der warme Sommerwind, der aus Richtung See blies, herein. Ich würde mich am besten nicht zu sehr an dieses Haus gewöhnen, doch so sauber und so aufgeräumt, wie es inzwischen war, hielte ich es hier wahrscheinlich eine Zeit lang aus.
Ich trug meinen Kulturbeutel ins Bad, stellte den bescheidenen Inhalt in den Spiegelschrank, duschte lang und kalt und wusch dabei all den Schmutz, der sich während des stundenlangen Putzens und der noch längeren Autofahrt auf meinem Körper angesammelt hatte, ab. Die sechzehn Stunden Fahrt aus Cincinnati in Ohio bis hierher hatte ich in zwei gleich lange Stücke aufgeteilt. Dabei hatte ich die erste Nacht in einem kleinen Motel an der Straße zugebracht, war dann in New York gewesen, hatte dort in einem Internetcafé nach einer freien Unterkunft an meinem Ziel gesucht und war danach die ganze letzte Nacht hindurch gefahren.
Mein eigentliches Ziel in Maine war eine Stadt am anderen Seeufer gewesen, die jedoch ein so beliebtes Urlaubsziel vor allem von Familien war, dass ich die Suche dort schließlich aufgegeben hatte und in diesem Städtchen namens Pelion gelandet war.
Ich trocknete mich ab, zog ein frisches T-Shirt und ein Paar sauberer Shorts an, griff nach meinem Handy und rief meine beste Freundin an. Ich hatte Natalie geschrieben, als ich zu Hause losgefahren war, und obwohl sie seither schon mehrmals versucht hatte, mich anzurufen, hatte ich als Antwort jedes Mal nur eine kurze Nachricht geschickt, weswegen ich ihr einfach einen Anruf schuldig war.
»Bree?«, rief Natalie über die lauten Stimmen irgendwelcher anderer Frauen hinweg.
»Hi, Nat. Ist’s gerade schlecht?«
»Warte kurz, ich nehme dich mit raus.« Sie legte ihre Hand über den Hörer, sagte irgendwas zu irgendwem und kam dann wieder an den Apparat. »Nein, es passt sehr gut! Ich kann es kaum erwarten, mit dir zu reden! Ich bin mit meiner Mom und meiner Tante Mittag essen, aber sie kommen auch gut ein paar Minuten ohne mich zurecht. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, nachdem du plötzlich einfach weg warst«, fügte sie in vorwurfsvollem Ton hinzu.
Ich seufzte leise. »Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Ich bin in Maine.« Das hatte ich ihr bereits geschrieben.
»Himmel, Bree, du warst plötzlich einfach nicht mehr da. Hast du überhaupt Gepäck dabei?«
»Ein bisschen was. Auf jeden Fall genug.«
Sie atmete vernehmlich aus. »Okay. Und wann kommst du zurück?«
»Das weiß ich nicht. Ich dachte, vielleicht bleibe ich erst mal ein bisschen hier. Aber wie dem auch sei – ich habe es dir bisher nicht erzählt, aber ich bin ziemlich knapp bei Kasse, und den größten Teil des Gelds, das ich noch hatte, habe ich gerade für die Kaution für meine neue Bleibe rausgehauen. Ich brauche also dringend einen Job, wenigstens für ein, zwei Monate, damit ich die Rückfahrt überhaupt bezahlen kann.«
Nach einer kurzen Pause meinte Nat: »Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Aber, Schätzchen, du hast einen Collegeabschluss. Komm zurück und mach etwas daraus. Du brauchst nicht wie ein Vagabund in einer Stadt zu leben, wo du keine Menschenseele kennst. Ich vermisse dich schon jetzt. Und Avery und Jordan fehlst du auch. Lass dir von deinen Freunden auf dem Weg zurück ins Leben helfen, denn wir lieben dich. Ich kann dir etwas Geld schicken, wenn du dann früher wieder heimkommst.«
»Nein danke, Nat. Ich … brauche diese Zeit, okay? Ich weiß, dass du mich liebst. Das weiß ich wirklich«, antwortete ich ruhig. »Und ich liebe dich auch. Aber das ist einfach etwas, was ich machen muss.«
Wieder legte meine Freundin eine kurze Pause ein. »Ist es wegen Jordan?«
Ich kaute einige Sekunden auf meiner Unterlippe. »Nein, oder auf jeden Fall nicht nur. Ich meine, vielleicht war das der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, aber nein, ich laufe nicht vor Jordan weg. Aber genau das hatte mir jetzt gerade noch gefehlt. Plötzlich wurde mir zu Hause alles einfach irgendwie … zu viel.«
»Ach, Süße, das wäre es jedem anderen an deiner Stelle sicher auch.«
Als ich nichts sagte, seufzte sie und fragte mich: »Denkst du, dass dir dieser seltsame spontane Ausflug hilft?«
In ihrer Stimme schwang ein Lächeln mit, und leise lachend sagte ich: »In gewisser Hinsicht, ja, in anderer noch nicht.«
»Dann hast du sie also immer noch?«, hakte sie vorsichtig nach.
»Ja«, räumte ich ein. »Aber hier an diesem Ort fühle ich mich wohl. Wirklich«, sagte ich und hoffte, dass ich möglichst fröhlich klang.
Wieder legte meine Freundin eine kurze Pause ein, doch schließlich meinte sie: »Ach, Süße, es liegt doch nicht am Ort.«
»Das habe ich damit auch nicht gemeint. Ich meine einfach, dass ich das Gefühl habe, als ob ich eine Zeit lang gut hier aufgehoben wäre und den ganzen Mist … verflixt, du musst doch sicher langsam wieder los. Deine Mom und deine Tante warten doch wahrscheinlich schon auf dich. Wir können auch ein andermal über diese Sache reden.«
»Meinetwegen«, stimmte sie mir zögernd zu. »Dann fühlst du dich dort also sicher?«
Ich zögerte. Ich fühlte mich, egal an welchem Ort, nie wirklich sicher. Und langsam fragte ich mich, ob ich mich jemals wieder sicher fühlen könnte. Doch schließlich sagte ich: »Oh ja, und obendrein ist es hier einfach wunderschön. Ich wohne hier in einem kleinen Haus direkt am See.« Ich blickte durch das Fenster und sog erneut den wunderbaren Blick aufs Wasser in mich auf.
»Kann ich dich dort mal besuchen?«
»Lass mich erst mal richtig ankommen. Vielleicht, bevor ich zurückkomme?«
»Abgemacht. Auch wenn du mir echt fehlst.«
»Du mir auch. Ich rufe dich bald wieder an, okay?«
»Okay. Bis dann, Süße.«
»Bis dann.«
Ich legte auf, trat näher an das große Fenster meines neuen Schlafzimmers, zog ordentlich den Vorhang zu und krabbelte unter die Decke meines frisch bezogenen Betts. Phoebe rollte sich zu meinen Füßen ein, und in dem Augenblick, in dem mein Kopf das Kissen berührte, schlief ich auch schon ein.
Ich wurde von lautem Vogelzwitschern und dem leisen Plätschern kleiner Wellen, die gegen das Ufer schlugen, aufgeweckt. Müde drehte ich mich nach dem Wecker auf dem Nachttisch um und sah, dass es bereits nach sechs, also schon früher Abend war. Ich streckte mich, setzte mich auf und sah mich in dem fremden Zimmer um.
Dann stand ich auf, und Phoebe folgte mir, als ich ins Badezimmer ging, mir die Zähne putzte und beim Gurgeln einen Blick in den Spiegelschrank über dem Waschbecken warf. Die dunklen Ringe unter meinen Augen waren noch nicht ganz verschwunden, doch zumindest hatten die fünf Stunden Schlaf, die ich bekommen hatte, sie gelindert. Ich kniff mir in die Wangen, um ein wenig Farbe zu bekommen, sah mein Spiegelbild mit einem breiten, falschen Grinsen an und schüttelte den Kopf. »Es wird alles gut, Bree. Du bist stark, und irgendwann wirst du auch wieder glücklich sein. Hörst du mich? Dieser Ort hat etwas Gutes an sich. Spürst du das?«
Ich legte meinen Kopf ein wenig schräg und starrte mich noch einen Augenblick im Spiegel an. Viele Menschen hielten vor dem Badezimmerspiegel aufmunternde Reden an sich selbst, oder? Das war total normal. Leise schnaubend schüttelte ich abermals den Kopf, wusch mir das Gesicht und drehte mein hellbraunes langes Haar zu einem wirren Knoten auf.
Dann ging ich in die Küche, öffnete die Kühlschranktür und sah auf die paar Lebensmittel, die ich in einer Kühltasche von zu Hause mitgebracht hatte. Es war nicht viel gewesen, was ich daheim im Eisschrank gehabt hatte: ein paar Mikrowellengerichte, Milch, Erdnussbutter, Brot, ein bisschen Obst und eine Packung Hundefutter. Das würde bestimmt für ein paar Tage reichen, ehe ich gezwungen wäre, in den Supermarkt am Ort zu gehen.
Ich machte ein Nudelgericht in der Mikrowelle warm, lehnte mich gegen die Arbeitsplatte und pikste die aufgewärmte Pasta mit der beiliegenden Plastikgabel auf. Dabei sah ich aus dem Küchenfenster und bemerkte eine alte Frau mit kurzem weißem Haar in einem blauen Kleid, die mit einem Korb in ihrer Hand aus dem Nachbarhaus kam und auf mein Häuschen zulief. Als ich sie leise klopfen hörte, warf ich meine halb gegessene Mahlzeit in den Mülleimer und öffnete die Tür.
Die alte Dame lächelte mich freundlich an. »Hallo, meine Liebe, ich heiße Anne Cabbott. Wie es aussieht, sind Sie meine neue Nachbarin. Willkommen hier in unserer Nachbarschaft.«
Ich lächelte zurück und nahm den Korb entgegen, den sie mir hinstreckte. »Bree Prescott. Danke. Das ist aber nett.«
Ich hob einen Zipfel des Geschirrtuchs, das den Korb bedeckte, und der süße Duft von frisch gebackenen Blaubeermuffins stieg mir in die Nase. »Die riechen wirklich köstlich. Haben Sie vielleicht Lust hereinzukommen?«
»Vielen Dank, aber eigentlich hatte ich Sie fragen wollen, ob Sie auf meiner Veranda einen Eistee mit mir trinken möchten. Denn ich habe gerade einen Krug gemacht.«
»Oh.« Ich zögerte, doch schließlich nickte ich. »Ja sicher, warum nicht? Ich ziehe mir nur schnell noch Schuhe an.«
Ich ging wieder ins Haus, stellte die Muffins auf der Arbeitsplatte in der Küche ab, lief weiter in mein Schlafzimmer und schlüpfte dort in meine Flip-Flops.
Als ich wieder an die Haustür kam, stand Anne am Rand der Veranda und sah auf den See hinaus. »Was für ein wunderbarer Abend. Ich versuche, abends immer vor dem Haus zu sitzen und das wunderbare Wetter zu genießen. Denn jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis ich mich beschwere, weil es bitterkalt geworden ist.«
Wir liefen los, und ich blickte sie fragend von der Seite an. »Leben Sie das ganze Jahr über hier?«
Sie nickte knapp. »Die meisten Leute hier auf dieser Seite des Sees leben das ganze Jahr über hier. Die Urlauber haben bisher noch kein Interesse an dieser Stadt. Die Touristenattraktionen sind alle da drüben.« Sie wies mit dem Kopf ans andere Seeufer, das nur als undeutlicher Schatten zu erkennen war. »Und damit sind die meisten Leute hier in Pelion sehr zufrieden. Aber trotzdem wird sich das bald ändern. Denn Victoria Hale, die Frau, der das Land, auf dem Pelion steht, gehört, will eine Reihe Ferienhäuser bauen, um die Touristen anzuziehen.« Seufzend stieg sie hoch zu ihrer Veranda, wo sie sich in einen Korbstuhl sinken ließ und mir den Platz auf der Hollywoodschaukel wies.
Ich lehnte mich gemütlich gegen die Kissen und sah mich um. Mit den bequemen weißen Korbmöbeln, auf denen im Wechsel gelbe oder leuchtend blaue Kissen lagen, und mit den unzähligen Töpfen voll Petunien und wild rankendem Jasmin war die Veranda ein wunderschöner, heimeliger Ort.
»Was halten Sie davon, Touristen hierherzulocken?«, fragte ich, und sie runzelte unmerklich die Stirn.
»Tja, nun, ich mag das Städtchen, wie es ist. Meiner Meinung nach sollen die Touristen ruhig dort drüben bleiben. Die Leute, die bisher bei uns vorbeischauen, reichen mir vollkommen aus. Ich lebe gern in einer kleinen Stadt, in der jeder jeden kennt. Und wenn die neuen Ferienhäuser kommen, müssen all die Häuschen weg, die bisher direkt am Ufer stehen.«
Jetzt runzelte auch ich die Stirn. »Oh, das tut mir leid.« Dann würde schließlich auch sie selbst wegziehen müssen.
Sie aber winkte ab. »Ich komme schon zurecht. Ich mache mir vor allem Sorgen um die Läden in der Stadt, die schließen müssen, weil der Platz dann für die Ferienanlage benötigt wird.«
Ich runzelte immer noch die Stirn, und nachdem wir kurz geschwiegen hatten, sagte ich: »Ich habe selber mal mit meinen Eltern Urlaub auf der anderen Seite des Sees gemacht, als ich ein kleines Mädchen war.«
Sie nahm den Eisteekrug vom Tisch, schenkte uns beiden ein und hielt mir eins der Gläser hin. »Ach ja? Und was führt Sie nach all der Zeit hierher zurück?«
Da ich etwas Zeit gewinnen wollte, nippte ich an meinem Glas. Schließlich sagte ich: »Ich wollte einfach mal kurz raus. Und ich war sehr glücklich während dieses Sommers dort.« Ich zuckte mit den Achseln, und obwohl ich hätte lächeln wollen, spürte ich, so wie jedes Mal, wenn ich von meinen Eltern sprach, einen Kloß im Hals. Trotzdem hoffte ich, dass mein Gesicht auch weiter freundlich war.
Sie sah mich an, trank einen Schluck von ihrem eigenen Eistee und nickte dann verständnisvoll. »Nun, meine Liebe, für mich klingt das nach einem durchaus guten Plan. Und wenn Sie hier schon einmal glücklich waren, werden Sie das sicher noch einmal. Denn ich denke, dass bestimmte Orte einfach richtig für bestimmte Menschen sind.«
Sie schenkte mir ein warmes Lächeln, und ich lächelte zurück. Ich behielt aber für mich, dass ich auch deshalb hergekommen war, weil hier an diesem Ort meine Familie zum letzten Mal glücklich und sorgenfrei gewesen war. Nach der Rückkehr von der Reise hatte man bei meiner Mutter Brustkrebs diagnostiziert, an dem sie innerhalb von einem halben Jahr gestorben war. Danach hatte es nur noch meinen Dad und mich gegeben.
»Wie lange wollen Sie bleiben?«, riss mich Anne aus meinen Gedanken.
»Ich bin mir noch nicht sicher. Denn ich habe keinen echten Plan. Allerdings brauche ich einen Job. Sie wissen nicht zufällig, wo ich in Pelion Arbeit finden kann?«
Sie stellte vorsichtig ihr Glas auf den Tisch. »Das weiß ich sogar ganz genau. Der Imbiss in der Stadt braucht jemanden, der morgens dort bedient. Sie bieten Frühstück und auch Mittagessen an. Ich war erst gestern dort und habe das Schild im Fenster hängen sehen. Die bisherige Bedienung will erst mal zu Hause bleiben, weil sie gerade erst ein Kind bekommen hat. Das Norm’s liegt direkt an der Hauptstraße. Sie können es unmöglich übersehen. Ein wirklich netter Laden und durchgehend gut besucht.« Sie zwinkerte mir zu. »Richten Sie dort einfach Grüße von mir aus.«
Ich lächelte sie an. »Vielen Dank. Das mache ich.«
Schweigend nippten wir erneut an unserem Tee, lauschten dem Zirpen der Grillen, dem Surren einer Handvoll Mücken, die um unsere Köpfe tanzten, dem Plätschern des Wassers und den fernen Rufen irgendwelcher Segler auf dem See, die wahrscheinlich auf dem Weg zurück zum Ufer waren.
»Wie herrlich friedlich es hier ist.«
»Ich hoffe, dass Sie mir diese Bemerkung nicht verübeln, aber Sie sehen aus, als könnten Sie das gut gebrauchen«, meinte Anne.
Ich atmete vernehmlich aus, stellte dann aber mit einem leisen Lachen fest: »Sie haben offensichtlich eine gute Menschenkenntnis.«
Ebenfalls mit einem leisen Lachen sagte sie: »Ich konnte Menschen immer schon gut einschätzen. Mein Bill hat stets gesagt, selbst wenn er wollte, könnte er mir einfach nichts verheimlichen, was natürlich unter anderem daran lag, dass wir uns liebten und uns so gut kannten, dass der andere fast so etwas wie ein Teil von einem selber war. Und sich selbst kann man nun mal nichts vormachen. Auch wenn sich manche Leute alle Mühe geben, das zu tun.«
»Tut mir leid. Dann lebt Ihr Mann also nicht mehr?«
»Oh, er ist schon fast zehn Jahre tot. Krebs. Aber trotzdem fehlt er mir noch immer.« Melancholie trübte kurz ihren Blick, doch dann straffte sie die Schultern und wies mit dem Kopf auf mein halb leeres Glas. »Am liebsten trank er seinen Eistee immer mit einem Schlückchen Bourbon. Hat immer gesagt, dass ihn das munter macht. Und ich habe ihm diese Freude immer gern gemacht, weil es nicht wirklich Arbeit für mich war und er dann immer so schön gelächelt hat.«
Ich hatte gerade einen kleinen Schluck von meinem Eistee genommen und musste mir die Hand vorhalten, sonst hätte ich den Tee bestimmt in hohem Bogen ausgespuckt. Doch schließlich gelang es mir zu schlucken, und ich fing an zu lachen. Sie sah mich grinsend an.
»Ich nehme an, dass Männer diesbezüglich wirklich ziemlich simpel sind.«
Sie lächelte. »Das lernen wir Frauen schon ziemlich früh, nicht wahr? Wartet daheim ein junger Mann auf Sie?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Ich habe ein paar gute Freunde, aber davon abgesehen wartet niemand dort auf mich.« Während ich dies sagte, traf mich das Bewusstsein meiner Einsamkeit wie ein Fausthieb in den Bauch. Die Erkenntnis war nicht neu, doch erst jetzt, als ich zum ersten Mal darüber sprach, drang sie vollends zu mir durch. Eilig leerte ich mein Glas, bevor mich die Gefühle überwältigen konnten, und stand entschlossen auf.
»Ich sollte langsam gehen. Danke für den Tee und die nette Gesellschaft.«
Lächelnd erhob sich auch Anne von ihrem Platz.
»Sie sind mir jederzeit willkommen, Bree. Falls Sie irgendetwas brauchen, wissen Sie, wo ich zu finden bin.«
»Danke, Anne. Das ist sehr nett. Oh. Ich müsste noch in eine Drogerie. Gibt es eine hier im Ort?«
»Ja. Haskell’s. Fahren Sie den Weg zurück, den Sie gekommen sind, dann sehen Sie den Laden auf der linken Seite. Direkt vor der einzigen Ampel, die es hier gibt. Sie können ihn gar nicht verfehlen.«
»Super. Nochmals vielen Dank.« Ich trat von der Veranda, und als ich ihr winkte, nickte sie und winkte gut gelaunt zurück.
Als ich durch den Garten lief, um meine Tasche aus dem Haus zu holen, sah ich, dass dort eine Pusteblume stand. Ich pflückte sie, hob sie vor meinen Mund, schloss die Augen, dachte an Annes Worte, flüsterte unhörbar »Frieden«, blies die Schirmchen fort, sah ihnen hinterher und hoffte, einer dieser Samen trüge dieses eine Wort zu einem Wesen, dass die Fähigkeit besäße, Wünsche zu erfüllen.
3
Bree
Die Abenddämmerung brach an, als ich in die ruhige, beinah altmodische kleine Innenstadt von Pelion fuhr. Die meisten Läden waren offenbar in Einzel- oder Familienbesitz, und hohe Bäume warfen ihre Schatten auf die breiten Gehwege, auf denen ich Familien und Paare durch die milde Abendluft dieses Spätsommertages schlendern sah. Ich liebte diese Tageszeit. Sie hatte etwas Magisches und Hoffnungsfrohes an sich, so als wollte sie mir sagen: »Du warst dir nicht sicher, ob es dir gelingen würde, aber wieder hast du einen Tag geschafft, nicht wahr?«
Als ich Haskell’s auf der linken Straßenseite entdeckte, stellte ich den Wagen auf dem zu der Drogerie gehörenden Parkplatz ab.
Zwar brauchte ich noch keine Lebensmittel, doch an ein paar andere, grundlegende Dinge hatte ich bei meinem Aufbruch in Ohio nicht gedacht. Nur deshalb war ich an diesem Abend überhaupt noch einmal losgefahren. Denn obwohl ich fünf Stunden geschlafen hatte, war ich eigentlich vollkommen erschöpft und freute mich bereits darauf, mit einem Buch ins Bett zu gehen.
Zehn Minuten später hatte ich Haskell’s schon wieder verlassen und lief durch die zunehmende Dunkelheit zu meinem Wagen. Während meines Einkaufs waren die Laternen angegangen und hüllten den Parkplatz in ein warmes, weiches Licht. Ich zog mir gerade die Handtasche höher über die Schulter, nahm die prall gefüllte Einkaufstüte in die andere Hand, als diese plötzlich riss und ihr Inhalt ungehindert auf den Asphalt kullerte.
»Verdammt!« Fluchend bückte ich mich nach dem Zeug, warf Shampoo und Spülung in meine große Handtasche und fuhr erschreckt zusammen, als ich aus dem Augenwinkel jemanden in meiner Nähe stehen bleiben sah. Ich blickte gerade auf, als ein Mann neben mir in die Hocke ging und mir die Packung Aspirin hinhielt, die offenbar direkt vor seine Füße gerollt war. Ich starrte ihn mit großen Augen an. Er war jung mit wirrem, langem, leicht gewelltem braunem Haar, das viel zu lange schon nicht mehr geschnitten worden war, und einem Bart, der eher ungepflegt als absichtlich zerzaust aussah. Er wäre vielleicht durchaus attraktiv gewesen, allerdings war sein Gesicht hinter dem Haar, das ihm bis in die Augen fiel, und seinem viel zu langen Bart nicht wirklich zu erkennen. Er trug verblichene Jeans sowie ein blaues T-Shirt, das sich über die Muskeln seines Oberkörpers spannte. Der Aufdruck auf dem Shirt war so verblichen, dass er sicher schon seit Langem nicht mehr lesbar war.
All diese Dinge nahm ich in dem Moment war, in dem ich meine Hand ausstreckte, um die Schmerzmittel von ihm entgegenzunehmen. In diesem Augenblick trafen sich unsere Blicke und schienen sich ineinander zu verfangen. Seine Augen waren tief, whiskeyfarben mit langen, dunklen Wimpern.
Ich starrte diesen Fremden an und hatte das Gefühl, als ob sich plötzlich etwas zwischen uns bewegte, als ob die Luft, die uns umgab, plötzlich weich und warm und irgendwie mit Händen greifbar wäre. Ich runzelte verwirrt die Stirn, und auch nachdem er selbst schnell wieder zu Boden sah, zog der Anblick seiner Augen mich weiterhin in seinen Bann. Wer war dieser seltsame Fremde, und warum stand ich wie angewurzelt da?
Ich schüttelte leicht den Kopf und kehrte in die Wirklichkeit zurück. »Danke«, sagte ich und nahm das Aspirin aus seiner ausgestreckten Hand. Er gab mir keine Antwort und sah mich auch nicht noch einmal an.
»Verdammt«, entfuhr es mir ein zweites Mal, als ich erneut auf die auf dem Asphalt verstreuten Gegenstände sah. Die Schachtel mit den Tampons war aufgegangen, und eine Reihe der verflixten Dinger lag auf dem Boden. Oh nein.
Er hob ein paar der Tampons auf, hielt sie mir hin, und eilig stopfte ich sie in die Tasche und sah wieder auf. Auch er bedachte mich erneut mit einem kurzen Blick, doch sein Gesicht war völlig ausdruckslos, und wieder wandte er sich eilig ab.
Mir stieg das Blut in die Wangen, und ich versuchte, etwas Small Talk mit dem fremden Mann zu machen, während er schon nach den nächsten Tampons griff. Eilig riss ich sie ihm aus den Händen und warf sie zu den anderen in meine Tasche. Ich kämpfte gegen ein nervöses Kichern an.
»Verfluchte Plastiktüten«, brabbelte ich, atmete tief durch und fuhr mit ruhigerer Stimme fort: »Die sind nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern obendrein noch nicht mal zuverlässig.«
Jetzt hielt der Mann mir einen Schokoriegel sowie einen weiteren Tampon hin, die ich ebenfalls mit einem innerlichen Stöhnen in der Tiefe meiner Handtasche verschwinden ließ.
»Früher habe ich versucht, brav zu sein, und mir Taschen gekauft, die man mehrmals verwenden kann. Die waren echt hübsch, mit Paisleymuster, bunten Punkten oder irgendwelchen netten Sprüchen drauf.« Kopfschüttelnd hob ich den letzten Tampon von der Erde auf. »Aber dann habe ich sie immer entweder daheim oder im Wagen liegen lassen, also haben sie mir nur sehr selten was genutzt.« Ich schüttelte erneut den Kopf, als mir der Typ die nächsten beiden Schokoriegel reichte.
»Danke«, sagte ich. »Ich glaube, das sind die Letzten.« Ich zeigte auf zwei Schokoriegel, die noch auf der Erde lagen, schaute auf, und wieder stieg mir eine heiße Röte ins Gesicht.
»Die waren gerade im Sonderangebot«, erklärte ich. »Ich habe ganz bestimmt nicht vor, sie alle auf einmal aufzuessen oder so.« Er blickte mich nicht an, doch um seine Mundwinkel herum nahm ich ein beinah unmerkliches Zucken war. Ich blinzelte, und im nächsten Augenblick war nichts mehr davon zu sehen.
Eilig nahm ich ihm die Schokoriegel aus der Hand und sah ihn aus zusammengekniffenen Augen an. »Ich habe einfach gerne Schokolade im Haus, falls mich die Lust auf etwas Süßes überkommt, wobei das hier ein ganzer Monatsvorrat ist.« Das war glatt gelogen. Denn sicher würde ich die Süßigkeiten innerhalb der nächsten beiden Tage aufessen und bereits auf der Fahrt zurück zu meinem Häuschen damit anfangen.
Wir standen beide wieder auf, und ich hängte mir die prall gefüllte Handtasche über die Schulter. »Tja, nun, danke für die Hilfe, dass Sie mich …und meine … Sachen … meine Schokolade … meine Mandeln … und die Kokosnuss gerettet haben …« Leicht verlegen brach ich ab und blickte ihn mit einem schiefen Grinsen an. »Wissen Sie, es würde mir echt helfen, wenn Sie auch mal etwas sagen würden, weil mir diese Sache doch ein bisschen peinlich ist.« Ich wurde sofort wieder ernst, denn plötzlich wirkte sein Blick verschlossen, die Wärme, die ich in seinen Augen zumindest kurz hatte aufblitzen sehen, wich erschreckender Leere.
Er machte auf dem Absatz kehrt und wandte sich zum Gehen.
»He, warten Sie!«, rief ich ihm hinterher, doch zu meiner Enttäuschung joggte er bereits geschmeidig los.
Ein seltsames Gefühl der Leere und des Verlusts stieg in mir auf, als er die Straße überquerte und verschwand.
Unglücklich stieg ich in meinen Wagen, blieb dort reglos sitzen und dachte über diese seltsame Begegnung nach. Schließlich ließ ich den Motor an und schaltete die Scheibenwischer ein. Da merkte ich, dass etwas daran hing. Ich beugte mich vor und sah genauer hin. Es waren zahlreiche Pusteblumen-Schirmchen, die eine leichte Brise fort von mir und meinem Wagen in die Richtung blies, in die der Mann verschwunden war.
Am nächsten Morgen wachte ich früh auf, zog die Vorhänge zurück und starrte auf den See, der bereits im warmen, goldenen Licht der Sommersonne lag. Ein großer Vogel stieg gemächlich in den blauen Himmel auf, und in der Ferne schaukelte ein Boot auf den fast unmerklichen Wellen.
An diese Aussicht könnte ich mich sicherlich gewöhnen.
Jetzt sprang auch Phoebe vom Bett und nahm zu meinen Füßen Platz. »Was meinst du, Mädchen?«, flüsterte ich leise, und sie riss ihr Maul zu einem Gähnen auf.
Ich atmete tief durch. »Heute Morgen nicht«, versuchte ich mir selber Mut zu machen. »Heute Morgen geht’s dir gut.«
Als ich langsam Richtung Dusche ging, entspannte ich mich leicht, und meine Hoffnung nahm mit jedem meiner Schritte zu. Doch kaum hatte ich das Wasser aufgedreht, versank die Welt um mich herum und das Prasseln der Dusche wurde zu Regen, der auf ein Hausdach schlug. Sofort ergriff mich kalte Furcht, und ich erstarrte, als der Donner laut in meinen Ohren hallte und die kalte Mündung einer Waffe über meine nackten Brüste glitt. Ich fuhr zusammen, als der Stahl auf meinen von der Kälte aufgerichteten Nippel traf, während ein dichter Strom von Tränen über meine Wangen rann. In meinem Kopf kreischte es wie ein Zug, der abrupt auf den Metallgleisen zum Stehen kam. Oh Gott, oh Gott. Ich hielt den Atem an und wartete in eisigem Entsetzen darauf, dass er abdrückte – wie bereits zuvor im Nebenraum, wo Dad in einer Lache seines eigenen Blutes lag. Doch meine Panik verdrängte schnell jeden Gedanken an meinen Vater. Ich brach in wildes Zittern aus, während der Regen weiter auf das Dach …
Erst, als draußen eine Wagentür ins Schloss geworfen wurde, kehrte ich ins Hier und Jetzt zurück. Durch einen Spalt im Duschvorhang spritzte das Wasser auf den Boden. Mir war derart übel, dass ich zur Toilette stürzte und mich unter lautem Würgen übergab. Dann ließ ich mich keuchend und noch immer zitternd auf den Boden sinken, weil mir die Kontrolle über meinen Körper wieder einmal vollkommen entglitten war.
Verzweifelt kämpfte ich gegen die aufsteigenden Tränen an, zählte von Hundert rückwärts, atmete tief durch, stand mühsam auf, schnappte mir ein Handtuch und wischte die Wasserpfütze vor der Dusche auf.
Dann zog ich mich aus, trat unter die inzwischen warme Dusche, schloss die Augen und versuchte, vollends in die Gegenwart zurückzukehren.
»Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut«, wiederholte ich mit zitternder Stimme mein Mantra und kämpfte gegen den Schmerz, die Schuldgefühle und das fortgesetzte leichte Zittern meines Körpers an. Es würde wieder alles gut werden, das wusste ich aus Erfahrung. Auch wenn ich noch etwas brauchen würde, um mich des Gefühls zu erwehren, wieder dort zu sein, an jenem Ort, in jenem Augenblick der grenzenlosen Trauer und der Todesangst. Und die Traurigkeit war seither mein ständiger Begleiter geblieben.
Die Flashbacks kamen jeden Morgen, aber bis zum Abend tankte ich dann immer neue Kraft und Zuversicht. Täglich hoffte ich beim Aufstehen, dass die grässlichen Erinnerungen endlich überwunden wären und ich nicht noch mal die Trauer und den Schmerz dieses grauenhaften Augenblicks durchleben müsste, seit dem nichts mehr so wie früher war.
Ich stieg aus der Dusche, trocknete mich ab, und als ich in den Spiegel blickte, sah ich nicht so schlimm wie an den meisten anderen Morgen aus.
Obwohl die Flashbacks nicht aufgehört hatten, hatte ich so gut wie schon seit einem halben Jahr nicht mehr geschlafen und empfand eine Zufriedenheit, die sicher daher rührte, dass kein anderes Geräusch so friedlich wie das sanfte Plätschern war, mit dem das Wasser sich am sandigen Ufer brach. Vielleicht würde das meine Seele heilen – oder mir wenigstens auch in Zukunft einen ruhigen Schlaf bescheren.
Ich ging ins Schlafzimmer zurück und zog mir Kaki-Shorts und eine ärmellose schwarze Bluse an. Ich hatte kaum noch Geld und brauchte wirklich dringend einen Job. Ich hatte vor, in die Stadt zu dem Imbiss zu fahren, von dem Anne gesprochen hatte, um mich als Bedienung zu bewerben. Da sollte ich möglichst präsentabel aussehen.
Ich föhnte mir die Haare, bürstete sie aus und schminkte mich dezent. Dann zog ich meine Sandalen an und trat in die warme Morgenluft hinaus.
Zehn Minuten später stellte ich den Wagen in der Hauptstraße des Orts ab. Das Norm’s sah wie ein ganz normaler Kleinstadt-Imbiss aus. Bereits um acht an einem Montagmorgen war er ziemlich gut besucht, und ich strahlte, als ich sah, dass das Schild, das meine Nachbarin gesehen hatte, immer noch im Fenster hing. Juhu!
Ich öffnete die Tür und wurde vom Geruch von Kaffee und gebratenem Speck begrüßt.
Statt an einen von den Tischen setzte ich mich vorne an den Tresen in die Nähe von zwei jungen Frauen in abgeschnittenen Jeans und Tanktops, die anscheinend nicht so wie die meisten anderen Gäste auf dem Weg zur Arbeit auf ein schnelles Frühstück hier vorbeigekommen waren.
Ich setzte mich auf einen Barhocker mit rotem Kunstlederbezug, und eins der beiden Mädchen lächelte mich freundlich an.
»Morgen«, sagte ich und lächelte zurück.
»Morgen«, grüßte sie.
Ich griff nach der Speisekarte, und die Frau hinter dem Tresen blickte über ihre Schulter und erklärte lächelnd: »Komme gleich.« Sie war nicht mehr jung mit kurzem grauem Haar und wirkte leicht gehetzt, als sie mit dem Bestellblock vor der Durchreiche zur Küche stand. Sie war offenbar allein und kam mit den Bestellungen kaum nach. Die meisten morgendlichen Gäste waren auf dem Weg zur Arbeit und wollten deshalb schnell bedient werden.
»Ich habe es nicht eilig«, meinte ich.
Sie brachte eine Reihe von Bestellungen an die diversen Tische, kam zu mir und fragte erschöpft: »Kaffee?«
»Ja, bitte. Wie es aussieht, haben Sie gerade alle Hände voll zu tun. Deshalb nehme ich einfach die Nummer drei so, wie sie in der Speisekarte steht.«
»Gott segne dich, mein Kind«, stellte sie lachend fest. »Sie kennen sich in dem Metier anscheinend aus.«
»Auf jeden Fall.« Lächelnd hielt ich ihr die Speisekarte hin. »Das tue ich, und deshalb ist mir klar, dass dies ein ungünstiger Zeitpunkt ist – aber ich habe das Schild in Ihrem Fenster hängen sehen.«
»Heißt das, Sie wollen den Job? Wann können Sie anfangen?«
»Sobald wie möglich. Ich kann gerne später noch mal wiederkommen, falls Sie sich noch etwas länger mit mir unterhalten wollen …«
»Oh, das wird nicht nötig sein. Sie haben Erfahrung als Bedienung, brauchen einen Job und wir brauchen dringend eine Kellnerin. Ich bin die Frau von Norm, deswegen kann ich einstellen, wen ich will. Und das tue ich hiermit. Kommen Sie wegen des Papierkrams einfach später noch einmal vorbei.« Sie reichte mir die Hand. »Ich bin übrigens Maggie Jansen.«
»Und ich bin Bree Prescott. Vielen, vielen Dank.«
Während ich noch dankbar grinste, lief sie bereits weiter, um die Kaffeetassen anderer Gäste wieder aufzufüllen. »Sie haben mir den Tag versüßt.«
So ein einfaches Bewerbungsgespräch hatte ich noch nie gehabt.
»Neu hier in der Stadt?«
Lächelnd nickte ich der jungen Frau neben mir zu. »Ich bin gestern erst hier angekommen.«
»Na, dann herzlich willkommen. Ich bin Melanie Scholl, und dies ist meine Schwester Liza.« Auch das andere Mädchen reichte mir die Hand, die ich mit einem neuerlichen Lächeln nahm.
»Freut mich.«
Als ich merkte, dass sie unter ihren Tanktops Badesachen trugen, blickte ich sie fragend an. »Macht ihr beiden Urlaub hier?«
Melanie lachte. »Nein. Solange die Touristen da sind, jobben wir am anderen Seeufer als Rettungsschwimmerinnen, und im Winter helfen wir dann wieder in der Pizzeria unserer Eltern aus.«
Nickend hob ich meinen Kaffeebecher an den Mund. Die beiden wirkten ungefähr so alt wie ich und sahen mit ihrem rötlich braunen Haar und ihren großen blauen Augen fast wie Zwillingsschwestern aus.
»Falls du irgendetwas über Pelion wissen willst, wende dich einfach vertrauensvoll an uns«, bot Liza augenzwinkernd an. »Denn es gibt keine schmutzige Geschichte, die wir nicht kennen. Wir können dir auch sagen, welche Jungs in Ordnung sind und um welche du lieber einen möglichst großen Bogen machst. Denn wir haben die Jungs in Pelion und am anderen Ufer inzwischen fast alle durch.«
»Okay, das werde ich mir merken. Ich bin wirklich froh, dass ich euch zwei getroffen habe.« Gerade, als ich wieder einen Schluck aus meinem Becher nehmen wollte, fiel mir etwas ein. »He, ich hätte wirklich eine Frage. Gestern Abend auf dem Parkplatz vor der Drogerie ist mir mein Zeug runtergefallen, und ein junger Mann ist stehen geblieben und hat mir beim Aufsammeln geholfen. Groß, schlank, gut gebaut, aber … keine Ahnung, irgendwie hat er kein Wort mit mir gesprochen … und dann hatte er noch diesen langen Bart …«
»Archer Hale«, erklärte Melanie. »Ich bin schockiert, dass er dir geholfen hat. Denn normalerweise geht er immer allen aus dem Weg.« Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Und normalerweise gehen ihm auch die Leute aus dem Weg.«
»Nun, er hatte sicher einfach keine andere Wahl«, erklärte ich. »Weil ihm meine Sachen praktisch direkt vor die Füße gekullert sind.«
»Trotzdem ist das ungewöhnlich«, stellte Melanie mit einem Achselzucken fest. »Aber wie dem auch sei – ich glaube, er ist taub. Deshalb redet er auch nicht. Er hatte irgendeinen Unfall, als er noch ein kleiner Junge war. Wir waren damals selbst erst fünf und sechs. Auf dem Highway, ein Stückchen außerhalb der Stadt. Seine Eltern und sein Onkel, der damals der Polizeichef hier in Pelion war, kamen dabei um. Und er selbst hat sein Gehör verloren, glaube ich. Danach hat sein anderer Onkel ihn zu sich ins Haus geholt, am Ende der Briar Road, hat ihn dort selbst unterrichtet, und bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren kam Archer niemals auch nur in die Stadt. Inzwischen lebt er ganz allein dort, und obwohl er ab und zu zum Einkaufen nach Pelion kommt, ist er der totale Einzelgänger.«
»Wow.« Ich runzelte die Stirn. »Das ist unglaublich traurig.«
»Ja«, stimmte mir Liza zu. »Vor allem, weil man einen solchen Körper hier nicht alle Tage sieht. Das ist Veranlagung. Wenn er nicht ein solcher Eigenbrötler wäre, hätte ich ihn mir wahrscheinlich längst gekrallt.«
Ihre Schwester rollte mit den Augen, und ich presste die Hand gegen meinen Mund, sonst hätte ich wahrscheinlich meinen Kaffee ausgespuckt.
»Du kleine Schlampe«, meinte Melanie. »Du hast dein Glück bei ihm bisher doch nur noch nicht versucht, weil er dich niemals auch nur eines Blickes würdigt, wenn du ihn irgendwo triffst.«
Liza dachte kurz darüber nach, schüttelte dann aber nachdrücklich den Kopf. »Wahrscheinlich weiß er überhaupt nicht, was ein Mann mit einem solchen Körper alles anstellen kann – was wirklich eine Schande ist.«
Wieder rollte Melanie mit ihren Augen und sah auf die Uhr, die über der Durchreiche zur Küche hing.
»Verflixt, wenn wir uns nicht beeilen, kommen wir zu spät zum Dienst.« Sie zückte ihren Geldbeutel und winkte Maggie zu. »Ich lasse das Geld einfach hier auf dem Tresen liegen, Mags.«
»Danke, Schätzchen.« Zwei randvolle Teller in den Händen, lief die Kellnerin an ihr vorbei.
Melanie schrieb irgendwas auf eine der Papierservietten und hielt sie mir hier. »Das ist meine Handynummer. Wir wollen bald zu einem Mädelsabend auf die andere Seite des Sees. Vielleicht hast du ja Lust.«
Lächelnd nahm ich die Serviette entgegen. »Oh, okay, tja, nun, vielleicht.« Eilig schrieb ich meine eigene Nummer auf eine Serviette und drückte sie ihr in die Hand. »Vielen Dank. Das ist echt nett von dir.«
Es überraschte mich, wie mich die Unterhaltung mit den beiden jungen Frauen aufgemuntert hatte. Vielleicht sollte ich mich endlich wieder dran erinnern, dass ich vor der schrecklichen Tragödie keine solche Eigenbrötlerin und auch nicht derart langweilig gewesen war. Oft kam es mir so vor, als wäre mein Leben mit jenem grauenhaften Tag zu Ende gegangen. Doch das stimmte nicht – und daran musste ich mich immer wieder selber erinnern.
Natürlich hatten meine Freunde nach Dads Tod versucht, mich immer wieder einmal vor die Tür zu locken, doch ich hatte einfach nicht die Energie für irgendwelche Unternehmungen gehabt.
Vielleicht würde es mir leichter fallen, mit Leuten auszugehen, die nichts von den Ereignissen wussten. Vielleicht hatte ich mich ja genau deswegen auf den Weg gemacht? Als eine Art Flucht? Vielleicht würde ich an einem neuen Ort ja neuen Lebensmut finden? Und dann hätte ich die Kraft, mich dem zu stellen, was von meinem Leben übrig war.
Melanie und Liza liefen eilig los, winkten auf dem Weg nach draußen fröhlich ein paar anderen Gästen zu, und wenig später stellte Maggie einen Teller vor mir auf dem Tresen ab.
Beim Essen dachte ich an das, was sie mir über Archer Hale berichtet hatten. Sein seltsames Verhalten ergab plötzlich einen Sinn. Weshalb war ich nicht selbst darauf gekommen, dass er vielleicht taubstumm war? Obwohl er offenbar des Lippenlesens mächtig war. Und ich hatte ihn aufs Schimpflichste beleidigt mit der Frage, ob er vielleicht auch mal etwas sagen könnte. Deshalb hatte er so ein finsteres Gesicht gemacht und war schnellstmöglich davonmarschiert.
Ich zuckte innerlich zusammen und biss in meinen Toast. »Super, Bree.«
Wenn ich ihn noch mal sähe, würde ich ihn um Verzeihung bitten. Und ihm deutlich machen, dass ich selbst die Gebärdensprache konnte, falls er Lust hätte, mit mir zu reden. Mein Vater war taub gewesen, ich hatte sie schon als kleines Kind gelernt.
Irgendwas an diesem Archer faszinierte mich – auch wenn ich keine Ahnung hatte, was. Etwas anderes, als dass er taubstumm und ich selbst mit dieser ganz besonderen Behinderung in der Familie aufgewachsen war. Ich grübelte darüber nach, doch mir fiel einfach keine Antwort ein.
Ich aß auf, doch als ich zahlen wollte, winkte Maggie ab. »Unsere Angestellten essen hier umsonst«, erklärte sie. »Kommen Sie wegen des Papierkrams einfach heute Nachmittag ab zwei noch mal vorbei.«
»Okay. Dann sehen wir uns nachher.« Grinsend legte ich das Trinkgeld auf den Tisch und wandte mich zum Gehen.
Nicht schlecht, sagte ich mir. Denn schließlich war ich erst seit einem Tag in dieser Stadt und hatte schon ein Häuschen, einen Job, in meiner Nachbarin Anne Cabbott so etwas wie eine Freundin gefunden, und mit den beiden offensichtlich wirklich netten jungen Frauen war ich vielleicht auf dem besten Weg dahin. Regelrecht beschwingt lief ich zurück zu meinem Wagen.
4
Bree
Früh am nächsten Vormittag fing ich im Imbiss an. Norm, der in der Küche stand und für die Gäste kochte, war ein bärbeißiger Kerl, der außer einem schlecht gelaunten »Morgen« kaum ein Wort mit mir sprach, der aber Maggie anzubeten schien. Im Grunde seines Herzens war er also sicherlich ein Softie, daher machte er mir keine Angst. Und da Maggies Stresslevel schon eine Stunde nach dem Beginn meiner ersten Schicht erheblich abzunehmen schien, hatte ich bei ihm vom ersten Tag an einen dicken Stein im Brett.
Der Imbiss war anscheinend immer gut besucht, die Arbeit allerdings war nicht besonders kompliziert, und die meisten Gäste waren wirklich angenehm. Ich konnte mich also beim besten Willen nicht beschweren, und die ersten beiden Tage in meinem neuen Job vergingen wie im Flug.
Am Mittwoch fuhr ich nach der Arbeit heim, duschte kurz, zog meinen Badeanzug, eine kurze Jeans und ein weißes Tanktop an, nahm Phoebe an die Leine und verließ das Haus, um mir den See und die Gegend ein bisschen anzusehen.
Als Anne, die gerade ihre Rosenbüsche goss, mich freundlich grüßte, blieb ich bei ihrem Grundstück stehen.
»Na, wie haben Sie sich eingelebt?« Sie stellte ihre leere Gießkanne auf den Boden und trat zu mir an den Zaun.
»Bestens. Ich hätte schon längst zu Ihnen rüberkommen wollen, um mich zu bedanken. Gleich am Montagmorgen war ich in dem Imbiss, und sie haben mich tatsächlich auf der Stelle eingestellt.«
»Oh, das freut mich. Maggie ist ein echter Schatz. Und vor Norm dürfen Sie keine Angst haben. Denn wie heißt es so zutreffend? Hunde, die bellen, beißen nicht.«
»Das habe ich ziemlich schnell gemerkt«, stimmte ich ihr lachend zu. »Und ich fühle mich dort wirklich wohl. Jetzt will ich mir endlich mal den See ein bisschen genauer ansehen.«
»O gut. Hier kann man leider nicht so gut spazieren gehen, das haben Sie sicherlich schon selbst gemerkt. Fahren Sie besser einfach die Briar Road hinunter, und folgen Sie dann den Schildern zu dem kleinen Strand.« Sie wies mir kurz den Weg und fügte dann hinzu: »Wenn Sie wollen, können Sie mein Fahrrad nehmen, weil ich selber nicht mehr damit fahre, seitdem ich den Lenker wegen der Arthritis in den Händen nicht mehr richtig halten kann. Aber es ist so gut wie neu und hat sogar einen Korb, in dem ihr Hündchen sitzen kann.« Lächelnd sah sie Phoebe an. »Hallo. Wie heißt du denn?«
»Phoebe« stellte ich die Kleine vor, und Phoebe stieß ein gut gelauntes leises Bellen aus.
»Na, du bist aber wirklich süß.« Anne bückte sich, und Phoebe leckte ihr die Hand.
»Das Fahrrad steht in meinem Gästezimmer. Würden Sie es gern mal sehen?«
»Sind Sie sicher? Obwohl ich natürlich lieber mit dem Rad als mit dem Wagen fahren würde. Es ist ja vermutlich nicht weit bis zum Strand.«
»Ja, natürlich.« Sie bedeutete mir, ihr zu folgen, und marschierte Richtung Haus. »Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie es benutzen würden. Ich bin früher immer damit losgefahren, um die wilden Blaubeeren zu pflücken, die es in der Gegend gibt. Legen Sie also am besten einfach ein paar Tüten in den Fahrradkorb, falls Sie während Ihres Ausflugs welche sammeln wollen. Backen Sie?«
»Hm.« Ich folgte ihr ins Haus. »Früher. In der letzten Zeit aber nicht mehr.«
Sie sah mich über ihre Schulter an. »Vielleicht inspirieren Sie ja die Blaubeeren dazu, sich wieder einmal eine Schürze umzubinden.«