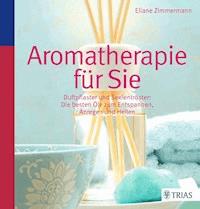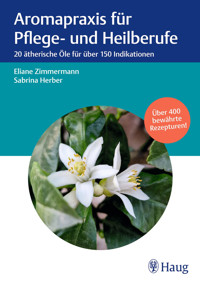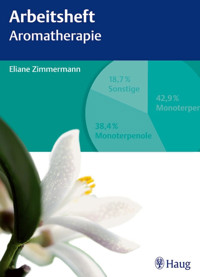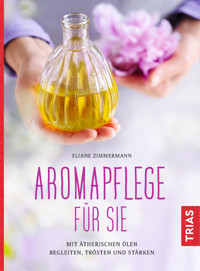79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haug Fachbuch
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ätherische Pflanzenöle pflegen, lindern, heilen
Von der Steigerung des Wohlbefindens bis zur Linderung von Krankheiten: Die Aromatherapie bietet ein enormes Wirkspektrum und punktet durch schonende Behandlung. In ihrem Standardwerk bündelt die erfahrene Praktikerin, Ausbilderin und Dozentin Eliane Zimmermann das essenzielle Wissen für die professionelle Anwendung der Aromatherapie.
Ätherische Öle mit ihren wichtigsten Eckdaten, Indikationen und Anwendungen, Grundlagen zu Botanik und Biochemie sowie zahlreiche Studienbelege – die ausgewogene Mischung aus fundiertem Fachwissen und konkreten Empfehlungen für die Praxis machen diesen Titel zu einem hilfreichen Begleiter in der Ausbildung und darüber hinaus.
Die didaktisch brillante Kombination zahlreicher Pflanzenfotos mit einprägsamen Tropfengrafiken zu den Hauptwirkstoffen ätherischer Öle macht es Ihnen leicht, Pflanzen erkennen zu lernen und die therapeutische Wirkung ihrer Öle auf einen Blick zu erfassen. Neue Inhalte u.a. zu Riechstörungen infolge Covid-19 und Behandlungsempfehlungen mittels Riechtraining, rechtlichen Aspekten und aktuellsten Studien. Abgerundet wird die Neuauflage durch weitere Porträts ätherischer Öle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1188
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe
Kursbuch für Ausbildung und Praxis
Eliane Zimmermann
7., überarbeitete und erweiterte Auflage
244 Abbildungen
Geleitwort zur 7. Auflage
Ein etabliertes Fachbuch zur Aromatherapie erscheint in der 7. Auflage. Die Neuauflage wurde erweitert und in vielen Abschnitten auf den aktuellsten Stand des derzeitigen Wissens gebracht. Ganz neu ist das lesenswerte Kapitel über Riechstörungen nach viralen Infektionen, das unter anderem auf zwei wichtige Krankheitssymptome einer SARS-CoV-2-Infektion näher eingeht, nämlich auf den temporären Verlust des Geruchs- und/oder des Geschmackssinns. Zudem wurde eine weitere Betrachtung zu SARS-CoV-2 in Kapitel 3 zur Wirksamkeit ätherischer Öle, dort in das Unterkapitel „Ätherische Öle und Viren“ aufgenommen. Aus meiner Sicht macht die ausgewogene Mischung aus fundiertem Fachwissen und konkreten Empfehlungen für die tägliche Praxis die Qualität dieses Fachbuches aus. Die inzwischen 7. Auflage ist schon für sich genommen ein Beleg dafür, dass der Inhalt des Buches alle Interessierten, gleichermaßen sowohl erfahrene Praktiker als auch Lehrende und Auszubildende, anspricht und überzeugt. Die allgemeine Wertschätzung, die das Fachbuch unter Aromatherapeutinnen und Aromaexpertinnen genießt, ist dem breit aufgestellten Wissen zu Theorie und Praxis der Aromatherapie seiner Autorin, Frau Eliane Zimmermann, zuzuschreiben. Ich selbst konnte mich wiederholt in gemeinsamen Veranstaltungen von ihrer Fach- und Sachkunde in Bezug auf die unterschiedlichsten Themen der Aromatherapie überzeugen.
In diesem fesselnden Fachbuch nimmt die Autorin die Leser mit auf eine interessante und abwechslungsreiche Reise durch die vielfältige Themenwelt der Aromatherapie. Eine sinnvolle, zielführende und sichere Therapie/Pflege mit ätherischen Ölen setzt vor allem ein fundiertes Wissen über die Chemie der verwendeten ätherischen Öle voraus. Es ist daher nur folgerichtig, dass der interessierte Leser zunächst sehr ausführlich über Chemie und Biochemie der unterschiedlichen Inhaltsstoffe ätherischer Öle informiert wird. Hierbei spannt die Autorin kenntnisreich einen weiten Bogen angefangen von der Ätherisch-Öl-führenden Pflanze über ihren Anbau und die Ölgewinnung aus verschiedenen Pflanzenteilen bis hin zur Biogenese (Bildung der Substanzen in der Pflanze) der wichtigsten Einzelstoffe (z.B. Monoterpene, Sesquiterpene, Phenylpropane). Diese Ausführungen sind häufig mit farbigen Abbildungen und übersichtlich gegliederten Tabellen versehen, sodass der Leser das Gelesene noch einmal in einprägsamer Kurzfassung präsentiert bekommt. Diese Form der Darstellung macht das Fachbuch zudem zu einem wertvollen Nachschlagewerk. Obwohl dem interessierten Leser hier einiges in Bezug auf chemische, biochemische, biologische und taxonomische Kenntnisse abverlangt wird, lohnt sich die intensive Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich. Es werden in den einzelnen Abschnitten nicht nur die biologischen und chemischen Eigenschaften und therapeutischen Einsatzmöglichkeiten der pflanzlichen Duftmoleküle ausführlich beschrieben, sondern es wird auch auf mögliche Nebenwirkungen hingewiesen. Letzteres ist für einen sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit den ätherischen Ölen unerlässlich und schützt den Anwender vor unangenehmen Überraschungen.
Das Herzstück des Fachbuches stellen die Ausführungen zu den therapeutischen Anwendungen der ätherischen Öle dar. Im Abschnitt „Viele Öle – viele Wirkungen“ verknüpft Frau Zimmermann kenntnisreich die Grundlagenforschung zu ätherischen Ölen mit ihren therapeutischen Anwendungen am Patienten. Sie thematisiert einerseits die pharmakodynamische Wirkung (z.B. antimikrobielle, antientzündliche, schmerzlindernde, wundheilende) und andererseits auch die psychodynamische Wirkung (z.B. Erwartungshaltung, Konditionierung, Verknüpfung von Erinnerung und Geruch, Bewertung eines Duftes als angenehm/unangenehm) von komplexen ätherischen Ölen und vielen ihrer chemischen Inhaltsstoffe – den beiden Säulen einer Ätherisch-Öl-Therapie. Aromatherapeutisches Arbeiten bedeutet für mich, dass man, wo immer möglich, beide Säulen nutzbringend für den Patienten einsetzen sollte.
Hervorzuheben sind auch die Bemühungen der Autorin, die Fülle der zahlreichen klinischen Studien zu ätherischen Ölen zu sichten und im Kontext des jeweils besprochenen Krankheitsbildes in Form ausführlicher Tabellen zu dokumentieren. Man muss die Inhalte der Tabellen nicht alle studieren, um einen Eindruck davon zu gewinnen, dass in den vergangenen Jahren große Fortschritte im Verständnis der verschiedenen Wirkungsweisen von ätherischen Ölen gemacht wurden. Mit Hilfe von molekularbiologischen, biochemischen, immunhistologischen und neuen bildgebenden Methoden haben Forscher weltweit dazu beigetragen, dass unser Verständnis über die therapeutische Wirkung von ätherischen Ölen und einzelnen ihrer Inhaltsstoffe bei verschiedenen Krankheiten deutlich verbessert werden konnte. Diese Entwicklung soll kurz an der wundheilungsfördernden Wirkung ätherischer Öle aufgezeigt werden.
Die im Tiermodell auf ihre wundheilungsfördernde Wirkung untersuchten ätherischen Öle, wie z.B. Eukalyptusöl, Lavendelöl, Rosmarinöl, Thymianöl, Teebaumöl, lassen übereinstimmende Wirkmechanismen erkennen. Sie fördern den Wundheilungsprozess, auch bei solchen Wunden, die mit Bakterien oder Hefepilzen infiziert sind, und verringern auch die Proliferation von Fibroblasten und Makrophagen und deren Migration in das Wundareal. Zudem fördern sie die Wundkontraktion, den Wundverschluss, die Kollagensynthese, die Regeneration des Granulationsgewebes, die Neubildung von Blutgefäßen (Angiogenese) sowie die Re-Epithelisierung.
Weiterhin ist aus meiner Sicht die Zusammenfassung der im Buch behandelten Themen in Form von übersichtlich gestalteten Steckbriefen in Teil 3 gut gelungen. Diese Steckbriefe informieren die Leserin und den Leser auf einen Blick und in aller Kürze über alle wichtigen Details der Ätherisch-Öl-Pflanzen, über die darin enthaltenen ätherischen Öle und Duftstoffe sowie ihre Wirkungen, Anwendungsgebiete und Nebenwirkungen. Sie enthalten zudem optisch ansprechende Farbfotos, Grafiken und übersichtliche Listen, die alle Interessierten unmittelbar in ihren Bann ziehen und ihnen schnell das Wichtigste vermitteln.
Am Ende des Buches finden wissenschaftlich interessierte Leserinnen und Leser ein ausführlich gestaltetes Literaturverzeichnis, das ihnen die Möglichkeit bietet, einzelne wissenschaftliche Arbeiten in entsprechenden Datenbanken nachzulesen, diese herunterzuladen und sich im Detail mit den Methoden und Ergebnissen von speziellen Untersuchungen auseinanderzusetzen.
Ich bin sicher, dass die 7. Neuauflage des Fachbuches zur Aromatherapie auch zukünftig und – wie ausgeführt – verdientermaßen auf großes Interesse bei Aromatherapeutinnen und Aromatherapeuten, bei Aromaexpertinnen und Aromaexperten stoßen wird, unabhängig davon, ob sie in der Ausbildung oder in der täglichen Praxis mit ätherischen Ölen zu tun haben.
Sandhausen, im Juni 2022
Prof. Dr. Jürgen Reichling
Akademischer Direktor und außerplanmäßiger Professor für Pharmazeutische Biologie am Institut für Pharmazie und Molekulare Biotechnologie der Universität Heidelberg; seit 2008 im Ruhestand. Forschungen u.a. auf dem Gebiet der antibakteriellen, antimykotischen und/oder antiviralen Wirkung von ätherischen Ölen.
Geleitworte zur 6. Auflage
Geleitwort von Ute Leube
Wertvolle Pflanzenrohstoffe sind heute begehrter als je zuvor. Davon war vor 30 Jahren bei unserer Firmengründung noch keine Rede. Hightech schien der Natur überlegen zu sein und die Ökobewegung wurde spöttisch belächelt. Heute gehören natürliche und zertifiziert biologische Rohstoffe zum guten Ton oder umhüllen zumindest den petrochemischen Kern vieler Industrieprodukte mit einem grünen Mäntelchen. Verbraucher haben es nicht leicht, den Werbedschungel zu durchschauen und müssen sich mühsam durch schwer verständliche Inhaltsangaben kämpfen. Immerhin wurde die Sehnsucht nach Natur erkannt, denn es wird hemmungslos mit ihr geworben, auch wenn sie vielleicht nur synthetisch nachempfunden oder in Spuren wirklich vorhanden ist. Wer die Gesetzgebung verfolgt, bekommt immer mehr den Eindruck, als seien natürliche Rohstoffe für den menschlichen Organismus gefährlicher als die vielen synthetischen Substanzen, über deren Langzeitwirkungen wir längst nicht alles wissen.
Als Hersteller sind wir der Werthaltigkeit unserer Wirkaussagen und der Produktsicherheit verpflichtet. Das setzt voraus, dass wir unsere Kenntnisse über natürliche Rohstoffe wie ätherische Öle ständig vertiefen und mit den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauern. Wir können nur dann hochwirksame Rezepturen kreieren, wenn wir die Inhaltsstoffe ganz genau kennen und mit Synergien zu spielen vermögen. Auch das Wissen um Herkunft und Entstehung unserer Rohstoffe ist uns wichtig, denn auf dem langen Weg bis zum finalen Produkt kann viel schiefgehen. Neben allen labortechnischen Analysemethoden ist uns die lückenlose Kontrolle vom Saatgut bis zum abgefüllten Fläschchen selbstverständlich, und das fängt tatsächlich bei der Bestimmung der botanisch richtigen Pflanze an.
Es macht uns hoffnungsfroh, dass immer mehr Krankenhäuser und Pflege-Institutionen naturheilkundliche Methoden wie die Aromatherapie in eine ganzheitliche Behandlung und Pflege mit einbeziehen, was von Patienten, Angehörigen und nicht zuletzt dem Pflegepersonal dankend angenommen wird. Die Aromatherapie ergänzt die konventionelle Medizin auf erstaunliche Weise – antibiotische Wirkungen können wieder aufleben, wo sie von inzwischen resistenten Keimen ausgehebelt wurden, und Krankenhauskeime beginnen, die hochbakterizid, -viruzid und -fungizid wirkenden ätherischen Öle zu fürchten. Die richtige Mischung aus ätherischen und fetten Ölen hilft, Nebenwirkungen von notwendigen medizinischen Maßnahmen zu lindern, und aus eigener Pflegeerfahrung bei meinen Eltern weiß ich, wie alte Haut auch bei monatelanger Bettlägerigkeit gesund und geschmeidig bleiben kann. Das und viele andere Möglichkeiten der Aromatherapie und -pflege verlangen fachliches Wissen und Klarheit über die Qualität der verwendeten Pflanzenstoffe. Ein umfassendes, fundiertes Nachschlagewerk wie das vorliegende ist da von größter Bedeutung.
Seit 1998 begleitet mich das längst liebgewonnene Nachschlagewerk von Eliane Zimmermann, die ich als Aromaexpertin, -lehrerin, -vortragende, -autorin und wissende Frau sehr schätze. Ich freue mich sehr über diese 6. Neuauflage, die in unzähligen Kleinigkeiten aktualisiert wurde und viele zusätzliche Informationen enthält. Es gibt typische Pflanzenfotos zu fast allen ätherischen Ölen, die wichtigsten Ölprofile sind hinterlegt mit mindestens 2 klinischen Studien, die – sehr komfortabel – kurz vorgestellt werden. Die spannende Pflanzen- und Insektenkommunikation wird genauso ausführlich erklärt wie viele andere Themen – das ganze Buch ist eine unglaubliche Fleißarbeit, die kein Detail auslässt.
Was mich besonders begeistert, ist die gleichzeitige Bedeutung von sehr wichtigen evidenzbasierten bzw. wissenschaftlichen Erkenntnissen und die Einbeziehung des zu behandelnden Menschen, dessen Nase den Weg zum richtigen Öl findet. Es ist ein ebenso kompetentes wie liebevolles Buch, das die Intention von Eliane „für den Menschen, nicht gegen die Krankheit“ bestens erfüllt. Ich möchte es all denen ans Herz legen, die mit der Aromatherapie professionell arbeiten oder sich für den Hausgebrauch auf verantwortungsvolles Fachwissen stützen wollen – all denen, die wie wir ätherische Öle nicht mehr aus ihrem Leben wegdenken können.
Oy-Mittelberg, Oktober 2017
Ute Leube
Mitgründerin von Primavera (www.primaveralife.com)
Geleitwort von Albrecht von Keyserlingk
Das Standardwerk der modernen wissenschaftlichen Aromatherapie von Eliane Zimmermann erscheint nun in 6., völlig überabeiteter und erweiterter Auflage. Dieses Kompendium gehört schon seit Jahren auch in die Fachbibliothek des Destillateurs und Extrakteurs. Die Fülle des zusammengetragenen Fachwissens, vordringlich für den lernenden und ausübenden Aromatherapeuten, gibt auch eine Menge zentraler Hinweise für die technischen Voraussetzungen zur Herstellung von qualitativ hochwertigen, biologisch zertifizierten ätherischen Ölen, die ihre Verwendung in der Aromatherapie finden wollen.
Ein Lehrbuch für Aromatherapie ist kein Lehrbuch zur Herstellung von ätherischen Ölen und deren Destillation, ist aber doch ein wesentlicher professioneller Gesprächspartner. Das therapeutische Medikament fordert eine wohldefinierte botanische Identität, die Reinheit und Vollständigkeit des ätherischen Öles und die Rückstandsfreiheit sowohl von Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden als auch von Lösungsmitteln.
Zur Herstellung eines therapeutischen Öles ist es wichtig zu wissen, welcher Teil einer Pflanze zu verwenden ist: Ist es Wurzel, Rinde, Stamm, Blatt, Blüte oder Frucht? In welchen Gegenden der Erde wachsen sie wild und in welchen Ländern werden sie landwirtschaftlich angebaut? In welchem Alter und in welcher Jahreszeit erntet man sie, und welche spezifischen Techniken sind bei der Destillation und Extraktion zu beachten?
Mit der Globalisierung und der weltumspannenden Kommunikation erweitert sich der potenzielle Lebensraum vieler Aroma- und Medizinalpflanzen. Teatree wächst im Mittelmeerraum, Vetiver und Campher stammen aus Südamerika und mit Manuka und Styrax kommen sie in die subtropischen Regionen Europas und können hier angebaut werden.
Professioneller Anbau ermöglicht kontrolliert und biologisch zertifizierbare Rohstoffe, bringt aber nicht die regional gewachsene pflanzenspezifische Destillierkunst automatisch mit und muss sich mit der Umsiedelung den europäischen Techniken anpassen. Das Lehrbuch von Eliane Zimmermann gibt Hunderte von einzelnen Hinweisen auf traditionelle Destillations- und Extraktionstechniken mit ihren individuellen, spezifischen Besonderheiten und historisch gewachsenen Gepflogenheiten. Diese Hinweise helfen dem ratsuchenden Destillateur und Extrakteur.
Ein besonderes Augenmerk verdienen jene Pflanzen, die nicht mit der relativ einfachen Wasserdampfdestillation gewonnen werden können, sondern extrahiert werden müssen. Die Extraktionen mit Hilfe von Lösungsmitteln, in diesem Buch als „solvent Extraction“ bezeichnet, erfordern wegen deren hoher Giftigkeit und der daran gebundenen schwierigen Rück- und Endreinigung spezifische Anforderungen für ein zertifizierbares Produkt, und es gibt noch eine Menge ungelöster Probleme. Das Kompendium von Eliane Zimmermann zeigt eine Fülle von Anregungen und zukunftsweisenden Forschungsansätzen auf.
Beim Lesen konnte ich persönlich manchmal das Buch nicht aus der Hand legen, weil mir plötzlich in dem trockenen sachlichen Text, zwischen molekularen Details der Pflanzenbeschreibungen, Sätze begegneten wie „blaue Berge“, „flimmernde Duftglocken an portugiesischen Küsten“. Und da war sie: eine tief romantische Liebe zu den Pflanzen, den Blüten und Düften aus der Aromawelt, die fürsorgliche Liebe der Autorin für ihren Patienten, die glitzernde Sonne auf dem Meereswasser des Mittelmeeres.
Ich wünsche dem Buch einen schönen, langen Lebensweg.
San Nicolao, Korsika, im Herbst 2017
Albrecht von Keyserlingk
Destillateur und Gründer von Essences Naturelles Corses (www.essences-naturelles-corses.fr)
Vorwort zur 7. Auflage
Die erste Auflage dieses Buches erschien 1998. Prof. Dietrich Wabner, mein inzwischen verstorbener wissenschaftlicher Mentor, schrieb damals in seinem Geleitwort: „Die Aromatherapie bewegt sich in einer entscheidenden Phase.“ Tatsächlich hat sich in diesen gut zwei Jahrzehnten vieles zum Positiven bewegt: Die Aromatherapie ist als komplementäres Heilverfahren heute sehr viel besser anerkannt als noch vor der Jahrtausendwende.
In vielen Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich konnte sich die evidenzbasierte Aromapflege fest etablieren und wird nun erfolgreich eingesetzt. Die eigentliche Aromatherapie, also die heilende Begleitung mit ätherischen Ölen, ist nur Heilpraktikerinnen, Heilpraktikern, Ärztinnen und Ärzten vorbehalten, in diesem Bereich ist eher nur ein kleiner Fortschritt zu beobachten.
Dennoch arbeiten inzwischen viele gut ausgebildete Aromatherapie-Profis umsichtig und kompetent mit den vielseitigen Naturdüften zum Nutzen und zum Wohl ihrer Klientinnen und Klienten. Denn der Übergang zwischen der Unterstützung des ganzheitlichen Wohlbefindens und der eigentlichen Therapie ist fließend, aus Sicht der Naturheilkundlerin können beide Bereiche nicht getrennt voneinander betrachtet werden.
Insbesondere an einer Ergänzung in dieser Neuauflage lässt sich die komplementäre – also im besten Sinn ergänzende – Arbeit in beiden Arbeitsfeldern gut illustrieren. Es geht um wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Übungen beim Verlust des Riechsinns, der nach einer Covid-19-Infektion über Wochen sehnsüchtig vermisst werden kann. Plötzlich kam mit dieser Krankheit die Bedeutsamkeit des Riechens in den Fokus von Normalbürgern. Mit gezielten Riechübungen und auch dank der „stechenden“ Eigenschaften einiger ätherischer Öle, die den Trigeminusnerv reizen, kann dieser temporäre Verlust verkürzt werden.
Der modisch-trendige und gleichzeitig oberflächliche Einzug der „Aromatherapie“ in die Welt der Influencerinnen und der sogenannten Social Media führte zu einer Flut an bunten Büchern, schnellen Kursen und Aroma-Konsumprodukten. Gleichzeitig nahm die seriöse Auseinandersetzung mit dem therapeutischen Einsatz von ätherischen Ölen stark zu und förderte deren Akzeptanz in den Heil- und Pflegeberufen.
Allerdings schwappen nach wie vor fragwürdige bis gefährliche Empfehlungen sowie haarsträubend überdosierte Rezepturen über den großen Teich zu uns. Etablierte und zuverlässige Öleanbieter werden bisweilen wegen angeblich unreiner Produkte verunglimpft und deutschsprachige Interessentinnen verunsichert. Es ist ein Trend zu beobachten, mithilfe von speziellen Marketingmethoden und stark überteuerten Ölen das Geldverdienen in den Vordergrund zu stellen.
Jedoch wird jedes Jahr mit unzähligen In-vitro-Studien als auch in klinischen Studien nachgewiesen, wie ungemein hilfreich ätherische Öle in der Behandlung insbesondere von chronischen Beschwerden sein können. Auch der verblüffende Einfluss von Riechstoffen auf die menschlichen Emotionen ist inzwischen wesentlich besser untersucht, als dies vor der Vergabe des Nobelpreises für das Enträtseln des Geruchssinnes im Jahr 2004 der Fall war.
Im Bereich der zunehmenden Resistenzen diverser Keime gegenüber der modernen „Wunderwaffe“ Antibiotikum konnte in der jüngsten Vergangenheit zuverlässig aufgezeigt werden, wie ätherische Öle Zellmembranen von pathogenen Keimen schädigen können. Von einigen Naturdüften ist bekannt, dass sie die Effluxpumpen mancher Keime verhindern, auch die Bildung der β-Lactamase wird unterbunden u.a. durch Oregano, zudem stören einige Riechmoleküle das Quorum sensing der Erreger empfindlich.
Es gibt also genügend Gründe, dieses Fachbuch, mittlerweile ein Klassiker für professionelle Anwender, alle paar Jahre gründlich zu überarbeiten und zu erweitern. In dieser Neuauflage habe ich wieder die Anfragen, Sorgen und Nöte von Pflegekräften sowie von den Teilnehmerinnen unserer Ausbildungskurse berücksichtigt und sie zum Nutzen möglichst vieler Leserinnen und Leser thematisiert. Wo möglich, wird die Wirkung und Wirkungsweise von Ölen durch relevante und aktuelle wissenschaftliche Studien belegt. Die meisten wissenschaftlichen Forschungsarbeiten zu ätherischen Ölen werden in englischer Sprache publiziert; ich habe den aktuellen Studienfundus deshalb wieder einmal sorgfältig gefiltert und kontextbezogen im Buch aufbereitet.
Die Verweise auf die seriösen Forschungsergebnisse werden dankbar als Hilfe für die allfälligen Diskussionen zwischen medizinischen und pflegerischen Abteilungen gewürdigt. Manche Leserinnen und Leser haben beim Durcharbeiten geseufzt angesichts der Wissenstiefe der Disziplin und des Umfangs dessen, was eine Aromatherapeutin wissen und beherrschen muss. Ich rate in diesem Falle jedem: Lassen Sie sich nicht entmutigen, die Mühe lohnt sich.
Dass man die Aromatherapie an 2 Wochenenden erlernen könne, wie immer wieder im Internet und in der wirklichen Welt geworben wird, halte ich für Augenwischerei und hohles Marketing. Und dass bereits ganze Seiten aus diesem Buch unter „fremden Federn“ zu finden sind, betrachte ich als Kompliment. Für mich steht die Aromatherapie für wesentlich mehr als „nur“ für Heilen. Ätherische Öle einzusetzen, bereichert und spendet – auch im Leiden – ein Stück mehr Wohlbefinden und Lebensqualität. Nur so ist der Weg zu echter Heilung überhaupt möglich. Körper und Seele werden mit ätherischen Ölen gleichermaßen angesprochen, somit bedeuten Aromatherapie und Aromapflege immer auch mit Wohlgeruch verbundene menschliche Zuwendung .
Die Arbeit mit ätherischen Ölen bekommt inzwischen auch einen wichtigen Stellenwert bei der täglichen Arbeit der Pflegenden, die unvermeidbar und regelmäßig mit der (Basis-)Emotion Ekel konfrontiert werden. Gefühle der Überforderung oder gar Ablehnung können mit passenden und individuell ausgesuchten Anti-Stress-Ölen aufgefangen werden. Die Kompetenz und die pflegerischen Aufgaben erfahren Stärkung und Aufwertung, Burnout-Symptome verlieren an Bedeutung.
Meine britische Kollegin Jane Buckle formulierte das Ziel der Aromatherapie so treffend: „Bringing care back into health care.“ Um es frei zu übersetzen: Wir müssen dem Gesundheitswesen Sorge, Fürsorge, Sorgfalt, Umsicht und Achtsamkeit zurückgeben. Dazu kann die Aromatherapie viel beitragen.
Bei meinen Kursbesuchern bedanke ich mich für die vielen unglaublich wertvollen Erfahrungsberichte und Inspirationen. Frau Wallstein, Frau Haßfeld und Herrn Böser gebührt Dank und Lob für die geduldige und sorgfältige Begleitung dieses umfangreichen Projektes. Herrn Geyer danke ich für die hinzugekommenen bunten „Luftballons“, die dieses dicke Werk so wohltuend mit Leichtigkeit und Abwechslung schmücken.
Glengarriff/Irland, im Juni 2022
Eliane Zimmermann
Einleitung
Merke
Die Aromatherapie ist eine ernst zu nehmende und auf naturwissenschaftlicher Basis begründbare, ergänzende Heilmethode, die sich von der Manipulation der Gefühle und von einer auf Placebowirkungen beruhenden Behandlungsmethode deutlich unterscheidet ▶ [79].
Die Therapie mit ätherischen Ölen ist ein Teilbereich der Phytotherapie. Sie gehört damit zur sog. „regulativen Medizin“ mit einer klaren Beziehung zwischen Präparat und Wirkung. Dem Körper wird mit sanften Heilmitteln ein „Angebot“ gemacht – und er verarbeitet diese so, wie sie ihm im jeweiligen Moment am besten tun. So ist zu erklären, dass beispielsweise Lavendelöl auf manche Menschen stark beruhigend wirken kann, während andere davon so richtig fit werden.
Mit naturwissenschaftlichen Methoden ist dieses Phänomen kaum zu beschreiben; dennoch kann es nicht abgestritten werden, kommt es doch tagtäglich vor: Jede Hebamme weiß beispielsweise, dass sich die Zusammensetzung der Milch einer stillenden Frau den Bedürfnissen des gestillten Säuglings auf wundersame Weise anpasst. Der Nährstoffgehalt passt sich ständig der jeweiligen Entwicklungsphase des Babys an. Doch wie der weibliche Körper in diesem Moment „weiß“, wann der kleine Mensch was braucht, bleibt (noch) ein Geheimnis. Ähnlich „weiß“ der aus dem Gleichgewicht geratene Körper meistens, was er mit ihm zugeführten Zubereitungen aus Pflanzen „tun“ soll.
Der Nachteil dieser schonenden Arbeit: Es kann Wochen oder gar Monate dauern, bis der Körper wieder im Lot ist. Jedoch sind meistens zumindest kleine Sofortwirkungen zu beobachten, und was vielleicht der wichtigste Aspekt ist: Wenn das richtige Mittel oder die richtige Kombination gefunden wurde, ist der Erfolg meist sehr anhaltend.
Anders wirken die meisten allopathischen Medikamente: Sie heilen selten die Ursachen der jeweiligen Erkrankung oder Störung, sondern dämmen die Symptome ein und töten bei Bedarf die Krankheitserreger ab. Das ist in Fällen von lebensbedrohlichen, akuten oder schmerzhaften Krankheiten wichtig und hilfreich. Bei chronisch kranken und psychosomatisch leidenden Menschen, empfindlichen Personen, Kindern etc. sind die unerwünschten Nebenwirkungen jedoch oft problematischer als die eigentliche Hilfe. Die konventionelle Medizin arbeitet häufig wie der Besitzer eines Autos, welcher sich über klappernde Geräusche aufregt, dann den losen Auspuff abreißt und nun glaubt, damit sei das Problem behoben.
Bei einem Fahrzeug, um dieses Beispiel weiterzuverfolgen, ist die unerwünschte Nebenwirkung „Funktionsstörung“ leicht ersichtlich. Beim allopathisch behandelten Menschen sind die Begleitumstände oft verborgener oder die unerwünschten Nebenwirkungen werden dem Zufall zugeschrieben. Doch nicht umsonst ist für nebenwirkungsreiche (Kampf-)Mittel ein „Waffenschein“, die Rezeptpflicht, vorgeschrieben.
In der Aromatherapie konzentrieren wir uns vorwiegend auf die lipophilen (fettlöslichen) Bestandteile einer Pflanze: die ätherischen Öle. Diese können wiederum aus vielen Hundert Bestandteilen zusammengesetzt sein, es sind – pharmakologisch gesehen – Vielstoffgemische.
Durch die Wasserdampfdestillation, die wichtigste Methode zur Gewinnung von ätherischen Ölen, werden der Pflanze nur diese fettlöslichen und flüchtigen (ätherischen) Stoffe entzogen, die aus sehr kleinen Molekülen bestehen. Während dieses Prozesses entstehen auch die sog. Hydrolate, in denen sich wasserlösliche Stoffe wie die wertvollen Pflanzensäuren befinden. Sie werden erst seit wenigen Jahren in der Literatur ausführlicher beschrieben und entsprechend auch praktisch eingesetzt. In manchen Fällen sind diese therapeutisch besonders sinnvoll in der Anwendung, z.B. Rosenhydrolat bei juckenden und entzündlichen Hautveränderungen.
Nach 30 Jahren der Anwendung von ätherischen Ölen sowohl in der Krankenpflege als auch in der Gesundheitsvorsorge konnten umfangreiche Erfahrungen über den sanften und dennoch in vielen Fällen hoch effektiven Einsatz der Aromapflege gesammelt werden. Dennoch können ätherische Öle bei unsachgemäßer Anwendung auch unerwünschte Nebenwirkungen haben. Sie sollten deshalb nicht ohne Fachwissen eingesetzt werden. Der auf ätherische Öle spezialisierte französische Allgemeinarzt Dr. Daniel Pénoël hat nach eigenem Bekunden in 10 Jahren lediglich 2 Patienten mit Antibiotika behandeln müssen, und das nur auf Wunsch von ängstlichen Eltern. Das komplexe Vielstoffgemisch in ätherischen Ölen schafft es auf einzigartige Weise, im Organismus des Menschen nur dort einzugreifen, wo es etwas zu korrigieren gibt – immer vorausgesetzt, die Öle werden korrekt und verträglich dosiert.
Moderne Forschung
Die komplexen Wirkungen von Hunderten von ätherischen Ölen werden überraschend oft in der modernen Wissenschaft untersucht. Wir können auf etliche Tausend Studien mit ätherischen Ölen zugreifen, oft werden sie von renommierten Universitäten durchgeführt. Der überwiegende Teil dieser Erkenntnisse stammt aus In-vitro-Arbeiten, also aus der Petrischale, die Ergebnisse sind dann eher theoretischer Natur. Leider finden auch unzählige Tierexperimente statt, so kommt man dann zu In-vivo-Ergebnissen, die sich jedoch nur bedingt auf die menschliche Physiologie übertragen lassen. Placebokontrollierte Doppelblindstudien finden in der westlichen Welt eher selten statt, da Ethikkommissionen diese Arbeiten oft nicht zulassen und der finanzielle Aufwand sehr hoch ist. Er führt selten zu patentierbaren Mitteln, welche das investierte Geld wieder einbringen.
In sog. „Entwicklungs- und Schwellenländern“ wird intensiver geforscht, da dort ein großer Teil der aromatischen Pflanzen wächst und man zudem auf preiswerte und verlässliche Arzneimittel angewiesen ist. Im deutschsprachigen Raum tut man sich noch schwer, diese Mittel ernst zu nehmen, das spiegelt sich insbesondere in Bedenken und Vorbehalten von ärztlicher Seite wider. In der englischsprachigen Welt sieht die Lage etwas besser aus, möglicherweise auch aufgrund der Tatsache, dass die Wissenschaftssprache Englisch ist. Selbst wenn also Arbeiten von deutschsprachigen Teams durchgeführt werden, werden sie in den anerkannten internationalen Fachzeitschriften (peer-reviewed journals) selten auf Deutsch publiziert.
In den ersten 15 Jahren des neuen Jahrhunderts sind die wissenschaftlichen Methoden und Möglichkeiten präziser geworden, immer bessere hochauflösende bildgebende Verfahren ermöglichen neue Einblicke in die Welt der Zellen. Es gab in der jüngsten Vergangenheit bemerkenswerte Erkenntnisse zu einzelnen ätherischen Ölen oder deren Hauptkomponenten, stellvertretend seien Folgende erwähnt:
Wegen der immer mehr nachlassenden Wirksamkeit von Antibiotika wird an Ergänzungen und Alternativen geforscht. Einige ätherische Öle wie Origanum vulgare (Oregano) sind bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen als Alternative denkbar, da sie bereits als einzunehmende Kapseln erhältlich sind und so eine systemische keimmindernde Wirkung entfalten. Forschungen am Quorum sensing (Gemeinschaftswahrnehmung) von Bakterien belegen die seit bald 30 Jahren gesammelte praktische Erfahrung, dass auch nur moderat antibakteriell wirksame ätherische Öle wie Lavendel oder Rose bei Infektionen hilfreich sein können, da sie die „Angriffslust“ von Keimen empfindlich zu stören vermögen ( ▶ [9], ▶ [304], ▶ [332], ▶ [521]).
In Deutschland konnte nachgewiesen werden, dass nicht nur die Nase bzw. Rezeptoren in der Riechschleimhaut riechen können, sondern vielerlei menschliche Zellen auf Reize von Riechstoffen reagieren, beispielsweise Herz-, Haut- und Blutzellen ( ▶ [34], ▶ [99]). Prostatakrebszellen reagieren auf den Veilchenduftstoff β-Ionon (auch Ionon genannt) mit einer Hemmung des Zellwachstums ▶ [501]. Auch Leberkrebszellen reduzieren ihr Wachstum, wenn sie mit einem Riechstoff in Kontakt kommen: Es handelt sich um den Zitronen-Eukalyptus-Duftstoff (–)-Citronellal ▶ [432]. Bestimmte Darmzellen sondern Serotonin ab, wenn sie mit Riechstoffen, wie sie in Gewürzen vorkommen, konfrontiert werden ▶ [73]. Das Wahrnehmen von Geruchsreizen durch den Trigeminusnerv ist genauer erforscht worden, er kann nicht nur stechende Gerüche wie Ammoniak und Campher wahrnehmen, sondern auch etwas feinere Düfte wie Benzaldehyd (Bittermandel), Linalool (Lavendel) und Citronellal (Zitronen-Eukalyptus; ▶ [652]).
Weltweit wird an der antitumoralen Wirkung insbesondere des Monoterpens d-Limonen, diverser Monoterpenole, einiger Sesquiterpene sowie einiger Furocumarine geforscht ( ▶ [50], ▶ [58], ▶ [581], ▶ [647], ▶ [699]). In einer Übersichtsarbeit, für die fast 130 wissenschaftliche Experimente gesichtet wurden, wird sogar festgehalten, dass die Suche nach natürlichen antitumoral wirkenden Substanzen einen der am schnellsten wachsenden Bereiche der Forschung ausmacht ▶ [203]. Zum Leidwesen der Betroffenen, handelt es sich vorwiegend um in-vitro-Arbeiten. Auf der Petrischale sind die erstaunlichen antitumoralen Wirkungen gut nachzuweisen. Doch ein menschlicher Körper ist freilich viel komplexer als unter Laborbedingungen gezüchtete Gewebe. Somit können wir die Ergebnisse aus diesen Studien allenfalls als prophylaktische Inspiration betrachten.
Im Jahr 2012 wurde in Japan ein medizinischer Forschungszweig, die „Forest Medicine“ (Waldmedizin), eingeführt. Nicht nur weiß man inzwischen, dass Riechstoffe (Terpene), die von Bäumen abgesondert werden, mit dem menschlichen Immunsystem interagieren können, sondern es konnte vielfach belegt werden, dass der Anblick und Austausch mit der Natur beispielsweise das Stresshormon Kortisol und sogar Blutzuckerwerte bei Diabetikern senken können ▶ [28].
Eine Zubereitung namens Silexan aus einem speziellen Lavendelöl, das besonders reich an Linalylacetat ist, wurde in mehreren Studien an weit über 1 000 Patienten untersucht. Die daraus entwickelten dünndarmlöslichen Kapseln (Lasea) hatten annähernd die gleiche Wirkung wie das viel eingesetzte Benzodiazepam Lorazepam – allerdings ohne das suchterzeugende Potenzial. Das in jeder deutschen Apotheke erhältliche Produkt wird inzwischen gerne bei Schlafstörungen und leichten Angstzuständen empfohlen ( ▶ [323], ▶ [659], ▶ [703], ▶ [750]).
Das neue Jahrtausend brachte auch bahnbrechende Erkenntnisse über die Kommunikation zwischen Pflanzen sowie ihre „Nachrichten“ an Feinde. Die Rolle von ätherischen Ölen als Pheromone und Signalstoffe von und für Insekten werden inzwischen etwas besser verstanden ▶ [482]. Pflanzen können mithilfe von ätherischen Ölen auch „befreundete“ Insekten anlocken, welche sie dabei unterstützen, Fraßfeinde abzuwehren. Von einigen Pflanzen ist bekannt, dass sie das Getier, das an ihnen knabbert, am Speichel identifizieren und daraufhin – mithilfe der flüchtigen Riechstoffe, die in solchen Fällen Signalstoffe sind – passgenau bestimmte Alliierte anlocken können ( ▶ [29], ▶ [349]). Bienen beispielsweise stellen Geraniol, Citral (auch in Rosen- und Lemongrassöl enthalten) und andere Terpene her und verwenden sie als Markierungspheromone ▶ [700]. Blattläuse stellen trans-β-Farnesen als Alarmpheromon her (auch in Schafgarbenöl enthalten), die Wanze Eurygaster integriceps stellt Vanillin als Sexuallockstoff her.
Auf molekularer Ebene ähneln einzelne Bestandteile von ätherischen Ölen erstaunlich einigen Neuropetiden (Botenstoffen) in unserem Gehirn. Abkömmlinge dieser Bausteine wie Vanillin und Anthranilat werden also von uns Menschen produziert und sind im Gehirnstoffwechsel an der Herstellung von stimmungsbestimmenden Stoffen wie Serotonin und Dopamin beteiligt. Insbesondere „Stinkstoffe“ wie Indol und auch Skatol, welche v.a. in Blütenabsolues vorkommen, sind auch bei diesen Auf- und Abbauprozessen von Nervenbotenstoffen beteiligt ▶ [662].
Verschiedene Pharmazieunternehmen im deutschsprachigen Raum haben ätherische Öle oder einzelne Bestandteile daraus bereits ausführlich unter die Lupe genommen (beispielsweise Klosterfrau mit Soledum, Pohl Booskamp mit Gelomyrtol und Gelositin, Spitzner mit Enteroplant, Wilmar Schwabe mit Lasea, Rowa mit Rowachol, Montavit mit Tavipec), sodass es von dieser Seite gesicherte Erkenntnisse gibt.
Wir bewegen uns mit der Aromatherapie also nicht auf der Spielwiese der Esoterik und energieschwingenden Wunderheilungen, sondern wir beschäftigen uns mit weitestgehend erwiesenen Tatsachen. Zudem zählt der Einsatz von ätherischen Ölen in sehr vielen Ländern der Erde zur traditionellen Volksmedizin, sodass uns recht viele empirisch gewonnene Erkenntnisse zur Verfügung stehen.
Traditionelle Anwendungen
Der Einsatz von Duftstoffen durch den Menschen wird seit Anbeginn der Aufzeichnungen dokumentiert.
Im Altertum, beispielsweise von den Priestern der ägyptischen Hochkulturen, wurden Duftstoffe vornehmlich aus Harzen und Blüten, später auch aus Gewürzen eingesetzt. Der Zweck war vermutlich die spirituelle Reinigung, die sich jedoch kaum von der „Therapie“ bei körperlichen Beschwerden unterschied. Hier musste dann ein „böser Geist“, der übrigens als übel riechend wahrgenommen wurde, vertrieben werden. Ganz wichtig war das Einbalsamieren der Toten. Dieses Mumifizieren verhinderte durch die Anwesenheit von antibakteriell wirksamen ätherischen Ölen das Faulen des Körpers, sodass dieser einfach getrocknet wurde. Das Räuchern von duftenden Substanzen hinterließ uns einen ganz bekannten Räucher- und Parfümstoff der Ägypter, das „Kyphi“, genauso wie das Wort Parfüm (per fumum, lat. = durch den Rauch), da die ursprüngliche Bedeutung dieses Modeproduktes im Beräuchern von Menschen und Gegenständen liegt ▶ [186].
„Weihrauch“ als Produkt des in Somalia und Ägypten einheimischen Olibanum-Baumes und auch als „Mischung von Duftstoffen zwecks Räucherung zur Weihe“ ist sicherlich eine der ältesten Duftanwendungen.
Hatschepsut, die Königin von Saba, und Kleopatra sind Frauengestalten, denen der verschwenderische Umgang mit „Parfüms“ nachgesagt wird. Es gibt heute eine nachempfundene Duftmischung „Song of Salomon“, in der die wichtigsten Düfte dieser Epoche enthalten sind.
In der Bibel sind auch sehr viele duftende Pflanzen und Substanzen erwähnt: Weihrauch, Myrrhe, Zimt, Narde, Kalmus, Galbanum, Cistrose, Lavendel, Myrte, Adlerholz ▶ [606]. Könige wurden mit duftenden Ölen gesalbt, Jesus bekam Räucherwaren zur Geburt überbracht. Manchmal wird behauptet, zu vorbiblischen Zeiten und auch rund um die Zeitenwende seien ätherische Öle im Einsatz gewesen. Da die „richtige“ Destillation erst später erfunden wurde (vorher destillierte man vermutlich nur Alkohol), handelte es sich bei den Salbungen, die Lahme wieder gehend gemacht haben sollen, höchstwahrscheinlich um Mazerate, also ölige Auszüge aus pflanzlichen Duftstoffen (in tierischen Fetten und auch in Olivenöl). Auch wurden heilende und stimmungsverändernde Räucherungen gemacht.
Die Römer um die Jahrtausendwende wurden bekannt durch ihre exzessive Verschwendung u.a. von Rosenprodukten. Die vermögenden Bürger stellten geradezu ihr Leben in den Dienst von Salben, Pomaden und Riechwässerchen. Cäsar soll sich erst in seinen Badestuhl gesetzt haben, wenn er über und über nach Parfüm duftete.
Im 10. Jahrhundert n. Chr. brachten die Araber die Technik der Destillation nach Spanien. Zwei Jahrhunderte später entbrannte in Frankreich ein Streit darüber, wer das Recht habe, Parfüm zu verkaufen. 1268 wurde die „Corporation des Maitres Gantiers“ gegründet, sodass zunächst die Handschuhmacher die Herren der Düfte wurden und sich nach einem Rechtsstreit 1614 „Parfümeur“ nennen durften. In Zeiten der äußerst ansteckenden Pest waren sie diejenigen, die selten erkrankten. Die Zeit von Königin Elisabeth I. von England (um 1650) war geprägt von duftenden Perücken, Pomaden und Pudern.
Über die Entstehung des „Kölnisch Wasser“ gab es lange Zeit unterschiedliche Versionen. Neuere Recherchen zeigen, dass der Italiener Johannis Maria Farina (1685–1766) in die Firma seines Bruders einstieg und dort in Köln den prägenden Duft der Adligen des 18. Jahrhunderts kreierte.
1792, also nach Farinas Zeit, überreichte ein Mönch dem Kaufmann Mühlens das Rezept für das Duftwasser „Aqua mirabilis“ zur Hochzeit. Auf der Pariser Weltausstellung 1867 war dieses Eau de Cologne mit der (Haus-)Nummer 4711 eine der größten Attraktionen. Hauptbestandteile vieler Kölnisch-Wasser-Varianten sind auch heute noch Bergamotte-, Neroli-, Petit-Grain- sowie Rosmarinöl.
In der Zeit um die französische Revolution herum waren neben der ersten Haute Couture feinste Düfte tonangebend; es wurden bereits Parfümkompositionen hergestellt. Die Zeit der Industrialisierung begann.
1874 wurde erstmals Vanillin synthetisiert. 1899 erschien das heute teilweise immer noch gültige Standardwerk zur Gewinnung und Zusammensetzung von ätherischen Ölen, Die ätherischen Öle von Gildemeister und Hoffmann, in Leipzig ▶ [214].
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schließlich besann man sich wieder auf die heilenden Aspekte der natürlichen Duftstoffe. Der Chemiker und Parfümeur René Maurice Gattefossé leitete mit der Erforschung der pharmazeutisch-medizinischen Eigenschaften der ätherischen Öle die Ära der Aromatherapie ein ▶ [694]. Er löschte nicht, wie es falsch in vielen Texten nachzulesen ist, nach einem Chemieunfall seine Verbrennungen mit Lavendelöl, sondern zog sich beim Wälzen im Gras (zum Löschen) eine Gasbrandinfektion mit Clostridium perfringens zu. Da diese Infektion im Ersten Weltkrieg der Schrecken aller Verwundeten war, wusste Gattefossé, dass er sich in Lebensgefahr befand und besann sich seines Wissens, dass Lavendelöl Infektionen bekämpfen kann. So rettete er mit diesem Öl sein Leben und setzte sich für die weitere medizinische Erforschung dieses und anderer ätherischer Öle ein. In Frankreich arbeiten darum v.a. Ärzte mit diesen Mitteln der Phytotherapie. In England dagegen wurde die Aromatherapie erst einmal eine Domäne von Kosmetikern und Masseuren, eingeleitet durch Kurse von Marguerite Maury und ihrer „Erben“ Danièle Ryman und Micheline Arcier sowie Robert Tisserand, Patricia Davis und Shirley Price.
Es gibt bereits frühe wissenschaftliche Studien mit ätherischen Ölen, doch erst seit Ende des 20. Jahrhunderts wird in klinischen, also randomisierten kontrollierten Studien (RCT) der medizinische Einsatz bei Krankheiten von einigen Institutionen untersucht.
Das neue Jahrtausend brachte auch einen Wermutstropfen mit sich: Die Anwendung von weltweit in unvorstellbaren Mengen gehandelten ätherischen Ölen nahm derart zu, dass manche Duftpflanzen inzwischen zu den gefährdeten Arten gehören. Nachdem es bereits zuvor große Sorgen samt Lieferengpässen von Sandelholz und Rosenholzöl gab, rutschten weitere Naturdüfte in die roten Listen. Es wird immer schwieriger, guten Weihrauch zu importieren, die zarten Bäume werden buchstäblich ausgeblutet, das Öl erfährt seit einigen Jahren einen Hype. Das zu intensive Ernten von Nardenwurzeln führte zur Gefährdung, seit Januar 2021 zählt sogar Eucalyptus radiata zu den bedrohten Pflanzen (www.airmidinstitute.org), auch Zedernholz wird immer knapper, der Bestand wurde in 10 Jahren halbiert. Es gehört also zum Handwerkszeug von bewusst und achtsam arbeitenden Aroma-Enthusiastinnen und -Enthusiasten, sich in diesem Bereich auszukennen. Und Menschen aufzuklären, dass Verschwendung der ätherischen Öle sowohl für die Haut als auch für die Natur ungesund ist.
Zur Arbeit mit diesem Buch
Dieses Buch gibt Ihnen eine Übersicht über die wesentlichen Inhalte einer fundierten Aromatherapie-Ausbildung, wie sie sich in Großbritannien bereits durchgesetzt hat. Es skizziert gleichzeitig viele wissenschaftliche Erkenntnisse aus den letzten drei Jahrzehnten. Sie können es von vorne bis hinten durchlesen, es aber genauso gut als Nachschlagewerk für Ihren speziellen Bereich benutzen.
In Teil 1 werden die botanischen und biochemischen Grundlagen erklärt, die für das Verständnis der Potenziale und die therapeutischen Wirkungen immens wichtig sind. Die Umsetzung in der therapeutischen Praxis ist Thema von Teil 2. Ausführlich wird auf Anwendungsmöglichkeiten eingegangen und in tabellarischer Form werden wichtige Indikationen übersichtlich dargestellt. Sie helfen im Pflegealltag, schnell die passenden Öle zu finden und sich selbst Mischungen zusammenzustellen. In Teil 3 erhalten Sie dann einen detaillierten Überblick über Pflanzen und ihre ätherischen Öle – welche Inhaltsstoffe und wichtige Eigenschaften diese auszeichnen, für welche Hauptindikationen sie eingesetzt werden und welche Nebenwirkungen ggf. zu beachten sind. Nützliche Hilfsmittel für die vertiefte Beschäftigung mit der Aromatherapie sind im Anhang zusammengefasst. Dort bietet Ihnen ein Rezepturenverzeichnis auch einen wertvollen Überblick und schnellen Zugriff auf alle im Buch vorgestellten Rezepturen (nach Anwendungsgebieten alphabetisch in ▶ Tab. 12.1 aufgelistet).
Sie finden Rezeptbeispiele, die jedoch nur als Anregungen verstanden werden sollen: Für eine ganzheitliche Therapie am Menschen muss man diesen erleben und sowohl die Auswahl der Öle als auch die Behandlungsmethode nach seiner momentanen Befindlichkeit treffen. Auch sollte, wann immer möglich, die Nase der Klientinnen und Klienten miteinbezogen werden. Duftvorlieben sollten respektiert werden, Abneigungen ebenso. Dennoch können Anfänger von den Tabellen profitieren, die sich in diesem Bereich bewährt haben.
Bitte bedenken Sie, dass Sie, wenn Sie Aromapflege oder Aromatherapie anbieten, immer für den Menschen ( ▶ Abb. 0.1) arbeiten und nicht gegen seine Befindlichkeitsstörungen. Lassen Sie sich nicht von komplizierten Diagnosen ablenken, sondern versuchen Sie zusammen mit Ihrer Klientin oder Ihrem Klienten herauszufinden, wie genau sich seine Beschwerde anfühlt, lassen Sie seine Nase mit entscheiden, nachdem Sie als Fachperson eine Vorauswahl an Düften getroffen haben. Im klinischen Bereich gibt es inzwischen etliche Anbieter von bewährten hochwertigen Fertigmischungen, mit denen Sie wohltuende und heilungsfördernde Dufterlebnisse auch in den „sterilsten“ Bereich der institutionalisierten Pflege bringen können.
Abb. 0.1 In der Naturheilkunde werden die Selbstheilungsfunktionen der Klientinnen und Klienten gestützt, anstatt nur gegen Symptome zu kämpfen.
Die ätherischen Öle sind in diesem Fachbuch, das sich an Fachleute wendet, meistens mit korrektem botanischem Namen benannt, insbesondere dann, wenn es sich um eine spezielle Auswahl für einen bestimmten Pflegeaspekt handelt. Für die „Übersetzung“ gibt es im Anhang ein Verzeichnis der Öle, das nach den deutschen Bezeichnungen geordnet ist. Wenn keine Pflanzenteile oder Chemotypen dazu genannt sind, spielen sie für die Anwendung nach heutigen Erkenntnissen keine wesentliche Rolle.
Wenn Ihnen die Fülle an Informationen in diesem Buch zu groß vorkommt oder Sie einen roten Faden durch die umfangreiche Materie wünschen, lege ich Ihnen mein ergänzendes Arbeitsheft Aromatherapie (Haug Verlag) ans Herz ▶ [769]. Darin nehme ich Sie sozusagen an die Hand und zeige Ihnen anhand von leicht zu lösenden kleinen Aufgaben, Fragen und Rätseln, welche Gebiete unserer „duften Materie“ besonders wichtig sind. Darin finden Sie, was Sie für eine Abschlussprüfung einer anspruchsvollen Ausbildung unbedingt wissen sollten.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und v.a. bei eigenen Erfahrungen. Dazu dürfen auch kleine „Fehler“ zählen, die einen lehren, achtsam mit diesen „duftenden Kraftpaketen“ umzugehen.
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Geleitwort zur 7. Auflage
Geleitworte zur 6. Auflage
Geleitwort von Ute Leube
Geleitwort von Albrecht von Keyserlingk
Vorwort zur 7. Auflage
Einleitung
Moderne Forschung
Traditionelle Anwendungen
Zur Arbeit mit diesem Buch
Teil I Von der Pflanze in die Flasche: die botanischen und chemischen Grundlagen der Aromatherapie
1 Herkunft und Herstellung ätherischer Öle
1.1 Botanik
1.1.1 Taxonomie
1.1.2 Stoffwechsel der Pflanzen
1.1.3 Funktionen von ätherischen Ölen
1.1.4 Pflanzenorgane
1.1.5 Pflanzenteile
1.1.6 Chemotyp
1.1.7 Dünger, Jahreszeit und geografische Lage
1.2 Anbauverfahren
1.2.1 Anbaumethoden
1.2.2 Siegel und Zertifizierungen
1.2.3 Hybride
1.3 Herstellungsverfahren
1.3.1 Gewinnungsverfahren
1.3.2 Duftstoffe aus dem Labor
1.4 Qualitätsprüfung
1.4.1 Sensorische Prüfung
1.4.2 Chemische Qualitätsanalyse
1.4.3 Öle aus der Apotheke
1.5 Haltbarkeit
1.5.1 Kalt gepresste Zitrusöle
1.5.2 Destillierte Öle
1.5.3 Mischungen
2 Biochemie der Inhaltsstoffe
2.1 Bildung der ätherischen Öle in der Pflanze
2.1.1 Organische Chemie
2.1.2 Chemie der ätherischen Öle
2.2 Dufte Moleküle und ihre Eigenschaften
2.2.1 Terpene und Terpenoide
2.2.2 Phenole und Phenylpropanderivate
2.3 Inhaltsstoffe und Begriffe in Stichworten
Teil II Von der Flasche unter die Haut: die therapeutische Anwendung ätherischer Öle
3 Grundlagen der Wirkung ätherischer Öle im menschlichen Organismus
3.1 Wege in den Körper
3.1.1 Nasale Anwendung
3.1.2 Perkutane Anwendung
3.1.3 Rektale und vaginale Anwendung
3.1.4 Orale Anwendung
3.2 Physiologische Wirkung
3.2.1 Studien
3.2.2 Psychisch-subjektive Wirkungen
3.2.3 Somatisch-pharmazeutische Wirkungen
3.2.4 Verarbeitung von ätherischen Ölen im menschlichen Körper
3.3 Wirksamkeit
3.3.1 Zwei Jahrhunderte Forschung
3.3.2 Ätherische Öle und Bakterien
3.3.3 Ätherische Öle und Pilze
3.3.4 Ätherische Öle und Viren
3.3.5 Ätherische Öle bei Schmerzen
3.3.6 Ätherische Öle bei degenerativen Erkrankungen
3.3.7 Aromapflege im klinischen und betreuenden Umfeld
3.3.8 Aromatherapie als wirksame Unterstützung bei seelischen Problemen
3.3.9 Aromapflege und -therapie bei geistiger Müdigkeit und körperlicher Überbeanspruchung
3.3.10 Ätherische Öle zur Behandlung von spezifischen Problemen von Frauen und Kindern
3.3.11 Ätherische Öle zur Behandlung von Hautkrankheiten
3.3.12 Ätherische Öle zur Behandlung von Erkrankungen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich
3.3.13 Ätherische Öle für Untersuchungen und gegen Beschwerden im Harn- und Verdauungstrakt
4 Therapiepraxis
4.1 Einkauf ätherischer Öle
4.1.1 Was muss aufs Etikett?
4.2 Auswahl, Dosis und unkomplizierte Anwendungsmethoden von ätherischen Ölen
4.2.1 Auswahl
4.2.2 Häufigkeit und Zeitpunkt
4.2.3 Dosierung und Verdünnung
4.2.4 Inhalation
4.2.5 Raumbeduftung und ätherische Öle bei riechenden Krankheiten
4.2.6 Einreibung und Teilmassage
4.2.7 Einnahme
4.3 Aromamassage
4.3.1 Berührung
4.3.2 Geschichte der Massage
4.3.3 Wirkungen von Aromamassage
4.3.4 Vorbereitung zur Massage
4.3.5 Erster Termin
4.3.6 Grifftechniken
4.4 Fette Pflanzenöle – mehr als Trägersubstanzen
4.4.1 Gewinnung von fetten Pflanzenölen
4.4.2 Öl ist nicht gleich Öl
4.4.3 Fett und Wasser
4.4.4 Haltbarkeit der Trägeröle
4.4.5 Pflanzenöle auf der Haut
4.4.6 Menge und Mischungen
4.4.7 Vielfalt der fetten Öle und ihre Wirkungen
4.5 Hydrolate – mehr als Wasser mit Duftstoffen
4.5.1 Gewinnung von Hydrolaten
4.5.2 Hydrolat ist nicht gleich Hydrolat
4.5.3 Haltbarkeit der Hydrolate
4.5.4 Hydrolate auf der Haut
4.5.5 Menge und Mischungen
4.5.6 Vielfalt der Hydrolate und ihre Wirkungen
4.6 Wasser und ätherische Öle
4.6.1 Hydrotherapie
4.6.2 Bäder
4.6.3 Waschungen
4.6.4 Wickel und Kompressen
5 Wichtige Indikationen
5.1 Bewährte Öle bei psychischen und körperlichen Symptomen
5.2 Übersicht: Auswahl der ätherischen Öle
5.3 Spezielle Anwendungen im klinischen Bereich, im Seniorenheim und in der ambulanten Pflege
5.3.1 Anregungen und Rezeptbeispiele
6 Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen
6.1 Toxikologie der Duftstoffe
6.1.1 Forschung zur Verträglichkeit
6.1.2 Sicherheitsvorkehrungen
6.1.3 Anwendungsfehler und Vergiftungen
6.2 Verträglichkeit und Allergien
6.2.1 Allergien
6.2.2 Haut und ätherische Öle
6.3 Kontraindikationen: Auf was Sie achten müssen!
6.3.1 Leber und ätherische Öle
6.3.2 Herz und Kreislauf und ätherische Öle
6.3.3 Atemwege und ätherische Öle
6.3.4 Zentrales Nervensystem und ätherische Öle
6.3.5 Augen und ätherische Öle
6.3.6 Nieren und ätherische Öle
6.3.7 Hormonsystem und ätherische Öle
6.3.8 Schwangerschaft und ätherische Öle
6.3.9 Besondere Vorsicht: Säuglinge
6.3.10 Krebserkrankungen und ätherische Öle
6.3.11 Wechselwirkungen mit Medikamenten
6.3.12 Gefahrstoffverordnung
6.3.13 Giftzentralen
Teil III Viele Öle – viele Wirkungen: Pflanzen und ätherische Öle im Überblick
7 Ätherische Öle
7.1 Abelmoschus moschatus Medik.
7.2 Abies alba Mill.
7.3 Abies balsamea L. (Mill.)
7.4 Abies grandis (Doug. ex D.Don) Lindl.
7.5 Abies sibirica Ledeb.
7.6 Acacia dealbata Link.
7.7 Achillea millefolium L.
7.8 Acorus calamus L. ‼
7.9 Agathosma betulina (P.J.Bergius) Pillans
7.10 Aloysia triphylla (L’Hér.) Britton
7.11 Alpinia galanga (L.) Willd.
7.12 Ammi visnaga (L.) Lam.
7.13 Amyris balsamifera L.
7.14 Anethum graveolens L.
7.15 Angelica archangelica L.
7.16 Aniba rosaeodora Ducke
7.17 Apium graveolens L.
7.18 Aquilaria malaccensis Lam.
7.19 Artemisia absinthium L. ‼
7.20 Artemisia dracunculus L.
7.21 Artemisia pallens Wall. ex DC.
7.22 Artemisia vulgaris L. ‼
7.23 Backhousia citriodora F.Muell.
7.24 Betula lenta L.
7.25 Boswellia sacra Flueck.
7.26 Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.
7.27 Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb.
7.28 Bursera delpechiana Poiss. ex Engl.
7.29 Bursera graveolens (Kunth) Triana u. Planch.
7.30 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. u. Thomson
7.31 Canarium luzonicum (Blume) A.Gray
7.32 Cannabis sativa L.
7.33 Carum carvi L.
7.34 Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière
7.35 Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don
7.36 Chamaemelum mixta Alloni
7.37 Chamaemelum nobile (L.) All.
7.38 Cinnamomum aromaticum Nees
7.39 Cinnamomum camphora (L.) J.Presl Chemotyp Campher
7.40 Cinnamomum camphora (L.) J.Presl Chemotyp 1,8-Cineol
7.41 Cinnamomum camphora (L.) J.Presl Chemotyp Linalool
7.42 Cinnamomum zeylanicum Blume (Blätter)
7.43 Cinnamomum zeylanicum Blume (Rinde)
7.44 Cinnamosma fragrans Baill.
7.45 Cistus ladanifer L.
7.46 Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle
7.47 Citrus × aurantium L. (Blätter)
7.48 Citrus × aurantium L. (Blüten)
7.49 Citrus × aurantium L. (Fruchtschale)
7.50 Citrus × bergamia Risso u. Poit.
7.51 Citrus × junos Sieb ex Tanaka
7.52 Citrus hystrix DC.
7.53 Citrus limon (L.) Osbeck
7.54 Citrus paradisi Macfad.
7.55 Citrus reticulata Blanco (Blätter)
7.56 Citrus reticulata Blanco (Fruchtschale)
7.57 Citrus sinensis L. Osbeck
7.58 Commiphora guidottii Chiov. ex Guid.
7.59 Commiphora molmol (Engl.) Engl. ex Tschirch
7.60 Copaifera officinalis L.
7.61 Coriandrum sativum L. (Früchte)
7.62 Coriandrum sativum L. (Kraut)
7.63 Cuminum cyminum L.
7.64 Cupressus sempervirens L.
7.65 Curcuma longa L.
7.66 Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W.Watson
7.67 Cymbopogon martini (Roxb.) W.Watson
7.68 Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor
7.69 Daucus carota L.
7.70 Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.
7.71 Elettaria cardamomum (L.) Matton
7.72 Eucalyptus citriodora Hook.
7.73 Eucalyptus dives Schauer
7.74 Eucalyptus globulus Labill.
7.75 Eucalyptus polybractea F.Muell. ex R.T.Baker Chemotyp 1,8-Cineol
7.76 Eucalyptus polybractea F.Muell. ex R.T.Baker Chemotyp Crypton
7.77 Eucalyptus radiata A.Cunn. ex DC.
7.78 Eucalyptus smithii F.Muell. ex R.T.Baker
7.79 Eucalyptus staigeriana F.Muell. ex F.M.Bailey
7.80 Ferula gummosa Boiss.
7.81 Foeniculum vulgare Mill.
7.82 Fokienia hodginsii (Dunn) A.Henry u. H.H.Thomas
7.83 Gaultheria fragrantissima Wall.
7.84 Geranium macrorrhizum L.
7.85 Hedychium coronarium Koenig
7.86 Helichrysum italicum (Roth) G.Don
7.87 Humulus lupulus L.
7.88 Hypericum perforatum L.
7.89 Hyssopus decumbens Jord. u. Fourr.
7.90 Illicium verum Hook.f.
7.91 Inula graveolens (L.) Desf.
7.92 Iris × germanica L.
7.93 Jasminum grandiflorum L.
7.94 Jasminum sambac L.
7.95 Juniperus ashei J.Buchholz
7.96 Juniperus communis L. (Früchte)
7.97 Juniperus communis L. (Zweige und Früchte)
7.98 Juniperus oxycedrus L.
7.99 Juniperus sabina L. ‼
7.100 Juniperus virginiana L.
7.101 Kunzea ericoides (A.Rich.) Joy Thomps.
7.102 Larix europaea DC.
7.103 Laurus nobilis L.
7.104 Lavandula angustifolia Mill. (kultiviert)
7.105 Lavandula angustifolia Mill. (aus Wildsammlung)
7.106 Lavandula latifolia Medik.
7.107 Lavandula stoechas L.
7.108 Lavandula × intermedia Super
7.109 Leptospermum petersonii F.M.Bailey
7.110 Leptospermum scoparium J.R.Forst. u. G.Forst.
7.111 Levisticum officinale W.D.J.Koch
7.112 Liquidambar orientalis Mill.
7.113 Litsea cubeba (Lour.) Pers.
7.114 Matricaria recutita L.
7.115 Melaleuca alternifolia (Maiden u. Betche) Cheel
7.116 Melaleuca ericifolia Smith
7.117 Melaleuca leucadendra var. cajuputi L.
7.118 Melaleuca viridiflora Sol. ex Gaertn.
7.119 Melissa officinalis L. Chemotyp Citral
7.120 Melissa officinalis L. Chemotyp Citronellal
7.121 Mentha arvensis L.
7.122 Mentha × citrata Ehrh.
7.123 Mentha × piperita L.
7.124 Mentha pulegium L.
7.125 Mentha spicata L.
7.126 Michelia alba DC.
7.127 Michelia champaca L.
7.128 Monarda fistulosa L. Chemotyp Geraniol
7.129 Myristica fragrans Houtt.
7.130 Myrocarpus fastigiatus Allemao
7.131 Myroxylon balsamum (L.) Harms
7.132 Myrtus communis L. Chemotyp 1,8-Cineol
7.133 Myrtus communis L. Chemotyp Myrtenylacetat
7.134 Myrtus communis L. Chemotyp Pinen
7.135 Nardostachys jatamansi (D.Don) DC.
7.136 Nepeta cataria L.
7.137 Nigella sativa L.
7.138 Ocimum basilicum L. Chemotyp Linalool
7.139 Ocimum basilicum L. Chemotyp Methylchavicol
7.140 Ocimum sanctum L.
7.141 Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer ‼
7.142 Origanum majorana L.
7.143 Origanum vulgare L.
7.144 Osmanthus fragrans Lour.
7.145 Pelargonium × graveolens L‘Hér.
7.146 Petroselinum crispum (Mill.) Fuss ‼
7.147 Peumus boldus Molina ‼
7.148 Pimenta dioica (L.) Merr.
7.149 Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore
7.150 Pimpinella anisum L.
7.151 Pinus cembra L.
7.152 Pinus mugo Turra
7.153 Pinus nigra ssp. laricio Maire
7.154 Pinus sylvestris L.
7.155 Piper nigrum L.
7.156 Pistacia lentiscus L.
7.157 Plumeria alba L.
7.158 Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
7.159 Polianthes tuberosa L.
7.160 Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb ‼
7.161 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
7.162 Ravensara aromatica Sonn.
7.163 Rhododendron anthopogon D.Don
7.164 Rosa × damascena Herrm.
7.165 Rosmarinus officinalis L. Chemotyp Bornan-2-on (Campher)
7.166 Rosmarinus officinalis L. Chemotyp 1,8-Cineol
7.167 Rosmarinus officinalis L. Chemotyp Verbenon/Bornylacetat (ABV)
7.168 Ruta graveolens L. ‼
7.169 Salvia lavandulifolia Vahl
7.170 Salvia officinalis L.
7.171 Salvia sclarea L.
7.172 Santalum album L.
7.173 Santalum austrocaledonicum Vieill.
7.174 Santolina chamaecyparissus L. ‼
7.175 Satureja montana L.
7.176 Saussurea costus (Falc.) Lipsch.
7.177 Schinus molle L.
7.178 Styrax tonkinensis Craib ex Hartwich (Siam)
7.179 Syzygium aromaticum L.
7.180 Tagetes minuta L.
7.181 Tanacetum vulgare L. ‼
7.182 Thuja occidentalis L. ‼
7.183 Thymus mastichina (L.) L.
7.184 Thymus serpyllum L.
7.185 Thymus vulgaris L. Chemotyp Linalool und Geraniol
7.186 Thymus vulgaris L. Chemotyp Thujanol
7.187 Thymus vulgaris Chemotyp Thymol und Carvacrol
7.188 Trachyspermum ammi (L.) Sprague
7.189 Valeriana officinalis L.
7.190 Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews
7.191 Vetiveria zizanioides (L.) Nash
7.192 Viola odorata L.
7.193 Vitex agnus-castus L.
7.194 Zingiber officinale Roscoe
Teil IV Anhang
8 Aromatherapie als Beruf
8.1 Aromatherapie in Frankreich
8.1.1 Verkauf von ätherischen Ölen
8.2 Aromatherapie in Großbritannien
8.2.1 Verkauf von ätherischen Ölen
8.3 Aromatherapie in Deutschland
8.3.1 Heilpraktikergesetz
8.3.2 Ein eigenständiger Beruf?
8.3.3 Aromamassage
8.3.4 Aromapflege im Krankenhaus
8.3.5 Ausbildungsmöglichkeiten in deutscher Sprache
8.3.6 Curriculum und Mindestanforderungen an eine qualifizierte Ausbildung
8.3.7 Verkauf von ätherischen Ölen
8.3.8 Arzneimittelgesetz und Verordnung über apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arzneimittel
8.3.9 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetz
8.3.10 „Komplementäre Pflegemethoden“ und geltendes Recht
8.4 Aromatherapie in Österreich
8.4.1 Aromapflege und geltendes Recht
8.5 Aromatherapie in der Schweiz
8.6 Eröffnung einer Praxis
8.6.1 Behörden
8.6.2 Titel und Tätigkeitsfeld
8.6.3 Existenzgründung
8.6.4 Geschäfte, Steuern und Versicherung
8.6.5 Werbung
8.6.6 Raum
8.6.7 Utensilien
8.6.8 Grundausstattung Öle
8.6.9 Beratung und Körperbehandlung
8.6.10 Abkürzungen
9 Bekannte Expertinnen und Experten der Aromatherapie
9.1 Frankreich
9.1.1 René-Maurice Gattefossé †
9.1.2 Jean Valnet †
9.1.3 Marguerite Maury †
9.2 Italien
9.2.1 Paolo Rovesti †
9.3 Großbritannien
9.3.1 Dr. Jane Buckle
9.3.2 Patricia Davis †
9.3.3 Rhiannon Lewis
9.3.4 Gabriel Mojay
9.3.5 Shirley und Len Price
9.3.6 Robert Tisserand
9.4 Deutschsprachiger Raum
9.4.1 Inge-Lore Andres
9.4.2 Ruth von Braunschweig
9.4.3 Evelyn Deutsch-Grasl
9.4.4 Susanne Fischer-Rizzi
9.4.5 Martin Henglein †
9.4.6 Ingeborg Stadelmann
9.4.7 Dietrich Wabner †
9.4.8 Monika Werner
10 Glossar von A–Z
11 Pflanzennamen Deutsch – Botanisch
12 Rezepturenverzeichnis
13 Nützliche Adressen und Hinweise
13.1 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit ätherischen Ölen in deutscher Sprache
13.2 Heilpraktikerinnen mit Angeboten zur Aromatherapie
13.3 Aromafachfrauen mit langjähriger Berufserfahrung
13.4 Apotheken, Apotheker, pharmazeutisch-technische Assistenten
13.5 Aromatogramme
13.6 Spezielle Aromapflege für institutionelle Einrichtungen (Krankenhäuser und Heime)
13.7 Aroma-Koffer aus Holz
13.8 Ätherische Öle, fette Öle, Hydrolate aus kontrolliert-biologischem Anbau
13.8.1 Deutschsprachiger Raum
13.8.2 Großbritannien und USA
13.8.3 Frankreich
13.9 Fertigkapseln und Globuli mit ätherischen Ölen
13.10 Inhalierstifte (befüllbar) für ätherische Öle
13.11 Fortbildung im Ausland
13.12 Internationale Vereine und Verbände
13.13 Zeitschriften und Web-Magazine
13.14 Großraumbeduftung, Duftobjekte
13.15 Kosmetische Fertigprodukte, duftfrei und mit ätherischen Ölen
13.16 Naturkosmetik und Bio-Rohstoffe zum Selbermachen
13.17 Versand und Erleben von Kräutern, seltenen Duftpflanzen und Samen
14 Literatur
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
Teil I Von der Pflanze in die Flasche: die botanischen und chemischen Grundlagen der Aromatherapie
1 Herkunft und Herstellung ätherischer Öle
2 Biochemie der Inhaltsstoffe
1 Herkunft und Herstellung ätherischer Öle
Warum beschäftigen wir uns als Aromapraktiker und Aromapflegende mit dem Aufbau, dem Stoffwechsel, der Fortpflanzung und der Namensgebung von Pflanzen? Wir haben es in der ganzheitlichen Aromapraxis (Aromatherapie, Aromapflege) mit Produkten aus lebendigen Pflanzen zu tun: mit ätherischen Ölen, Absolues und Resinoiden sowie mit fetten Ölen und Hydrolaten. Synthetische, tierische und mineralische Produkte werden nicht angewendet.
1.1 Botanik
Da wir also mit Wirkstoffen aus Pflanzen arbeiten, ist es wichtig, die Herkunft des jeweiligen ätherischen Öles, nämlich die Ursprungspflanze, genauer kennenzulernen. Wie groß ist sie, welche Farben haben ihre Blätter und Blüten, welche Struktur und Konsistenz haben ihre einzelnen Organe, wo wächst sie bevorzugt, hat sie bestimmte Nachbarpflanzen, macht sie sich „dünn“ oder „breit“, blüht und duftet sie eher bei Tag oder eher bei Nacht etc.? Im Idealfall kann man sie in ihrer natürlichen Umgebung betrachten, sie anfassen, ihr Aroma schmecken, ihren Duft einatmen. Das ist nicht immer möglich, auch wenn in Deutschland viele gute Botanische Gärten, Apothekergärten, (Kräuter-)Gärtnereien und Baumschulen zur Verfügung stehen. Gute Abbildungen und getrocknete Pflanzen können beim Kennenlernen hilfreich sein und nicht zuletzt auch das Studium des Lebensraumes der einzelnen Pflanze (wächst sie eher in der Wüste oder an feuchten Orten etc.).
Nach der alten Lehre der „Signatur“ gibt die äußere Erscheinung einer Pflanze dem geschulten Auge bereits mögliche Hinweise auf deren Verwendung ▶ [227]. Bei den ätherischen Ölen haben wir 2 sehr deutliche Beispiele: Der sich breitmachende, vor Kraft strotzende und auffällige Atlaszeder-Baum versorgt uns mit einem Öl, das bei Immunschwäche, Minderwertigkeitsgefühlen und Erschöpfungszuständen ausgesprochen hilfreich ist. Die schlanke, zum Himmel strebende Italienische Zypresse (Cupressus sempervirens) unterstützt uns mit einem Öl, das beim „Konzentrieren und Sammeln“ hilft: Alles, was irgendwie aus den Fugen geraten ist, wird „geordnet“, seien es Krampfadern, Cellulite, mangelnde Konzentrationskraft oder Trauerarbeit.
Bestimmte theoretische Grundlagen der Botanik sind für in der Naturheilkunde tätige Menschen auch deswegen nötig: Sie ermöglichen die internationale Verständigung, da die botanischen Namen von Pflanzen weltweit gültig sind. Zudem gibt der vor Jahrhunderten vergebene Artname in vielen Fällen dem Kenner auch Informationen über Aussehen, Wirkung oder Einsatzgebiet.
1.1.1 Taxonomie
Merke
Taxonomie (taxis, gr. = Ordnung) ist ein Teilgebiet der Systematik, das sich mit der Definition der Taxa (Gruppe von Lebewesen, z.B. Stamm, Klasse, Ordnung, Familie) und deren Benennung nach den internationalen Regeln der zoologischen und botanischen Nomenklatur befasst ▶ [173].
Die Arbeit der Klassifizierung der Pflanzen verhilft uns zu einer gewissen Übersicht, zudem können wir bei manchen Pflanzenfamilien deutliche Ähnlichkeiten im Aussehen und in der Wirkung der ätherischen Öle feststellen.
Für botanische Laien schwer nachzuvollziehen sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse, weswegen es regelmäßig zu Neuerungen in Namen und Familienzuordnungen kommt. Führende Botaniker aus aller Welt treffen sich alle 5 Jahre in einer internationalen Konferenz zwecks Abstimmung von neuen Namen, Familienzugehörigkeiten und sonstigen Erkenntnissen.
Die Grundlagen der modernen Botanik wurden im 18. Jahrhundert gelegt. Es gab zwar über 50 Systeme zur Klassifizierung von Pflanzen, doch nur das System von Carl von Linné (1707–1778) hat bis in die heutige Zeit überlebt und wird als Taxonomie (taxis, gr. = Ordnung) bezeichnet. Diese Form der Klassifizierung ergibt sich nach der Anordnung der Fortpflanzungsorgane in den jeweiligen Blüten der Pflanzen. Sie hat weltweite Gültigkeit. Das Pflanzenreich wird in 5 große Hauptgruppen unterteilt:
Angiospermae – Bedecktsamer: Das sind ein- und mehrjährige Kräuter und auch viele Bäume und Sträucher (die Samen sitzen gut bedeckt in einer Art Gebärmutter).
Gymnospermae – Nacktsamer: Das sind v.a. Nadelhölzer und Ginkgogewächse (die Samen liegen recht ungeschützt an einzelnen Pflanzenstrukturen wie Zapfen).
Pteridophyta – Farnpflanzen, Bärlapp und Schachtelhalme
Bryophyta – Moose und Lebermoose
Algae – Algen
Für die Gewinnung von ätherischen Ölen werden fast nur blühende Pflanzen aus der Gruppe der Angiospermae (Blütenöle, Zitrusschalenöle, Kräuteröle, Gewürzöle, Holzöle) verwendet, sowie einige wenige Pflanzen aus der Gruppe der Gymnospermae (Nadelöle).
Info
Carl von Linné
Die Taxonomie ist eng verknüpft mit dem Namen Carl von Linné, auch Linnaeus genannt. Hinter vielen botanischen Bezeichnungen finden wir den Buchstaben „L.“. Namensgeber dieser Formen war der schwedische Naturforscher. Er wurde am 23. Mai 1707 in Råshult geboren und starb am 10. Januar 1778 in Uppsala.
Nach dem Studium der Medizin und der Naturwissenschaften unternahm er zunächst Forschungs- und Studienreisen nach Lappland, in die Niederlande, nach Großbritannien und Frankreich. Er wurde Arzt in Stockholm, 1739 Präsident der Stockholmer Akademie der Wissenschaften, deren Gründung er mitbewirkt hatte, 1741 wurde er Professor der Anatomie und Medizin in Uppsala, 1742 übernahm er die Professur in Botanik. Linné gestaltete den Botanischen Garten und errichtete ein naturhistorisches Museum.
Der viel beschäftigte Wissenschaftler hat die Grundlagen der botanischen Fachsprache geschaffen, d. h. eine Beschreibung in bestehender Reihenfolge der einzelnen Pflanzenteile. Zudem führte er die binäre Nomenklatur ein, z.B. Weißtanne: Abies alba. Die Abkürzung L. hinter einem Pflanzen- oder Tiernamen besagt, dass er diese Art als Erster beschrieben und benannt hat. Das 1735 veröffentlichte Linné-System war auf Unterschiede in den Geschlechtsorganen der Pflanzen aufgebaut (Sexualsystem). Auch zoologische und mineralogische Systeme gab er heraus.
Quelle: ▶ [77]
1.1.1.1 Pflanzenfamilien
Um die Wirkungen der ätherischen Öle zu studieren, ist es hilfreich, ihre Familienzugehörigkeit zu kennen. Mitglieder einer Familie verfügen oft über ähnliche Wirkungen und ähnliche Kontraindikationen. Zum Beispiel ist die äußere schirmartige Blütengestalt bei allen Apiaceae (Umbelliferae, Doldenblütengewächse) sehr ähnlich. Ihre ätherischen Öle enthalten mal mehr und mal weniger Monoterpenketone oder Phenylether, viele wirken regulierend auf den Hormonhaushalt (z.B. Anis, Fenchel), blähungswidrig und verdauungsfördernd (z.B. Kümmel, Koriander).
In der Familie der Asteraceae (Compositae, Korbblütengewächse) – viele erinnern in ihrer Gestalt an Gänseblümchen oder Sonnenblumen – finden wir einige ätherische Öle, die nur zur Anwendung von erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten geeignet sind (z.B. Estragon, Tagetes) oder gar nicht verwendet werden sollten (z.B. Beifuß, Wermut, Rainfarn). Die entkrampfenden und entzündungshemmenden Kamillen dagegen gehören zur Grundausstattung der Aromatherapeutin/des Aromatherapeuten.
Die Familie der Pinaceae (Kieferngewächse) versorgt uns mit ausgezeichneten Helfern bei Atemwegserkrankungen, die auch hervorragend die Luft desinfizieren können: Kiefernnadelöl, Tannennadelöl, Fichtennadelöl.
Viele ätherische Öle, die aus Pflanzen der Familie der Myrtaceae (Myrtengewächse) destilliert werden, sind mittlerweile fast ein Synonym für „Anti-Erkältungsmittel“: Eukalyptus, Myrte, Cajeput. Ihr Duft wird mit „medizinisch“ beschrieben; einige sind auch wirksame Mittel bei venösen Leiden. Einige Myrtengewächse bieten hervorragende antiinfektiöse ätherische Öle: Gewürznelke und Piment.
Die Öle der meisten Lamiaceae (Labiatae, Lippenblütengewächse) sind ausgezeichnet verträglich. Früher wurde vom Gebrauch in der (problematischen) Schwangerschaft abgeraten, heutzutage spricht nichts gegen die äußere und gut verdünnte Anwendung, wenn entsprechende Indikationen vorliegen. Beispielsweise kann verdünntes Pfefferminzöl in der Schwangerschaft inhaliert, Melissenöl bei viralen Erkrankungen eingerieben, ein Fußbad mit 1 Tropfen Rosmarinöl bei niedrigem Blutdruck durchgeführt werden. Einige von ihnen wirken leicht blutdruckerhöhend.
Die Zitrusöle aus der Familie der Rautengewächse (Rutaceae) haben sowohl einen Bezug zum Verdauungstrakt als auch zur Psyche: Mandarine, Orange, Zitrone. Ihre Blüten (Neroli) und Blätter (Petit Grain) helfen der „zerknitterten Seele“.
Merke
Trotz aller Gemeinsamkeiten ist es unerlässlich, jedes einzelne ätherische Öl und seine Inhaltsstoffe samt Nebenwirkungen gut kennenzulernen und, wann immer möglich, die Duftpräferenzen der Patienten zu respektieren.
Etwa 40 Pflanzenfamilien beliefern uns mit Duftstoffen. Nicht jede Pflanze, die stark duftet, lässt ihren Duft „einfangen“ (z.B. Maiglöckchen, Flieder), da die Duftstoffe durch Hitze, Druck oder Lösungsmittel zerstört werden (oder die Ausbeute zu gering für die Vermarktung ist).
Heutzutage sind rund 3 000 ätherische Öle, Absolues und Resinoide bekannt, jedoch nur ca. 300 davon werden für pharmazeutische, landwirtschaftliche und kosmetische Zwecke sowie für die Lebensmittel- und Parfümbranche genutzt ▶ [581].
Nachfolgend sind die wichtigsten Pflanzenfamilien aufgelistet, aus denen düfteliefernde Pflanzen hervorgehen. Übrigens werden sie im Deutschen meistens falsch betont ausgesprochen. Im Standardwerk Zander – Handwörterbuch der Pflanzennamen kann man nachlesen, dass die Aussprache Geraniáceae, Lamiáceae, Lauráceae, Rosáceae, Santaláceae, Lavándula, Zíngiber usw. lautet ▶ [173]. Ausführliche Beschreibungen der ätherischen Öle, die zu den jeweiligen Pflanzenfamilien gehören, finden Sie in ▶ Kap. 7.
Info
Pflanzenfamilien und wichtige Gattungen mit aromatherapeutisch verwendeten Arten
Amaryllidaceae, Amaryllisgewächse
Hyazinthe
Knoblauch
Narzisse
Zwiebel
Anarcadiaceae, Sumachgewächse
Mastix
Roter Pfeffer
Annonaceae, Flaschenbaumgewächse
Ylang Ylang
Apiaceae/Umbelliferae, Doldenblütengewächse
Angelika
Anis
Asafoetida
Dill
Fenchel
Galbanum
Karotte
Koriander
Kreuzkümmel
Liebstöckel
Petersilie
Sellerie
Asparagaceae, Spargelgewächse
Tuberose
Asteraceae/Compositae, Korbblütengewächse
Alant
Beifuß
Calendula
Costus
Davana
Estragon
Immortelle
Kamille (deutsch)
Kamille (römisch)
Rainfarn
Heiligenkraut
Schafgarbe
Tagetes
Wermut
Burseraceae, Balsambaumgewächse
Elemi
Linaloe
Opoponax
Palo Santo
Myrrhe
Weihrauch
Caprifoliaceae, Geißblattgewächse
Baldrian
Narde
Cistaceae, Cistrosengewächse
Cistrose
Cupressaceae, Zypressengewächse
Cade
Thuja
Wacholder
Texas-Zeder
Zypresse
Ericaceae, Erikagewächse
Rhododendron
Wintergrün
Geraniaceae, Storchschnabelgewächse
Rosengeranie
Hamamelidaceae, Hamamelisgewächse
Styrax
Hypericaceae, Johanniskrautgewächse
Johanniskraut
Iridaceae, Schwertliliengewächse
Iris
Safran
Lamiaceae/Labiatae, Lippenblütengewächse
Basilikum
Bohnenkraut
Lavendel
Majoran
Melisse
Mönchspfeffer
Monarde
Oregano
Patchouli
Pfefferminze
Rosmarin
Salbei
Thymian
Ysop
Lauraceae, Lorbeergewächse
Cassiazimt
Kampferbaum
Litsea cubeba
Lorbeer
Massoia
Ravintsara
Rosenholz
Sassafras
Zimt
Leguminosae/Fabaceae, Hülsenfrüchtler, früher Papilionaceae, Schmetterlingsblütengewächse
Cabreuva
Cassie
Copaiba
Ginster
Mimose
Steinklee
Tolubalsam
Perubalsam
Tonka
Magnoliaceae, Magnoliengewächse
Magnolie
Champaca
Malvaceae, Malvengewächse
Moschuskörner
Myristicaceae, Muskatnussgewächse
Muskatnuss
Macis („Muskatblüte“)
Myrtaceae, Myrtengewächse
Bay
Cajeput
Eukalyptus
Kanuka
Manuka
Myrte
Nelkenbaum
Niaouli
Teebaum
Zitronen-Teebaum
Zitronenmyrte
Oleaceae, Ölbaumgewächse
Jasmin
Osmanthus
Orchidaceae, Orchideengewächse
Vanille
Pinaceae/Abietaceae, Kieferngewächse
Balsamtanne
Douglasie
Fichte
Lärche
Latschenkiefer
Meerkiefer
Riesentanne
Weißtanne
Zeder
Zirbelkiefer
Piperaceae, Pfeffergewächse
Kubebe
Pfeffer
Poaceae/Gramineae, Gräser
Citronella
Lemongrass
Palmarosa
Vetiver
Rosaceae, Rosengewächse
Bittermandel
Rose
Rutaceae, Rautengewächse
Amyris
Bergamotte
Boronia
Bucco
Clementine
Grapefruit
Limette
Mandarine
Orange
Pampelmuse
Raute
Yuzu
Zitrone
Santalaceae, Sandelholzgewächse
Sandelholz
Schisandraceae/Illiciaceae, Sternanisgewächse
Sternanis
Sterculiaceae, Sterkuliengewächse
Kakao
Styracaceae, Storaxbaumgewächse
Benzoe
Verbenaceae, Eisenkrautgewächse
Zitronenverbene („Eisenkraut“)
Violaceae, Veilchengewächse
Veilchen
Zingiberaceae, Ingwergewächse
Galgant
Ginger Lily
Ingwer
Kardamom
Kurkuma
1.1.1.2 Binäre Nomenklatur
Die ebenfalls von Linné geschaffene binäre Nomenklatur (binarius, lat. = zwei enthaltend; nomenclatura, lat. = Namensverzeichnis) ordnet jeder bekannten Pflanze 2 Namen zu. Sie ist – im Gegensatz zu lokal verwendeten, teils sehr unterschiedlichen Namen – international gültig.
Als botanischer Laie kann man sich Eselsbrücken ausdenken, um das System der Pflanzenbenennung nachvollziehen zu können. Da wir nur mit 3 Bestandteilen der wissenschaftlichen Klassifizierung arbeiten, könnte die Merkhilfe folgendermaßen aussehen:
Pflanzenfamilie (Familia):
z.B. Lamiaceae, Rutaceae, Rosaceae
Eselsbrücke: das „Volk“ der Bayern oder das „Volk“ der Ostfriesen
Gattung (Genus):
z.B. Lavandula, Citrus, Rosa
Eselsbrücke: die Nachnamen, also der Clan der Müllers, Meyers, Schmidts (Tante, Onkel, Oma, Opa etc.)
Art (Spezies):
z.B. angustifolium, aurantium, damascena