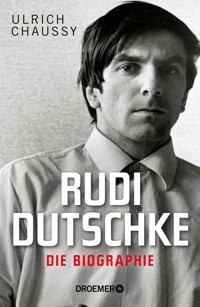19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bei der Recherche über das Dorf Obersalzberg, den Wohnort und zweiten Regierungssitz Hitlers in der Nähe von Berchtesgaden, stößt Ulrich Chaussy auf Arthur Eichengrün. Wer war dieser völlig vergessene jüdische Nachbar Hitlers? In drei Jahrzehnten Arbeit rekonstruiert Chaussy Eichengrüns Biografie und entdeckt einen der bedeutendsten Chemiker und Erfinder der Kaiserzeit und der Weimarer Republik wieder: Eichengrün ist Forscher, Erfinder und Unternehmer in Personalunion. Er synthetisiert Kokain und wir verdanken ihm das Aspirin. Er erfindet den unbrennbaren Kinofilm und revolutioniert mit seinem Cellon-Spannlack den Bau der stoffbespannten Flugzeuge und Zeppeline. Ab 1933 gelten all seine Verdienste nichts mehr. Er verliert allen Besitz. Plötzlich ist der assimilierte Patriot nur noch eines: Jude. Deportiert ins KZ Theresienstadt muss der große Chemiker erkennen, dass er eines nicht umformen und synthetisieren konnte: Eine Identität, die ihn vor dem Rassenwahn der Nationalsozialisten hätte schützen können. Ulrich Chaussy schreibt Arthur Eichengrün, diesen großen Erfinder und Wissenschaftler, fulminant zurück ins kollektive Gedächtnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ulrich Chaussy
Arthur Eichengrün
Der Mann, der alles erfinden konnte,
nur nicht sich selbst
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal, Rohrdorf
Umschlagmotiv: © Bayer AG, Bayer Archives Leverkusen
Mit einem Stammbaum von Peter Palm, Berlin
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN Print: 978-3-451-39216-0
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-83156-0
Inhalt
Der verschwundene Nachbar aus dem getilgten Dorf
Eichengrün – auf der Suche nach einem Unbekannten
Eine Kindheit in der Kaiserzeit – im KZ erinnert
C. H. E. M. I. E. – eine Emanzipationsformel
Ausflug nach Berlin – Eichengrüns Lehrjahre
Abschied von Aachen – und der Religion
BAYER – der Aufstieg als Pharmazeut
ASPIRIN – ein Sieg, bitterer als jede Niederlage
Amour fou – in den Alpen
Obersalzberg I – ein Bergdorf verwandelt sich
»Blitzlicht Bayer« – der Gipfel- und der Bilderstürmer
Fotos, Bilder, Filme – der lange Abschied von Bayer
Berlin – Cellon kommt von Lonne
Obersalzberg II – mehr als eine Sommerfrische
Im Krieg 1914–1918 – die Konjunktur der Chemiker
Neustart nach dem Krieg – Cellon für den Frieden
»Diese Schlange im Gras« – Aufstieg und Fall des Ed Edwards-Eichengrün
Die Rochade – Patchworkfamilie Eichengrün
Obersalzberg III – Fluchtpunkt Berchtesgaden
»Dem Ingenör ist nichts zu schwör« – Eichengrüns Kunststoffuniversum
Cellon-Werke und »Celloner« – eine verschwundene Fabrikwelt und ihre Menschen
Das Haberfeldtreiben – Abschied vom Obersalzberg
Roaring Twenties – Eichengrün und seine Kinder
Cellon überall – Höhenflug vor dem Absturz
Kaiserdamm 34 – Nachbar Göring
Arisierung – vom Dableiben und Fortgehen
Göring, oder: die Kunst des Plünderns
Vergesst Eichengrün – Flucht nach München
Berlin – Rückkehr ohne Ankunft
Globke, Klauer und die arische Erfinderehre – Denunziation und Deportation ins KZ
Der Schmerz bleibt – Rückkehr und Rehabilitierung
Das Ende in Bayern – und ein Vermächtnis
Der Kreis schließt sich – welche Wege Erinnerung geht
Über den Autor
Stammbaum Arthur Eichengrün
Abbildungsverzeichnis
Der verschwundene Nachbar aus dem getilgten Dorf
Doktor Eichengrün. Als ich diesen Namen im Januar 1987 das erste Mal hörte und ein Foto von ihm sah, dachte ich mir nichts dabei, ihn nicht zu kennen. Ich war im Berchtesgadener Land auf der Suche nach Erinnerungen an Häuser und Menschen des verschwundenen bayerischen Alpendorfes Obersalzberg. Begonnen hatte alles mit dem Auftrag, über den Bau des sogenannten Führersperrbezirks1 zu berichten.
Die Redaktion der historischen Radiosendereihe »ZeitZeichen« des WDR hatte mir einen Artikel aus dem Völkischen Beobachter vom Januar 1937 geschickt. Darin wurde über eine Rede Adolf Hitlers vor den Bauarbeitern beim Richtfest der Außenstelle der Reichskanzlei in Bischofswiesen berichtet. Ich sollte schildern, wie der Rückzugsort des »Führers« in den Bergen entstand und allmählich zu einem zweiten Regierungssitz ausgebaut wurde – und berichten, was davon 50 Jahre später übrig war. Bei meinen ersten Auffahrten vom Berchtesgadener Tal vier Kilometer steil die B 425 bergan fand ich damals hinter dem Ortsschild Obersalzberg beiderseits der steilen Bergstraße nur wucherndes Unterholz, bis rechter Hand das noch heute existierende Hotel Türken auftauchte und nach einer weiteren Rechtskurve auf einem Plateau die Haltestelle der Spezialbusse, die die Besucher eine noch steilere Bergstraße 800 Meter höher hinauf zum Kehlsteinhaus verfrachteten, das die Amerikaner 1945 in »Eagle’s Nest« umgetauft haben. Vom BerghofHitlers keine Spur, keine weithin sichtbare Ruine, keine Wegweiser ins Unterholz.
NS-Sightseeing am Obersalzberg in den 1980er Jahren.
Nur am Kiosk mit den Obersalzbergsouvenirs, neben den Luis-Trenker-Hüten, den Edelweißaufnähern, den Wanderstöcken mit den passenden Stocknägeln, da strahlten im Hochglanz Hitlers einst bescheidenes Haus Wachenfeld, später zum klobigen Berghof erweitert, das Landhaus Göring, die Villa Bormann und das Karree der SS-Kaserne; sie prangten von den Titelseiten zahlreicher Broschüren mit bunten Bildern, in denen die repräsentative Architektur der 1930er Jahre angepriesen und von der Zerstörung der Führersperrgebiet-Pracht durch alliierte Bomber am 25. April 1945 mit einem unhörbaren Wimmern berichtet wurde. Sic transit gloria tertii Imperii.
Vor dem Andenkenkiosk entdeckte ich in einer verglasten Vitrine ein topografisches Modell des Obersalzbergs. Darin waren wie auf einem plastischen Monopoly-Spielplan kleine Modelle der NS-Bauten an ihrem einstigen Standort eingesetzt, so wie sie auch in den Broschüren auf Karten eingezeichnet waren, die ich notgedrungen zur Orientierung erworben hatte. Es gab nur diese zwischen Nostalgie und Kitsch oszillierende Publizistik.
Postkarte vom Obersalzberg, ca. 1935. Mitte rechts außen das frisch errichtete Landhaus Göring, im Zentrum halb links unten Mitterwurf- und Oberwurflehen.
Aber was war eigentlich mit all den pittoresken Häusern und ihren Bewohnern geschehen, die ich auf einer Reihe alter Postkarten aus den 1920er und 1930er Jahren vom Obersalzberg entdeckt hatte? Auch diese Häuser hatten einst hier gestanden, einige sogar genau am selben Ort wie die NS-Bauten, etwa die SS-Kaserne. Im topografischen Modell des Berges vor dem Souvenirkiosk fehlten sie. In den Übersichtsplänen der Broschüren mit so klangvollen Namen wie »Obersalzberg. Biographie des III. Reiches« ebenso. Ihre Umrisse und Standorte waren nicht eingezeichnet, als hätten sie nie existiert.
So stieß ich unversehens bei der Recherche über den Bau von Hitlers Führersperrbezirk auf eine verdrängte Geschichte hinter der Geschichte. Im Kern beinhaltet sie, dass die eigentliche Zerstörung Obersalzbergs nicht, wie allgemein angenommen, im Bombenhagel der Alliierten am Ende des Krieges geschah. Sie handelt davon, dass der Bau des Führersperrbezirks selbst die Zerstörung des organisch gewachsenen Bergbauerndorfes Obersalzberg bedeutete. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden zum Verkauf genötigt und vertrieben, ihre Häuser abgerissen.
Die Mehrheit der Umgesiedelten bestand aus bäuerlichen Familien, die sich nahe ihrer Heimat im Berchtesgadener Land eine Bleibe suchen und eine neue Existenz aufbauen mussten. In den meist von Berchtesgadener Verlagen gestalteten Broschüren wurde das Schicksal der Obersalzberger in stumpfer Empathielosigkeit ignoriert. Am Nichtwissen lag es nicht. Was am Obersalzberg geschehen war, dass Familien Haus und Hof verloren hatten und vertrieben worden waren, war im Berchtesgadener Tal und der Marktgemeinde kein Geheimnis. Als ich die Zimmerwirtin auf meiner ersten Recherchereise fragte, was aus den Häusern und ihren Bewohnern auf den alten Obersalzbergpostkarten geworden sei, benannte mir Frau Rasp gleich einen Anlaufpunkt. Sie instruierte mich auf die Weise, die man im Berchtesgadener Land kennen muss, um Menschen und Orte zuordnen und finden zu können: In Obersalzberg, da habe es einen Bauern gegeben, den alle bei seinem Hausnamen den »Emerer« nannten. Mit Familiennamen habe er Josef Hölzl geheißen. Sein Hof, das Oberwurflehen, befand sich mitten im Geschehen, und Hölzl wurde mit seiner Familie von dort vertrieben. Ich solle nach Oberau fahren, zum Gasthof Priesterstein. Dort lebe jetzt Johanna Stangassinger, die jüngste Tochter des Emerer, die am Obersalzberg geboren und aufgewachsen sei. Sie habe diese Heimatvertreibung miterlebt.
Ich fuhr nach Oberau. Das Dorf und der Gasthof Priesterstein liegen fünf Kilometer nördlich vom ehemaligen Ortskern Obersalzbergs entfernt. Von den Fensterplätzen im Gastraum des Gasthofs Priesterstein sieht man direkt dorthin. Schaut man bei wolkenlosem Wetter nach links oben, blinkt Hitlers Kehlsteinhaus in der Sonne. Mit dieser Landmarke und Perspektive hatte Johanna Stangassinger immerzu ein optisches Memento vor Augen. Ich fragte die Kellnerin nach Frau Stangassinger. Die sei in der Küche, sie werde ihr Bescheid sagen. Nach einer Weile erschien sie, die Schürze um- und in ihren Auskünften kurz angebunden: Ja, sie sei die Tochter des Emerer. Aber Obersalzberg und ihre alte Heimat gebe es nicht mehr und damit nichts mehr zu erzählen. Sie zeigte sich bei meinen ersten Besuchen widerstrebend, über ihre Kindheit und Jugend, über die Erlebnisse ihrer Familie in Obersalzberg und den erzwungenen Abschied von dort zu erzählen. Als sei ihr mein Interesse suspekt und müsse auf Ernsthaftigkeit geprüft werden, vertröstete sie mich – sie habe zu tun –, verschwand in der Küche und ließ mich warten. Die Ausdauerprobe war kein reiner Vorwand, denn mit ihren mehr als 70 Jahren arbeitete sie noch voll in der Küche des von Sohn und Schwiegertochter geführten Gasthofes mit. Die Wartezeit versüßte ich mir mit ihrer Spezialität, einem karamellisierten, speckigen Kaiserschmarrn, den sie versiert in einer alten schwarzen Eisenpfanne briet. Das Warten und das Wiederkommen belohnte Johanna Stangassinger mit zunehmender Auskunftsbereitschaft.
Johanna Stangassinger, geb. Hölzl, aus dem Oberwurflehen in Obersalzberg.
Ein resolutes Wesen funkelte aus ihren Augen, und mit ihrer rauen, dunklen Stimme ließ sie die Erinnerungen an die Zeit in Obersalzberg in einprägsamen Bildern lebendig werden, auch jenen Tag im Januar 1937, der den endgültigen Abschied der Familie Hölzl vom Obersalzberg bedeutete.
»Meinen Vater und meine Mutter wollten sie ins KZ bringen. Der Bormann, der war bei uns im Haus, und dann hat er gesagt: ›Herr Hölzl, Sie brauchen das Haus nicht zu verkaufen, aber dann kriegen Sie gar nichts, und Sie kommen ins KZ.‹ – Das hab’ ich wortwörtlich in der Stube drinnen gehört, wie das der Bormann gesagt hat.«2
So lakonisch und genau, wie Johanna Stangassinger das Schicksal der eigenen Familie berichtete, schilderte sie mir auch, was in der Nachbarschaft geschah. Sie erlebte den Auftakt der Vertreibungswelle im August 1933. Von der anderen Straßenseite aus wurde sie zur Augenzeugin der Verhaftung des Türkenwirts Karl Schuster durch die Gestapo.
»Es war gerade ein Uhr Mittag. Ich war vorm Haus, und da seh ich, wie ein großer Panzerwagen, ein gepanzerter Mercedes, vorfährt. Da stiegen vier bis sechs Kripobeamte aus – ich kannt’ sie alle beim Namen, weil sie ja zum Teil in unserem Haus gewohnt haben, haben die Türen aufgerissen und den Karl Schuster rausgezerrt, rein ins Auto, und dann schrie seine Frau: ›Karle, was ist denn los!‹ – Ich hör das heut noch in meinen Ohren! – Und dann hat sie sich vor das Auto hingeschmissen, und sie lag da, und dann hat’s einer einfach brutal weggezerrt, und dann sind sie weggefahren.«3
Johann Stangassinger begriff damals, was der zynische NS-Euphemismus Schutzhaft bedeutete. Schuster gab nur Wochen nach dem Gefängnisaufenthalt auf und verkaufte. Ebenso hautnah erlebte sie vier Jahre später, wie die in Eigenleistung der Obersalzberger errichtete Kapelle Maria Hilf abgerissen wurde, die neben dem Oberwurflehen auf dem Grund der Hölzls stand. Sie sah, wie den zum Zwangsverkauf genötigten Obersalzberger Familien die Dächer ihrer Häuser abgerissen wurden, während sie noch darin wohnten. Die Ohnmacht und die Wut, die sie damals empfand, vibrierten hörbar in ihrer Stimme, wenn sie erzählte.
Johanna Stangassinger war nie dazu zu bewegen, mit mir an den Ort zu fahren, an dem einst das Oberwurflehen gestanden hatte, nicht ein Mal im Laufe der über Jahre ausgedehnten Recherche, die mich immer wieder zu ihr geführt hat. Keine Zeit, sagte sie jedes Mal, die Arbeit in der Gastronomie geht nie aus, und verschwand im Haus. Kam dann wieder, setzte sich doch zu mir, beugte sich über alte Bilder, strapazierte ihr Gedächtnis, nahm sich Zeit. Sie redete mit einer Energie und Bitterkeit von der verlorenen Heimat, davon, was geschehen ist und was sie gesehen hat, als sei all das gestern gewesen und nicht vor über 50 Jahren, als sie eine zwanzigjährige Bauerntochter war. Diese Bitterkeit, die sie meist mit einem trockenen Lachen wieder beiseitewischte, war der wahre Grund, warum Johanna Stangassinger bei einem Lokaltermin in der alten Heimat nicht mitmachte.
»Nein, nein«, wehrte sie ab, »ich schau nimmer hin. Wenn ich grad einmal vorbeifahr an der Straße vielleicht, aber aussteigen tu ich nicht. Da sind mir die Wildnis und der ganze Saustall zu groß, und die ganze Atmosphäre ist weg. Man weiß gar nicht mehr, wo’s Haus gestanden hat. Da haben sie den Bormann-Stollen reingegraben auf unserem Grund, und das schaut aus wie ein Gräuel der Verwüstung. Nein, da geht nix mehr«,4 sagte sie, und ihre Augen verrieten, dass sie in diesem Fall die Arbeit nur vorschob.
Und wie sahen das Leben, der Alltag, die Nachbarschaft aus, bevor Hitler nach Obersalzberg kam? – Darüber gab Johanna Stangassinger nüchtern Auskunft. Über das harte und ärmliche Leben auf dem Bergbauernhof mit seinen mageren Weiden, über den Zuverdienst ihrer Mutter durch den Pensionsbetrieb für die Gäste aus der Stadt, über den zweistündigen Weg hin und zurück zur Schule in Berchtesgaden. Sprach sie über die abenteuerliche Kinderfreiheit in der Natur, geriet sie in schwelgerische Begeisterung. Sie holte ein Fotoalbum herbei und zeigte mir die vielen Kinder in Obersalzberg, allein in der unmittelbaren Nachbarschaft eine stattliche Schar, fünf bei den Hölzls und fünf bei der Familie des Türkenwirts Schuster, dann die Cousins und Cousinen der Hölzl-Kinder aus dem Alpengasthof Steiner, ein Stück die Dorfstraße hinab. »Dann war eine Judenfamilie oben, die waren unsere Nachbarn, die Eichengrüns, die sind dann weggezogen. Die hatten zwei Kinder, die Hille und den Hans.«5 Eine ganze Reihe von Fotos in Johanna Stangassingers Album, aufgenommen im benachbarten Mitterwurflehen, zeigt, dass die beiden zu den Dorfkindern dazugehörten. Das Haus der Eichengrüns sei ein offenes Haus gewesen, in dem sich die Obersalzberger Kinderschar immer wieder traf.
Hille und Hans vor dem Brunnen in Haus Mitterwurf mit Hund Kras.
Auf einem Bild posieren vor dem Brunnen am Haus nur die Geschwister. Hildegard, die in der Familie und unter den Kindern Hille gerufen wurde, und ihr Bruder Hans, sie im Dirndl, er in Trachtenjanker und Lederhose, auf einem anderen Foto drängelt sich vor und auf dem Brunnen eine Traube von 14 Kindern, Hans und Hille mittendrin. Eine ähnlich große Kinderschar sitzt an einer Kindergeburtstagstafel auf einer überdachten Terrasse im Freien.
»Da ist jedes Obersalzberger Kind eingeladen worden, da hat’s Kakao gegeben, Wurstbrote und dann Süßigkeiten, Schokolade und Kuchen, und a jeder hat ein Paket gekriegt, jedes Kind; und das war unser schönstes Fest, wenn wir bei den Eichengrüns eingeladen waren. Da hat kein Mensch gesagt: Öha! Juden!? – Na ja: Juden. Das war auch a Mensch wie wir auch.«6
Kindergeburtstag in Mitterwurf, im Hintergrund Arthur Eichengrün.
Im Hintergrund, am Kopfende des Tisches, hat ein Mann im Janker mit weißem Hemd und Krawatte Platz genommen und schaut dem Treiben beim Kindergeburtstag lächelnd zu. Das ist der Doktor Arthur Eichengrün. Den »Doktor« betont Johanna Stangassinger.
Von ihm, dem Doktor, gibt es noch ein weiteres Bild, das sowohl in das Familienalbum der Hölzls als auch das der Familie Steiner eingeklebt wurde, ganz offenbar ein mitgebrachtes Geschenk, denn dieses Porträtfoto ist nicht am Obersalzberg entstanden.
Es zeigt ihn nicht im Mitterwurflehen, sondern in einem städtischen Salon, diesmal im eleganten Anzug, vor einem offenen Kamin mit kunstvoll verziertem Sims. Eichengrün posiert aufrecht in einem Sessel sitzend, die Beine übereinandergeschlagen, auf dem dunklen Leder seiner Schuhe spiegeln sich Lichtreflexe. In der linken Hand, auf die Lehne gestützt, hält er eine brennende Zigarette. Eichengrün ist auf diesem Bild etwa 40 Jahre alt. Er hat eine hohe Stirn, geschwungene Brauen und einen sorgfältig gespitzten Oberlippenbart. Er schaut prüfend in die Kamera, als frage er sich, ob der Fotograf das Material wohl richtig belichte.
Seit ich dieses Bild in den Fotoalben der vom Obersalzberg vertriebenen Familien Hölzl und Steiner entdeckt hatte, wollte ich herausfinden, wer der elegante Herr Eichengrün gewesen ist, wie es ihn ins Berchtesgadener Land verschlagen hatte und was aus ihm und seiner jüdischen Familie nach ihrem Weggang vom Obersalzberg wurde.
Die einheimischen ehemaligen Nachbarn wussten nur wenig: Ein Geldmann sei er gewesen. Ein Doktor. Ein Erfinder und Fabrikant aus Berlin. Er habe irgendetwas mit Aspirin und mit dem Zeppelin zu tun gehabt, davon habe die Familie gelegentlich gesprochen. Eines Tages sei erst er verschwunden gewesen und dann auch seine Familie. Das Haus hätten sie verloren wie die anderen Obersalzberger auch, nur etwas früher.
Wohin waren sie verschwunden? Hatten sie Nazizeit und Krieg überlebt? Johanna Stangassinger, die die Jahre der Nachbarschaft so genau beobachtet und in der Erinnerung bewahrt hatte, hat sie mit der Auslöschung ihres Heimatortes aus den Augen verloren und konnte mir nicht weiterhelfen.
1 Begriffe, geografische Bezeichnungen und Organisationsnamen und Redewendungen, die im Nationalsozialismus geprägt wurden, habe ich im gesamten Buchtext mit kursiver Schrift kenntlich gemacht. Aus dem schon 1916 erbauten und damals »Haus Wachenfeld« benannten Gebäude, das Hitler 1928 bezieht und 1937 umbaut und erweitert, wird dann der Berghof.
2 Johanna Stangassinger im Interview mit dem Autor, Januar 1987.
3 Ebenda.
4 Ebenda.
5 Ebenda.
6 Johanna Stangassinger im Interview mit dem Autor, Juli 1999.
Eichengrün – auf der Suche nach einem Unbekannten
Eichengrün und Aspirin. Nur diese beiden Namen brachte ich von der ersten Recherche Ende der 1980er Jahre aus Berchtesgaden mit, um den einstigen jüdischen Nachbarn der alteingesessenen und dann aus Obersalzberg vertriebenen Bauernfamilien auf die Spur zu kommen. Der Große Brockhaus verzeichnete bis zur 20. Auflage 1996 nichts zu Eichengrün, wohl aber zu Aspirin, wenn auch nur einen kurzen Verweis: »Aspirin®[...], Warenzeichen für Arzneimittel mit dem Wirkstoff ➝Acetylsalicylsäure«.1 Dieser Eintrag erwies sich, was Arthur Eichengrün anging, als tote Spur: »Acetylsalicylsäure, Acidum acetyl(o)salicylicum, Abkömmling der Salicylsäure; 1859 erstmals synthetisierter und 1899 von H. Dreser eingeführter schmerzstillender, fiebersenkender und entzündungshemmender Arzneistoff«.2 Wohl aber listet das Lexikon im Telegrammstil die medizinische Potenz eines Jahrhundertmedikaments auf: »A. hemmt auch die Zusammenballung von Blutplättchen (Thrombozytenaggregation) und ist z. Z. der bedeutendste Thrombozytenaggregationshemmer. A. wird deshalb außer als Schmerzmittel v. a. auch als Prophylaxe von Thrombosen und Embolien, aber auch zur Prophylaxe gegen das Wiederauftreten eines Herzinfarktes verwendet […].«3
Wie Eichengrün finden? Glücklicherweise bot mir 1990 das rauschende und piepende Telefonmodem an meinem ersten internetfähigen Computer einen hilfreichen Vorgeschmack auf die heutigen Möglichkeiten der Onlinerecherche. Ich gab »Eichengrün« in die Maske der neu eingerichteten bundesweiten Telefonnummernsuche der Deutschen Bundespost ein, und das BTX-System spuckte auf dem Monitor in grüner Schrift auf schwarzem Grund fünf Treffer aus. Mit Glück landete ich gleich mit den ersten zwei Eichengrüns unter selber Adresse in Königswinter am rechten Platz.4
Ja, sagte mir Waltraud Eichengrün, ihr Ehemann Ernst sei ein Enkel von Doktor Arthur Eichengrün. Und ich sei mittlerweile der zweite Interessent, der sich bei ihr nach dem Großvater ihres Mannes erkundige und damit an kaum angeschaute Episoden der Familiengeschichte rühre. Ernst habe um sie bislang einen Bogen gemacht. Geschichte sei, beruflich gesehen, sein Thema – er war zu dieser Zeit Pressesprecher des Bundesarchivs in Koblenz –, aber der privaten, familiären Geschichtserforschung gehe er noch aus dem Wege, in einer Mischung aus beruflicher Belastung und der Ahnung, dass für ihn mit dieser Recherche bedrückende Erinnerungen und Einblicke verbunden sein würden.
Waltraud Eichengrün hörte sich an, was ich zur Familie Eichengrün über die einstigen Nachbarn in Obersalzberg in Erfahrung gebracht hatte. Was ich darüber berichte, sei ihr gänzlich unbekannt. Sie und ihr Mann könnten zu diesem spannenden Lebensabschnitt von Arthur Eichengrün allerdings nichts beitragen. So ähnlich sei es ihr und ihrem Mann kürzlich auch mit dem anderen Interessenten ergangen, mit dem Mediziner Michael de Ridder aus Berlin. Er habe nach Dokumenten über den Großvater aus der Familie gefragt und sie erbeten. Er habe ihnen im Gegenzug Informationen aus einem Bereich mitgebracht, in den sie bislang kaum Einblick gehabt hatten, über Arthur Eichengrüns frühe Berufsjahre als pharmazeutischer Chemiker bei den Farbenfabriken, vormals Friedrich Bayer Co. Elberfeld, heute schlicht Bayer. Sie kenne nur wenige Dokumente. Es gebe aber einen gedruckten Lebenslauf, der in vielen fotokopierten Exemplaren im Nachlass des Großvaters aufbewahrt und immer wieder hervorgeholt werde, wenn es im familiären Gespräch um Arthur Eichengrün gehe. Sie werde mir eine Kopie zuschicken.
Ein paar Tage nach unserem Gespräch kam sie mit der Post. Ich zog sie samt einem ermutigenden Begleitschreiben von Waltraud Eichengrün aus dem Umschlag und faltete das Blatt mit der Biografie auf, die aus einem Buch kopiert worden war, ein eng gesetzter Lexikonartikel mit einem in den zweispaltigen Text eingefügten Fotoporträt. An der hohen Stirn und dem prüfenden Blick in die Kamera erkannte ich sofort den Mann aus den Familienfotoalben der Obersalzberger Nachbarn wieder. Hier aber posiert nicht ein entspannt lächelnder Privatmann auf der Terrasse des Obersalzberger Hauses oder vor dem Kamin einer Stadtvilla, sondern eine Zelebrität. Eichengrün trägt zum weißen Hemd mit hohem Kragen eine schmale Krawatte. Der Schnauzbart ist jetzt nicht mehr dandyhaft gezwirbelt, sondern akkurat gestutzt, und der über die Jahre lichter gewordene Haaransatz lässt die hohe Stirn noch höher erscheinen.
Die Überraschung aber bietet der Text, ein dichter, mit Informationen vollgepackter Lexikoneintrag. In äußerst knapper Form werden Eichengrüns Familiendaten, seine Lern- und Lebensstationen, seine Fähigkeiten und eine Fülle von Erfindungen, Ehrungen und Verdienste aufgezählt, eine Lebenssumme an Leistungen, die es höchst plausibel machte, dass man sich dieses Mannes bestimmt auch in Zukunft erinnern solle und werde. Mit genau dieser Absicht war Eichengrüns Biografie verfasst worden – wie auch die Lebensläufe der anderen etwa 8500 Personen, die im Jahr 1930 im Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft aufgenommen wurden.5
Kein Geringerer als Ferdinand Tönnies, der Begründer der modernen Soziologie in Deutschland, schrieb das programmatische Vorwort dieses Who’s who der Weimarer Republik. Er begründet darin das Konzept und die Kriterien für das 1930 herausgebrachte völlig neuartige Nachschlagewerk. Im Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft wurden die darin aufgenommenen Persönlichkeiten gänzlich anders ausgewählt als in vergleichbaren Vorgängerwerken wie etwa dem »Gotha«, für den allein die adelige Geburt als Aufnahmekriterium galt.6 Aber die monarchistische Ständegesellschaft mit ihrer starren Struktur ist nach 1918 Geschichte. In der ersten deutschen parlamentarischen Demokratie, so Tönnies in seinem Vorwort, sollten nicht Herkunft, Standes- oder Religionszugehörigkeit, sondern allein die Bedeutung und die Leistungen einer Persönlichkeit im gegenwärtigen geistigen, wirtschaftlichen und politischen Gefüge der Gesellschaft zählen, weshalb Zeitgenossen wie Arthur Eichengrün im Fokus standen. Das Reichshandbuch müsse daher als eine Ergänzung zur Allgemeinen Deutschen Biographie willkommen sein, denn, so Tönnies: »Ein Inventar der l e b e n d e n H ä u p t e r deutscher Nation, deutschen Geistes ist es, was das Reichshandbuch bieten kann und soll.«7
Arthur Eichengrün im »Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft«.
Man braucht zwei Hände für dieses Handbuch; die beiden in blaues Leder gebundenen Folianten wiegen zwölf Kilo. Die eingeprägten goldenen Titellettern, die aufwendige Ausstattung, der Druck auf schwerem Hochglanzpapier mit den gestochen scharfen Fotoporträts fordern demonstrativ Respekt ein für die Persönlichkeiten, die darin Aufnahme gefunden haben.
»Eichengrün, Arthur. Dr. phil., Dr. Ing. E. h. der Technischen Hochschule Hannover, Gründer und Inhaber der Cellon-Werke. Geb. 13.8.1867 in Aachen – Vater: Tuchfabrikant. Mutter: Emma, geb. Meyer. – Ver. mit Lucie, geb. Bartsch. – Kinder: Edgar, Dipl.-Ing.; Hans-Günther; Alice; Lottie; Hildegard, Dipl.-Ing.«8
Wie exakt passende Puzzlestücke fand ich die von Johanna Stangassinger genannten Namen ihrer kindlichen Spielgefährten Hille und Hans in den ersten Zeilen der Biografie des Arthur Eichengrün im Reichshandbuch wieder. Zusammen mit den Bildern aus den Familienfotoalben der ehemaligen Obersalzberger bewiesen sie, dass ich tatsächlich den Nachbarn des Emerer-Bauern vom Oberwurflehen gefunden hatte, der lange Jahre im Mitterwurflehen gelebt hatte – und dessen Familie schräg über die Straße auch noch den Nachbarn Hitler bekam.
Zur Genugtuung über diesen Fund gesellte sich Verwunderung. Ich war zufällig und beiläufig am Obersalzberg auf einen Unbekannten aufmerksam geworden. Arthur Eichengrün war wie in einem kleinen ewigen Licht in der privaten Erinnerung einer alten Dame an ihre Kindheit lebendig geblieben. Aber im gegenwärtigen, kollektiven und öffentlichen Gedächtnis der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1986, existierte Arthur Eichengrün nicht mehr. Als hätte dieser Mann nie gelebt. Dabei war er in Deutschland vom Kaiserreich bis an das Ende der Weimarer Republik als eine herausragende wissenschaftliche und wirtschaftlich kreative Persönlichkeit anerkannt gewesen, was das Reichshandbuch eindrucksvoll belegt.
So ausgelöscht die öffentliche Erinnerung war, blieb nur der Weg über die Familie, zu der ich mit Waltraud und Ernst Eichengrün einen ersten Zugang gefunden hatte.
Ernst Eichengrün lernte ich zunächst nur als knorrige, mit Berliner Dialekt gefärbte Telefonstimme kennen, knapp, aber präzise in seinen Auskünften. Anfangs hielt ich seine Lakonie für Skepsis mir gegenüber. Allmählich begriff ich, dass er es liebt, subtile ironische Pointen zu setzen.
»Ihre Frau erzählte mir, Sie könnten mir über Familie Eichengrün am Obersalzberg nichts berichten – warum?«
»Weil Dr. E.« – Enkel Ernst machte mich gleich mit dem familieninternen Kürzel für Arthur Eichengrün vertraut – »mit drei Frauen drei Familien Eichengrün nacheinander begründet hat. Und er ließ die jeweils vorangegangenen dann hinter sich. Er sprach nicht über diese Zäsuren. Ich bin ein Enkel aus Ehe Nummer eins mit Lizzy Fechheimer. Die wohnte in Potsdam, und ich nannte sie Granny, weil sie Amerikanerin war. Am Obersalzberg, das war Ehe Nummer zwei. Und als ich 1935 geboren wurde, da war er längst schon bei Ehe Nummer drei angelangt, das war die mit Lucie Bartsch, die zur Zeit des Reichshandbuchs aktuell war. Die traf ich, wenn ich Opi in Funkturmnähe am Kaiserdamm besuchte. Lucie Bartsch war für mich Oma Lutz. Das war so, und warum es so war, darüber wurde nicht gesprochen, erst recht nicht Kindern wie mir gegenüber.«
Ähnlich diskret wie in Ehe- und Familienangelegenheiten sind die Lexikoneinträge im Reichshandbuch in Fragen der Konfession und Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Sie werden generell ausgespart. Nur drei Jahre vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten behandeln die Autoren der Lexikonartikel des Reichshandbuches Religion als Privatsache, die den Rang und die Stellung einer Persönlichkeit in der Gesellschaft nicht berührt, da aus dem religiösen Bekenntnis oder der ethnischen Abstammung eines Menschen weder eine Exzellenz noch eine Abwertung abgeleitet wird. Arthur Eichengrüns Herkunft aus einer jüdischen Familie wird in dem ausführlichen eineinhalbspaltigen Eintrag über ihn nicht erwähnt, genauso wenig wie beispielsweise die katholische Taufe des »Führers der NSDAP Adolf Hitler«, dem ebenfalls im Reichshandbuch ein Artikel gewidmet ist, wenn auch ein sehr kurzer mit einem nur briefmarkengroßen Foto.9
Ein paar Zeilen weiter in Eichengrüns Eintrag fand ich das zweite passende Puzzleteil, das mir die Obersalzbergerin Johanna Stangassinger über ihren Nachbarn an die Hand gegeben hatte, es fügte sich in Eichengrüns Lebenslauf im Reichshandbuch nahtlos ein:
»[…] 1895 wurde er von Carl Duisberg als Leiter der neu gegründeten pharmazeutischen-wissenschaftlichen Abteilung der Farbenfabriken, vorm. Friedrich Bayer & Co., Elberfeld (der jetzigen I.G. Farben) berufen und wurde 1900 Prokurist dieser Firma und Leiter auch der photographischen und technischen Abteilungen. Aus jener Zeit stammen zahlreiche Erfindungen auf diesen Arbeitsgebieten, von welchen die ›neuen Arzneimittel‹ Protargol, Helmitol, Citarin, Asprin, Mesotan besonders genannt seien. […]«10
Aspirin. Damit fällt das zweite Codewort, das ich von Johanna Stangassinger gehört und das sich bei mir wie ein Ohrwurm eingenistet hatte. Das Reichshandbuch ordnete es in einer Aufzählung tatsächlich als eine seiner pharmazeutischen Erfindungen dem Obersalzberger Nachbarn Dr. Eichengrün zu und legte die Spur zu seiner beruflichen Laufbahn bei seinem wichtigsten Arbeitgeber, der Farbenfabriken, vormals Friedrich Bayer Co. Elberfeld – und zu dem Mann, der Bayer groß gemacht hat: Carl Duisberg. Ihm, der den jungen Chemiker für Bayer entdeckte und der den damals weltweit größten Chemiekonzern I.G. Farben organisierte und leitete, ist im Reichshandbuch ein noch etwas umfangreicherer Artikel11 gewidmet als Arthur Eichengrün.
Wenn mich die Aspirin-Spur interessiere, riet mir Waltraud Eichengrün, dann solle ich Michael de Ridder fragen. Der habe sich schon vor einiger Zeit damit befasst. De Ridder war jener Interessent, der sich schon vor mir bei ihr auf der Suche nach Auskünften und Unterlagen über Arthur Eichengrün in Königswinter gemeldet hatte. Er war damals aus Berlin angereist. Für ihn habe Ernst eine Pappschublade mit Dokumenten aus dem Nachlass seines Großvaters gefüllt und mitgegeben. Dieses Material könne ich doch von de Ridder übernehmen.
Michael de Ridder war nicht am Obersalzberg auf Arthur Eichengrün gestoßen, sondern an einem ganz anderen Schauplatz. Er recherchierte und verfasste in den 1980er Jahren seine medizinische Dissertation zum Thema »Heroin – die Geschichte einer pharmazeutischen Spezialität«.12 Heroin, das mag erstaunen, war der Marken- und Handelsname für die chemische Substanz Diacetylmorphin, die von den Farbenfabriken synthetisiert und 1898 auf den Arzneimarkt gebracht wurde: als Hustenmittel. In seiner medizingeschichtlichen Untersuchung widmete sich de Ridder der bizarren Karriere des Heroins: Wie hatte sich eine nach systematischer pharmazeutischer Forschung industriell erzeugte Arznei, die von Ärzten als Heilmittel angesehen und verordnet wurde, zu einer gefährlichen Suchtdroge entwickelt?
Bei seinen Recherchen im Firmenarchiv der Bayer AG war Michael de Ridder dabei wiederholt auf vier Namen gestoßen: auf Bayer-Direktor Carl Duisberg, den Laborchemiker Felix Hoffmann, den Pharmakologen Heinrich Dreser – und auf den Chemiker und Pharmazeuten Arthur Eichengrün. Sie alle arbeiteten bei Bayer an der Entwicklung neuer Heilmittel, an ihrer Prüfung und Markteinführung.
De Ridder las im Bayer-Archiv alle noch erhaltenen Akten zum Thema und entdeckte, dass der Chemiker Felix Hoffmann am 10. August des Jahres 1897 die Acetylsalicylsäure synthetisiert hatte. Nur elf Tage später, am 21. August, verzeichnete Hoffmann in seinem Laborjournal in der gleichen Versuchsreihe die Synthese des Diacetylmorphins. Was ihren Ursprung anbelangt, kamen das schädliche Suchtgift Heroin und das medizinisch vielseitige Heilmittel Aspirin fast gleichzeitig aus derselben Küche.
Auf skurrilem Weg und gänzlich unerwartet war ich mit Arthur Eichengrün auf einen Zeitgenossen gestoßen, den ich kennenlernen wollte. Immer weiter angetrieben hat mich der merkwürdige Mahlstrom des Vergessens, der so viele Erinnerungen und Zeugnisse verschlungen und in die Tiefe gezogen hatte, bis an der Oberfläche der deutschen Nachkriegsgesellschaft nichts und niemand mehr an Dr. Dr. h. c. Dr. h. c. Arthur Eichengrün erinnerte. Wäre da nicht die alte Dame gewesen, die von ihrer Obersalzberger Kindheit im bäuerlichen Oberwurflehen schwärmte und von den Kindergeburtstagen im Haus Mitterwurf bei der Judenfamilie nebenan. Sie gab mir mit dem Namen Eichengrün den Schlüssel für meine Recherchen und setzte mich so auf seine Spur: Die führte zu den Nachkommen der verschiedenen Familienzweige in Deutschland, Spanien, Namibia, Holland und Israel. Sie vertrauten mir ihre Erinnerungen an, Erinnerungssplitter aus dem Blickwinkel der sechs- bis zwölfjährigen Kinder, die sie in den 1930er und 1940er Jahren gewesen waren, ehe sie ihren Großvater aus den Augen verloren, die einen im Krieg, die anderen durch die Emigration. Anfangs zurückhaltend, bald bereitwillig gaben sie mir Einblick in das, was ihnen in ihren Familien vom Großvater und Urgroßvater Arthur Eichengrün geblieben war.
Was ich vorfand, waren keine vollständigen und systematisch geordneten Nachlässe, sondern Fragmente. Die großen Lücken, die in den privaten, familiären Beständen klaffen, sind den Umständen der Verfolgung geschuldet, der Eichengrün und seine Familie ausgesetzt waren. Sein berufliches Lebenswerk – nach den ebenfalls bedeutenden und prägenden Jahren bei Bayer – waren die 1908 in Berlin gegründeten Cellon-Werke. Sie wurden ihm zwischen 1933 und 1938 durch die Arisierung genommen, als eigenständige Firma zerschlagen und als ein Betriebsteil unter anderen in ein aus mehreren einst jüdischen Firmen zusammengezimmertes Konsortium eingegliedert. Von den Cellon-Werken blieb so gut wie nichts. Keine Firmenakten, keine Pläne, alles abgewickelt und vernichtet.
Das Haus Mitterwurf am Obersalzberg wurde 1937 abgerissen, in Berlin die repräsentative Wilmersdorfer Appartementwohnung am Kaiserdamm 34 im Bombenkrieg dem Erdboden gleichgemacht und nicht wiederaufgebaut. Die letzte Berliner Wohnung von Arthur und Lucie Eichengrün in der Pommerschen Straße, von der ihn die Gestapo im Mai 1944 zur Deportation in das KZ Theresienstadt abholte, ging beim Einmarsch der Roten Armee ein Jahr später in Flammen auf. Wie viele persönliche und berufliche Dokumente und Bilder, Korrespondenzen und Akten dabei unwiederbringlich verloren gingen, darüber kann man nur spekulieren. Zu einem immer schmaleren Rinnsal geriet, was übrig war, mit der Flucht aus dem zerstörten Berlin in ein Domizil im bayerischen Bad Wiessee. Dieses letzte Quartier hat ihm die amerikanische Militärregierung zugeteilt – in einem von ihr nach dem Einmarsch beschlagnahmten Kurheim mit dem klangvollen Namen Hotel Eden.
Die Briefe, die er innerhalb der Familie schrieb, haben sich teilweise bei seinen Kindern erhalten, die meisten bei Tochter Hille, seiner zuverlässigsten und prompt antwortenden Briefpartnerin, mit der er die kontinuierlichste Korrespondenz führte – und die die väterlichen Briefe seit ihrer Jugendzeit wie einen Schatz bewahrt hat.
Immerzu war ich auf der Suche nach Selbstzeugnissen Eichengrüns, nach Aufzeichnungen, nach Tagebüchern. Zumindest nach seiner Rückkehr aus dem KZ Theresienstadt hätte er – endlich frei – auf die abenteuerlichen, erfolgreichen und schmerzlichen Wendungen seines Lebens zurückblicken können. Ich hatte mir erhofft, sein Resümee zu erfahren. Sah er seinen so entschieden eingeschlagenen Weg als deutscher Jude als gescheitert an? Welchen Täuschungen und Selbsttäuschungen war er erlegen? Hätte er sein Schicksal wenden können?
Solche Texte aus seiner Feder sind nie aufgetaucht. Seine Gedanken, seine Selbstreflexion behielt er für sich. Nur sehr wenige Äußerungen lassen erahnen, was ihn in den Zeitläuften umtrieb. Auch gegenüber der Öffentlichkeit hat sich Eichengrün nicht bemüßigt gefühlt, sich zu äußern. Er war nicht nur auf Distanz zur Politik. Er hielt sich auch in wirtschaftlichen und fachlichen Fragen bedeckt, obwohl ihm in den gut drei Jahrzehnten seiner erfolgreichen Laufbahn als Wissenschaftler, Erfinder und Industrieller öffentliches Gehör sicher gewesen wäre. Seine im Druck veröffentlichten Fachvorträge vor geladenem Publikum lassen darauf schließen, dass er durchaus über rhetorisches Geschick verfügte. Interviews für die Presse gab er nicht. Gelegentlich erschien sein Bild in Illustrierten, etwa an der Seite berühmter Kollegen wie Karl Goldschmidt und Fritz Haber.
Einmal glaubte ich mich einem unverhofften Ziel nahe, nämlich Eichengrüns Stimme hören zu können. Seine Enkelin Petra Nicholson-Gorn berichtete mir, sie habe 1939 die etwas krächzende, aber deutlich erkennbare Stimme des Großvaters vernommen, als ihre Mutter Lottie mehrfach dünne, elastische Schallfolien auf dem Grammophon abspielte. Lottie war bereits 1935 nach London emigriert und hatte ihre Tochter 1938 nachgeholt. In diesem Jahr entschloss sich der bis dahin widerstrebende Arthur Eichengrün dann doch, die Auswanderung nach England zu wagen. Lottie setzte zu dieser Zeit alle Hebel in Bewegung, um ihrem Vater die Einwanderung nach Großbritannien zu ermöglichen. »Opi«, so nannte Petra den Großvater, »Opi hatte Mami ein Dictaphon gegeben, vor Jahren, und hat auf Schallplatten aus Cellon seine Briefe geschrieben. Die wurden entweder von Freunden rausgebracht oder mit der Post geschickt«.13 Petra lauschte beglückt Opis vertrauter Stimme, mit ihren zwölf Jahren begriff sie aber noch nicht, worum es ging: Lottie musste der Einwanderungsbehörde im Home Office, dem Innenministerium, die bedrängte Lage und die zunehmende rassistische Verfolgung ihres Vaters glaubhaft darlegen. Und was konnte glaubhafter sein als die Stimme des Betroffenen. Hier half Eichengrün seine Erfindung »zur Herstellung prägefähiger Sprechmaschinenplatten«, die er erstmals bereits 1911 im Deutschen Reich, dann in Großbritannien, in Österreich14 und in den USA zum Patent angemeldet und über Jahre weiterentwickelt hatte.
Patentschriften Eichengrüns für England, die Schweiz, das Deutsche Reich, die USA und Österreich. Rechts unten das Patent für Schallplatten aus Cellon.
Für seine Schallfolienprototypen hatte sich Eichengrün die gesamte Apparatur gebaut – inklusive Schallaufnahmegerät, in das er sprechen und das die Schallrille in die Cellonfolie schneiden konnte, die, wie sich Enkelin Petra erinnerte, als Alternative zu den zerbrechlichen Schelllackplatten gedacht war. »Biegsam waren sie und gingen in ein Kuvert rein mit etwas Pappe, ganz dünn, und die setzte man auf die Maschine. Und wahrscheinlich waren es diese Platten, die meine Mutter zum Home Office gebracht hat. Ich hab’ die Platten nicht mehr.« Dank Petras Hinweis führte eine heiße Spur in die National Archives in Kew bei London. Dort entdeckte ich die Immigrations- und Einbürgerungsakten von Lottie, von ihrer Tochter Petra, auch die von Lotties Halbbruder Hans Günther. Von Arthur Eichengrün aber tauchte nur noch die Signatur seiner Akte auf: »Dr. Arthur Eichengrun E4739«.
War diese Akte vielleicht noch nicht ans Archiv abgegeben worden? Damit begann die Suche im britischen Innenministerium, die nach monatelangen Nachforschungen mit dem freundlichen Bedauern der Sachbearbeiterin Paulette Olivier endete: Sie teilte mir mit, dass die Akte E4739 tatsächlich mit Datum 25. November 1938 angelegt, dann aber vernichtet worden sei, da Arthur Eichengrün im Unterschied zu seinen Kindern nie im Vereinigten Königreich angekommen war.
Es ist frustrierend, sich auf die Spur wichtiger Quellen zu begeben, um dann zu erfahren, dass sie unwiederbringlich verloren sind. Man wünscht sie sich herbei – und beginnt schließlich, sie zu imaginieren. Ich stelle mir also lebhaft vor, wie der Erfinder Eichengrün nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in seiner bedrängten Lage immer mehr verstummte, verstummen musste – und wie er am ehesten wohl vor dem selbstgebauten, grammophonähnlichen Aufnahmegerät ausgepackt hat. Wie er seine Botschaften mit erhobener Stimme in die rauschende und knisternde Tonrille auf den extra dafür ausgetüftelten Schallfolien aus Cellon ritzte.
Hallo! Hier Eichengrün.
Werter Herr Autor – Sie müßten wissen, ich habe mein ganzes Leben mit exakten wissenschaftlichen Methoden gearbeitet. Sie werden sich daher nicht wundern, daß icb Ihre spekulativen Spielereien ablehne.
Aber bitte! Wenn Sie meinen, auf diese Weise mehr über mich in Erfahrung zu bringen, werde ich von Zeit zu Zeit kurze Cellon-Schallfolien-Botschaften an Sie richten.
Nur – glauben Sie bloß nicht, daß ich Ihnen immer nur das apportiere, was Sie gerade hören wollen. Nichts für ungut, aber auf Widerspruch sollten Sie sich gefaßt machen. Ohne Widerspruch hätte ich mich nie so lange Zeit so gut behaupten können. Wobei ich gleich die Gelegenheit nutze, Ihr nostalgisches Klischee von der knisternden Grammophonplatte zu korrigieren: Das war ja der Clou meiner Erfindung, daß ich mit meiner speziellen Cellon-Mischung dem Rauschen und Knistern den Garaus hätte machen können. Hat sich aber damals leider gegen den billigeren Schellack nicht behaupten können. Als sich dann Anfang der dreißiger Jahre Vinyl vor allem in Amerika durchzusetzen begann, da konnte ich ab 1933 aus bekannten Gründen nicht mehr mitmischen.
Sei’s drum – wenn sich Ihre Ungenauigkeiten auch sonst in einem erträglichen Rahmen halten, werde ich Ihnen gelegentlich weitere Botschaften zukommen lassen. Was meine Privatsphäre angeht: Erhoffen Sie sich nichts! Da Sie keine Tagebücher gefunden haben, gibt es sie eben nicht für Sie. Ich binde Ihnen nicht einmal auf die Nase, ob ich solche geführt habe oder nicht oder ob ich, für den Fall, daß ich das getan habe, in den wirren Zeitläuften, in denen ich mich bewegen mußte, ihrer verlustig gegangen bin oder sie gar selbst eines Tages im Kamin eingeschürt habe.
Ich bemerke allerdings im Moment, da ich Ihnen dies wie ein allumfassendes Dementi darlege, daß Sie mit einer Vermutung nicht so falschliegen. Eine gewisse Verschlossenheit kann ich nicht leugnen, auch diese Neigung, Dinge nicht nach außen zu tragen, sondern sie mit mir selbst auszumachen. Und was die Quellen angeht, die Sie möglichst vollständig versammeln wollen: Suchen Sie weiter! – Ich durfte ja mein Leben lang erfinden, was immer ich wollte. Immerzu erfinden. Ob Sie das als Biograph dürfen – das müssen Sie mit Ihrem Lektor und den Lesern ausmachen. Und selbstverständlich mit den Leserinnen. Man ist in diesen sprachlichen Fragen, das muß ich zugeben, zu Ihrer Zeit empfindsamer als zu meiner, in der wir uns doch einbildeten, an Galanterie gegenüber den Damen alle zu übertreffen, die nach uns kamen.
1 Brockhaus die Enzyclopädie in 24 Bänden, Band 2, 20. Auflage, Leipzig, Mannheim, 1996, S. 218.
2 Ebenda, Band 1, S. 105.
3 Ebenda.
4 Die übrigen drei Eichengrüns haben nach Ernst Eichengrüns intensiven genealogischen Recherchen mit der Linie von Arthur Eichengrün keine Berührung.
5 Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft. Das Handbuch der Persönlichkeiten in Wort und Bild. Schriftleitung Robert Volz, mit einem Vorwort von Ferdinand Tönnies. Zwei Bände, Berlin, Band 1 1930, Band 2 1931.
6 Das »Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft« blieb ein Solitär. Weder gab es einen früheren Jahrgangsband, noch ist nach der Ausgabe von 1930/31 je ein neuer Jahrgangsband erschienen. Das verwundert nicht. Eine Revision der 8500 Biografien nach den Ausgrenzungskriterien des NS-Staates hätte das Werk schlagartig halbiert.
7 Ferdinand Tönnies, Über die Gesellschaft, in: Reichshandbuch, Band 1.
8 Reichshandbuch, Band 1, S. 378 f.
9 Reichshandbuch, Band 1, S. 771. Immerhin findet Hitlers Beschäftigung mit dem Judentum in den 27 Zeilen seiner Kurzbiografie eine bemüht sachlich-neutrale Erwähnung: »In Wien kam er früh mit den Problemen des Marxismus und der Judenfrage in Berührung, die er ebenso eifrig studierte, wie er bereits damals eine Lösung für die großdeutsche Frage zu finden suchte.«
10 Reichshandbuch, Biografie Arthur Eichengrün, S. 378.
11 Reichshandbuch, Biografie Carl Duisberg, S. 352 f.
12 Eine überarbeitete Version dieser Dissertation hat Michael de Ridder als Buch vorgelegt: Heroin. Vom Arzneimittel zur Droge, Frankfurt am Main 2000.
13Petra Nicholson-Gorn im Interview mit dem Autor, 31.01.2001, Puerto de la Cruz, Teneriffa.
14 Kais. Königl. Patentamt, Österreichische Patentschrift Nr. 722706, Dr. Arthur Eichengrün in Berlin, Verfahren zur Herstellung prägefähiger Sprechmaschinenplatten, ausgegeben am 10. November 1916.
Eine Kindheit in der Kaiserzeit – im KZ erinnert
»Gegen Ende der theresianischen Zeit«, so berichtet die Schriftstellerin Gerty Spieß, »verbrachte der alte Herr jede freie Stunde da droben an seinem kahlen Tisch unter der Dachluke, die mit ihrem bescheidenen Dreiecksauge seiner beharrlichen Arbeit das Licht spendete: Er schrieb Tagebuch.«1 Der alte Herr, der jüdische Pelzhändler Philipp Manes, war im Juli 1942 gemeinsam mit seiner Frau Gertrud ins KZ Theresienstadt deportiert worden. Er hatte zuvor seine gesamte bürgerliche Existenz verloren, sein Geschäft und seine Wohnung in Berlin. Nur die Ausreise seiner vier Töchter hatte das Ehepaar bewerkstelligen können. Im Ghetto angekommen, entwickelte der rüstige Siebzigjährige eine rastlose soziale und kulturelle Aktivität. Im sogenannten Orientierungsdienst der jüdischen Selbstverwaltung half er traumatisierten Mithäftlingen, sich im Alltag des Lagers zurechtzufinden. Alle restliche Zeit verwendete er darauf, ein Kulturprogramm von Häftlingen für Häftlinge zu organisieren, Lesungen, Konzerte und Vorträge. Die Begegnungen mit zahllosen Musikerinnen, Literaten, Schauspielerinnen, Rabbinern, Juristen, Politikern und Wissenschaftlern inspirierten Manes zu einem ehrgeizigen Vorhaben. Er führte biografische Interviews und verdichtete sie zu Porträts der einst profilierten Persönlichkeiten, die die Nationalsozialisten aus dem einzigen Grund aus dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben verbannt hatten, weil sie Jüdinnen und Juden waren.
Manes’ »Tatsachenbericht« und die darin enthaltenen jüdischen Biografien waren ein Akt des Widerstands gegen die Infamie der Absonderung der jüdischen Deutschen aus ihrem angestammten Umfeld in Arbeit und Beruf, ihrer Wohnumgebung und Nachbarschaft. Sie ging mit antisemitischen Diffamierungen einher: Jüdinnen und Juden seien unfähig zu produktiver wirtschaftlicher Arbeit, wissenschaftlicher Erkenntnis, eigenständigen künstlerischen und kulturellen Leistungen, ihr Wesen erschöpfe sich in Schachern, Raffgier und Ausbeutung. Mit seinen biografischen Porträts trat Philipp Manes den Gegenbeweis an: In Theresienstadt war nicht der Abschaum, es war hier eine Elite der deutschen Gesellschaft auf vielen Gebieten versammelt. Manes fragte sich durch, vom Oberrabbiner Leo Baeck über die Schauspielerin und Schriftstellerin Elsa Bernstein zum ehemaligen Reichsinnenminister Georg Gradnauer und wurde weiterempfohlen zu:
»Dr. Dr. Arthur Eichengrün. Man hat mich mehrfach auf diesen Prominenten aufmerksam gemacht, der einer der interessantesten Männer des Ghettos – weil [er, U. C.] der größte Erfinder unserer deutschen chemischen Industrie sein solle. Ich klopfte mehrfach vergeblich im Haus Seestr. 20 an die Tür – immer blieb sie verschlossen – der Bewohner benutzte das herrliche Wetter – um draußen Erholung zu suchen.
Heute kam ich wohl ein wenig früher als sonst und fand Einlaß. Allerdings lag man noch – des Ausruhens wegen – im Bett. Schnell in die Hausjacke, eine Decke über die Knie, mir Platz angeboten, und es konnte das Interview beginnen.«2
Manes’ »Tatsachenbericht«, in dem das Interview mit Arthur Eichengrün enthalten ist, gelangte nach der Befreiung des Lagers über seine in England lebende Tochter Eva Manes an die Wiener Holocaust Library in London. Es ist neben einem Brief Eichengrüns an seine Tochter Hille3 das einzige bekannte Zeugnis über seine Lebensumstände im KZ, das die Nationalsozialisten beschönigend abwechselnd Ghetto Theresienstadt und jüdisches Siedlungsgebiet Theresienstadt nannten.
Philipp Manes, porträtiert im April 1944 von Arthur Goldschmidt in Theresienstadt.
»So ganz einfach wurde mir die Anknüpfung nicht« – an dieser Stelle meint man den Interviewer Manes leise seufzen zu hören. »Mein Gegenüber ist Gelehrter, Forscher, Prüfer und will auch von mir wissen, wohin die Fahrt.« Das Manuskript in Manes’ Handschrift, verfasst im September 1944, ist an einigen Stellen mit ebenfalls schwer lesbaren Streichungen und Bemerkungen des recht peniblen, 78 Jahre alten Porträtierten versehen. Eichengrün hat Korrektur gelesen.
Warum zitiere ich dieses sehr spät in Eichengrüns Leben entstandene Zeugnis so früh in dieser Biografie? Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur das einzige, noch dazu autorisierte Interview, das Arthur Eichengrün je in seinem Leben gegeben hat. Vor allem ist es das einzige autobiografische Dokument, in dem Eichengrün über seine Kindheit, Jugend, Studienzeit und den Beginn der Berufslaufbahn berichtet. Manes liefert dazu in seinem Rahmentext eine plausible Vermutung:
»Verständlich, denn bestimmt hat er in seinem ganzen Leben nicht für Erzählungen Zeit gehabt, sicher schickte er seine Gedanken nie rückwärts, sondern immer nur vorwärts. Sein Gehirn ging drei Viertel des Tages auf neuen, unbekannten Wegen, spürte und sann, warf sich spekulative Probleme auf und gab keine Ruhe, ehe sie gelöst, das Ziel erreicht war.«4
Philipp Manes hat in Theresienstadt schon vor seinem ersten Besuch einige Informationen über Eichengrün zusammengetragen, die er im Rahmentext seines Interviews erwähnt.
»Draußen wäre das die Sache der gelehrten Herren des Faches gewesen, die hätten vor dem 1. Oktober, an dem sich zum 50. Male der Tag jährte, der den jungen Forscher zur IG Farben5 führte, lange Abhandlungen geschrieben, Festschriften wären erschienen, die Erlanger Universität hätte am goldenen Jubiläumstage den Doktortitel in prunkvoller Weise erneuert. Die ganze wissenschaftliche Welt hätte sich um den berühmten Sohn Deutschlands geschart und ihm, der dem Erdenkreis das Aspirin geschenkt, gehuldigt. Hier in Th. gedachte nur die sorgende Betreuerin des Tages und stellte mit Herbstblumen eine Torte auf den Tisch. Ich aber will den Mut aufbringen, dies gewaltige – in seinen Auswirkungen unübersehbare Leben – zu schildern – indem ich versuche, ohne Stenogramm das widerzugeben, was die im Bereiche der Chemie völlig ungeschulten Ohren aufnehmen und behalten.«6
Manes verrät nicht, wem in Theresienstadt er diejenigen Informationen verdankt, die Eichengrün in seinem Interviewtext selbst nicht erwähnt. Spürbar ist, dass er seinem Gesprächspartner mit einem an Unterwürfigkeit grenzenden Respekt gegenübertritt, nicht zuletzt, weil er, der einstige Pelzhändler, sich nicht berufen fühlte, die Koryphäe Eichengrün zu würdigen, wäre da nicht die Extremsituation des Konzentrationslagers. Wobei Eichengrüns Situation im Mikrokosmos Theresienstadt eine Besonderheit aufweist, die mit der propagandistischen Funktion dieses KZs als Vorzeigelager für die Nationalsozialisten zusammenhängt: Er hatte eine individuelle Postadresse, sie lautete: Seestraße 20. In diesem und den benachbarten Häusern waren Häftlinge einer besonderen Kategorie in individuellen Zimmern untergebracht. In diese war auch Arthur Eichengrün eingestuft worden, was Philipp Manes’ Respekt noch zusätzlich gesteigert haben mag.
»Dieser große Mann – er ist es wirklich auch körperlich, 1.85 mt. mindestens – …«, und schon meldet sich an dieser Stelle erstmals Arthur Eichengrün mit einem Federstrich in seiner Handschrift zu Wort. Er streicht »1.85« durch – und setzt »1 Meter 76« darunter. Folgen wir weiter dem von Eichengrün korrigierten Manes-Text: »Dieser große Mann – er ist es wirklich auch körperlich, 1 Meter 76 mindestens, lebt in dem kleinsten Hinterzimmer des Hauses der Prominenten. Auf und ab zu gehen, wie es die Denker lieben, kann er nicht: Bett – Chaiselongue – dazwischen ein Tisch, bequemer Sessel – Schrank und Gestell – in der Ecke kleiner Kanonenofen. […]
Die Praeliminarien schienen zur Zufriedenheit ausgefallen. – Aber wie das Werk beginnen?
›Wichtigste Episoden mit der Hand niederschreiben‹, schlug ich vor.
›Nein – meine Handschrift kann man nicht lesen‹.« – Das, muss der entzifferungsgeplagte Biograf kurz einwerfen, ist leider wahr – worauf sogleich das Wort wieder an Philipp Manes geht:
»›Geschulter Stenotypistin diktieren?‹
›Das wird nur selten möglich sein – da die Damen kaum frei sein werden, und womit sie bezahlen? Wenige sind solche Idealisten, daß sie ihre Mittagszeit hergeben.‹«
Eichengrün befindet sich seit seiner Deportation nach Theresienstadt im Mai 1944 in einem kuriosen Zwischenreich, in dem er noch immer alten Gewohnheiten nachhängt, als könne er sie mit einem Fingerschnipsen herbeizitieren. Wie alle Häftlinge ist Eichengrün im KZ seiner Freiheit beraubt. Aber er muss nicht mit Dutzenden Leidensgenossen in einer mit Stockbetten vollgestopften Häftlingsbaracke hausen, ohne jede Privatsphäre, als Nummer ohne Namen und Adresse. Eichengrün gehörte der von der SS bestimmten Gruppe der sogenannten Prominenten an, war unter den 28 000 Häftlingen einer von knapp 200 Privilegierten, denen bessere Wohnverhältnisse und Ernährung zugestanden wurden.7
Dabei ist das Zimmer, das er allein bewohnt, eher ein Verschlag, gegen den eine jede Kammer, wie sie Eichengrün einst seinen Hausangestellten geboten hat, eine gediegene Wohnung gewesen sein dürfte. Manes vermerkt diese äußeren Umstände, notiert aber auch die stoische Haltung seines Gegenübers.
Auch ohne die ihm gewohnte Stenotypistin mit Diktierblock nimmt Eichengrün nach dem Vorgespräch das Angebot an: Er erzählt, Manes macht Notizen, auf deren Grundlage er das Interview ausformulieren wird – und beginnt sogleich, um keine Zeit zu verlieren.
Er startet seine biografische Erforschung ganz klassisch, ab ovo. Damit versetzt er Arthur Eichengrün aus dem tristen Zimmer in Theresienstadt über 700 Kilometer nach Westen, wo er ihn eintauchen lässt in seine unbeschwerte Kindheit und Jugend.
»Ich bin am 13. August 1867 in Aachen geboren, mein Vater war Tuchfabrikant – meine Mutter, geborene Meyer, hatte ebenfalls einen Tuchfabrikanten zum Vater.«8 – Es war typisch, dass das Tuchgewerbe in familiärer Tradition und über Generationen hinweg betrieben wurde – so wie es Eichengrün vom Vater Julius Eichengrün und von seinem Großvater mütterlicherseits berichtet. Dieser Großvater war Moritz Meyer, der als Fabrikant eine gewichtige Rolle im Aachener Tuchgewerbe spielte, aber auch als Patriarch in seiner Familie.
Die meisten der Spinnereien, Tuchwebereien, Färbereien, Appreturanstalten und Textilhandelshäuser in der alten Dom- und Kaiserstadt wurden von jüdischen Fabrikanten begründet und geführt. Hier galt im Gefolge der Französischen Revolution 20 Jahre früher als in den anderen deutschen Landen Gewerbefreiheit für die Juden. Von 1804 an verhalf die napoleonische Politik der wirtschaftlichen Entwicklung zu weiterem Aufschwung.9 Aachen stieg im 19. Jahrhundert zu einer der führenden Textilmetropolen Deutschlands auf. In einer Karte aus dem Jahr 185010 sind um die 50 Betriebe im Stadtgebiet eingezeichnet, von kleinen Manufakturen bis hin zu Fabriken mit mehreren Hundert Arbeiterinnen und Arbeitern. Die boomenden Fabriken waren die größten Arbeitgeber, der Stolz und das wirtschaftliche Rückgrat der Stadt, man versteckte sie nicht am Stadtrand. Große Fabrikhallen mit ihren rauchenden Schornsteinen und die oft direkt benachbarten Wohnhäuser prägten die Innenstadt entlang der Hauptstraßen, wie etwa die Tuchfabrik M. Meyer & Comp. mit seinen drei Giebelfassaden zur Wilhelmstraße, ein ansehnliches Unternehmen, wie der »Amtliche Katalog der Ausstellung des Deutschen Reiches zur Pariser Weltausstellung 1873« vermeldet: »Vollständige Tuchfabrication. Spez. Nouveautés in Paletot- und Hosenstoffen, so wie Damen-Confectionsartike. 2 Etablissements; in Aachen und Burtscheid. […] 700 Arb., davon 300 ausserhalb der Fabrik. Directionspersonal 25. 3 Dampfmaschinen von zusammen 120, 1 Wasserrad von 10 Pferd Stärken.«
Vom Zuschnitt und Interieur der Meyer’schen Fabrikantenvilla hat eines der sechs Kinder von Moritz Meyer ausführlich in einer Familienchronik berichtet, seine Tochter Elvira, Arthur Eichengrüns Tante: »Dort hatten wir ein prächtiges Haus mit 16 Zimmern, großem Garten und daran anstoßender riesiger Tuchfabrik, dann Stallungen für fünf Pferde. Davon entfielen zwei für die Fabrik, zwei für unseren Gebrauch und Papas Reitpferd.«11
Wir – damit meint die Chronistin Elvira Meyer ihren Vater Moritz, ihre Mutter Sybilla und ihre fünf Geschwister. Elvira schildert deren Lebenswege, Ehen und Familien, Erfolge und Katastrophen völlig unverblümt und ohne Rücksicht auf sorgsam gehütete Familiengeheimnisse. Ihre Enkelin Amelis von Mettenheim, die sie in einem Privatdruck für die Familie veröffentlicht hat, berichtet in ihren Anmerkungen, »dass manch einer der Familie ihr viel Geld dafür geben würde, wenn sie es unterließe«.12 Zwar berichtet Elvira Hirschhorn mit Stolz, Wohlwollen und Sympathie über die Erfolge und den Aufstieg ihrer deutsch-jüdischen Familie, aber sie scheut sich auch nicht, mit kritischem Blick hinter deren Fassade zu schauen. Wo immer es mir möglich war, ihre Angaben mit einer Nachrecherche zu überprüfen, haben sie sich als korrekt erwiesen.
Die unumstrittene Hauptperson darin ist Arthur Eichengrüns Großvater Moritz Meyer. Er kam aus dem westfälischen Warendorf und profilierte sich innerhalb weniger Jahre als einer der erfolgreichsten Tuchfabrikanten Aachens. Er war noch nicht einmal dreißig, als er mit seinem fünf Jahre älteren Bruder Elias nach Aachen zog und mit ihm die Tuchfabrik M. Meyer & Comp. sowie die Kleiderhandlung Gebr. Meyer gründete und diese Firmen zur zweitgrößten Tuchfabrik der Stadt mit angeschlossenem Handelsbetrieb entwickelte. Diese geschickte Kombination aus der Fabrikation von feinen Tuchen und dem forcierten Absatz der eigenen Ware in den modeverliebten Metropolen des Deutschen Reiches wie des europäischen und überseeischen Auslands, gepaart mit der flexiblen Reaktion auf den sich wandelnden Geschmack und die Nachfrage des Publikums nach textilen Neuigkeiten, ließen Moritz Meyer zu einem der wohlhabendsten Bürger Aachens aufsteigen. In der Tuchbranche der Stadt galten Moritz und Elias Meyer als die »Buckspinkönige«, weil sie die Fertigung des kräftig gewalkten Streichgarngewebes perfektioniert hatten und erstklassige Qualität liefern konnten.
Fast zugleich mit der Gründung seiner Firmen hatte Moritz Meyer 1843 die dreiundzwanzigjährige Sybille Salomon geheiratet, und im gleichen Tempo, in dem seine Unternehmungen wuchsen und in neue oder zusätzliche Quartiere umzogen, wuchs seine Familie und zog vom Seilgraben in ein großes Haus an der Oberen Theaterstraße 43. Die Fabrikantenbrüder und ihre Familien genossen ihren Wohlstand, den man indirekt an ihren Abgaben ablesen kann – nach einer erhaltenen Statistik führten sie im Jahr 1874 mit 1201 Goldmark direkter Steuern den vierthöchsten Betrag aller Gewerbetreibenden für die Aachener Synagogengemeinde ab.13 Elias Meyer engagierte sich auch von 1854 an als einer der drei Gemeindevorsteher.
Beide Brüder haben zwar jüdische Frauen geheiratet, aber sie bewegten sich in ihrem gesellschaftlichen Leben nicht mehr in einem hermetisch abgeschlossenen jüdischen Milieu. Moritz hatte schon als junger Mann christliche Freunde, die bei seiner Hochzeit als Trauzeugen fungierten. Elias, der mit seiner Frau Friederica kinderlos blieb, rief eine Stipendienstiftung für Studierende an der RWTH Aachen ins Leben. Im Stiftungsstatut verfügten sie: »Daß die Stipendien abwechselnd einem Bekenner der jüdischen und der christlichen Religion […] verliehen werden«.14 Beide Brüder, Elias und Moritz, wurden 1861 in die den Honoratioren der Stadt vorbehaltene »Aachener Erholungsgesellschaft« aufgenommen, in der es zuvor nur wenige jüdische Mitglieder gegeben hatte. Das ist nur ein Beleg dafür, dass sich in Aachen ein zunehmend liberales Klima entwickelte. Aufgeschlossene Persönlichkeiten wie etwa die Gebrüder Meyer bewegten sich nicht nur in ihrem tradierten jüdischen Umfeld; sie überschritten es. Und offenbar öffneten sich im gleichen Maße auch die bislang auf Abgrenzung ausgerichteten christlichen wie jüdischen und bürgerschaftlichen Institutionen. Nichts in den überlieferten Fakten der bilderbuchartigen Erfolgsgeschichte von Moritz Meyer deutet darauf hin, dass er Rückschläge erlitten oder sich je gegen Diskriminierungen oder Widerstände hat durchsetzen müssen, die ihm entgegenschlugen, weil er Jude war. Als er 1888 starb, hinterließ er ein Vermögen von zwei Millionen Goldmark – das entspricht nach heutiger Kaufkraft fast 20 Millionen Euro –, dessen Großteil der erstgeborene und einzige Sohn Eduard erbte.
Doch auch für seine fünf Töchter sorgte der Familienpatriarch in einer Mischung aus opulenter Großzügigkeit und unerbittlicher Strenge. Seine achtzehnjährige Tochter Emma bekam beide Seiten ausgiebig zu spüren. So löste Moritz Meyer die bereits geschlossene Verlobung Emmas kurzerhand gegen deren Willen wieder auf, als ihr holländischer Verlobter die Absprache brach, nach einem vereinbarten Auslandsaufenthalt in Java nach Aachen zu übersiedeln. Die Tochter war zwar untröstlich, aber sie fügte sich. »Zur damaligen Zeit wagte kein Kind, der Eltern Willen zu mißachten«, konstatiert Emmas Schwester Elvira lakonisch in ihrer Familienchronik. Als sich zwei Jahre später ein neuer Bewerber um Emmas Hand aus Paderborn einfand, der sich flexibel auf die Vorschläge des Schwiegervaters in spe einließ, zeigte sich Moritz Meyer von seiner großzügigen Seite: »Meinem Vater hatte es nicht zugesagt«, berichtet Elvira einige Zeilen später in ihrer Chronik, »daß Julius Eichengrün in Paderborn ein Manufacturwarengeschäft besaß. Er richtete ihm und seinem Bruder Hermann eine Tuchfabrik in Aachen ein.« 15 Dieser familienpolitische Coup wurde damit abgerundet, dass zwei Jahre nach Julius sein Bruder Hermann Eichengrün Ida heiratete, eine weitere Tochter von Moritz Meyer. Beide Schwiegersöhne hatten es in Paderborn in jungen Jahren zu gestandenen Kaufleuten und angesehenen Bürgern gebracht. Sie zählten zu den ersten Juden, die im Jahr 1856 als Mitglied in die »Paderborner Harmoniegesellschaft« aufgenommen wurden, Julius gehörte ab 1860 darüber hinaus der Paderborner Stadtverordnetenversammlung an.16
Damit sind die Hauptpersonen der Kindheit und Jugend von Arthur Eichengrün versammelt. Wie sehr er den Großvater Moritz Meyer als Vorbild verehrt hat, belegt das einzige Schriftstück, das sich von Arthur Eichengrün aus dessen Kindheit bewahrt hat: ein Geburtstagsgruß. Ich fand ihn bei seinem Enkel Jonny Heimann in Windhoek in einem Schuhkarton unter alten Fotografien: »Lieber Großpapa!«, schreibt der Zwölfjährige in gestochener Sütterlinschrift. »Ich verspreche Dir, mich zu bemühen, immer brav zu sein, damit Du recht lieb behältst Deinen Dich herzlich liebenden Enkel Arthur«. Den Geburtstagsgruß musste Arthur nicht mit der Post aufgeben. Er war seinem bewunderten Großvater nicht nur emotional eng verbunden, als dessen erster Enkel er ein Jahr nach der Hochzeit der Eltern geboren wurde. Er war ihm auch räumlich nahe. »Emma bewohnte mit ihren vier Kindern das Haus neben uns.«17 Mal direkt, mal zwischen den Zeilen gibt Familienchronistin Elvira Hirschhorn zu erkennen, dass Moritz Meyer auch nach der Verheiratung in der Ehe seiner Tochter Emma mit Julius Eichengrün die Fäden in der Hand behielt und zog – möglicherweise auch ziehen musste.
Moritz Meyer hatte seiner Tochter 1866 eine schlüsselfertige Tuchfabrik mit über 250 Arbeitern als Mitgift für den Schwiegersohn eingerichtet.18 Julius hatte zuvor ein »Manufacturwarengeschäft« in Paderborn betrieben. Mit Textilhandel kannte er sich leidlich aus, mit den Mysterien der Produktion feinen Tuches hatten aber weder Julius noch sein ebenfalls in die Fabrik als Teilhaber eingetretener Bruder Hermann Erfahrung. »Diese Action wurde verhängnisvoll«, notiert die Familienchronistin: »Anfangs halfen ihnen gute Meister über die Schwierigkeiten hinweg, aber auf die Dauer hielt solches Stückwerk nicht. Sie fabrizierten glänzend, merkten aber nicht, dass sie bei jedem Stück Tuch ihr eigenes Geld zusetzten. Als das Geld zur Neige ging, blieb Papa nichts übrig, als für schweres Geld die Fabrik zu übernehmen, um einen Zusammenbruch zu verhüten.«19
Von Kindheit an erfuhr Arthur Eichengrün, dass die zentrale Figur und der Entscheider in allen wichtigen Angelegenheiten auch in der eigenen Familie nicht der Vater war, sondern der Großvater: ständig präsent im Haus nebenan, mit Durchgangstür in die Wohnung von Tochter, Schwiegersohn und Enkelkindern.
In dieser Wohnung in der Wilhelmstraße 50 hatte Arthur am 13. August 1867 um fünf Uhr morgens das Licht der Welt erblickt. Die Wohnung in der Wilhelmstraße war wie ein Kokon. Hier kam zwei Jahre später Schwester Meta zur Welt. Auf einer frühen Fotografie sitzt sie in einem schräg gestreiften Kleid wie eine Puppe drapiert auf einem gepolsterten Stuhl, daneben Arthur, stehend und gerade so groß, dass er sich an Wange und Schulter der Schwester anschmiegen kann.
Arthur und seine Schwester Meta.
In der Wilhelmstraße kommen mit deutlichem Abstand in den Jahren 1875 und 1878 noch die beiden jüngeren Brüder Ernst und Eduard zur Welt. Hier spielten sich auch die ersten Schuljahre Arthurs ab, da er anstatt in einer Grundschule durch einen Privatlehrer zu Hause unterrichtet wurde. Erst als er fast neun Jahre alt war, wurde er im Mai 1876 auf dem traditionsreichen humanistischen Kaiser-Karls-Gymnasium eingeschult.20
Ähnlich wie es einst der Großvater dem künftigen Schwiegersohn gegenüber gehalten hatte, sah Julius die Notwendigkeit, seinen Sohn mit einem attraktiven Angebot in seinen Beruf zu locken. Daran erinnert sich Arthur Eichengrün im Interview mit Philipp Manes: »Mein Vater wünschte, ich möge die Fabrikantenlaufbahn ergreifen, und in sein Unternehmen als Lehrling eintreten. Wenn ich mich dazu entschließen würde, sollte ich als Belohnung vor Eintritt in den Beruf eine Ferienreise nach Spanien und Italien zum Geschenk erhalten. Das konnte wohl einen jungen Menschen locken – in die weite Welt ziehen – sorgenlos reisen, sehen, was man bisher nur aus Büchern Abbildungen gelernt. Wer hätte da nicht begeistert ja gesagt und wäre dankbar dem gütigen Vater um den Hals gefallen?«21 Wann genau Julius Eichengrün seinem Sohn das Angebot unterbreitete, bleibt unerwähnt, doch alles spricht für das Jahr 1885, in dem Arthur das Abitur ablegte.
Offerierte der Vater dem Sohn die Fabriklaufbahn, weil er ihn wegen eher mäßiger Leistungen für ein akademisches, wissenschaftliches Studium nicht geeignet hielt? Ließ umgekehrt sein Zeugnis schon die Begabung und Brillanz in den Naturwissenschaften, insbesondere in der Chemie, ahnen? – Meine Suche danach in Aachen mündete in einer unerwarteten Entdeckung.22 Es gibt in den dortigen Schulunterlagen kein Abiturzeugnis, weil der siebzehnjährige Arthur Eichengrün das Kaiser-Karls-Gymnasium und Aachen nach der Unterprima urplötzlich Richtung Stuttgart verließ, um ein Jahr später im September 1885 sein Abitur an einer Schule mit dem gleichen altsprachlichen Bildungsangebot abzulegen wie in Aachen, dem Eberhard-Karls-Gymnasium. Zweierlei geht aus dem dort erhaltenen Zeugnis hervor: Arthur drehte dort keine Ehrenrunde, genauso wenig wie in den vorangegangenen Aachener Gymnasialklassen. Mit seinem Zeugnis, »Gesamtnote befriedigend«, war er zwar nicht der Primus, rangierte aber im oberen Drittel seiner Klasse und war, gerade vier Wochen nach seinem 18. Geburtstag, ein recht junger Abiturient.23
Weder hatten schlechte schulische Leistungen im Kaiser-Karls-Gymnasium den Schul- und Ortswechsel notwendig gemacht, noch hatte Arthur am Aachener Gymnasium einen disziplinarischen Verstoß begangen, der einen Schulverweis nach sich zog. So abrupt, wie er mit 17 Jahren aus seiner Heimatstadt verschwunden war, kehrte er ein Jahr später mit dem Abiturzeugnis in der Hand zurück. Das muss der Moment gewesen sein, in dem er das Angebot des Vaters, in die Tuchfabrik einzutreten, ausschlug und sich an der Rheinisch-Westfälischen Hochschule Aachen für das Studium der Chemie immatrikulierte.