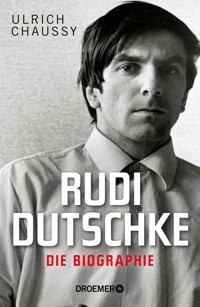
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Achtundsechzig" ist in der Bundesrepublik mit dem Namen Rudi Dutschke verbunden. Er war Gesicht und Stimme der deutschen Studentenbewegung, repräsentierte Aufbruch und Generationenkonflikt wie kein zweiter. Ulrich Chaussy kennt Dutschke wie kaum ein anderer. Seine Biographie zeichnet das spannende Bild eines mitreißenden Menschen, dem nur wenige Jahre öffentlichen Wirkens gegönnt waren, bis ein Rechtsradikaler ihn bei einem Attentat schwerst verletzte. Niemand anders hat der 68er-Bewegung so sehr seinen Stempel aufgedrückt wie Rudi Dutschke (1940-1979). Mit ihm ist die Revolte der Studenten mehr als nur verbunden – seine individuelle Biografie ist mit dem Verlauf einer kollektiven Bewegung eins geworden, insbesondere durch das Attentat vom Gründonnerstag 1968, das er nur um Haaresbreite überlebte und an dessen Spätfolgen er schließlich starb. Ulrich Chaussy kennt Rudi Dutschke wie kein zweiter Biograph. Er hat mit allen wichtigen Zeitzeugen gesprochen, hat alle relevanten Archive ausgewertet, als Ergebnis seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit Dutschke und 68 legt er diese komplett neu bearbeitete und erweiterte Biographie vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ulrich Chaussy
Rudi Dutschke
Die Biographie
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Achtundsechzig« ist in der Bundesrepublik mit dem Namen Rudi Dutschke verbunden. Er war Gesicht und Stimme der deutschen Studentenbewegung, repräsentierte Aufbruch und Generationenkonflikt wie kein zweiter. Ulrich Chaussy kennt Dutschke wie kaum ein anderer. Seine Biographie zeichnet das spannende Bild eines mitreißenden Menschen, dem nur wenige Jahre öffentlichen Wirkens gegönnt waren, bis ein Rechtsradikaler ihn bei einem Attentat schwerst verletzte.
Niemand anders hat der 68er-Bewegung so sehr seinen Stempel aufgedrückt wie Rudi Dutschke (1940-1979). Mit ihm ist die Revolte der Studenten mehr als nur verbunden – seine individuelle Biografie ist mit dem Verlauf einer kollektiven Bewegung eins geworden, insbesondere durch das Attentat vom Gründonnerstag 1968, das er nur um Haaresbreite überlebte und an dessen Spätfolgen er schließlich starb.
Ulrich Chaussy kennt Rudi Dutschke wie kein zweiter Biograph. Er hat mit allen wichtigen Zeitzeugen gesprochen, hat alle relevanten Archive ausgewertet, als Ergebnis seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit Dutschke und 68 legt er diese komplett neu bearbeitete und erweiterte Biographie vor.
Inhaltsübersicht
11. April 1968
I. Teil
Vater, Mutter. Soldaten, Soldaten
Luckenwalde, 7. März 1940
Strenge Regeln
Fragen und Schweigen. Der 17. Juni 1953
Verweigerung
Grenzgänger mit Schultasche
West-Berlin wird Rest-Berlin: 13. August 1961
Student, Rebell
Erste Orientierung
Blumenkohlohren
Café am Steinplatz
Studentenleben
Ein Revolutionär namens Jesus
Berliner Stillleben mit John und Jackie
Subversive Aktion
Personenbeschreibung
Erste Aktion
Theorie, ohne Weltmacht im Rücken
Eine Amerikanerin in Berlin
Wir sind satt, weil die anderen hungern
Betreten des Rasens und Revolutionen untersagt
Hier wird es nun ernst …
News from Berlin in Chicago
Beim »stinkenden Leichnam«
Was der Junge bloß macht!
II. Teil
Genosse
Besuch beim SDS
Back again in Germany
Vietnam-Szenen: Washington, Saigon, Hanoi, West-Berlin
In Russland
»Anschlag« im SDS
Freie Universität?
Der gute Draht
In Sachen Espinoza gegen das Land Berlin
»Das Land, das Brot und natürlich die Würde«
Jedem seine Message
Der große Plan
Inspektor und andere
Der Traum von der Kommune
Heirat
Bürgerschreck
Sit-in mit Frischeiern
Debattenkampf im SDS
Der Kronzeuge widerruft
Panorama über den Kochelsee hinaus
Die Torpedokäfer
»Hier ist nichts verbürgt …«
Presse-Premiere
Gretchens Nebenwidersprüche
Amerika, Amerika
Gegen die große Verbrüderung …
… und Vietnam
Abstand von der Kommune
Amsterdam, Juli 1965: PROVO
Protest als Happening – SPAPRO / SPAziergangsPROtest
Dutschkes dolles Ding, oder: Die publizistische Geburt eines Mythos
Die Tage und Wochen der Kommune
»Extreme Elemente« und eine »neue konservative Partei«
Jugendclub Ça Ira oder: Wer sich sonst noch bewegen lässt
2. Juni 1967 – Der Tod des Benno Ohnesorg
Albertz, Springer
Revolutionär
Ratlos
»Zu den Massen …« – Charmeoffensive auf dem Ku’damm
Durch die nahe, unerreichbare Heimat
»Linker Faschismus«?
Ex cathedra für Teufel
Das Gefängnis und das Wohnhaus
Che Guevara
Tribunal gegen Monopol – Die Anti-Springer-Kampagne
Pichelsdorf I – Ohnmachtsgefühle und Machtfantasien
Pichelsdorf II – Dr. Mabuse und die Konspiration
Guerilla-Fieber. Frankfurt, Mailand, Kuba, Bolivien, überall
Kraftprobe
Bündnispartner?
Die Ausnahme
Zu Protokoll
Friede auf Erden
Hosea-Che
Vietnam-Kongress. Berlin tanzt
Return to Sender – Dutschke und die Bombe von Verfassungsschutzagent Peter Urbach
Familienvater oder Berufsrevolutionär?
Alles ist in Afri-Cola
Prag
Wie Schuppen von den Augen
Arglos
III. Teil
Opfer
Ermittlungen über Josef Bachmann, der auf Rudi Dutschke schoss
Im Wirtschaftswunderland
Berliner Lehrwochen
Berlin, 11. April 1968
Karfreitag
Ostern
Protokoll einer Therapie
Bestandsaufnahme
Anonym
Vernehmungen
Münchenbuchsee
Italien
Persona non grata
»Lieber Josef Bachmann!«
Ungewissheit
»Lieber Rudi Dutschke«
»Im Namen des Volkes«
Exilant. Szenen 1969–1979
London, Limes Avenue No. 10
Schwierige Rückkehr
Blick durchs Fernrohr. Eine Revolte wird abgewickelt
»Ich will nicht in der Menschen Hand fallen …«
Das Sicherheitsrisiko
Ein neues Exil und wieder keine Ruhe?
Besuche
Dr. Rudi Dutschke
Deutschland, Deutschland ohne alles
Wieder da?
Angst
Welcher Kampf geht weiter?
Gefangen im eigenen Mythos – und in dem von »der Partei«
»Die Bevölkerung ist hellwach …« (Balthasar Ehret, Weisweil)
Grüne Zeiten
Gestatten Sie mir bitte zu träumen
Epilog
Rudi Dutschkes mythenüberwuchertes Nachleben
Rudi Dutschke und die »Geheimen« in Ost und West
Wie dieses Buch entstand
Wie dieses Buch fortgeschrieben wurde. Vom Sprudeln neuer Quellen
Rudi Dutschke lebt hier nicht mehr – Gegen unbefugte Vereinnahmungen
Dank – über drei Jahrzehnte hinweg
Anhang
Rudi Dutschkes Abituraufsatz
Auswahlbibliographie und Quellen
11. April 1968
Am Morgen des 11. April 1968 um 9.10 Uhr fährt der Transitzug aus München im West-Berliner Bahnhof Zoo ein. Die Reisenden sind übernächtigt von der sich endlos ziehenden Fahrt durch die DDR. Während der kurzen Halte auf gleißend ausgeleuchteten Bahnsteigen hatten wie immer nur die Grenzbeamten ein- oder aussteigen dürfen. Unter den Passagieren, die am Bahnhof Zoo den Zug verlassen, ist ein schmächtiger, junger Mann. Er ist am Vorabend um 21.52 Uhr in München losgefahren. Sein glattes Gesicht ist bartlos und blass, seine kurzen Haare sind sorgfältig gescheitelt. Die Frisur und sein scheuer Blick lassen Josef Bachmann jünger erscheinen als 24. Dagegen könnte ein geschulter Beobachter an der Wölbung der hellbraunen Wildlederjacke unterhalb der linken Schulter erkennen, dass Bachmann eine Pistole im Schulterhalfter bei sich hat.
Aber das haben zu seiner Erleichterung nicht einmal die Volkspolizisten bemerkt, die wie immer zur Passkontrolle in das abgedunkelte Abteil traten und routinemäßig nach Funkgeräten und Waffen fragten. Sie haben auch nicht in die blaugrüne Einkaufstasche geschaut, in der Bachmann eine weitere Pistole, Marke Röhm RG 5, Kaliber sechs Millimeter, die Gaspatronen und die etwa einhundert Schuss scharfe Patronen in Wäsche eingewickelt versteckt hatte.1 Einer der Grenzbeamten hat nur wie üblich den vor seinem Bauch hängenden Koffer mit Visaformularen, Stempeln und Fahndungsliste aufgeklappt, den ihm hingestreckten Pass durchgeblättert, im schnellen Wechsel das Bild im Pass und den zu ihm aufschauenden Bachmann fixiert, den Visumstempel auf eine freie Seite gedrückt, hat schließlich den Pass zurückgegeben, seinen Koffer zugeklappt und ist aus dem Abteil verschwunden.
Bachmann kann danach seine braune Reisetasche aus dem Gepäcknetz fischen und die Zeitungen entnehmen, die er vor der Abfahrt in München gekauft hat, einen Spiegel und die Bild-Zeitung. Danach sucht er aus einem Briefumschlag mit Zeitungsausschnitten einen Artikel hervor, den er vor einigen Tagen aus der rechtsextremen DNZ, der Deutschen National- und Soldatenzeitung ausgeschnitten hat. Meist gelten deren hoch empörte Schlagzeilen den »Verzichtspolitikern«, allen voran dem SPD-Vorsitzenden Willy Brandt, die nach Auffassung des DNZ-Verlegers Gerhard Frey den »Ausverkauf Deutschlands« betrieben. Diesmal zielen die Schlagzeilen aber auf einen anderen:
© Deutsche National- und Soldatenzeitung vom 22. März 1968, Titelseite (Ausriss)
Unter der Überschrift sind fünf Fotos eines jungen Mannes zu sehen, Rudi Dutschke: Profil von links, von vorn, noch einmal links, redend mit offenem Mund, halbrechts von vorn, Profil von rechts. Bilder wie aus einer Fahndungskartei der Polizei.
Bachmann liest noch einmal, was da steht: »Die Forderung des Tages heißt: Stoppt die linksradikale Revolution jetzt! Deutschland wird sonst das Mekka der Unzufriedenen aus aller Welt. Was einst Petersburg und Paris waren, die Wiege von Weltrevolutionen, kann heute schon Berlin werden. Mit Verharmlosen ist niemandem mehr geholfen, seitdem die Dutschkisten sich nicht scheuen, offen die Revolution zu predigen.«2
Dann die Fotos. Bachmann studiert sie genau. Er ist Dutschke noch nie begegnet und muss ihn sicher erkennen, wenn er ihm zum ersten Mal gegenübertritt.
Er löscht das Licht, versucht zu schlafen, döst, bis der Zug im Bahnhof Zoo ankommt, der Endstation, Bachmanns Ziel. Ein wenig kennt er sich hier aus. Bachmann ist am 11. April 1968 nicht zum ersten Mal in Berlin. Vom Bahnhof aus geht er in die Kantstraße. Dort, in einem An- und Verkaufsgeschäft, versetzt er ein Kofferradio. Er bekommt dafür 32 Mark. Jetzt kann er frühstücken, nur ein paar Schrippen und Wurst, auf einer Bank beim Bahnhof Zoo. Es ist etwa elf Uhr, als er zum Taxistand schlendert und sich bei einigen Fahrern nach der Adresse von Rudi Dutschke erkundigt. Zur Antwort erhält er mal Achselzucken, mal die spöttische Auskunft, er solle doch bei Ulbricht in der Zone nachfragen. Ein weiterer scheint Bescheid zu wissen: »Der Dutschke ist doch so einer von der Kommune. Da müssen Sie in die Kaiser-Friedrich-Straße. Da sind die irgendwo.«
Bachmann macht sich auf den Weg. In der Kaiser-Friedrich-Straße trifft er einen Postboten. Von ihm erfährt er die Hausnummer und klingelt im Haus 54a. Es dauert, bis ein Mann mit Wuschelkopf die Tür einen Spalt öffnet. Auch ihn erkennt Bachmann, es ist Rainer Langhans. Von dem sind zu dieser Zeit auch alle paar Tage Bilder in der Zeitung. Aber Langhans interessiert Bachmann nicht. Er sucht Dutschke und fragt nach ihm. Nein, Rudi wohne hier nicht, und er wisse auch nicht, wo, sagt Langhans und fügt noch hinzu, er solle doch mal beim SDS am Kurfürstendamm 140 fragen. Dann schließt er die Tür wieder.
Bachmann sucht sich eine Telefonzelle, ruft an beim SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, Landesverband Berlin, Kurfürstendamm 140. Aber am Telefon erhält er über Dutschke keine Auskunft. Mit dem Einwohnermeldeamt ergeht es Bachmann genauso. Auskunftersuchen grundsätzlich nur persönlich, gegen Bearbeitungsgebühr. Er könne vorbeikommen.
Ungefähr um 15:00 Uhr ist Bachmann dort. Student sei er, er komme aus Westdeutschland und wolle Rudi Dutschke besuchen, nur so, in einer Privatsache. Die Angestellte reicht ihm ein Antragsformular, kassiert eine Mark Bearbeitungsgebühr, verschwindet zwischen den Karteischränken und kommt mit einem Zettel zurück. Darauf steht: Rudolf Dutschke, Student, 1000 Berlin 31, Kurfürstendamm 140, bei Mahler.
Was Bachmann weiter unternimmt, hält später der Staatsanwalt in der Anklageschrift fest:
»Mit dem Autobus fuhr er zum Bahnhof Zoo, aß hier einen Teller Linsensuppe und zwei Buletten und ging dann zu Fuß zum Grundstück Kurfürstendamm 140. Er ging dann in das Haus hinein, suchte jedoch nicht das Büro des SDS auf, sondern verließ das Haus wieder. Vor dem Eingang fragte er ein zufällig vorbeikommendes ›Falken‹-Mitglied nach Dutschkes Anschrift. Er überlegte nun, ob er sein Vorhaben vorläufig aufgeben, nach München zurückfahren und dort Dutschke treffen sollte. Er wusste, dass Dutschke einige Tage später in München erwartet wurde.
Als er gegen 16.35 Uhr den Kurfürstendamm überquerte und auf dem Mittelstreifen stand, blickte er sich noch einmal um. Dabei sah er, dass Rudi Dutschke mit einem Fahrrad aus dem Hause Kurfürstendamm 140 trat.
Der Angeschuldigte ging zurück und auf Dutschke zu.
Auf der Fahrbahn des Kurfürstendamms stieß er aus Unachtsamkeit gegen einen fahrenden PKW, dessen Außenspiegel zerbrach. Der Fahrer hielt an und forderte vom Angeschuldigten Schadenersatz. Dutschke hatte inzwischen am Fahrbahnrand das Grundstück Kurfürstendamm 142 erreicht.
Der Angeschuldigte ging zu ihm hin.«3
Rudi Dutschke erinnerte sich Jahre später so:
»Ohne etwas zu ahnen, sah ich, wie er immer näher kam. Dann stand er nur noch sechs bis sieben Meter vor mir auf dem Mittelweg der Straße. Nachdem die letzte Autowelle an ihm und mir vorübergefahren war, ging Bachmann nun über die Straße, dicht an mir und meinem Fahrrad vorbei auf den Gehweg. Kaum hatte er diesen erreicht, wandte er sich direkt an mich und fragte, vielleicht zwei Meter entfernt: ›Sind Sie Rudi Dutschke?‹
Ich zögerte nicht und sagte ›Ja‹.«4
Was in den folgenden Momenten geschieht, erfragt ein knappes Jahr später Landgerichtsdirektor Heinz Brandt. Er hat den Angeklagten Bachmann im Schwurgerichtssaal zur Vernehmung in den Zeugenstand vor seinen Richtertisch gerufen:
»Und Sie haben ihn gefragt?
– Ob er Dutschke ist, und er sagte Ja.
Sie kannten ihn?
– Man kennt ihn von Bildern.
Und dann?
– Dann sagte ich, du dreckiges Kommunistenschwein. Dutschke kam auf mich zu, und ich zog den Revolver und schoss den ersten Schuss.
Warum?
– Warum? Ich dachte, ich weiß auch nicht, mein überhitztes …
Sie standen vor ihm, aus welcher Entfernung schossen Sie?
– Eineinhalb Meter.
Und warum schossen Sie?
– Ich war so im Hass, ich hatte so eine Wut.«5
Josef Bachmann schießt dreimal. Der erste Schuss geht in die rechte Wange. Halb springt, halb stürzt Dutschke von seinem Rad herunter auf die Fahrbahn, taumelt, reißt sich blitzartig die Schuhe von den Füßen und seine Armbanduhr vom Handgelenk. Dann sinkt er zu Boden.
Bachmann beugt sich nach vorne und legt noch einmal auf den Mann an, der etwa einen Meter vor ihm auf dem Boden liegt. Er zielt auf Dutschkes Kopf, drückt zweimal ab, trifft ihn in die Schulter und in den Kopf.
Bachmann springt auf und rennt los, den Kurfürstendamm entlang Richtung Bahnhof Zoo, biegt nach einigen Hundert Metern rechts in die Nestorstraße ab und versteckt sich dort im Keller eines Rohbaus. Dort unten würgt er hastig eine Handvoll Schlaftabletten hinunter.
Dutschke hat trotz der drei Kugeln nicht das Bewusstsein verloren. Er richtet sich auf, torkelt mit blutverschmiertem Gesicht in Richtung SDS-Zentrum. Nach einigen Schritten bricht er jedoch blutüberstömt zusammen. Passanten betten ihn auf einer Sitzbank vor dem SDS-Zentrum.
Es ist 16.39 Uhr.
Sofort schickt der Sender Freies Berlin einen Übertragungswagen zum Ku’damm. Über sämtliche Sender der Bundesrepublik ist wenig später der Bericht von Rudolf Wagner zu hören. Die Stimme des Reporterprofis bebt:
»Im Augenblick ist die Polizei bei der Spurensicherung.
Es ist furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße, es sind die Blutflecken zu sehen, sorgsam von Kreidestrichen umrahmt, wie es bei den polizeilichen Untersuchungen so zu sein pflegt. Es ist außerdem ein Stück von dem Lauf der Pistole zu sehen, ein Stück, abgesägt scheint es mit der Kimme, ganz deutlich. Und außerdem liegt das Fahrrad noch genau in der Stellung, in der Rudi Dutschke auf den Bürgersteig dann stürzte, nachdem er von drei, vier Schüssen getroffen wurde. Es ist wirklich … es ist einfach schrecklich anzusehen. Nun, die Polizei, die Kriminalpolizei ist erst eine Stunde danach hier an den Unfallort gekommen. Einer der Augenzeugen ist in der Umgebung. Darf ich Sie bitten, Sie standen doch gegenüber und haben das ganze Geschehen erlebt?
– Ja. Wir dachten, dass hier auf Tauben geschossen wird. Aber dann sahen wir einen Mann weglaufen, und dann kamen wir hier rüber und sahen Herrn Dutschke liegen. Er stand auf und schrie nach Vater und Mutter und: ›Ich muss zum Friseur, muss zum Friseur‹, und ist dann ungefähr 50 Meter weitergelaufen und ist dort umgekippt. Und seine letzten Worte waren: ›Soldaten, Soldaten.‹«6
11. April 1968, Berlin, Kurfürstendamm 142. Tatortfoto der Polizei
© picture alliance/zb
I. Teil
Vater, Mutter. Soldaten, Soldaten
Luckenwalde, 7. März 1940
Als Elsbeth Dutschke am 7. März 1940 ihr viertes Kind zur Welt brachte, war ihr Mann Alfred weit fort. Nur eine Hebamme half ihr in dem Mansardenzimmer des kleinen Hauses ihres Schwagers. Vom Fenster an der geraden Stirnwand rechts der Schräge, unter der das Bett stand, blickte man über die Dorfstraße von Schönefeld auf die brachen Äcker und die Wiesen der Mark Brandenburg.
Drei Kinder hatte Elsbeth Dutschke schon. Manfred, Günter und Helmut. Seit die Hebamme da war, warteten sie unten in der Küche mit Onkel und Tante.
Auch diesmal gebar sie einen Jungen. Elsbeth Dutschke ließ ihn auf den Namen Alfred Willi Rudolf Dutschke taufen. Aber so redeten ihn später nur Staatsanwälte und andere Amtspersonen an. In der Familie, bei den Freunden, später in den Zeitungen und Sendern, auf Demonstrationen und Buchtiteln hieß er Rudi. Rudi Dutschke.
Rudi Dutschkes Vater Alfred erfuhr die Nachricht von der Geburt seines vierten Sohnes durch einen Feldpostbrief. Seit einem halben Jahr war Deutschland im Krieg und der Postbeamte Alfred Dutschke als Soldat an der Front.
Zu Hause im märkischen Dorf Schönefeld, 50 Kilometer südlich von Berlin, war von diesem Krieg im März 1940 kaum etwas zu spüren. Elsbeth Dutschke hatte genug Essen und Kleidung und ein Dach überm Kopf für sich und ihre Kinder. Die weitverzweigte Verwandtschaft am Ort half, wenn Not am Mann war. Die vierfache Mutter stammte aus einer Bauernfamilie und hatte von Kind auf bis zu ihrer Heirat auf dem elterlichen Hof mitgearbeitet, der in Kolzenburg lag, wie Schönefeld ein kleines Dorf in der Umgebung der Kreisstadt Luckenwalde. Ihre engere Heimat, die Mark Brandenburg, hat Elsbeth Heinrich nur für kurze Zeit verlassen. Das war 1932, als sie mit 22 Jahren Alfred Dutschke aus dem Nachbardorf Schönefeld heiratete. Der musste ein Handwerk lernen, weil der Bauernhof seiner Eltern nicht genug für die siebenköpfige Familie abwarf. Er begann eine Elektrikerlehre. Die brach er ab, als sich die Chance bot, zur Reichswehr zu gehen, denn Alfred Dutschke schwärmte für Militär und Uniformen. 1933 wurde der Bauernsohn, der Elektriker werden wollte und Soldat geworden war, bei der Reichspost in Koblenz angestellt. Dorthin zog er mit seiner Familie.
Wie Tausende Reservisten wurde Alfred Dutschke nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 zur Wehrmacht einberufen. Für Elsbeth Dutschke lag es nahe, mit ihren drei Söhnen in die heimatliche Mark Brandenburg in die Nähe der Eltern und Schwiegereltern zurückzukehren. Sie war gerade wieder schwanger geworden. Unterkunft fand sie im Haus ihres Schwagers Willi. Dort kam Rudi Dutschke am 7. März 1940 auf die Welt.
Rudi, Mutter Elsbeth Dutschke, Helmut, Manfred und Günter, 1946
© Archiv Chaussy, Familie Dutschke, Luckenwalde
Elsbeth Dutschke ist von ihren Söhnen als eine einfache, strenge und sehr fromme Frau beschrieben worden. Sie war die Respektsperson in der Familie und blieb sie auch für ihren jüngsten Sohn Rudi, als dieser sich fern dem Luckenwalder Elternhaus und jenseits der Mauer in West-Berlin und der Bundesrepublik zur Verkörperung des antiautoritären Rebellen schlechthin entwickelte. Elsbeth Dutschke hatte sich Respekt verschaffen müssen, auf Jahre allein mit vier Söhnen, deren Vater im Krieg war. Ihr Mann Alfred war lange fort, vom ersten Kriegstag an, bis er Anfang 1945 bei Brünn in russische Kriegsgefangenschaft geriet. In Gefangenschaft blieb er dann zwei weitere Jahre, bei harter Arbeit, in einem Waldlager zwischen Leningrad und Moskau. Wegen Krankheit wurde er 1947 nach Hause entlassen. Dystrophie, Unterernährung, stand auf dem Entlassungsschein.
An Politik war Elsbeth Dutschke wenig interessiert. Alfred Dutschke wählte bis 1933, als Hitler an die Macht kam, deutschnational. Eine Katastrophe sah er mit dem Krieg nicht heraufziehen, allerdings zog er auch nicht mit Begeisterung ins Feld. Für ihn war Soldat zu sein eine nationale Pflicht. Der Krieg kostete Alfred Dutschke sieben Jahre seines Lebens. Als er von zu Hause wegging, war er 39 Jahre alt. Mit 46 kam er zurück.
Ein Kind muss nicht wissen, was Krieg ist und woher er kommt. Es spürt ihn. Erinnerungen, die sich dem drei-, vier-, fünfjährigen Rudi einbrennen: die Fenster verdunkeln am Abend. Kein Licht darf nach außen dringen. Das Sirenengeheul und dann ab in den Luftschutzkeller. Meistens brummen die Bomberverbände der Alliierten über Schönefeld und Luckenwalde hinweg. Einmal fallen ein paar Bomben in der Nachbarschaft, versehentlich, heißt es: »Mit dem Beten begann ich schon in den Vierzigerjahren, und als die Bomben in der Nähe unseres Hauses fielen, die unbekannten Flugzeuge über unsere Stadt flogen, hatte ich dazu, wie viele andere, durchaus Gründe.«7
In Ungewissheit und Angst zu beten, lernt Rudi von seiner Mutter. Auf den sonntäglichen Kirchgang nimmt sie ihren Jüngsten immer mit. Schon früh fühlt er sich in der Gemeinde heimisch. Als Rudi drei Jahre alt ist, wohnt die Familie in Luckenwalde.
Eines Tages steht in der Küche ein Soldat. Rudi hat Angst vor dem fremden Mann und wirft sich seiner Mutter in den Schoß. »Was will der da? Der soll weggehen«, protestiert er. Aber der Soldat bleibt, bis sein Fronturlaub zu Ende ist. Das ist Rudis erste Begegnung mit seinem Vater und für vier Jahre die letzte.
Strenge Regeln
Als Rudi fünf ist, sagen die Erwachsenen, der Krieg sei vorbei. Zu essen gibt es jetzt weniger als zuvor. Und noch immer muss Elsbeth Dutschke allein für ihre vier Söhne sorgen. Die Stimmung zu Hause ist gedrückt.
»Der Grund für das Beten, der Krieg, war weg, doch es ging noch weiter. Schließlich war der Vater noch nicht zu Hause, und die Mutter weinte des Öfteren, es war nicht zu übersehen«,8 erinnert sich Rudi Dutschke später.
Wer in der Not der Nachkriegsjahre durchkommen will, muss sich zu helfen wissen. Dutschkes in Schönefeld haben einen Gemüsegarten und helfen Elsbeth und ihren vier Kindern in Luckenwalde. Auf der Fahrt nach Schönefeld begleitet Rudi oft seine Mutter. Er ist fünf, als er Ende 1945 zum ersten Mal einen russischen Soldaten sieht.
»Wenige Kilometer vor meinem Heimatdorf Schönefeld wurden Mutter und ich von dem Soldaten angehalten, und er nahm uns unser Fahrrad weg. Es war das meines Vaters, der sich zu dieser Zeit noch im Lager in der Sowjetunion befand. Der Verlust unseres Fahrrades regte mich weniger auf als meine Mutter, schließlich schauten die Augen des Soldaten freundlich auf uns, zum anderen erhielten wir ein anderes Fahrrad, eines für Frauen mit Kinder-Vordersitz.«9
Schülermannschaft Fortschritt Luckenwalde 1949/50, vorne mit Ball: Rudi Dutschke
© Archiv Chaussy, Familie Dutschke, Luckenwalde
1946 wird Rudi in der Ernst-Moritz-Arndt-Schule eingeschult. Sein Schulfreund Klaus berichtet, Rudi sei Musterschüler und Rabauke zugleich gewesen. Einer, der paukt. In seinem Lieblingsfach Geschichte lernt er, bis er alle Jahreszahlen von Schlachten, Kriegen und Königen auswendig hersagen kann. Aber für einen Streber sei Rudi zu gesellig und zu frech gewesen. Er widerspricht der Meinung seiner Lehrer, wenn er zu Hause beim Lesen auf andere Argumente stößt, und beteiligt sich an den Streichen seiner Mitschüler. Einmal beziehen die Banknachbarn Klaus und Rudi Prügel vom Lehrer. Sie hatten einem Mädchen in der Bank vor ihnen den Zopf abgeschnitten.
In Luckenwalde, der verschlafenen märkischen Kleinstadt, ist wenig los. Rudi vertreibt sich die Zeit mit Sport, erst spielerisch, bald voller Ehrgeiz. Fast jeden Tag steigt gleich nach Schulschluss ein Fußballmatch mit Schulfreunden. Nachmittags, nach dem Mittagessen und den Schulaufgaben, trainiert er alleine im Garten hinter dem Haus: Hochsprung und Stabhochsprung über eine von der Garage zur Wäschestange aufgespannte Wäscheleine, Kugelstoßen und Gewichtheben mit schweren Steinen.
Sport ist für Rudi Kräftemessen mit anderen. Als Zehnjähriger heult er vor Wut, wenn ihn einer seiner älteren Brüder besiegt. Rudi schätzt seine Stärken und Schwächen ab. Er ist athletisch gebaut, aber klein. Die meiste Kraft sitzt in den Beinen. Also gezieltes Training, vor allem im Dreisprung und Stabhochsprung. Rudi übt ohne Trainer, als hätte er zwei hinter sich, einen Antreiber und einen Aufpasser.10
Seine Sportbegeisterung roch nach Askese. Sich fernhalten von schädlichen Genüssen, um anderswo umso mehr leisten zu können, war das Motto auch des erwachsenen Rudi Dutschke, der nicht rauchte und keinen Alkohol trank. Im Sport wuchsen viele Freundschaften, aber nur unter Jungen. Rudi störte das nicht, von den »Weibern«, wie er als Jugendlicher abschätzig sagte, wollte er nichts wissen. Mannschaftsfotos, vordere Reihe in der Hocke, die hintere stehend, zeigen ihn in Turnhose, Unterhemd, mit Bürstenhaarschnitt, die Arme um die Schultern der Freunde gelegt, lachend, einen Sportsfreund. Viel später erst sprach er von »sportlicher Enthaltsamkeit von der Sexualität«, konnte er zugeben, dass hinter der despektierlichen Distanz zum anderen Geschlecht auch Angst und Verklemmung gesteckt hat.
Fragen und Schweigen. Der 17. Juni 1953
vorne: Elsbeth und Alfred Dutschke, dahinter v. l. die Söhne Rudi, Manfred, Günter und Helmut
© Archiv Chaussy, Familie Dutschke, Luckenwalde
Dass es ab 1949 zwei deutsche Staaten gab, war auch in Luckenwalde in der Mark Brandenburg zu spüren. Die Lehrer in der Schule schärfen die beiden Namen ein: »Deutsche Demokratische Republik« für den eigenen Staat, »Bundesrepublik Deutschland« für den westlichen Teil Deutschlands. Und eine weitere Besonderheit: Die Osthälfte der ehemaligen deutschen Reichshauptstadt hieß ab sofort: »Das demokratische Berlin, Hauptstadt der DDR«, die andere Hälfte im Westen »besondere politische Einheit West-Berlin«. Die Radiosender aus der Bundesrepublik und aus West-Berlin verwendeten andere Namen. Da gab es allenfalls eine »sogenannte DDR« oder die »Sowjetische Besatzungszone« oder ganz lakonisch »die Zone« und »Ost-Berlin«. Der 17. Juni 1953 ist der erste Tag in Rudis Leben, an dem diese Unterschiede ins Gewicht fielen.
»Die Eigenartigkeit des 17. Juni 1953 wurde uns am frühen Morgen um 6.30 Uhr deutlich gemacht, als unsere Eltern meine Brüder und mich weckten. Vater und Mutter waren äußerst unruhig, sprachen immer wieder auf uns ein, auf keinen Fall dort hinzugehen oder stehen zu bleiben, wo viele Menschen zusammengekommen seien, miteinander sprechen usw. Wir sollten der bevorstehenden Arbeit und Schule unverändert nachgehen und pünktlich nach Hause kommen, d.h. nach der Beendigung der Tätigkeit in der Fabrik, in der Landwirtschaft und in der Schule. Was war los? Warum diese Aufregung? Wir hörten unseren Sender, den der DDR; dieser sprach von ›Provokationen des westdeutschen Revanchismus im Bündnis mit dem US-Imperialismus‹. Das war mir ein ziemliches Rätsel, meinen älteren Brüdern, inzwischen 15 und 19 Jahre alt, gleichermaßen. Vater und Mutter wollten es uns nicht erklären – oder konnten es nicht. Wir hörten den ›RIAS‹ (›Rundfunk im Amerikanischen Sektor‹), dieser sprach von ›Kampf um Freiheit‹ am meisten, wies aber auch auf nicht erfüllte Lohnforderungen der Arbeiter hin. Das klang für unsere jungen Köpfe einsichtiger, besonders für die meiner Brüder.
Unsere Schule lief am 17. Juni so ab wie an jedem Tag, über die sich weiter entwickelnden Unruhen in den Fabriken Ost-Berlins und in vielen Städten der DDR hörte ich nichts (!) in der Schule, das erfolgte erst gegen Abend, im Besonderen, aber nicht nur, über die Westsender..11Die Familie schimpfte gegen die eigene Regierung, über die westliche – und wusste nicht wirklich die Lage einzuschätzen. Die Erschießungen von Arbeitern empörten und verunsicherten uns, es war aber nicht ein Klassenbewusstsein, sondern ein christlich-allgemeines mit all seinen Schwierigkeiten.«12
Auch am Morgen des 18. Juni ermahnen die Eltern Rudi und seine Brüder, unverzüglich nach der Schule nach Hause zu kommen. Von seinem Freund erfährt Rudi auf dem Schulweg, dass dessen Vater, der in Ost-Berlin arbeitet, in der Nacht nicht nach Hause gekommen und die Familie in heller Aufregung ist.
Rudi betet still. So hat er es von seiner Mutter gelernt, wenn sie sich in Bedrängnis fühlte. Nach außen schaut er kritisch und erstmals mit Misstrauen. Er bemerkt, dass weniger Menschen als sonst auf der Straße sind. Dafür beherrscht die Rote Armee das Straßenbild. Überall Militärfahrzeuge, überall Soldaten.
Diese Sowjetsoldaten schauen nicht so freundlich wie jener, der vor Jahren seiner Mutter das Rad des Vaters genommen und ihr eines mit Kindersitz für Rudi gegeben hat:
»Die Augen der Sowjetsoldaten wie die Stimmung der ganzen Stadt waren am 18. Juni 1953 völlig anders. Es waren nicht mehr die befreienden Augen der antifaschistischen Front, des so großen Sieges über den deutschen Faschismus. Es waren vielmehr die hemmenden und überspannten Augen einer Roten Armee, die gegen die DDR-Arbeiter und Werktätigen, auch gegen uns auf den Straßen sich bewegte.
Als K. und ich ihnen auf dem Weg zur Schule begegneten, ihnen ein nicht ganz ehrliches ›mo gelam‹ (wie geht es?) zuriefen, blieben die Gesichter der Soldaten hart und verwiesen uns sprachlos auf die Litfaßsäule: Die Zusammenballung von mehr als zwei Personen in den Straßen wird aufgelöst; wer nach 20 Uhr auf der Straße angetroffen wird, hat mit Verhaftung und direkter Verurteilung zu rechnen – dies und anderes mehr stand dort. Die Unruhe der Eltern wurde verständlicher, aber es war damit für uns keine Aufklärung erfolgt.
Die Lehrer und Lehrerinnen in der Schule ließen den Unterricht bei uns so ablaufen, als ob die gesellschaftlichen Verkehrsformen jenes Tages, die Prozesse der Übergänge die gleichen wie vorher in der ›normalen Lage‹ der Stadt gewesen wären. Als ob in den Straßen, in den Fabriken, Wohnbezirken und Häusern nichts Spezifisches sich abspiele. Der Schein der Sicherheit, Ruhe und Ordnung wurde durch einen höheren Grad der Reizbarkeit der Lehrer und Lehrerinnen bestimmt. Es ging uns besser als ihnen, aber wir verstanden noch weniger jetzt als vorher. Aufklärung und eine Form der Information, die die Lage unserem Alter entsprechend für uns erkennbar gemacht hätte, erreichte uns nicht. Wir kehrten nach Hause zurück, ohne verstanden zu haben – unserem Alter gemäß.«
Nach 1945 und in der Gründungsphase beider deutscher Staaten sind die Schrecken des Krieges den Deutschen noch sehr gegenwärtig. Kundgebungsparolen wie »Nie wieder Krieg!« und »Niemals wieder eine Waffe in eines Deutschen Hand!« und die Militärpolitik beider deutscher Staaten stimmen für einige wenige Jahre nahtlos überein.
Beide Staaten haben zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Armeen, und es gibt beiderseits der deutsch-deutschen Grenze nur wenige, die das Volk wieder unter Waffen sehen wollen. Die Trümmer sind allgegenwärtig. Der Krieg lebt noch.
Auf der Suche nach Lesestoff stößt Rudi zu Hause auf die alten Hefte aus der Reihe »Der Frontsoldat erzählt«. Alfred Dutschke hat diese Hefte nach dem Ersten Weltkrieg begeistert gelesen und aufgehoben. Bei Rudi hinterlassen die kriegsverherrlichenden Bücher der damaligen Frontsoldaten einen völlig anderen Eindruck als bei seinem Vater dreißig Jahre zuvor. Der sieht seinen Sohn mal beim Schmökern und ruft aus: »Rudi, du wirst noch mal General!« Ein gründliches Missverständnis, wie Alfred Dutschke bald bemerken wird. Zu Beginn der Fünfzigerjahre fragt niemand in Luckenwalde nach Generälen oder Soldaten. Im Gegenteil, Pazifismus steht allenthalben, auch bei den Lehrern hoch im Kurs. »Damals lernten wir Antikriegsgedichte und lasen Texte, kritische Texte gegen den Krieg. Alle Lehrer, die wir hatten, waren so eingestellt«, erinnert sich Rudis Schulfreund Bernd Thesing. »Ich erinnere mich noch an so Sprüche: ›Nie wieder soll eine deutsche Mutter ihren Sohn beweinen müssen‹, ›Nie wieder Krieg‹. Und ich weiß noch, dass wir damals dazu aufgefordert wurden und dann alle gemeinsam unser Kriegsspielzeug, das wir so hatten, auf den Müll geschickt haben.«
Verweigerung
»Nach 1952 lernte ich Rudi Dutschke kennen. Mir persönlich fiel er durch seine regelmäßige Teilnahme an den Gottesdiensten in der Kirche auf. Er kam aus einem sehr kirchlichen Elternhaus. Seine Mutter war ein treues Mitglied der Evangelischen Frauenhilfe. Der Vater war fast sonntäglich in der Kirche. In dieser Kirche veranstaltete die ›Junge Gemeinde‹ zuweilen Gemeindeabende, die einen volksmissionarischen Charakter haben sollten. Rudi nahm daran teil, nicht nur als Zuhörer, sondern mitwirkend. Er ergriff gelegentlich das Wort. Das geschah sachlich und frei von künstlichem Enthusiasmus. Dabei stellte er seine Meinung nicht in den Schatten. Er war offen im Gespräch, zuweilen auch kritisch. Er besaß eine gewisse schon damals auffallende Begabung, in gut formulierten Sätzen das zu sagen, was er dachte oder sagen wollte.«13
So erinnert sich der ehemalige Pfarrer Martin Skrodt der St. Petri-Gemeinde an Rudi Dutschke. Die Versammlungen und Gruppenabende der Jungen Gemeinde standen im angenehmen Kontrast zur Atmosphäre der Schule und in der FDJ, über die Dutschke vier Jahre später als Abiturient resümiert: »Wie es so allgemein üblich war, trat auch ich in die FDJ ein, ohne die richtige Überzeugung zu haben. Obwohl ich nun schon seit vier Jahren an Wahleinsätzen, Versammlungen und Sportveranstaltungen der FDJ teilnehme, habe ich noch keinen richtigen Kontakt zur FDJ bekommen. Das liegt wahrhaftig nicht an meiner Gesinnung. Ich sehe den Hauptgrund darin, dass sich niemand von der FDJ mit mir in sachlicher Diskussion politisch auseinandergesetzt hat.«14
Konfirmand Rudi Dutschke, 1954
© Archiv Chaussy, Familie Dutschke, Luckenwalde
Die Junge Gemeinde bot einen Schutzraum, in dem frei gesprochen werden konnte. Dabei ging es meist um Glaubensfragen, einmal aber schlug ein brisantes politisches Thema bis in die Gesprächsrunde der Jungen Gemeinde durch. Aus der FDJ, in der Dutschke ebenfalls Mitglied war, kam der Aufruf, auf die kirchliche Konfirmation zu verzichten und stattdessen nur an der staatlichen Jugendweihe teilzunehmen. Dagegen protestierte er und setzte seine Lösung durch: Rudi Dutschke ließ sich konfirmieren und blieb Mitglied der FDJ.
Die geselligen Veranstaltungen der Jungen Gemeinde fanden in einem von der Kirche angemieteten Gewerberaum oder in der geräumigen Pfarrwohnung statt: Tanzabende, Kostümfeste und immer wieder, vor allem im Sommer, Ausflüge in die märkische Landschaft zum Baden oder Spielen. »Selbst nach West-Berlin (die Grenze existierte damals noch nicht) wurden Fahrten unternommen«, erinnert sich Pfarrer Skrodt, »bei Rudi zeigten sich schon damals Leitungsfähigkeiten, er konnte eine Gruppe mit Elan führen.«15
1954 wechselte Rudi Dutschke auf die Gerhart-Hauptmann-Oberschule über. In dem massigen Gründerzeitbau sind seit 1910 Generationen von Gymnasiasten ausgebildet worden.16 Nun soll hier die Elite eines Arbeiter-und-Bauern-Staates geschliffen werden. Eliten aber sind verdächtig, ihre Mitglieder tanzen gern aus der Reihe. Die einzig legale Elite der DDR ist die Partei; sie will es bleiben und scheint die Gefahren für ihre Stellung durch den Schulbetrieb förmlich zu wittern. So ist der pädagogische Schulbetrieb von politischen Kontrollmechanismen der SED flankiert. Die Schule hat einen Direktor und ein Lehrerkollegium. Aber neben dem Direktor steht der Parteisekretär der Schule, der sich regelmäßig mit den Lehrerinnen und Lehrern berät, die in der SED sind und sich in der Betriebsparteiorganisation (BPO) über ihr Vorgehen in allen Schulfragen beraten. Außerdem ist dem Lehrerkollegium ein hauptamtlicher FDJ-Schulsekretär beigeordnet. Er sorgt dafür, dass die Initiativen, Direktiven und Parolen der Staatsjugend die Jugendlichen nicht nur in der wohlorganisierten Freizeit erreichen, sondern in schönem Gleichklang auch im Schulbetrieb.
Junge Gemeinde beim Badeausflug, links: Rudi Dutschke
© Archiv Chaussy
Direktor Johannes Schöckel schwört auf zackige Fahnenappelle im Schulhof und bei Feierstunden in der Aula. Die auszurichten hatte der Genosse Direktor selbst in einer Eliteschule der unmittelbar vorangehenden Epoche gelernt. Er war nach der Erinnerung von Rudi Dutschkes Mitschülern Absolvent einer Napola, eine jener Nationalpolitischen Lehranstalten, in denen sich Nazi-Pädagogen um die Heranbildung von »Nationalsozialisten, tüchtig an Leib und Seele für den Dienst an Volk und Staat« mühten.
Jetzt war Schöckel zum SED-Mitglied mutiert. Er präsentierte sich den Schülern als besonders strammer Genosse, der in ideologisch-politischen Fragen keinerlei Abweichungen von der jeweils gültigen Parteilinie duldete.17 Die aber machte zwischen 1954 und 1958 heftige Kapriolen. An zwei nicht so biegsamen, ansonsten sehr verschiedenen Zeitgenossen wird das auf tragisch-komische Weise sichtbar, an Rudi Dutschke und seinem Klassenkameraden Hans-Günter Bedurke.
In Rudi Dutschkes erstem Oberschuljahr 1954 verursacht eine Schreckschuss-Spielzeugpistole mit Knallplättchen allerhöchste Aufregung. Sie gehört dem 14-jährigen Hans-Günter Bedurke. Er zeigt die Pistole herum und protzt damit vor seinen Mitschülerinnen und Mitschülern, bis er von einem Lehrer erwischt wird. An das folgende verschärfte Donnerwetter der Schulleitung erinnert sich Klassenlehrer Bodo Kulessa noch genau. Bedurkes pubertäres Imponiergehabe wird schulöffentlich als politische Provokation gegen den pazifistischen Geist des friedliebenden Arbeiter-und-Bauern-Staates gerügt.
1958, vier Jahre später, in Bedurkes und Dutschkes Abiturjahr, hat sich die DDR wie die Bundesrepublik bereits zur Remilitarisierung entschlossen und ruft nun mit der gleichen Entschlossenheit ihre männliche Jugend zu den Waffen, mit der bislang der pazifistische Ekel vor der Rüstung verkündet worden war.
Jetzt avanciert Hans-Günter Bedurke zum einzigen ungetrübten Stolz der Schulleitung in der Abiturklasse 12A. Denn von den sechs Jungen in der Klasse meldet sich nur Bedurke freudig zum Militär, um diesmal eine scharfe Waffe zu tragen. Nach den Werbeaufrufen der FDJ und den persönlichen Appellen der Lehrer ist dieses Ergebnis eine agitatorische Pleite, die im »Schulecho«, der Zeitung der Gerhart-Hauptmann-Schule, nur mühsam mit Hilfe der Gesamtstatistik beider Abiturklassen in einen Erfolg umgebogen werden kann: »Die Abiturienten der Gerhart-Hauptmann-Oberschule haben erkannt, dass es nicht nur notwendig ist, ihre Kraft für den Aufbau des Sozialismus einzusetzen, sondern dass es eine Ehrenpflicht eines jeden Patrioten ist, die Errungenschaften unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates vor den aggressiven imperialistischen Kräften zu schützen. Daher haben von 26 Abiturienten 21 ihre Bereitschaft erklärt, nach Ablegung des Abiturs den Ehrendienst in unserer Nationalen Volksarmee aufzunehmen.«18
Der pazifistische Wurm steckt in der Abiturklasse 12A, in der drei Schüler aus der Reihe tanzen, Manfred Neye, Reinhard Bry und Rudi Dutschke. Dass besonders Dutschke mit der unter propagandistischem Getöse eingeleiteten Entwicklung zur Wiederbewaffnung nicht einverstanden war, war seit November 1957 an der Schule allgemein bekannt. Denn da hatte er vor großem Publikum in der Jahreshauptversammlung der FDJ-Schulgruppe seinen Unmut über die Abkehr von der pazifistischen Position der DDR-Gründerzeit offen geäußert. »Dort war es negativen Kräften gelungen, das Bild zu bestimmen«, berichtet der Parteisekretär der Schule, Wolfgang Gattner, im Jahresrechenschaftsbericht 1957: »So äußerte der Jugendfreund Dutschke, wenn er das Wort ›schießen‹ höre, liefe es ihm kalt über den Rücken. Keiner wolle Krieg. Das Verbot der Westreisen sei ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Man solle doch immer alle Deutschen an einen Tisch bringen. Und der Jugendfreund Neye setzte hinzu, dass die Schüler nicht von der Notwendigkeit des Eintritts in die NVA überzeugt seien. Er äußerte fernerhin sein Befremden über das Verbot einer ›Misswahl‹ durch die Schule. Beide Schüler erhielten für ihre Ausführungen starken Beifall.«19
Die Reaktionen der Lehrer an der Gerhart-Hauptmann-Oberschule spiegeln Verunsicherung und Nervosität. Als Ursache für den Widerspruch mancher ihrer Schüler gegen die von ihnen minutiös weitergeleiteten Vorgaben von Staats- und Parteiführung orten sie »westliche Einflüsse«. So gilt ihnen die für den Abschlussball geplante Kür der drei hübschesten Abiturientinnen des Jahres 1958 durch ihre männlichen Mitschüler als ein bedenkliches Zeichen »westlich dekadenter Lebensweise«.
Diese Art ansteckender Krankheit kann man sich nach Meinung der Lehrer vor allem mit Tagesreisen ins lockende West-Berlin einfangen. Deshalb predigen sie gegen solche Erkundungsfahrten, die am Ende doch alle unternehmen. Alle Anzeichen abweichenden Verhaltens und Dresscodes werden in den Fünfzigerjahren in der DDR misstrauisch beäugt, nicht nur von den Lehrern.
Die Schullaufbahn von Dutschkes Klassenkameraden Reinhard Bry droht zu scheitern, weil er im dunklen Pullover anstatt im weißen Hemd mit Krawatte bei der Eröffnung des Luckenwalder FDJ-Klubhauses exzessiv Rock ’n’ Roll tanzt und darauf in einem Artikel der Lokalzeitung Märkische Volksstimme bloßgestellt wird. Bry versucht sich mit einem süffisanten Leserbrief an die Zeitung zu wehren. Doch die Redaktion reicht diesen unveröffentlicht an die Gerhart-Hauptmann-Oberschule weiter.
Direktor Schöckel dreht die Denunziationsspirale sogleich weiter. Er schreibt an die Obere Schulbehörde im Rat des Kreises und beschreibt Bry als suspekten bürgerlich-dekadenten DDR-Verweigerer: »Seit dem 11. Schuljahr fällt seine betont westliche Kleidung, sein Haarschnitt und seine bewusste Zurückhaltung in politischen Gesprächen auf. Er versuchte, sich auf alle erdenkliche Art und Weise von gesellschaftlichen Einsätzen fernzuhalten, und musste überall dort, wo ihm dies nicht gelang, beständig zur Ordnung und Disziplin gerufen werden. Bry ist einer der wenigen Abiturienten, die es ablehnten, nach dem Abitur den Ehrendienst in unserer NVA abzuleisten.«20 Schöckel will mit seiner Intervention Bry nicht nur von der von ihm geleiteten Gerhart-Hauptmann-Schule weisen, sondern ein generelles Oberschulverbot für ihn erwirken.
Brys Rettung: Irgendeine schützende Hand verweist auf einen pädagogischen Formfehler. Kein Lehrer hatte nach dem Zeitungsartikel mit dem Schüler Bry gesprochen, ihn ermahnt und belehrt, wie er sich korrekt zu verhalten habe. Und so wird die Angelegenheit mit einer scharfen Rüge Brys vor einer Schülervollversammlung in der Aula erledigt. Bei der steht noch ein aus Sicht der Pädagogen weit ernsterer Fall im Mittelpunkt: Die Weigerung des Abiturienten Rudi Dutschke, sich freiwillig zum Ehrendienst bei der Nationalen Volksarmee zu verpflichten.
Schon nach Dutschkes Diskussionsbeiträgen bei der FDJ muss sich Schulleiter Schöckel den aufmüpfigen Schüler vorgeknöpft haben. Rudi Dutschke hatte daraufhin mit dem Datum 4. Februar 1958 eine handschriftliche »Darstellung meiner Entwicklung« an den Direktor geschickt und hoffte mit seinen Erfahrungen als Kriegskind auf Verständnis:
»So sah ich schon sehr früh die Schrecken des Krieges. Ich hörte, dass mein Onkel bei Maikop durch einen Volltreffer in seinem Panzer ums Leben gekommen war. Die Benachrichtigung darüber sagte aus: ›Gefallen für Führer und Reich‹. Was uns dieser Führer und dieses Reich gebracht haben, sehen wir erst heute, da an eine Einheit Deutschlands noch nicht wieder zu denken ist. Es soll nicht noch einmal heißen ›gefallen‹. Meine Mutter hat uns vier Söhne nicht für den Krieg geboren. Wir hassen den Krieg und wollen den Frieden. Wenn ich auch an Gott glaube und nicht zur Volksarmee gehe, so glaube ich dennoch, ein guter Sozialist zu sein. Ich glaube auch zu wissen, was ich dem Staat, der mir den Besuch der Oberschule ohne finanzielle Opfer ermöglichte, schuldig bin. Ich werde in der Produktion so arbeiten, dass ich mithelfe, unseren Staat zu stärken und zu festigen.«21
Aus der Sicht des Direktors Schöckel ist dieser Brief eine Provokation: Dutschke hatte seine Chance einzulenken. Er hat sie halsstarrig ausgeschlagen. Er will Konfrontation. Die soll er haben, vor aller Ohren auf der Schülervollversammlung. Etwa 150 Schüler der oberen Klassen und die Lehrer der Schule strömen Anfang 1958 in der Aula der Schule zusammen. Direktor Schöckel tritt vor an das Rednerpult auf der blumengeschmückten Bühne.
Es gehe heute, beginnt er, um den freiwilligen Eintritt aller Schüler der Gerhart-Hauptmann-Oberschule in die Nationale Volksarmee nach dem erfolgreich abgelegten Abitur und insbesondere um den Schüler Rudolf Dutschke. Im Gegensatz zu den meisten anderen Schülern seines Abiturjahrgangs habe es Jugendfreund Dutschke offen abgelehnt, nach seinem Abitur den freiwilligen Dienst bei der NVA anzutreten. Selbstverständlich sei dieser Dienst freiwillig, aber der Schüler Rudolf Dutschke müsse sich klarmachen, was seine Haltung bedeute. Dies sei nichts anderes als falsch verstandener Pazifismus und als solcher eine nicht vertretbare gesellschaftlich inaktive Haltung. Dutschke erhalte aber an dieser Stelle Gelegenheit, seine Haltung darzustellen und gegebenenfalls zu überdenken.
Jeder im Saal weiß, dass es jetzt um Dutschkes Zukunft geht. Um seinen Berufswunsch, für den er sich im Sprechen vor Publikum übt. Sein großes Vorbild ist der Reporter Harry Valérien. Schon seit 1956 haben Dutschkes ein Fernsehgerät, in dem Rudi jede erreichbare Sportsendung verfolgt. Er will Sportjournalist werden und trainiert zu Hause vor seinen Brüdern als Rundfunkreporter. Aber das ist einfacher, als vor Lehrern und Mitschülern zu begründen, warum er politisch anders denkt als sie.
Rudi Dutschke dreht diese Frage in seiner Rede um. Warum, fragt er, denken die anderen, denken die Lehrer nicht wie er? Haben sie vergessen, was noch vor wenigen Jahren an dieser Schule gelehrt und gelernt worden ist? Er nennt Beispiele aus dem Unterricht der vergangenen Jahre, erinnert Lehrer und Mitschüler an die Ächtung des Militarismus, daran, dass »niemals wieder eine Waffe in eines Deutschen Hand« geraten sollte. Dutschke zählt pazifistische Gedichte und Texte auf, die noch vor Kurzem bei den Lehrern und Schülern hoch im Kurs standen. Damals habe niemand Pazifismus als »gesellschaftlich inaktive Handlung« bezeichnet. Warum ist das heute anders? Rudi zitiert aus den Schulbüchern. Warum haben wir vor wenigen Jahren noch als Kinder die Spielzeugwaffen auf den Müll geworfen und sollen jetzt an richtigen Waffen ausgebildet werden?
Sein Schul- und Sportkamerad Bernd Thesing erinnert sich, dass Rudi Dutschke ruhig, abgewogen und ohne Polemik gesprochen habe. Er habe damit geendet, dass er an seiner Entscheidung nichts Unrechtes finde. Und schließlich sei der Dienst bei der Nationalen Volksarmee der freien Entscheidung jedes Einzelnen überlassen. Er jedenfalls bleibe bei seiner Entscheidung, diesen Dienst mit der Waffe nicht anzutreten. Erst wenn es eine allgemeine Wehrpflicht gebe, werde er diese Frage für sich erneut überdenken.
Es sei sehr still gewesen in der Schulaula, erinnert sich Thesing. Nach Dutschkes Rede klatschen seine Mitschüler spontan. Mehr Provokation erlauben sie sich nicht gegenüber dem Schulleiter und dem FDJ-Sekretär, der nach Dutschke noch einmal die Verpflichtung der Jugend zum Dienst in der NVA beschwört. Nach ihren Ansprachen gibt es zwar keinen Beifall, aber niemand traut sich, Rudi Dutschke in der Versammlung offen zur Seite zu stehen, auch nicht einer seiner immerhin drei Klassenkameraden, die sich ebenfalls weigern, zur NVA zu gehen.
Rudi Dutschke hat zehn Jahre später seine Argumentation in dieser Rede etwas anders dargestellt: »Ich bekannte mich zur Wiedervereinigung, bekannte mich zum Sozialismus, aber nicht zu dem Sozialismus, wie er betrieben wurde, und sprach mich gegen den Eintritt in die Nationale Volksarmee aus. Ich war nicht bereit, in einer Armee zu dienen, die die Pflicht haben könnte, auf eine andere deutsche Armee zu schießen, in einer Bürgerkriegsarmee, und zwar in zwei deutschen Staaten, ohne wirkliche Selbstständigkeit auf beiden Seiten, das lehnte ich ab.«22 Wie weit Dutschke auch immer in seiner Rede gegangen war, sie hatte Folgen, nicht nur für ihn selbst. Wenige Tage darauf streiten sich die in der SED organisierten Lehrer darüber, wer für diese Panne verantwortlich ist, für »diesen Einzelfall von Pazifismus«, wie Schulleiter Schöckel formuliert. Ein absurder Dialog entspinnt sich, in dem die Hilflosigkeit der Lehrer als Gedankenkontrolleure vor einem offenkundig querdenkerischen Schüler zum Ausdruck kommt. Eine Kollegin stellt Dutschkes Geschichtslehrer, dem Genossen Marinowitz, die bohrende Frage, wie es denn möglich sei, dass so ein Schüler eine Eins in Geschichte bekommen habe. »Dutschke ist fleißig«, antwortet Marinowitz entschuldigend , und man meint, ein Achselzucken zu bemerken, wenn er fortfährt: »Dutschke trägt aber recht seltsame Meinungen in Diskussionen, z.B.: Wäre es nicht ratsamer, das Geld, das für den Sputnik ausgegeben wurde, zum Wohnungsbau zu verwenden.«
Die Quittung für sein unbotmäßiges Verhalten bekommt Rudi Dutschke im Juli 1958 mit seinem Abiturzeugnis. Statt einer verdienten »Zwei« ist die Gesamtnote auf »Drei« heruntergesetzt, und die Worte des Schulleiters von der »inaktiven gesellschaftlichen Haltung« finden sich im Zeugnis wieder. Damit ist vorerst die Chance zum ersehnten Studium an der Hochschule für Sportjournalistik in Leipzig vertan. Dutschke bleibt nur, sich in einer Berufsausbildung und »in der Produktion zu bewähren«. Eine Lehrstelle ist bald gefunden. Er lernt Industriekaufmann im VEB TEWA Luckenwalde, einem Betrieb, in dem Beschläge für Möbel hergestellt wurden.
Dieser Beruf interessiert ihn nicht, er will lediglich die ihm versprochene Chance wahren, danach von seinem Betrieb zum ersehnten Sportjournalistik-Studium vorgeschlagen zu werden. Dutschke gibt sich Mühe bei seiner Lehre und findet in der Freizeit Gelegenheit, Sport zu treiben. Im Mai 1959 wird er Bezirksmeister im Stabhochsprung mit 3,30 Metern, am 1. Mai 1960 gewinnt er in Genthin einen Wettkampf, an dem auch Sportler aus der Bundesrepublik teilnehmen, mit einem Sprung von 3,60 Metern.
Rudi Dutschke beim Stabhochsprung
© Archiv Chaussy, Familie Dutschke, Luckenwalde
Auch die nächste Hürde, die zum Studium, meint Dutschke glatt genommen zu haben. Im März 1960 hat er seine Prüfung zum Industriekaufmann mit der Note »sehr gut« abgelegt und schickt seine Bewerbungsunterlagen an die Universität Leipzig.
Aber nun holt ihn erneut die in der Oberschule angelegte Kaderakte ein. Rudi Dutschke wird zu einem Gespräch in seinen Betrieb VEB TEWA gebeten. Dort trifft er im Büro der Betriebsgewerkschaftsleitung neben dem BGL-Vorsitzenden auf den NVA-Hauptmann Schenk vom Luckenwalder Wehrkreiskommando. Die beiden machen ihm klar, auch nach seiner »Bewährung in der Produktion« müsse er sich nun als Voraussetzung für das Studium zu einem zweijährigen freiwilligen Dienst in der NVA bereitfinden. Dutschke, lutherisch sturköpfig, findet sich nicht bereit.
Deprimiert trifft er nach diesem Gespräch seinen Freund Bernd Thesing. Ein Satz des NVA-Offiziers hat sich ihm besonders eingeprägt: Wenn er nicht zur NVA gehe, sei er für den Bonner Revanchisten Adenauer. Und wenn er für Adenauer sei, flöge er innerhalb von drei Wochen von jedem Studienplatz, den er eventuell erreichen sollte. Dutschke muss einsehen: Alle Bemühungen, mit seinen in puncto Pazifismus von der Staats- und Parteiräson abweichenden Haltung in der DDR akzeptiert und nicht diskriminiert zu werden, sind gescheitert.
Grenzgänger mit Schultasche
Rudi Dutschke, seine Eltern und Brüder waren zunächst ratlos. Aber nach langer Diskussion im Familienkreis wurde entschieden: Rudi wollte studieren – also sollte er. Weil er aber in der DDR nicht durfte, blieb nur West-Berlin. West-Berlin liegt gerade 50 Kilometer von Luckenwalde entfernt.
Dutschke erkundigte sich nach den Bedingungen für ein Studium an der Freien Universität. Er erfuhr, dass er als DDR-Bürger als Student angenommen würde, und auch, dass die DDR ihren Bürgern das Studium an der West-Berliner Universität nicht verwehrte. Nur einen Haken hatte die Sache: Dutschkes DDR-Abitur wurde in West-Berlin nicht anerkannt. Es gab jedoch die Möglichkeit, das »Westabitur« nachzuholen.
Auf dem Askanischen Gymnasium in Tempelhof schrieb sich Dutschke für solch einen Abiturkurs ein, den er von Oktober 1960 bis Juni 1961 absolvierte. Um täglich von Luckenwalde zur Schule nach West-Berlin zu pendeln, war der Weg zu weit. Er mietete eine Studentenbude in der Steglitzer Lutherstraße nahe der Schule, kehrte aber über die Wochenenden so oft wie möglich heim zu seinen Eltern, zu den Brüdern und zu den Sportfreunden. In Luckenwalde war er zu Hause. Ans Abhauen dachte er auch dann noch nicht, als sich seit Anfang 1961 immer mehr DDR-Bürger über Berlin in den Westen absetzten.
Ab und zu munkelte man im Sommer 1961 auch im Familienkreis, ob die DDR-Regierung wohl das Schlupfloch Berlin dichtmachen würde. Erste Gerüchte darüber waren im Umlauf, die in der Familie anfangs niemand ernst nahm. Aber auch wenn Rudi Dutschke keinerlei Anstalten traf, seiner Heimatstadt Luckenwalde den Rücken zu kehren, verabschiedete er sich in seiner Zeit als »Grenzgänger mit Schultasche« innerlich von der positiven Identifikation mit dem politischen System des Arbeiter-und-Bauern- Staates DDR, zu der er erzogen und mit der er aufgewachsen war.
Das offenbart ein lange verschollenes Dokument, der Deutsch-Abitur-Aufsatz Dutschkes am Askanischen Gymnasium, bewertet mit der Bestnote seines Jahrgangs, einer Eins. Der Entstehungszeitpunkt ist genau zu bestimmen: Es war der Tag der schriftlichen Abiturprüfung am 16. Mai 1961. Der aus den Akten im Schularchiv des Askanischen Gymnasiums verschwundene Aufsatz ist nach Jahrzehnten wieder aufgetaucht,23 am Anfang der zehn Aktenordner umfassenden Personenakte Rudi Dutschke, die das Landesamtes für Verfassungsschutz in West-Berlin angelegt hat.24
So wie die Agenten des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR ein paar Jahre zuvor das Schularchiv der Gerhart-Hauptmann-Oberschule in Luckenwalde plünderten, um sich über den Werdegang des renitenten Wehrdienstverweigerers Dutschke schlauzumachen, griffen ihre westlichen Geheimdienstkollegen auf die Unterlagen des Askanischen Gymnasiums zu, als Rudi Dutschke 1966 erstmals ins Visier der West-Berliner Staatsschützer geraten war. Dabei ist ihnen mit diesem Abituraufsatz ein echter Fang gelungen. Zu erörtern hatte Dutschke einen einzelnen Artikel des Grundgesetzes: »Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.«
Dutschke beschränkt sich in seinem Aufsatz jedoch nicht auf eine beschreibende, pragmatische Auslegung des Artikels 21 durch die verschiedenen Parteien des politischen Spektrums, etwa darauf, wie Parteien in der Öffentlichkeit für politische Projekte, für ihre Programme und für ihre Repräsentanten werben. Er argumentiert zunächst historisch und beschreibt, wie es – im Gegensatz zum Einparteienstaat DDR – zum pluralistischen Parteienspektrum der Bundesrepublik kam.
»Von 1933 bis 1945 währte die Herrschaft des ›Tausendjährigen Reiches‹. Die gemeinsamen Anstrengungen der westlichen Alliierten im Bündnis mit der Sowjetunion hatten den Faschismus in die Knie gezwungen. Gewissermaßen ein Paradoxon in der Geschichte der Menschheit. Die Freiheit hatte sich mit der Unfreiheit verbunden, um die bisher mächtigste Ausprägung der Unfreiheit, den Faschismus, niederzuringen. So geschah es denn auch.«25
Nur zwei Jahre zuvor hatte Dutschke seinen Erklärungen, als jugendlicher Pazifist den Dienst mit der Waffe abzulehnen, immer das Bekenntnis hinzugefügt: Er wisse, was er als guter Sozialist seinem Staat schuldig sei. Was damals nach positiver Identifikation klang und auch so gemeint war, ist bei dem jetzt 20-Jährigen in radikale Desillusionierung über die Gesellschaftsordnung der Staaten im Einflussbereich der Sowjetunion umgeschlagen:
»Die Siegermächte nutzten ihre Siegerrechte verschieden aus. Aus den Waffenbrüdern wurden erbitterte Gegner. Die Sowjetunion wurde zum Symbol der Bedrohung der Freiheit in Form des Siegeszuges des Kommunismus. Amerika im Bündnis mit den anderen Nationen wurde zum Beschützer der bedrohten Freiheit. Aus diesen verschiedenen Situationen entstand die Spaltung Deutschlands. Die Zone wurde abhängig in jeder Beziehung. Den Menschen wurde und wird das Recht auf Selbstbestimmung verweigert, um dieses Gebiet dem Kommunismus zu erhalten. In der heutigen Bundesrepublik gingen die Alliierten einen anderen Weg. Die Angelsachsen, die schon immer Demokraten waren, glaubten durch die Gewährung der politischen Grundfreiheiten in der Bundesrepublik eine Demokratie errichten zu können.«26
Die Abstimmung Tausender DDR-Bürger Richtung Westen mit den Füßen ist gerade voll im Gang, als Dutschke seinen Abituraufsatz in fast kindlicher, gleichmäßiger Schönschrift auf zwölf halbspaltig beschriebenen Seiten zu Papier bringt. Beinahe 20000 DDR-Bürgerinnen und -Bürger sind es allein in diesem Mai 1961, die sich alle im Notaufnahmelager Marienfelde melden und registrieren lassen müssen, gar nicht weit von der Askanischen Schule entfernt.
Dutschkes Abiturtext ist jedoch mehr als ein nachdenkliches Echo auf die große Fluchtbewegung. Er beschränkt sich nicht auf eine Abrechnung mit der DDR, die er ganz der Diktion der westdeutschen Politiker folgend die Zone nennt. Aber er stimmt eben nicht – sozusagen als Kontrastprogramm – eine Hymne auf die pluralistische westdeutsche Parteiendemokratie an. Auch wenn sich schon abzeichnet, dass Dutschke, der Grenzgänger mit Schulmappe, dort, von wo er kommt, vielleicht nicht mehr bleiben kann, so sieht er auch, wohin er geht, ernste Mängel und Probleme: Die pluralistische Parteiendemokratie als System könnte in Dutschkes Augen durchaus funktionieren, aber, so fürchtet er, die Menschen, die Bürger in Deutschland, sind nicht in die Lage versetzt worden, das System mit Leben zu erfüllen.
»Man gab diesem neuen Staat ein Grundgesetz, in dem unter anderem die Parteien als Träger der politischen Willensbildung ausgewiesen wurden. Ja, man gab!! Ohne Diskussion, ohne Umerziehung begann das politische Leben in der Bundesrepublik anzulaufen. Die westlichen Verbündeten gaben den Menschen, die mehr oder weniger Helfer des Regimes waren, die vollständige Freiheit. Einige Kriegsverbrecher wurden verurteilt, andere nach kurzer Zeit wieder entlassen. Die Deutschen, die gerade noch kläglich Befehlsempfänger waren, sollten plötzlich Demokraten sein.«
Auch in dieser Passage schimmert durch, dass der Prüfling Dutschke wahrnimmt, was um ihn herum geschieht. In Jerusalem läuft seit April 1961 der Prozess gegen Adolf Eichmann, der die Deportation von Hunderttausenden europäischen Juden in die Vernichtungslager organisierte. Eichmann redet vor Gericht über Befehl und Gehorsam, und die Welt begreift an dem Angeklagten, den die Zeitungen und das Fernsehen im schusssicheren Glaskasten zeigen, was Hannah Arendt die Banalität des Bösen nennt: dass solche Pflichterfüllung ein Verbrechen ist. In der Bundesrepublik sind davon unbeeindruckt ehemalige Nationalsozialisten längst in verantwortliche Positionen eingerückt.
Dutschke erwähnt einen Fall wenige Zeilen später, der just am Tag seiner Abiturprüfung Schlagzeilen macht: In Niedersachsen ist Wilhelm Schepmann, ein Nazi der ersten Stunde und ehemaliger SA-Chef der Kreisstadt Gifhorn, ebendort demokratisch erneut zum zweiten Bürgermeister gekürt worden.27 Vorgänge wie dieser lassen Dutschke fragen, warum die im Gegensatz zur DDR in der Bundesrepublik gewährte Freiheit alleine nicht ausreicht, eine »neue politische Denkungsart des deutschen Volkes« entstehen zu lassen, und liefert die Antwort gleich mit:
»Die größte Chance in der Geschichte Deutschlands, die Deutschen zum demokratischen Bewusstsein zu erziehen, wurde wegen einer Freiheit, die ohne sittliche Überzeugungen bleibt, vergeben. (…) An diesem traurigen Zustand sind die Alliierten und die Arbeit der Parteien in den Jahren 1948 bis zur Gegenwart schuld. Die Parteien ließen es zu, dass ein Großteil des Volkes einfach einen Strich unter die unbewältigte Vergangenheit zog. Die Würdelosigkeit der Menschen begann dort, wo aus dem Fakt des Überlebens die Grundlage des Weiterlebens gesehen wurde. Wer so die Vergangenheit bewältigte, der wird nie ein Demokrat werden.«
Hier lässt sich der Korrektor des Aufsatzes Dr. Lahmeier, der kaum Rechtschreib- und Ausdrucksfehler vermerkt, aber mehrfach mit einer Schlangenlinie markierte Passagen mit einem »gut!« und »sehr gut!« kommentiert, zu einem Begeisterungsausruf hinreißen: »Das ist großartig gesehen!«, schreibt er an den Rand des Textes und hebt in seiner Begründung für die Note Eins zu einer Eloge an:
»Das ist eine gedanklich tiefe, politisch reife Arbeit, die der Verfasser mit der ihm eigenen ausgezeichneten Faktenkenntnis angefertigt hat. Seine mitunter sehr harten Bemerkungen zur gegenwärtigen Lage des politischen Lebens und der Parteien in Westdeutschland kommen bei aller Schärfe niemals aus einer destruktiven Haltung, sondern gerade aus einem ausgeprägten Sinn für die politische Verantwortung des einzelnen Menschen.«28
Damit hat Rudi Dutschke im Juni 1961 das Westabitur, die »Anerkennung des Reifezeugnisses der sowjetischen Besatzungszone« in der Schultasche. Anfang Juli bewirbt er sich für ein Geschichtsstudium an der Philosophischen Fakultät der West-Berliner Freien Universität. Als Nebenfächer gibt er Erdkunde, Soziologie und Publizistik an.29 Er stellt sich darauf ein, künftig ein studentischer Grenzgänger mit Kollegmappe zu werden. Aber es kommt anders.
West-Abituraufsatz Dutschkes 1961, Ausriss
© Landesarchiv Berlin (LAB)
West-Berlin wird Rest-Berlin: 13. August 1961
Anfang August verdichten sich mit der Zunahme der Flüchtlingszahlen auch die Gerüchte über eine unmittelbar bevorstehende Grenzschließung. Um Rudi Dutschkes im zweiten Anlauf errungene Chance auf ein Studium nicht zu gefährden, fällt wieder eine Entscheidung im Familienrat. Alle sind sich im Klaren, dass er mit dem Studium zwar erst im Wintersemester, Anfang November, beginnen kann, aber niemand kann sicher sagen, ob ihm dann noch die Einreise nach West-Berlin und das Pendeln nach Luckenwalde möglich sein wird.
»Als die Lage immer kritischer wurde in den ersten Augusttagen, rieten mir meine Eltern, um meine Zukunft nicht zu gefährden, nach Berlin (West) zu gehen«, gibt Dutschke wenig später in seinem »Antrag auf Aufenthaltserlaubnis für das Bundesgebiet« an. Er soll sofort in sein Studentenzimmer nach West-Berlin überwechseln. Am 10. August, einem Donnerstag, ist es so weit.30 Sein Bruder Helmut bringt Rudi auf dem Motorrad nach Teltow: »Zu Hause in Luckenwalde konnte ich noch zu meiner weinenden Mutter sagen: Du, ich bin mit Sicherheit schnell wieder zurück. Ihr habt mit eurer Annahme bestimmt unrecht. Will doch unbedingt bald wieder mit den Brüdern unsere glänzend wachsenden Pflaumen von den Bäumen runterholen. Damit du wieder deinen so gut schmeckenden Pflaumenkuchen machen kannst. Ich lachte, Mutter weinte, Vater war äußerst ernst und die Brüder sprachlos – das Motorrad setzte sich in Bewegung.«31 Helmut setzte Rudi in Teltow ab und fuhr zurück nach Luckenwalde. Es dauerte sechs Jahre, bis er die Brüder und den Vater wieder treffen konnte – bie der Beerdigung der Mutter.
Im Lauf des Jahres 1961 erlebte die DDR den größten Flüchtlingsstrom seit ihrer Gründung 1949. Die »Republikflüchtigen« – so der DDR-Jargon – gingen meist aus Unzufriedenheit mit der schleppenden wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, viele aber auch aus politischer Enttäuschung über den »ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden«. Berlin spielte eine wichtige Rolle bei der einsetzenden Massenflucht. Die vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges hatten die Stadt wie einen großen Kuchen unter sich geteilt. Mit sowjetischer Duldung hatte die DDR-Regierung Ost-Berlin, den sowjetischen Sektor, zu »Berlin – Hauptstadt der DDR« erklärt, mit Duldung und Unterstützung der Westalliierten Amerika, Frankreich und Großbritannien hatte die Bundesregierung West-Berlin zum üppig dekorierten »Schaufenster der Freiheit« ausgestattet – so nannte West-Berlins erster Regierender Bürgermeister Ernst Reuter seine Stadt.
Wer die paar Schritte von der Allee Unter den Linden hinüber zum Potsdamer Platz ging, der überschritt die anderswo scharf bewachte und undurchlässige Grenze zwischen Ost und West. Kapitalistischer Nachkriegsboom und sozialistischer Neuaufbau lebten auf Tuchfühlung und Rufweite – das gab es nur in Berlin. Jährlich verkauften die Kinos und Theater in West-Berlin etwa acht Millionen Karten an Besucher aus der DDR. Aber es gab nicht nur die Neugierigen, die nach einem Schaufensterbummel und ein paar Stunden Kinogenuss wieder über den Potsdamer Platz in den Ostteil der Stadt oder einen anderen Ort der DDR zurückkehrten. Etwa 60000 Ost-Berliner arbeiteten 1961 im Westteil der Stadt, weil es dort bessere Löhne gab. Diese Arbeiter fehlten in den Betrieben Ost-Berlins. Und es gab einen wachsenden Flüchtlingsstrom. Aus allen Teilen der DDR kamen Menschen nach Ost-Berlin und setzten sich dann in den Westteil der Stadt ab. Dieser Flüchtlingsstrom drohte die Wirtschaft der gesamten DDR auszubluten.
Schon seit 1958 spielte die Regierung der DDR mit dem Gedanken, das Schlupfloch West-Berlin zu schließen. Damals war erstmals die Idee aufgekommen, den Ostsektor der Stadt hermetisch von den Westsektoren abzuriegeln. Der geheime Plan hieß »Operation Chinesische Mauer«. Er wurde erst in Kraft gesetzt, als die Zahl der Flüchtenden seit Anfang 1961 kontinuierlich immer weiter anstieg. Im Juni waren es noch 20000 Menschen, im Juli schon 30415 mit ständig steigender Tendenz. Die letzten von ihnen kamen am Abend des 12. August. In der Nacht machten die DDR-Grenztruppen und die Volkspolizei mit großem Aufgebot die Grenze dicht.
Als die Berliner am Morgen des 13. August erwachten, verbreitete sich die Nachricht vom Beginn des Mauerbaus wie ein Lauffeuer. Inzwischen arbeiteten die Bautrupps der Volkspolizei nicht nur in der Ebertstraße und am Potsdamer Platz, sondern am gesamten Grenzverlauf zwischen Ost- und West-Berlin. Jede noch so kleine Straße wurde abgesperrt. Nicht überall mit Mauerwerk oder vorgefertigten Betonplatten, oft mit hastig gezogenen Holz- und Drahtzäunen, manchmal nur mit von einer zur anderen Straßenseite ausgelegten Stacheldrahtrolle. Überall standen bewaffnete Posten der DDR Wache.
Viele West-Berliner zieht es an diesem Sonntagmorgen an die Grenze. Da stehen sie mit einer Mischung aus Neugierde, Unglauben, Wut und Empörung in kleinen Gruppen beisammen und debattieren aufgeregt miteinander. Warum denn hier niemand was dagegen unternimmt, ereifern sie sich, wo doch sonst die Politiker immer den Mund so voll nehmen von wegen Wiedervereinigung. Wo sind die denn jetzt? Und wo sind denn jetzt die Amerikaner, die sind doch die große Schutzmacht Berlins?
Manchmal, wenn die kleinen Gruppen zu einer Traube von Menschen anwachsen, schallen Sprechchöre in Richtung Ost-Berlin. »Weg mit der Mauer«, rufen die Leute, und: »Reißt die Mauer ein.«
Aber die Absperrungen bleiben, und die Zäune werden nach und nach durch die massive Mauer ersetzt, die sich an der von den Alliierten gezogenen Demarkationslinie zwischen dem Ost- und den drei Westsektoren quer durch Berlin zieht. Keiner der politisch Verantwortlichen im Westen greift ein. Vor allem aber rollen die Panzer der Schutzmächte Großbritannien, Frankreich und Amerika nicht, wie es sich so mancher Berliner in diesen Tagen wünscht. Die einzige Reaktion der Westmächte auf den Mauerbau ist, mit drei Tagen Verspätung, eine schriftliche Protestnote.





























