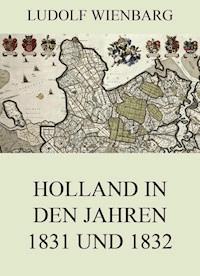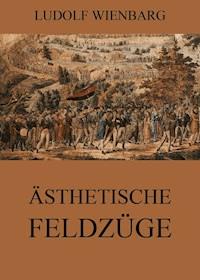
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1834 veröffentlichte der bekannte Schriftsteller des Vormärz diese Sammlung mit 22 seiner Vorlesungen unter dem Titel "Ästhetische Feldzüge".
Das E-Book Ästhetische Feldzüge wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ästhetische Feldzüge
Ludolf Wienbarg
Inhalt:
Ludolf Wienbarg – Biografie und Bibliografie
Ästhetische Feldzüge
Vorwort.
Worte der Zueignung.
Erste Vorlesung.
Zweite Vorlesung.
Dritte Vorlesung.
Vierte Vorlesung.
Fünfte Vorlesung.
Sechste Vorlesung.
Siebente Vorlesung.
Achte Vorlesung.
Neunte Vorlesung.
Zehnte Vorlesung.
Elfte Vorlesung.
Zwölfte Vorlesung.
Dreizehnte Vorlesung.
Vierzehnte Vorlesung.
Fünfzehnte Vorlesung.
Sechzehnte Vorlesung.
Siebzehnte Vorlesung.
Achtzehnte Vorlesung.
Neunzehnte Vorlesung.
Zwanzigste Vorlesung.
Einundzwanzigste Vorlesung.
Zweiundzwanzigste Vorlesung.
Dreiundzwanzigste Vorlesung.
Vierundzwanzigste Vorlesung.
Ästhetische Feldzüge , L. Wienbarg
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849639983
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Ludolf Wienbarg – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 25. Dez. 1802 in Altona, gest. 2. Jan. 1872 in Schleswig, studierte in Kiel und Bonn Theologie, dann Philosophie, habilitierte sich 1834 an der Universität in Kiel, wo er aber nur ein Semester lang Vorlesungen über Ästhetik und deutsche Literatur hielt, lebte darauf in Frankfurt a. M., am Rhein, auf Helgoland und seit dem Ende der 1830er Jahre meist in Hamburg. Das Bundestagsverbot vom 10. Dez. 1835 gegen die Schriften des Jungen Deutschland (s. d.), das auch ihn namentlich ausführte, schädigte seine Entwickelung und verbitterte ihn für lange Zeit. Im Hamburg war W. als Mitarbeiter und Herausgeber beteiligt an den »Literarischen und kritischen Blättern der Börsenhalle«, der »Hamburger neuen Zeitung« und des »Altonaer Merkurs«. Am schleswig-holsteinischen Kriege 1848 nahm er als Stabsadjutant im Freikorps, 1849 als freiwilliger Jäger teil. Wienbargs Hauptwerk sind die »Ästhetischen Feldzüge« (Hamb. 1834), ein Buch voll fruchtbarer Gedanken, das die jungdeutschen Literaturanschauungen geistvoll präzisierte, und das in den Schriften »Die neueste Literatur« (Mannh. 1835, 2. Ausg., Hamb. 1838) und »Wanderungen durch den Tierkreis« (das. 1835) bedeutsame Ergänzungen fand. In den »Geschichtlichen Vorträgen über altdeutsche Sprache und Literatur« (Hamb. 1838) suchte er die Ergebnisse der jungen germanistischen Wissenschaft weitern Kreisen zugänglich zu machen. Das Buch »Holland in den Jahren 1831 und 1832« (Hamb. 1833, 2 Bde.) lehnt sich an Heines »Reisebilder« an, das »Tagebuch von Helgoland« (das. 1838), voll lyrischer Schönheiten, ist ein reinerer Ausdruck seines Innern. Später schrieb er noch: »Darstellungen aus den schleswig-holsteinischen Feldzügen« (Kiel 1850–1851, 2 Bde.), »Das Geheimnis des Worts« (Hamb. 1852) und eine »Geschichte Schleswigs« (das. 1862, 2 Bde.). Vgl. Schweizer, Ludolf W. als jungdeutscher Ästhetiker und Kunstkritiker (Leipz. 1896).
Ästhetische Feldzüge
Dem jungen Deutschland gewidmet
Vorwort.
I.
Ich schreibe gern für das neugedruckte Buch dieses tapferen Holsteiners den Auftakt. Ehrlich zu sprechen: ich hab' ihn bis jetzt nicht genauer gekannt. Heute weiß ich, daß er eins von den brennenden Geblüten war, für die (wie für unsereinen) alles Aesthetische nur ein Aushängeschild bleibt, ein Vorwand, ein Anlaß: die Welt vorwärtszubringen – in bessere Freiheit und klügere Menschlichkeit.
Ludolf Wienbarg (welcher das Wort vom Jungen Deutschland in dieser Schrift geprägt hat) war einunddreißig, als er seine Reden vor der Jugend hielt, nach vier Jahrzehnten starb er, in Vergessenheit; ein Zeitungsmann; einer vom Troß. Dennoch umleuchtet.
Wienbarg hatte »das Vertrauen auf die Zeit, die Rosen und Ketten bricht.« Kam sie heut? Rosen brach sie kaum. Ketten doch. Aller guten Vorläufer soll gedacht sein.
II.
Wienbarg ist, unterirdisch, ein Schwarmgeist. Aber zugleich ein heutiger Mensch. So gewiß er das Mittelalter schätzt: so gewiß verlacht er die nach ihm rückgewandte Sehnsucht. Er haßt Schnürung der Seelen, romantischen Schlendrian ... und den »Unfug Historie«. Unfug Historie? Derlei kann bei Nietzsche stehn. Es steht bei Nietzsche – in dem Abschnitt vom »Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben.«
Wer spricht: Wienbarg oder Nietzsche? wenn es etwa heißt: »Das Leben ist des Lebens höchster Zweck« –? Der Satz steht in diesem Buch. Wer spricht, Wienbarg oder Nietzsche? wenn es heißt: »Befreit die Welt von den Sünden der Schwäche« –? Der Satz steht wieder in diesem Buch. (Auch der andre: die herrschende Moral stelle »alles Treibende und Liebende in uns ... als das Sündhafte dar«.) Ja, dergleichen ist zwar ein Vorklang für Nietzsche. Doch nicht minder, scheint mir, ein Nachklang: von der deutschen Romantik; von Friedrich Schlegel und dem ganz jungen Clemens Brentano.
Nietzsche war ein wildgewordener Romantiker – das Junge Deutschland aber hat erkennenden Verstand auf die blaue Blume gepfropft. Auch Wienbarg. Es war kein Unglück.
III.
Dieser reisige Holste bleibt ein feurig edles Herz. Kein großer Stilist im Sinn eines Bahnbrechers: doch ein guter Kopf mit reiner, morgenfrischer Seele. Mit einem Ohr für die Musik der Zukunft.
Wienbarg, der vorgebliche Aesthetiker, fesselt am stärksten, wenn er die Zeit erziehen will. Wenn er Geschichtsphilosopheme zusammenträumt. Er kommt in den »Aesthetischen Feldzügen« vom Hundersten ins Tausendste, spricht manchmal sogar von Aesthetik – doch hier nicht am glücklichsten. Der Schmus, welcher mit diesem ... Wissenszweig verbunden ist, hat bei Wienbarg mildere Form.
Er ist kein Wissenschaftler: sondern ein Beflügler. Am fortreißendsten, wo er Ankläger der stumpfen Epoche wird und Künder des Ersehnten. Ein Mensch mit phantastischem Windhauch – dennoch vernunftklar. Man spürt Fördernd-Unverdrossenes, Umwehtes, Offenmütiges. Auch er hätte das Wort sagen können, das in der Einleitung zu meinen Gesammelten Schriften steht: »Beschäftigungen mit der Kunst – ja. Bis aufs Herzblut. Aber sie waren fast immer ein Vorwand für den Kampf um eine kühne vernünftigere Menschenordnung.«
IV.
Wienbarg zeigt im Ausdruck zwischendurch Manches vom Jean Paul. Doch Ziel des Zeitalters wird ihm nicht der verschwärmte Freund aus Wunsiedel: sondern der revolutionäre Dichter. Das ist für ihn Heinrich Heine.
Wienbarg hat in dieser Schrift Heines Weltbedeutung früh erkannt – als Heine noch ein junger Dreißiger war. Er merkt, daß Heine, dem Byron »an Penetration des Verstandes überlegen« ist. Heine wird zur Akme des Buchs.
Ein Jrrtum begegnet ihm. Heine stammt von Juden, sagt er, »aber von einer christlichen Mutter«. Er führt nun gewisse seeleninnigere, tiefere Züge Heinrich Heines auf diese vermeinte »deutsche Mutter« zurück – darin ein drolliger (wenn auch edlerer) Vorläufer der späteren Rassenf ... f ... so.. forschung, worin H. St. Chamberlain als erster Käse geduftet hat, seit er das Material zu den »Grundlügen des neunzehnten Jahrhunderts« zusammentrog.
Ludolf Wienbarg war von adligerem Holz. Der Ammenglaube blieb ein Nebenzug an ihm. Sein Hauptzug wies in Wahnlosigkeit und bessere Ferne.
Er war einer von Vielen. Doch ein Entflammer. Ein Kämpe. Ein Mithelfer. Sein Andenken sei gesegnet.
Juni 1919.
Alfred Kerr.
Worte der Zueignung.
Dir junges Deutschland widme ich diese Reden, nicht dem alten. Ein jeder Schriftsteller sollte nur gleich von vornherein erklären, welchem Deutschland er sein Buch bestimmt und in wessen Hände er dasselbe zu sehen wünscht. Liberal und illiberal sind Bezeichnungen, die den wahren Unterschied keineswegs angeben. Mit dem Schilde der Liberalität ausgerüstet sind jetzt die meisten Schriftsteller, die für das alte Deutschland schreiben, sei es für das adlige, oder für das gelehrte, oder für das philiströse alte Deutschland, aus welchen drei Bestandteilen dasselbe bekanntlich zusammengesetzt ist. Wer aber dem jungen Deutschland schreibt, der erklärt, daß er jenen altdeutschen Adel nicht anerkennt, daß er jene altdeutsche tote Gelehrsamkeit in die Grabgewölbe ägyptischer Pyramiden verwünscht, und daß er allem altdeutschen Philisterium den Krieg erklärt und dasselbe bis unter den Zipfel der wohlbekannten Nachtmütze unerbittlich zu verfolgen willens ist.
Dir junges Deutschland widme ich diese Reden, flüchtige Ergüsse wechselnder Aufregung, aber alle aus der Sehnsucht des Gemüts nach einem besseren und schöneren Volksleben entsprungen. Ich hielt sie als Vorlesungen auf einer norddeutschen Akademie, hoffe aber, sie werden den Geruch der vier Fakultäten nicht mit sich bringen, der bekanntlich nicht der frischeste ist. Ich war noch von der Luft da draußen angeweht, und der Sommer 1833 war der erste und letzte meines Dozierens. Universitätsluft, Hofluft und sonstige schlechte und verdorbene Luftarten, die sich vom freien und sonnigen Völkertage absondern, muß man entweder gänzlich vermeiden oder nur auf kurze Zeit einatmen. Riechflaschen mit scharfsatirischem Essig, wie ihn z. B. Börne in Paris destilliert, sind in diesem Fall nicht zu verachten. Lobenswert ist auch die Vorsicht, die man beim Besuch der Hundsgrotte beobachtet – sonderlich wenn's in die Hofluft geht –, man bücke sich nicht zu oft und zu tief. Abschreckend ist das Beispiel von Ministern und Hofleuten, die des Lichtes ihrer Augen und ihres Verstandes dadurch beraubt worden sind und schwer und ängstlich nach Luft schnappen.
Dir junges Deutschland widme ich diese Reden, dem bräunlichen wie dem blonden, welches letztere mich umgab und die Muse war, die mich zweimal in der Woche begeisterte. Ja begeisternd ist der Anblick aufstrebender Jünglinge, aber Zorn und Unmut mischt sich in die Begeisterung, wenn man sie als Züchtlinge gelehrter Weckanstalten vor sich sieht. Sklaverei ist ihr Studium, nicht Freiheit. Stricke und Bande müssen sie flechten für ihre eigenen Arme und Füße, dazu verurteilt sie der Staat. Die Unglücklichen, wie haben sie mich gesucht und geliebt, als ich ihnen die Freiheit wenigstens im Bilde zeigte.
Preußen trägt sich mit dem Plan, die alten Universitäten umzuschmelzen. Immerhin und mag das gelehrte Deutschland auch Blut über den Frevel schwitzen. Ich traue freilich dem neuen Gusse nicht, weil ich nicht einsehe, woher Preußen das rechte Metall dazu nehmen will, es wäre denn preußischevangelisches Kanonen- und Glockengut. Aber auch dieses halte ich für besser als die alte tonlose Mischung, die selbst unter Thors Hammerschlägen keinen Klang mehr von sich geben würde.
Zur Zeit der Reformation waren die Universitäten Stützpunkte für den Hebel des neuen Umschwungs. Gegenwärtig bewegen sie nichts, ja sie sind Widerstände der Bewegung und müssen als solche aus dem Wege geräumt werden.
Zu warnen aber sind junge Männer von Kraft und Talent, sich nicht unbedacht jener edlen Täuschung hinzugeben, als ob sich dennoch ein zeitgemäßer und volkstümlicher Wirkungskreis für sie auf unseren Universitäten erschwingen lasse. Glaubt mir, ihr hebt den Fluch nicht auf, den die Zeit über jene alten Gemäuer ausgesprochen hat, ihr setzt euch hingegen der Gefahr aus, mit demselben Fluche auf euren eigenen geistigen Schwingen belastet zu werden. Zittert vor der greisen alma mater, die als Ahnfrau unserer Universitäten ihr faltenreiches, mottenzerfressenes Gewand auf dem Boden der Aula einherschleift und ihre alten Liebhaber-Pedanten durch junge und frische zu rekrutieren sucht. Zittert vor ihrer dürren Umarmung, vor dem Kuß ihrer gespenstischen grauen Lippen, denn sie saugt euch das Blut langsam aus den Adern und schrumpft die Hochgefühle eurer Brust zu jenem Minimum zusammen, das etwa einem alten ausgedörrten Wilhelm Traugott Krug oder Christian Daniel Beck kaum verschlägt, um damit den letzten Atemzug für den Himmel zu bestreiten. Denkt daran, daß alle großen Deutschen der neueren Zeit nur zu ihrem Unglück deutsche Universitätslehrer geworden sind, daß ein Fichte, Schelling, Niebuhr, Schleiermacher, geborene Tribunen des Volks, für das Volk und ihren eigenen höheren Ruhm verlorengegangen sind. Fichtes Reden an die deutsche Nation verhallten nicht bloß deswegen in den Wind, weil die Nation taub war, sondern weil zwischen ihr und ihm eine Scheidewand aufgerichtet war, die selbst Fichtes eherne Stimme nicht zu durchdringen vermochte.
Nun denn, junges Deutschland, mit Gott! Wir leben ja noch einen Tag zusammen, und wer weiß, ob unser Hort und Führer uns so lange durch die Wüste ziehen läßt wie Moses die Israeliten.
Ist aber eine Silberlocke unter deiner Schar, ein Greis mit jugendlichem Herzen, ich küsse ihm Auge und Stirn und wünsche auch mir einen warmen Frühling unter der Eisdecke künftiger Jahre.
Erste Vorlesung.
Meine Herren. Sie wollen mir die Ehre geben, meinen Vorträgen über Ästhetik beizuwohnen. Ich freue mich über Ihre Zahl, und ich bemerke mit Vergnügen, aber nicht ohne Gefühl meiner unzulänglichen Kräfte und Hilfsmittel, die Teilnahme und Aufmerksamkeit, womit Sie der Eröffnung dieser in mehr als einer Hinsicht bedenklichen Vorträge entgegensehen. Es ist zwar das, was die Seele, das Prinzip der Ästhetik ausmacht, nämlich das Schöne, die Form, die Gestalt schon im Altertum von den tiefsinnigsten Weisen behandelt worden; allein wie abstechend von dieser Behandlung ist die heutige Form einer akademischen Disziplin, in welcher die Ästhetik seit Baumgartens Zeit in Deutschland aufgetreten ist. Selbst der Name rührt aus dieser Zeit her, er ist von Baumgartens Erfindung und war den alten Griechen und Römern in diesem Sinne völlig unbekannt.
Aestheticabetitelt Baumgarten die beiden Volumina, welche im Jahr 1750 und 1758 aus Licht traten. Den Barbarismus des Wortes will ich nicht tadeln, nur den Barbarismus, der darin lag, ein solches Werk in lateinischer Sprache zu schreiben. Barbarisch – pedantisch war der Ursprung der Ästhetik oder der vagen Wissenschaft, welche man mit diesem Namen bald allgemeiner zu bezeichnen anfing. Riedel und Sulzer machten daraus eine Theorie der schönen Künste und letzterer schrieb sogar eine solche »allgemeine Theorie der schönen Künste« nach alphabetischer Ordnung, zwei Quartbände unfruchtbarer Theorien, die weder dem Philosophen noch dem Künstler förderlich sein konnten. In ein höheres Gebiet wurde die Ästhetik aufgenommen, als Kant seinen eminenten Scharfsinn auch nach dieser Seite wandte und in »der Kritik der Urteilskraft« eine von seinem Standpunkt und seinen Prinzipien ausgehende Kritik des Geschmacks aufstellte. Nach ihm wurde die Ästhetik von mehreren Professoren der Philosophie bearbeitet, am vollständigsten von Fr. Bouterwek, dessen Werk (in zwei Bänden) das bekannteste ist und drei Auflagen erlebt hat. Grundzüge ästhetischer Vorlesungen schrieb 1808 Heinrich Luden, die auf seine bekannte Weise geistreich und gediegen sind. Blühender und an wahrem ästhetischen Gehalt reicher ist die Vorschule der Ästhetik von Jean Paul, die 1813 eine neue Auflage erlebte.
Ich werde mein Urteil über diese akademischen Schriften (die Jean Paulische gehört nicht in ihren Kreis) zusammenfassen und nur vorher bemerken, daß die Ästhetik nicht immer mit den Ansprüchen auf wissenschaftliche Form und Vollständigkeit in Deutschland aufgetreten, sondern daß es sehr interessante ästhetische Abhandlungen gibt, die sich ungebundener und freier auslassen. Dazu gehören die ästhetischen Abhandlungen von Schiller, die ich als bekannt voraussetze, z.B. sein Aufsah über die ästhetische Erziehung des Menschen, über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen (!), über naive und sentimentale Dichtung, über das Erhabene, seine Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst usw. Auch lassen sich viele Aufsätze von Goethe in den Propyläen und in Kunst und Altertum als sehr bedeutende Beiträge zu der Ästhetik des Goetheschen Jahrhunderts betrachten. Was Schiller betrifft, so behandelte er die Theorie des Schönen mehr in Beziehung auf dichterische Form und geselliges Leben, dagegen Goethe mehr die bildenden Künste, insbesondere die Antike ins Auge faßte. Bildender für den Geschmack sind bei weitem die Bemerkungen von Goethe, insofern sie mehr aus dem einheitlichen Quell des Goetheschen Lebens hervordringen und die ungetrübtesten Anschauungen der Welt und ihrer Schönheiten in Natur, Kunst und Leben enthalten, wie die sämtlichen Goetheschen Werke, seien sie Gedichte oder Prosa. Während Goethes geistige Magnetnadel sich unverwandt gegen den schönen Kunstpol neigte, bewegt sich Schillers ringende Natur nach den entgegengesetztesten Richtungen und strebt vergebens nach dem Schwerpunkt, der seiner geistigen Natur angemessen war. Reinhold hatte ihn in Jena in die Kantische Philosophie eingeführt, als Schiller auf dortiger Akademie historische Vorlesungen hielt. Nun geriet er zwischen zwei Feuer, das griechische der Kunst und Poesie, das in Weimar glühte, und das nordische der Philosophie, welches zu jener Zeit mit kritisch verzehrendem Feuer, von der Ostsee, aus Königsberg ausgebrochen war. Es ist gewiß, daß seine schönere Natur zuletzt den Sieg davontrug, was besonders seit der Zeit merklich wird, als die Vorurteile zwischen ihm und Goethe hinweggefallen waren und beide große Naturen durch gegenseitigen Umtausch ihrer Gedanken und persönlichen Umgang in Weimar wetteifernd ihrer Ausbildung entgegenschritten. Allein seine erwähnten ästhetischen Ansichten tragen noch deutlich die Spuren geistiger Entzweiung, die aus dem Studium der Kantischen Philosophie für ihn resultierte. Er ist sich selbst nicht klar und läßt daher auch einen sehr unklaren Eindruck auf den Leser zurück. Die Bewunderung für Kants diktatorisches und von der moralischen Seite so erhabenes Genie, die ihm Rein holds Vorträge und Studium der Kantischen Kritiken eingeflößt hatte, verleitete ihn zur Annahme Kantischer Prinzipien, die, wie man sie sonst auch versteht, auslegt, billigt oder verwirft, von niemand so leicht als kunstförderlich oder auch nur verträglich mit den Forderungen des ästhetischen Sinnes betrachtet werden mögen. Es gibt vielleicht keinen konsequenten Kantianer gegenwärtig auf der Welt, damals aber war alle Welt kantisch, es ging eine Seuche durch Deutschland, sich kantisch auszudrücken, und bei Dietrich in Göttingen erschien im Jahr 1801 sogar eine Kantische Postlehre mit dem Titel: »Vorläufige Darstellung der Begründung einer allgemeinen Postanstalt.«
Daher findet man denn auch die meisten Handbücher der Ästhetik, die aus jener Zeit stammen, mehr oder weniger in die abstrakten Formeln der Kantischen Philosophie gebannt, z.B. die von Ben David und von Krug, welcher schon als solcher und inmitten seiner Philosophie, der leibhaftige Tod für Ae Ästhetik ist.
An sich, meine Herren, gehört das Element der Ästhetik, das Schöne, ohne Zweifel in den Kreis der erhabensten Philosophie. Die Wirkungen der Schönheit, die Schönheit selber ist uns ein Geheimnis, ein Rätsel, zu dessen Auflösung wir den Schlüssel bei einer Wissenschaft suchen, von der, wie Sie wissen, wenigstens die Rede geht, daß sie den großen goldenen Schlüssel zu allen Geheimnissen der Welt, wenn auch nicht besitzt, doch wenigstens zu schmieden beflissen sei. Dennoch, meine Herren, und wenn, der Schlüssel auch gefunden wäre, ist Aufschließen und Schauen offenbar zweierlei. Nehmen wir z.B. an, daß der verstorbene Hegel, unter dessen Schriften man ebenfalls eine Ästhetik findet, die im geschlossenen Ringe seiner Philosophie ihren bestimmten Platz und Namen hat, daß Hegel den Grund und das Wesen aller Dinge nicht allein tiefer erforscht hätte, als alle seine Vorgänger, sondern auch wirklich und wahrhaftig in diesem Grunde angelangt wäre und von da aus imstande wäre, die ganze Welt dem lieben Gott nachzukonstruieren und zu beweisen, warum alles so wäre und nicht anders sein könnte, als es ist, könnte er mehr tun, als uns das Warum der Schönheit in abstrakter Formel auszusprechen, könnte er uns mit schöpferischer Kraft eine Ahnung der Schönheit selbst ins Herz flößen? Muß nicht das Schöne auch wieder durch das Schöne bezeichnet werden, um sich als schön fühlen zu lassen, kann man durch undichterische Schönheitslehren über die Schönheit belehren, hebt nicht eine abstrakte Definition die Schönheit, die sie definieren will, und daher sich selber auf, kann man die geistigste Blüte alles Erschaffenen, sei es dem unmittelbaren Quell der Natur oder den Händen der Kunst entsprungen, unter das anatomische Seziermesser bringen, und ist das, was unter solchen Händen seufzt, tot oder lebendig zu nennen?
Nicht jede Philosophie also hat, als solche, die Kraft und die Eigenschaft, das Prinzip der Schönheit würdig darzustellen, und noch weniger läßt sich erwarten von den Schriften der gelehrten Pedanterie, wie ein solches musterhaftes Beispiel oder Gegenspiel der Ästhetik in Baumgartens lateinischen Werken vorliegt, der die ausländische Form natürlich noch zum geringsten Vorwurfe dient. Schon der Name Ästhetik ist so unpassend als möglich, dieser Name, der das verdiente Schicksal gehabt hat, anfangs nur unter lateinisch-deutschen Gelehrten, unter akademischen Kathedristen bekannt zu sein, bei seinem Eintritt ins große Publikum aber, so wie in gegenwärtiger Zeit, von den Gelehrten fast verachtet, von süßlichen Schöngeistern erniedrigt und in der meisten Munde bespöttelt zu werden. Es wäre in der Tat sehr zu wünschen, daß der Name und die ganze Behandlung dessen, was man unter diesem Namen zusammenfaßte, in Deutschland gar nicht aufgekommen wäre. Das Gefühl des Schönen ist unter den Deutschen keineswegs so verbreitet, befestigt und veredelt, daß es geschützt und sicher genug wäre vor den erkältenden Einflüssen, womit dasselbe auf der einen Seite von dem hölzernen Zepter der Schulgelehrsamkeit, auf der anderen von dem leichfertigen Geckentum des Gallizismus bedroht wird Die Ästhetik ist als Wissenschaft für Deutschland viel zu früh gekommen. Das Gefühl des Schönen muß sich vor allem erst durch das Leben befruchten und bilden, wenn es in Büchern und Hörsälen würdig dargestellt und ein wahrhaft integranter Teil der Philosophie werden soll. Das Schöne selbst aber schwebt nicht in der Luft, ebensowenig wie die Blüte und das Rosenblatt, es muß befestigt sein an einem Stamme, es muß Charakter haben, und nichts fehlte zur Zeit, als Baumgarten seine Ästhetik schrieb, der deutschen Nation mehr als diese. Nationalgefühl muß dem Gefühl fürs Schöne, politische Bildung der ästhetischen vorausgehen. Ohne Kraft gibt es keine Gewandtheit, ohne Charakter keinen Ausdruck, ohne Ausdruck keine Schönheit, weder im Stil des Bildhauers, noch im Stil des Schriftstellers. Beglückter war das griechische Volk als wir. Es besaß freilich keine Ästhetik, aber dafür platonische Dialogen, worunter wahre Opfer an die Göttin der Schönheit, behandelten sie auch nicht, wie sie tun, das xaloy xagatoy als ihren Hauptgegenstand und identifizierte ihr Urheber auch nicht, wie er tut, das Schöne mit dem ewig Einen, mit Gott selber. Unsere neuere Ästhetik beschränkt sich daher auch, aus Mangel an Lebensfülle, gänzlich auf das Schöne oder die Schönheiten in Poesie und Kunst und sind, wie auch viele den Namen führen, bloße Theorien der sogenannten schönen Künste und Wissenschaften, die zu Anfang einige vorläufige Definitionen vom Schönen, Erhabenen, Anmutigen, Witzigen usw. aufstellen und dann allerlei und mancherlei aus der Geschichte und Technik der schönen Künste und Wissenschaften folgen lassen. Es gibt nur eine einzige Schrift über gewöhnliche Ästhetik, die genial und ästhetisch ist, die Jean Paulische, wie nur ein einziges Werk, das die Ästhetik im höhern, im griechisch-platonischen Sinne auffaßt, der Erwin von Solger. Allein schon aus der allgemeinen Unkunde dieses Werks muß sich zweierlei klarmachen, daß es entweder nicht in zeitgemäßer Form geschrieben, oder daß sein Inhalt nicht zeitansprechend sei. Beides ist mir ausgemacht. Die Form ist dialogisch und der Inhalt eine Vergötterung des Schönen mit einem Anschein des Enthusiasmus, der dem Platonischen nicht allein nahekommt, sondern ihn noch zu übertreffen scheint, der aber lange nicht die Wärme und Kunstlosigkeit hat, als der des griechischen Meisters. Um sich davon einen Begriff zu machen, vergleiche man die so wahre als genievolle Schilderung, die Jean Paul von den Griechen gibt, mit dem Leben, das wir Deutsche in Deutschland führen, so wird man einsehen, daß die Begeisterung eines platonischen Dialogs, wie des Symposions, eine natürliche, Solgers aber eine gemachte war, wie mehr und weniger jede Begeisterung, die isoliert steht und ihre Quelle nicht aus der Zeit nimmt.
Zweite Vorlesung.
Meine Herren. Ich bitte Sie, sich aus der ersten Vorlesung den Satz ins Gedächtnis zurückzurufen, daß der Gegenstand der Ästhetik, die Schönheit und deren Erscheinung in den Gebieten des Lebens und der Kunst weder von abstrakter Philosophie, noch von geist-und ahnungsloser Gelehrsamkeit aufgewiesen und dargestellt werden könne; daß aber die deutsche Ästhetik, als akademische Wissenschaft, mit wenigen Ausnahmen eben das Schicksal gehabt habe, von solchen Männern geschrieben und gelehrt worden zu sein, denen der rechte Natursinn und die Bildung für die Schönheit bald völlig abging, bald nur in sehr geringem Grade beiwohnte. Einseitigkeit in jeder Art ist keiner Wissenschaft nachteiliger, als der Lehre vom Schönen, ja es steht eben die Einseitigkeit im graden Widerspruch mit der Schönheit, welche die freie Entfaltung liebt und nur im Elemente der Freiheit sowohl gedeihen, als verstanden werden kann. Wenn in der Philosophie, in der Wissenschaft eine große einseitige Schärfe des Verstandes, der Abstraktion, wenn in Sachen der Gelehrsamkeit eine gewisse einseitige Stärke des Gedächtnisses bedeutenden Leistungen nicht nur nicht hinderlich, sondern förderlich scheint – eine Bemerkung, die sich Ihnen bei der Geschichte der Philosophie und der Gelehrsamkeit aufdringen wird –, so ist dies der umgekehrte Fall bei den Lehren des Geschmacks, welche bei einseitigen Richtungen der darstellenden Individuen und ganzer Zeitalter um desto geschmackloser und den Sinn für das Schöne um desto weniger erregend und bildend sind, je naturwidriger und unharmonischer, das heißt, je einseitiger die Bildung ihrer Urheber war. Ich möchte noch immer, nach allem, was bisher in Deutschland Ästhetisches und über Ästhetik geschrieben worden, so viele Goldkörner Lessing, Herder, Jean Paul, Schiller, selbst Bouterwek auf diesen dürren Boden hingestreut haben, ich möchte noch immer dem Jünger des Schönen und dem Freund seiner eigenen harmonischen Ausbildung den Rat geben, sich seinem eigenen Genius zu überlassen und statt sich durch mehr oder minder willkürliche Räsonnements über die Schönheiten in Kunst und Poesie verwirren zu lassen, sich nur an die meisterhaften Kunstprodukte der alten und neuen Zeit selbst zu halten und bei ihrer Lesung, ihrem Anschauen sich von den unausbleiblichen Wirkungen der geistigen Kraft der Schönheit lebendig zu erfüllen, wozu dem Deutschen insbesondere Goethes Werke als musterhaft vorschweben.
Doch vielleicht, meine Herren, kommt den Deutschen, als Nation, die Schönheitslehre und der Schönheitssinn viel zu früh, und dies war der zweite Hauptsatz der ersten Vorlesung, in der ich diese Behauptung aufzustellen gewagt habe. Die Schönheit, sagte ich, beruht auf Kraft und Charakter, sie beruht auf leiblicher und geistiger Gesundheit, auf Lebensfrische, auf Behaglichkeit, auf Freiheit und Harmonie; denn unter diesen Grundbedingungen kann jedes Volk des Erdbodens, nicht allein das griechische unter seinem ewigblauen Himmel und mit seiner offenen, sonnigheitern Sinnlichkeit, sondern auch der Deutsche, der Nordmann unter rauherem Himmel, den Sinn für Schönheit unter sich ausbilden und aller Segnungen desselben und des doppelten und dreifachen Lebensgenusses, der aus diesem Sinn entspringt, teilhaftig werden. Aber fast mehr noch als der Grieche, der Sohn des Südens, hat der Deutsche, der Nordmann auf die Ausbildung seines Charakters hinzuarbeiten; unser Geist ist von Natur formloser, als der griechische; zwischen untätiger Ruhe und träger Beharrung und momentaner heftiger Aufregung und aufblitzenden Leidenschaften schwanken die Besseren und die Besten unter uns hin und her, die geistigsten Äußerungen und die tiefsten Gemeinheiten vereinigen sich oft in einer und derselben Person. An Leuten, die vor Gelehrsamkeit strotzen und halb darüber platzen, wie an Leuten, die vor lauter Scharfsinn und Spitzfindigkeit beständig auf Nadeln gehen, an überschwänglichen Poeten, an wahnsinnigen Musicis, an eingehimmelten, augenverdrehenden Frömmlern, an Charakteren dieser Art, fehlt es allerdings nicht in Deutschland, allein ihre Fülle und Anzahl bestätigt eben meine Behauptung, daß man zu wenig Charakter und Ausbildung desselben unter uns antreffe. Es sind diese und ähnliche bizarre Originale (die noch dazu oft nur schlechte Kopien), lebendige Muster der charakterlosen Einseitigkeit einer zersplitterten Zeit, die sich zum wahren Charakter der Humanität in gar kein anderes Verhältnis stellen lassen, als in das der Scheuchbilder einer menschlichen Gestalt zur menschlichen Gestalt selber. Daß solche und ähnliche Charaktere oder Charakterverzerrungen unfähig sind, den Stempel der Schönheit aufzunehmen, bedarf wohl keiner Erläuterung. Eine zweite und noch zahlreichere Gattung von Charakteren liefern uns die Geschäftsmänner in allen Zweigen des Lebens; die Amtleute, Juristen, Advokaten, Sachwalter; diese Generalpächter des Gesetzes und der Gerechtigkeit, die noch in so vielen Ländern die Barbarei eines unbekannten, undeutschen, unvolkstümlichen und daher rechtlosen Rechts täglich verewigen und die daher seit alter Zeit eine pedantisch gelehrte Kaste bilden, welche, wie alles Kastenwesen, der freien Bildung und schönen Humanität schnurstracks entgegenläuft, – die Ärzte, welche ebenfalls ihre Wissenschaft und ihr ganzes Treiben vor den Augen der gebildeten Nation verbergen und sich in den Nimbus einer Kunst hüllen, die an unsern eigenen Leibern experimentiert und tastet, – die Schulmänner, die sich noch immer nicht entschließen können, ihre Perücke abzulegen und deutsche Jünglinge statt Latinisten und Gräzisisten fürs Leben heranzubilden – die Theologen – kurz alle Ämter, die als sogenannte Brotstudien auf unseren Universitäten in eigenen abgeschlossenen Disziplinen gelehrt werden, wie wenig entsprechen sie im ganzen, großen, wie im einzelnen dem reinen Bilde der Humanität, und wie selten kann man beim Anblick des Wirkens der in diesen und durch diese Disziplinen ausgebildeten Männer freudig ausrufen, hier ist ein Charakter, der rein und freudig im Geiste seines Volkes und im Höheren der Menschheit ruht, ein individueller Mensch, der natürlich und aus dem Grunde lebt, der die Wissenschaft, die Kunst und alles was er treibt, nicht auf angelernte Weise handwerksmäßig treibt, sondern mit innerem Drang, mit eigenem Denken und nach selbstgemachten Erfahrungen, ein Geist, dessen charakterischer Zug es eben ist, die Bahn, die Art und Weise seiner Tätigkeit sich weder von außen aufdringen zu lassen, noch sich selber mit Willkür zu setzen, sondern mit klarer Besonnenheit zu wählen. An der Bildung eines solchen Mannes, meine Herren, mag vielleicht die letzte Feile fehlen, seiner geistigen Gestaltung, seiner leiblichen Erscheinung noch manches abgehen, was der Grieche des Perikles, der auf jeden Zug, auf jedes Wort, auf jede Bewegung achtete, Sorgfalt verwandte, was der ungern vermißt hätte, es mag ihm noch nicht der rechte Sinn aufgegangen sein für die tiefe Bedeutsamkeit der äußeren schönen Form, für die himmlische Blüte des Geistes, für den reinen Abdruck der innern Harmonie, es mag ihm Sinn und Gemüt noch nicht gehörig aufgeschlossen sein für die Freuden der Kunst, für den Genuß der Poesie, er mag den Apoll von Belvedere noch nicht bewundern, sich für die Goethesche Iphigenie noch nicht begeistern, sich vom Zauber einer schönen Gegend, einer Mozartschen Musik nicht hinreißen lassen, sich überhaupt noch nicht über den bloßen baren Ernst des Lebens in die freiere Region erhoben haben, wo der Ernst ein Spiel und das Spiel ein Ernst ist, ich meine die Region der Kunst, der ästhetischen Anschauungen des Lebens – aber er ist vorbereitet, er ist des Besten würdig, was Gott für uns bestimmt hat, des Genusses, den nur derjenige ahnt, dem er dafür Empfänglichkeit gegeben, und dem Welt, Erziehung und Gesellschaft dessen nicht beraubt haben.
Allein, solange noch das Leben selbst, das uns von der Wiege auf umfängt, solange noch die Schule, die Universität, diese Bildungsmittel unseres Geistes, später der Staat und das, was jetzt unter dem Namen der guten Societé und im weitern Umfang der bürgerlichen Gesellschaft besteht, solange dies alles der eigentümlichen Bildung und Entwicklung unsers Charakters mit Händen und Füßen entgegenarbeitet, werden solche Männer immer nur zu den seltenen Erscheinungen gehören und somit auch die Ausbildung des Schönheitsinnes, nach meiner innigsten Überzeugung, eine vergebliche, ja in vielen Fällen schädliche sein, eine Erfahrung, die wir sowohl an jenen geschmackvollen Kunstkennern machen, welche in unmännlicher Sorglosigkeit und Unbekümmertheit die Wissenschaft ums Vaterland und die großen Interessen der Zeit, in italienischen und antiken Kunstgenüssen schwelgen, oder wenn sie es nicht zur Kunstkennerschaft bringen, fade Schöngeister werden, die sich bei den Gebildeten und die Ästhetik mit ihrer. Person beim großen Haufen lächerlich machen. Vom letzteren habe ich bisher noch gar nicht einmal gesprochen, indem ich die Unfähigkeit unserer Zeit Zum Genuß und zur Würdigung des Schönen in dieser Einleitung berührte. Wer hat ihn, diesen großen Haufen, besser geschildert als Kant in seinem Werke über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, wenn er spottend fragt: wohlbeleibte Personen, deren Autor der Koch ist und deren Werke von seinem Geschmack im Keller liegen, werden bei gemeinen Zoten und einem plumpen Scherz in eben so lebhafte Freude geraten, als diejenige ist, worauf Personen von edler Empfindung so stolz sind. Ein bequemer Mann, der die Lektüre der Bücher liebt, weil es sich so wohl dabei einschlafen läßt; der Kaufmann, dem alles Vergnügen läppisch erscheint, dasjenige ausgenommen, das ein kluger Mann genießt, wenn er seinen Handlungsvorteil überschlägt; der Liebhaber der Jagd, er mag nun Fliegen jagen, wie Domitian, oder wilde Tiere, alle diese haben ein Gefühl, welches sie fähig macht, Vergnügen nach ihrer Art zu genießen, ohne daß sie andere beneiden dürfen oder auch von andern sich einen Begriff machen können – allein, ich wende für jetzt keine Aufmerksamkeit darauf. Es gibt noch ein Gefühl von feinerer Art, und so fort, unter diesem Gefühl verstand Kant das Gefühl für das Schöne und Erhabene, das in ihm selbst, wenn auch mit Übergewicht für das geistig und moralisch Erhabene lebendiger war als in den meisten seiner späteren Jünger, Fichte und Schelling ausgenommen.
Überhaupt bin ich weit entfernt, wenn ich den Deutschen der nächstvergangenen und heutigen Welt das rechte Lebenselement und daher den rechten Sinn der Schönheit abspreche, in dieser Behauptung den Einflüsterungen gewisser Schriftsteller Raum zu geben, die allzu leichtfertig über unsere Nation den Stab brechen. Vor dieser Gesinnung schütze uns nicht eben die Stumpfheit, die man uns überm Rheine vorwirft und die Gleichgültigkeit gegen das Urteil der Welt – denn man kann wohl sagen, daß die ganze Welt über uns richtet, und daß wir nicht allein dem raschen Franzosen, sondern auch dem bedächtigen Engländer, ja selbst dem knechtisch-feigen Italiener ein willkommner satirischer Stoff sind – sondern der Glaube an unsere Nation, das Vertrauen auf die Zeit, die Rosen und Ketten bricht, die Kenntnis unserer Geschichte, die uns einen Spiegel vorhält, worin wir eine bessere und glänzendere Vorzeit beschauen.
Ja, ich bin im Gegenteil so weit entfernt von Kleinmut, daß ich der Überzeugung lebe, keine einzige von den großen europäischen Nationen sei von der Natur besser bedacht, als eben die unsrige, Das sehen wir am Mittelalter, an demselben Mittelalter, das, als es veraltet war, Luthers Hand, und der dreißigjährige Krieg, und der siebenjährige, und die Revolution und Napoleon und die Befreiungskriege, alles, was auf Deutschland losgestürmt hat, nicht so weit hat zerstören und abbrechen können, daß nicht noch gegenwärtig die alten zerbröckelten Säulen und Bogengänge in Schulen und auf Universitäten, in Kirche und Staat vor unsern Augen daständen und uns an eine Zeit ermahnten, deren geistiges Prinzip längst untergegangen ist, deren leiblicher Schutt aber noch immer unausgekehrt, Leben und Wachstum hemmend in der Gegenwart liegt. So großartig baute jenes granitne Mittelalter, solche Massen türmte es in die Luft, mit so festem Kitt band es die Formen seines Lebens aneinander fest und so lange Zeit muß es dauern, daß nach seinem Fall, eine neue Generation sich wieder erheben und auf eigenem Grund und Boden für sich dastehen kann. Unzweifelhaft leiden wir Deutschen bloß am Mittelalter – daher unsere Pfaffen, daher unsere Höfe, daher unsere Ritter, daher unsere lateinischen Juristen, medici, theologi,