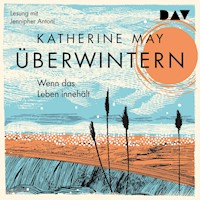19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Bestsellerautorin Katherine May findet auf einer einjährigen Wanderung inmitten betörend wilder Küstenlandschaften zur Selbsterkenntnis: Sie ist Autistin. Das erschüttert sie bis ins Mark, eröffnet ihr jedoch die Chance, endlich das Leben zu leben, das ihr entspricht.
Im August 2015 macht Katherine May sich auf, um den 1041 Kilometer langen South West Coast Path Way entlang der Küsten von Somerset, Devon und Cornwall nach Dorset zu wandern. Sie will den Kopf freibekommen, endlich verstehen, warum ihr so vieles in ihrem Leben schwerer zu fallen scheint als anderen: Warum hat sie immer wieder das Gefühl, nicht recht zu verstehen, was andere meinen, wenn sie mit ihr sprechen? Warum verspürt sie so oft den Impuls, aus einer Gruppe Menschen in die Einsamkeit zu flüchten? Und warum empfindet sie es als besonders herausfordernd, Mutter zu sein? Je öfter sie einen Fuß vor den anderen setzt, bei Wind und Wetter an der Küste entlang, desto klarer wird ihr, woher ihr »Anderssein« rührt – und dass die Wanderung auch eine Wanderung zu ihr selbst ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Katherine May
Auf wilden Pfaden
Wie ich endlich aufbrach und zu mir selbst fand
Aus dem Englischen von Marieke Heimburger
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel The Electricity of Every Living Thing. A Woman’s Walk in the Wild to Find Her Way Home bei Melville House Publishing, Orion Publishing Group, London.
eBook Insel Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025.
Deutsche Erstausgabe © der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2025 © Katherine May 2019
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlagillustration: David Eldridge, London
eISBN 978-3-458-78453-1
www.insel-verlag.de
Widmung
Für Bertie
Motto
Das Universum ist voller magischer Dinge,
die geduldig darauf warten,
dass unsere Sinne schärfer werden.
Eden Phillpotts, A Shadow Passes
… zu oft zu schnell zu weit zu gehen ist gar nicht gut.
Durch den unentwegten Kontakt der Füße mit der Straße
dringt etwas von der Straße in uns ein.
Flann O’Brien, The Third Policeman
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Inhalt
Anmerkung zu den Illustrationen an den Kapitelanfängen:
Anmerkung der Autorin
Prolog Isle of Thanet, November
Teil Eins Desolation Point
1 Minehead Strandpromenade,
August
2 Von Minehead nach
Foreland Point, August
3 Von
Foreland Point
nach Ilfracombe
, September
4 Von Ilfracombe nach
Barnstaple, Oktober
5 Von
Barnstaple
nach
Appledore, November
6 Von Dover nach
Shepherdswell, Dezember
7 Von
Shepherdswell
nach
Canterbury, Dezember
8 Von
Canterbury
nach
Chartham, Januar
9 Von Whitstable nach
Seasalter, Januar
10 Von
Chartham
nach
Chilham, Januar
Teil Zwei Hartland
1 Von Appledore nach
Clovelly,
Februar
2 Von Hart
land Point
zum Eden Project über Tintagel, Februar
3 Von Clovelly nach
Hartland Quay,
Februar
4 Von
Hartland Quay
nach Morwenstow, Februar
5 Von
Chilham
nach
Chartham,
Februar
6 Die Kreidefelsen von
Dover, März
7 Von Morwenstow nach
St Gennys, März
8 Von
St Gennys
nach
Mawgan Porth, März
Teil Drei Outer Hope
1 Von Whitstable nach
Canterbury, Mai
2 Von Whitstable nach Thorndon Wood, Mai
3 Von London nach
Canterbury, Mai
4 In den South Hams
in De
von
, Juni
5 Der äu
ß
erste Zipfel von
Cornwall im Auto, Juli
6 Devon, Ende
August
Epilog
Dank
Anmerkung zu den Wanderrouten
Quellen
Informationen zum Buch
Anmerkung zu den Illustrationen an den Kapitelanfängen:
Die Linien stellen den Verlauf meiner Wanderroute dar.
Anmerkung der Autorin
Ich habe immer gesagt, ich hoffe, dieses Buch wird sehr schnell an Aktualität verlieren.
Noch hat es das nicht, aber ich bin weiter optimistisch. Ich schrieb dieses Buch, weil ich auf der Suche war nach etwas, worin ich mich spiegeln konnte, als ich im stolzen Alter von neununddreißig Jahren begriff, dass ich Autistin bin. Es gab da ein paar Websites, durch die ich immer wieder scrollte, als könnte ich mich vielleicht zwischen den dortigen Zeilen finden. Es gab eine Handvoll Bücher, in denen ich mich wiedererkennen konnte, wenn ich ein Auge zudrückte. Aber ansonsten schien die ganze Welt zu glauben, dass Autismus ein Phänomen sei, das nur kleine Jungs betrifft, die nicht für sich selbst sprechen können. Die Vorstellung, dass eine erwachsene Frau diese Diagnose für sich in Anspruch nehmen könnte – zumal eine Frau, die doch ganz offenkundig sehr gut zurechtkam –, fanden einige Leute in meinem Umfeld absurd. Manche unterstellten mir sogar, ich würde versuchen, Ressourcen abzuziehen von anderen, die sie viel dringender brauchten.
Das ist gerade mal sechs Jahre her. Einiges hat sich seither verändert, aber nicht viel. Das Gefühl der Desorientierung, das ich in diesem Buch beschreibe – das Gefühl, in einer Informationswüste verloren zu sein –, ist nach wie vor der gemeinsame Nenner von spät diagnostizierten Autistinnen und Autisten. Menschen wie ich fragen sich oft ihr ganzes Leben lang, warum uns vieles so schwerfällt. Ärztinnen, Lehrer und psychosoziale Fachkräfte sind immer noch nicht in der Lage, Autismus routiniert zu erkennen, und ihr Wissen darüber ist meist erschreckend veraltet. Die Unsichtbarkeit hält an. Mein Buch ist darum leider immer noch sehr aktuell.
Aber ein Memoir ist immer nur eine Momentaufnahme – unbeständig, unvollkommen, flüchtig. Würde ich dieses Buch noch einmal schreiben, würde ich einiges anders machen. Ich staune selbst, wie sehr sich meine Sprache seither verändert hat. Die Bezeichnung »Asperger-Syndrom« benutze ich nicht mehr, einerseits weil der Namensgeber Teil des Eugenik-Apparats der Nazis war, andererseits weil ich mich nicht von der sehr großen Autismus-Community abgrenzen möchte. Als ich dieses Buch schrieb, wurmte mich das zweite S in ASS, das für »Störung« steht, weil für mich Autismus ein Wesensmerkmal ist, eine neurologische Abweichung, aber kein Defizit. Nolens volens nahm ich damals hin, dass ich den etablierten Standardbegriff benutzen musste. Seither nutze ich aber viel lieber die neutralere Bezeichnung ASV – Autismus-Spektrum-Variante – und möchte dazu anregen, das zu übernehmen. Sprache ist wichtig. Mit Bedacht gewählte Worte können die Welt verändern.
Mich hat die wirklich beeindruckende Autismus-Community verändert, auf die ich online gestoßen bin und die mich ständig dazu anregt, noch mehr über meinen Platz in der Welt nachzudenken. Ihr folgend, habe ich mich immer gründlicher informiert und bin ich immer kritischer und wahrscheinlich auch politischer geworden. Mein Verständnis davon, wie Individuen ihren Autismus erleben, ist viel intersektioneller geworden, und ich habe mehr Zeit damit verbracht, über das zweifelhafte Privileg nachzudenken, in der Lage zu sein, mich als neurotypisch auszugeben – und auch so durchzugehen. Insbesondere habe ich eine regelrechte Ehrfurcht davor entwickelt, wie diese überall auf der Welt verstreuten Menschen selbst größten Herausforderungen voller Einfühlungsvermögen, Anteilnahme und Bedacht begegnen. Man kann Autismus nicht wirklich verstehen, ohne den bunten Alltag von Autistinnen und Autisten zu verstehen.
Es gibt nicht die eine allgemeingültige Version von Autismus, vielmehr verbirgt sich hinter diesem Begriff eine Vielzahl sich überlappender Persönlichkeitsmerkmale. Der Begriff »Spektrum« ist ein kläglicher Versuch, unsere schillernde Vielfalt zu fassen – dabei aber viel zu linear und zu starr. Wenn ich uns mit einem Bild beschreiben sollte, dann wäre es so etwas wie ein Sternbild oder vielleicht eine ganze Galaxie: Millionen unterschiedlich funkelnder Sterne, ich einer von ihnen, und jeder strahlt auf seine ganz eigene Weise. Wer etwas über Autismus lernen möchte, sollte bereit sein, alles, was er bisher darüber zu wissen glaubte, über Bord zu werfen und sich auf so viele individuelle Geschichten und Perspektiven wie möglich einzulassen. Wir sind nicht die stumpfen Roboter, als die wir in der Literatur so oft dargestellt werden. Wir sind humorvolle, liebende, über-empathische Menschen, deren Gehirne etwas anders funktionieren, und die die Welt häufig als enorm anstrengend erleben. So etwas erfährt man nur selten aus Erzählungen Dritter.
Ich schrieb dieses Buch, als ich mitten in der Transformation steckte, mitten in einer Flut neuer Erkenntnisse über mich selbst. Seither habe ich viel gelernt. Ich habe begriffen, dass ich über viele Jahre versucht hatte, mich in eine Schablone zu pressen, die gar nicht für mich gemacht war, und dass ich deshalb immer wieder krank wurde. Jetzt, endlich, habe ich akzeptiert, dass ich besser auf mich aufpassen muss, weil ich nicht repariert oder optimiert werden kann, und das will ich auch gar nicht. Es sind diese Einsichten – diese tiefen, körperlichen Erfahrungen –, die ich in mein Buch Überwintern einfließen ließ. Seither haben sie einer großen Zahl ganz unterschiedlicher Menschen geholfen, und doch entsprangen sie meiner neurodivergenten Wahrnehmung der Welt. Überwintern ist etwas, womit man Bekanntschaft schließt, wenn man autistisch ist, und man lernt, es durchzustehen. Dieses Buch handelt von dem schmerzhaften Weg dorthin.
Katherine May,Juni 2021
Prolog
Isle of Thanet, November
Ein Spätnachmittag im November, es ist bereits dunkel. Ich sitze am Steuer meines Autos. Links von mir das Meer vor Westgate, rechts von mir die sanfte Bucht vor Pegwell. Nicht, dass ich in der Dunkelheit irgendetwas davon sehen könnte, aber ich kenne die Strecke gut. Das Land fühlt sich weit an, wenn das Meer in der Nähe ist, und die Isle of Thanet ist die östlichste Spitze von Kent, eine in die Nordsee ragende Halbinsel, auf der man unversehens von Wasser umgeben ist.
Ich bin spät dran. Ich hasse es, spät dran zu sein. Ich schalte das Radio ein, um mich abzulenken. Ein Mann interviewt eine Frau. Sie spricht davon, wie intensiv sie ihre Umgebung wahrnimmt, davon, wie überempfänglich alle ihre Sinne für Licht und Geräusche, Berührungen und Gerüche sind. So sehr, dass es ihr zu schaffen macht. Es nieselt. Ich betätige den Scheibenwischer, der mir zwei halbrunde Ausblicke beschert. Sie verstehe die Leute oft nicht, warum konnten sie nicht einfach sagen, was sie meinten. Mein Reden, denke ich. Viel Glück.
Dann sagt der Interviewer, sein Sohn befände sich auch auf dem autistischen Spektrum. Der Junge müsse immer alles aufschreiben, sonst könne er es nicht verstehen. Und ich denke, Ja, ja, geht mir doch genauso. Ich hasse es, wenn Pläne nur mündlich gemacht werden, ich weiß genau, dass ich sie mir dann nicht merken kann. Namen muss ich immer geschrieben sehen, sonst vergesse ich sie sofort wieder. Na gut, Gesichter kann ich mir auch nicht merken. Sie tauchen aus dem Nebel vor mir auf, und dorthin verschwinden sie auch wieder, und meistens habe ich keine Ahnung, ob sie mir früher schon mal begegnet sind. Die Stützen meines Lebens sind Aufzeichnungen in meinen Notizbüchern, Adressbücher und Listen. Sie alle helfen mir auf die Sprünge, wenn ich mal wieder was vergessen habe.
Aber so geht es doch jedem. Wir versuchen alle, irgendwie zurechtzukommen.
»Es heißt, autistische Menschen hätten schlechte soziale Fähigkeiten und seien mehr oder weniger ›seelenblind‹. Gilt das auch für Sie?«, fragt der Interviewer.
»Ja, schon«, sagt die Frau. »Heute kann ich besser damit umgehen als früher, weil ich mir des Problems jetzt bewusster bin. Ich beobachte die Mimik anderer Menschen sehr genau, achte ständig auf den Tonfall ihrer Stimme und die Körpersprache.« Gott sei Dank sind meine sozialen Fähigkeiten in Ordnung, denke ich. Gott sei Dank komme ich prima mit allen zurecht. In mir regt sich ein winziges Unbehagen, ich schiebe die Anstrengung, die es mich jedes Mal kostet, das Gefühl, mich gekünstelt zu verhalten, beiseite. Ich kann das gut, aber ich muss hinzufügen: inzwischen.
»Denken Sie im Großen und Ganzen eher in Bildern als in Sprache?«, fragt er.
»Ja«, sagt die Frau. »Ich habe ein eidetisches Gedächtnis.«
Okay, das habe ich ganz sicher nicht. Obwohl sich mir manchmal ganze Seiten eines Buches einprägen, ich sie quasi auf der Innenseite meiner Lider sehe. Meine Französischlehrerin in der Schule lachte, als ich seitenweise Vokabeln herunterbetete: »Du schummelst!«, sagte sie. »Du liest das ab von der Kopie, die du in deinem Kopf gespeichert hast.« Und ich, dreizehn, wand mich auf meinem Stuhl, weil ich nicht wusste, ob das als Kompliment gemeint war und ich mitlachen sollte, oder als Vorwurf.
»Haben Sie sich als Kind für andere Kinder interessiert?«, fragt der Mann.
»Nein, überhaupt nicht. Als ich älter wurde, habe ich versucht, mit anderen zu spielen, aber irgendwas machte ich immer falsch. Mit siebzehn hatte ich dann einen Zusammenbruch, weil ich mich einfach überhaupt nicht mehr zurechtfand.«
Ich muss zurückdenken an jene trüben Tage, als ich überlegte, einfach gar nichts mehr zu sagen, weil ich immer das Falsche sagte. An jene entsetzlichen Tage, an denen ich mit dem Kopf gegen die Wand schlug, nur, um die weißen Blitze zu sehen, die dabei in meinem Kopf entstanden. An die seltsamen Tage des Krankseins, als die Medikamente dafür sorgten, dass alle anderen sagten, ich sei wieder fast ganz die Alte, während ich die Tabletten in der Kehle spürte und kämpfte, um sie nicht wieder auszuspucken …
»Ein Autismus-Klischee lautet, dass romantische Beziehungen extrem schwierig sind«, sagt er. »Sie sind verheiratet. Wie lief das bei Ihnen mit der Partnersuche?«
In dem Moment blaffe ich das Radio an: »Sag mal, geht’s noch? Als wären wir alle totale Monster!«
Und dieses eine kleine Wort überrascht mich: wir.
Teil Eins
Desolation Point
1
Minehead Strandpromenade, August
Wir kommen viel zu spät in Minehead an.
Wir hatten vor, unseren noch schlafenden Jungen in eine Decke eingemummelt auf seinen Autositz zu packen und um halb sechs in Whitstable loszufahren. Wir gingen davon aus, dass er so ungefähr bei Bristol aufwachen würde, und wollten dann irgendwo anhalten und ein stilvolles, idyllisches Familienfrühstück einlegen. Und mittags, so der Plan, wäre ich bereits auf dem South West Coast Path unterwegs.
Ich weiß nicht, wann wir endlich lernen werden, dass Pläne in unserer Familie ein hoffnungsloses Unterfangen sind. Als Bert uns um acht Uhr mit einem lauten »DAAAAAAAADDDDDDYYYYYYY« aus seinem Zimmer weckt, ist schnell klar, dass wir vergessen hatten, den Wecker auf fünf zu stellen. Nach einigem Hickhack fahren wir um neun Uhr endlich los – und damit pünktlich für den dicksten Verkehr. Ganz England scheint sich vorgenommen zu haben, dieses verlängerte und letzte Wochenende vor Schuljahresbeginn voll auszukosten und im Westen des Landes zu verbringen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als schlecht gelaunt im Stau zu stehen und unterwegs mehrere Raststätten anzufahren.
Um drei Uhr nachmittags erreichen wir dann endlich Minehead. »Sind wir jetzt in Devon?«, fragt Bert, und ich sage »Ja«, weil ich keine Lust habe, ihm hier und jetzt eine neue Grafschaft zu präsentieren. De facto sind wir nämlich in Somerset, aber Devon kennt er schon, und wenn alles planmäßig verläuft, werde ich morgen Nachmittag die Grenze überqueren.
»Wir sind in Devon«, sage ich. »Und es ist wunderschön hier.« Ich setze mich auf die Kante des offenen Kofferraums und schnüre meine Wanderstiefel. Jenseits des Kiesstrands sehe ich die Ferienanlage Minehead Butlins. Ich frage mich, ob ich das Richtige tue, ob es mir wirklich helfen und guttun wird, diesen wilden Pfad zu gehen, nach dem ich mich so sehr gesehnt habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das hier ein Irrweg, vielleicht ist es doch gar nicht das, was ich will.
Eine riesige metallene Landkarte, gehalten von zwei riesigen metallenen Händen, markiert den Startpunkt. Ich posiere mit Bert für ein Foto, dann scrolle ich durch die Bilder auf meinem Handy, weil ich eins davon mit einem kecken Es geht los! auf Twitter posten will. Aber dann bin ich entsetzt, wie dick ich auf den Fotos aussehe, und poste stattdessen eins von Bert, wie er verschmitzt lächelnd vor der Wanderkarte steht. Ich finde es derzeit grundsätzlich besser, Fotos von ihm statt von mir zu posten.
»Ich muss jetzt wirklich los«, sage ich an H gewandt. »Sonst komme ich ja nie an.« Ich werde unruhig. Ich muss mich in Bewegung setzen. Die beiden sind so schrecklich langsam, und ich bin heute auf Hochtouren.
»Na, dann geh doch«, sagt er. »Wo genau musst du hin?«
»Weiß ich nicht. Ich denke mal, dass ich einfach der Küstenlinie folge. Darauf achte, dass das Meer immer rechts von mir ist.«
»Da kann ja nicht viel schiefgehen«, sagt er. »Nicht mal bei dir.«
»Nicht mal bei mir.«
»Wir treffen dich dann später.«
Wir schlendern die Strandpromenade entlang, an einem Pub, einem Café und einer Eisdiele vorbei. Bert will einen Lolli. H sucht eine öffentliche Toilette. Ich werde immer gereizter. Wie lange wollen wir denn noch durch Minehead trödeln? Wahrscheinlich war das alles eine dämliche Idee von mir, und ich werde nie loskommen. Ich muss noch gut vierzehn Kilometer schaffen, bevor die Sonne untergeht, und ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt noch vierzehn Kilometer schaffen kann.
Doch dann interessiert sich Bert plötzlich rasend für einen Spielplatz, ich bekomme einen Vorsprung, drehe mich um und sage: »Tschüüüüss! Wir sehen uns in Porlock Weir!« Und damit bin ich weg, allein auf dem South West Coast Path, auf meinen eigenen Füßen.
Der South West Coast Path ist ein ziemlich anspruchsvoller, schroffer und schonungsloser Küstenfernwanderweg im Südwesten Englands. Er führt von Minehead in Somerset bis Poole Harbour in Dorset zunächst an Devons Nordküste entlang, umrundet dann ganz Cornwall und verläuft weiter an Devons Südküste. Ich nenne ihn schonungslos, weil er auf fast schon böswillige Weise jede Abkürzung verweigert, selbst da, wo jeder vernünftige Mensch eine nehmen würde. Immer wieder muss man an der Steilküste nicht ganz ungefährliche Abstiege in irgendwelche Buchten bewältigen, nur um gleich darauf wieder steil bergauf zu kraxeln und dann, oben angekommen, einen viel vernünftigeren, praktisch flach verlaufenden Weg zu entdecken.
So ist er, der SWCP: glorreich und brutal. Auf seinen 1014 Kilometern klammert er sich stets an die äußerste Kante der zerklüfteten Küstenlinie, eine Kante, von der regelmäßig ganze Brocken abbrechen und im Meer verschwinden. Manchmal könnte man meinen, der Weg wurde für Bergziegen entworfen, nicht für Menschen.
Früher, als der Weg noch keinen eigenen Namen hatte und nicht mit schicken Eichelsymbolen markiert war, wurde er von Küstenwachen benutzt. Sie hatten ein Wegenetz entwickelt, dem sie folgten, um in abgelegenen Buchten nach Schmugglern Ausschau zu halten. Das erklärt vielleicht die vielen anstrengenden Auf- und Abstiege, aber ich glaube, dafür gibt es noch einen anderen Grund. Ich glaube, der SWCP hat auch viel mit einer etwas befremdlichen Naturbegeisterung zu tun. Jedenfalls habe ich immer, wenn ich auf ihm unterwegs bin, das Gefühl, dass jemand anderes meinen Drang teilt, die Welt in ihrer ganzen Größe kennenzulernen, ihre Grenzen mit meinen Füßen zu erkunden, und zwar auf dem längsten und härtesten Weg.
Das mag nun vielleicht nicht danach geklungen haben, aber: Ich liebe den SWCP! Es drängt mich immer wieder zu ihm, insbesondere zu der Strecke zwischen Bantham und Start Point, die um den südlichsten Zipfel von Devon führt. Dort bin ich durch meine persönlichen höchsten Höhen und tiefsten Tiefen gegangen, denn ich habe diese Ecke immer dann wieder aufgesucht, wenn es in meinem Leben gerade am allerbesten lief – und wenn es ein Scherbenhaufen war. In den South Hams kann ich immer wunderbar abschalten und auftanken.
Der SWCP trat in mein Leben, nachdem H und ich heimlich im Standesamt von Maidstone in Kent (also sehr weit im Osten) geheiratet hatten. Danach wollten wir genauso heimlich in den Westen abhauen, uns dort in ein strohgedecktes Häuschen verkriechen und unseren Freunden mit ein paar lustigen Postkarten von unserer Eheschließung berichten. So weit, so schlecht geplant. Wir wurden von einer älteren, über einen Gehstock gebeugten Dame in Empfang genommen, die uns erzählte, die letzten Gäste seien »etwas rätselhaft« gewesen, sie seien nämlich bei Nacht und Nebel abgereist und nie wieder aufgetaucht. Der Grund dafür wurde schnell klar: Im Bad roch es nach altem Urin, überall waren Spinnen, und jedes Mal, wenn wir das Licht ausmachten, fing es irgendwo fies an zu rascheln. Zwei schlaflose Nächte hielten wir es dort aus, dann vertrauten wir uns der Touristen-Info in Kingsbridge an.
Die Frau hinter dem Tresen schüttelte bedauernd den Kopf und sagte: »Diese schrecklichen alten Cottages!« Dann griff sie zum Telefon, und nach einem kurzen Gespräch mit einer uns unbekannten dritten Person, im Verlaufe dessen sie uns als »ganz reizendes junges Paar« anpries, verkündete sie uns, wir hätten riesiges Glück, so kurzfristig überhaupt etwas zu finden, und dass sie überzeugt sei, dass wir uns dort wohler fühlen würden.
Etwas beklommen fuhren wir nach Salcombe – einen uns völlig unbekannten Ort – und zogen ernsthaft in Erwägung, die ganze Sache abzublasen und nach Hause zu fahren, falls uns in dem angesteuerten Bed&Breakfast Nylonbettwäsche und Jesus-Darstellungen an den Wänden erwarteten. Doch dann übertraf es alle unsere Erwartungen: Eine mehrstöckige Altbauvilla mit blass gestrichenen Wänden und Seegrasfußböden sowie eine wunderbare Vermieterin, die den Rest der Woche immer dann, wenn wir auf unserem Balkon saßen und jemand draußen vorbeiging, auf uns zeigte und quietschte: »Die beiden sind durchgebrannt! Und bei mir untergeschlüpft! Bei mir wohnen zwei waschechte Ausreißer!«
Uns machte das nichts aus. Wir waren viel zu sehr damit beschäftigt, die Aussicht über den Ästuar zu bewundern, auf dessen Blau sich hunderte weißer Boote tummelten und hinter dem in der Ferne East Portlemouth zu sehen war. In jener Woche kauften wir unsere allererste Wanderkarte und unternahmen unsere erste richtige Wanderung (ein fehlgeschlagener Streifzug durch Dartmoor, auf dem wir prompt die Orientierung verloren, als sich urplötzlich ein dichter Julinebel auf das Land legte – was, wie wir später erfuhren, völlig normal ist). Wir studierten die Karte auf der Suche nach Stränden, an denen ich schwimmen könnte, und manövrierten das Auto über schmalste, farngesäumte Landstraßen zu unberührten Buchten an wilden Wassern.
Eines Abends, es dämmerte bereits, war das sonst so klare Meer bei Thurlestone voller Quallen, und vielleicht war das der Moment – ich bin mir nicht ganz sicher –, in dem wir versuchen wollten, einen besseren Blick auf das berühmte Felsentor zu bekommen, und schließlich auf dem South West Coast Path nach Hope Cove marschierten. Auf dem Weg sahen wir rote Klippen und Schwalben, die sich immer wieder kurz auf die Wasseroberfläche eines Flusses stürzten, um zu trinken. Ich konnte mein Glück nicht fassen, einen solchen Weg gefunden zu haben, der so anders war als alles, was ich aus unserer Heimat Kent kannte. Natürlich liebte ich unsere Kiesstrände und flachen Sandküsten, aber das hier war etwas ganz anderes. Hier wurde man für einen kurzen Fußmarsch mit einer schroffen Steilküste belohnt, an der sich kleine Buchten und Gezeitentümpel aneinanderreihten, wie wir sie nur aus den Bilderbüchern unserer Kindheit kannten. Wir waren hingerissen!
Und diese Begeisterung hat bis heute nicht nachgelassen. Ich bin wie besessen von Süddevon, ich muss einfach immer wieder dahin. Aber als ich das letzte Mal dort war, ging ich keinen einzigen Schritt auf dem SWCP. Wir hatten Bert dabei, und irgendwie ging das nicht. Andere Mütter hätten sich wahrscheinlich eine Trage umgeschnallt und wären mit dem Kind auf dem Rücken über die Klippen spaziert, aber mir ist ja schon lange klar, dass ich nicht so bin wie andere Mütter. Mich schreckt nicht nur die mit einer solchen Aktion verbundene körperliche Anstrengung (oder die Gefahr – ich bin nämlich nicht trittsicher); mich hindert etwas viel Unsäglicheres daran: Ich möchte nicht mit einem Kind auf dem Rücken wandern. Ich möchte wieder wie früher nur mit H stundenlang umherstreifen und mit sonnenerhitzter Haut nach Hause kommen mit dem Gefühl, dass unsere Welt nun wieder in Ordnung ist. Noch lieber möchte ich allerdings allein wandern. Und ich dachte, ich hätte kein Recht mehr darauf.
Ich weiß auch nicht, was sich geändert hat, warum ich jetzt doch hier bin.
Ich glaube, es liegt an einer neuen inneren Einstellung. Daran, dass ich schon fast achtunddreißig bin und meine Augenbrauen der Schwerkraft Richtung Lider folgen. Daran, dass meine Glieder steifer werden und meine Körpermitte dicker. Daran, dass ich jetzt wahrscheinlich schon die Hälfte meines Lebens hinter mir habe, dass mir die Zeit davonläuft, dass ich denke: Jetzt oder nie.
Aber auch andere Dinge haben dazu beigetragen. Im Juli waren wir in Devon, in Gara Rock, das gleich oberhalb meines absoluten Lieblingsstrands liegt. Zum ersten Mal blieben wir oben im Café und gingen nicht den steilen Weg zur Bucht hinunter. Das war einfacher, als alles da runterzuschleppen. Ich schämte mich für meine Bequemlichkeit, war aber gleichzeitig so erschöpft und faul und hatte wirklich keine Lust, am Ende des Nachmittags ein Kleinkind wieder nach oben zu schleppen. Ich befürchtete, wir könnten uns alle einen Sonnenbrand zuziehen, und hatte auch gar nicht die richtigen Schuhe an.
Und so saßen wir da unter Glas und aßen Scones mit Erdbeermarmelade, als mir klar wurde, dass ich die Bodenhaftung verloren hatte. Als ich Bert bekam, träumte ich davon, ihm etwas ganz anderes als das hier zu geben: endlose am Strand verbrachte Tage; im Auto auf dem Weg nach Hause schlafen; das Meer als Sehnsuchtsort, wie es auch für mich ein Sehnsuchtsort war – wobei ich ihm gerne mitgeben würde, nicht so empfindlich auf Sand und Unvorhergesehenes zu reagieren. Ich verstand nicht, weshalb ich ihm all das nicht geben konnte. Es war wie mit so vielen anderen Dingen seit seiner Geburt: Zwischen dem, was ich gerne wollte, und dem, was ich tatsächlich konnte, war eine unsichtbare Barriere.
Wir aßen die Scones und tranken unseren Tee, dann beschlossen wir, nach Hause zu fahren. Auf dem Weg zurück zum Parkplatz drehte Bert sich um zu der grandiosen Aussicht, kniff die Augen zusammen und fing an zu singen:
So viele Wolken da am Himmel
Und der Wind, der Wind, der Wind
Der weht uns gleich weg!
Ich habe so ungefähr jedem, den ich kenne, von diesem Augenblick erzählt, und alle haben gesagt: »Hach, ja, in dem Alter denken die sich immer so nette kleine Lieder aus!« Aber für mich war es mehr als das. Mein kleiner Sohn – gerade mal drei Jahre und drei Monate alt – sah zum Meer hinaus und spiegelte mir meine Gedanken. Die Wolken, der Himmel, der Wind. Der Zauber all dieser Dinge. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass er in der Lage war, so zu staunen.
Dann, eine Woche später, verlief ich mich im Wald. Auf der Rückfahrt von der Arbeit nach Hause hielt ich kurz beim Bleaner Forst an, um dort meine übliche Runde zu gehen, aber als ich ausstieg, machte sich gerade eine Gruppe japanischer Schulkinder auf denselben Weg. Sie plapperten ganz schön laut, und ein paar von ihnen schnitten Grimassen, als ich an ihnen vorbeifuhr. Andere Menschen empfinde ich als elektrisch geladen, es fühlt sich an, als würde der von ihnen ausgesendete Strom meinen Körper umbranden, bis ich vollkommen erschöpft bin. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber es hat mit den Geräuschen zu tun, die sie machen, mit ihren abrupten Bewegungen, damit, dass sie jederzeit irgendeinen Anspruch an mich stellen könnten. Die Luft wird dadurch für mich irgendwie dick, als würden Menschen keinen Geruch abgeben, sondern … eine Textur. Ich habe dann das Gefühl, nicht atmen zu können. Ich war in den Wald gefahren, um dem zu entkommen, und dann begegnete es mir dort auch, als hätte es mich verfolgt. Ich überlegte, kehrtzumachen, die Vorstellung, auf meiner friedlichen Runde die ganze Zeit dieses akustische Chaos im Ohr zu haben, war mir einfach unerträglich. Aber dann hatte ich eine geniale Idee! Ich würde die Runde einfach andersherum gehen. Und so marschierte ich in entgegengesetzter Richtung los.
Ich bin einfach zu blöd. Ich muss schon relativ früh irgendwo falsch abgebogen sein, denn es dauerte nicht lange, da fand ich mich auf etwas wieder, das einem Elfenpfad glich: Alles war von dickem Moos und Spinnweben bedeckt. Hier war ganz offensichtlich schon lange niemand mehr gegangen. Das einzig Vernünftige an diesem Punkt wäre gewesen, meiner eigenen Spur zurück zu folgen, aber nein. Ich hielt mich für besonders schlau und wollte zu meinem eigentlichen Weg zurückkehren, sobald ich diesen unberührten Teil des Waldes erkundet hatte.
Drei Stunden später, nachdem ich wohl den gesamten alten Wald durchstreift hatte, stieß ich halb verdurstet und mit schmerzenden Gliedern auf einen Mann, der die Brüste seiner Freundin fotografierte (ich wollte ihn unter diesen Umständen nicht nach dem Weg fragen), und überlegte, ob ich irgendwann nach Wasser graben müsste. Keine Ahnung, wie ich auf die Schnapsidee gekommen war, dass ich auch nur einen Funken Orientierungssinn hätte, schließlich hatte ich mein ganzes Leben noch keinen. Google Maps wollte nicht laden. Eine ganze Weile versuchte ich, herauszufinden, wo die Sonne am Himmel stand, um dann entsprechend zu navigieren, aber genauer als »da oben« wurde es nicht, und so musste ich einfach darauf vertrauen, dass ich, wenn ich nur immer in exakt dieselbe Richtung lief, irgendwann wieder auf Zivilisation stoßen würde. Ich schrieb einer Freundin mit der Bitte, Bert vom Kindergarten abzuholen, und musste ganz oben auf einem Hügel mit meinem Handy herumfuchteln, bis die Nachricht beim zwanzigsten Versuch endlich versendet wurde.
Und dann, nachdem ich das mit Bert geregelt hatte, ging es mir ganz hervorragend. Ich war frei, mich zu verlaufen und zu verausgaben. Auf einmal war das lustig. Befreiend. Irgendwann, tief im Wald, hörte ich auf, ständig nachzuschauen, ob ich Handyempfang hatte, und bemerkte ein knisterndes Geräusch, wie von Stromleitungen. Ich steckte das Handy in die Tasche und lauschte. Der Wald um mich herum lebte. Er wuchs und veränderte sich, zog Wasser aus dem Boden, begann neues Leben und trennte sich von allem Toten. Es war so laut, so absolut. Wenn ich je an einen Gott hätte glauben sollen, dort hätte ich ihn gefunden. Es war fantastisch.
Und in dem Moment ging mir auf, wie sehr ich mich selbst aus den Augen verloren hatte. Nein, falsch: Das war mir schon sehr oft aufgegangen, immer wieder. Und ich hatte mich gegen die Erkenntnis gewehrt, darunter gelitten, sie betrauert. Das hier war neu. Das war der Moment, in dem mir aufging, dass ich mich wiederfinden musste. Der Moment, in dem mir aufging, dass die Welt mir als Mutter eines kleinen Kindes nie erlauben würde, allein zu sein, dass ich genau das aber dringend brauchte.
Als ich nach Hause kam, ließ ich mich dafür aufziehen, dass ich keinen Orientierungssinn hatte, versorgte meine Füße großflächig mit Blasenpflastern und beschloss stillschweigend, noch vor meinem vierzigsten Geburtstag den kompletten South West Coast Path zu wandern.
Ich erzählte allen möglichen Leuten im Freundeskreis davon, bevor ich H einweihte, weil ich überzeugt war, er würde es mir ausreden wollen. Doch weit gefehlt. Er sagte nur: »Okay.« Und: »Darf ich ab und zu mitkommen?« Und dabei beließen wir es zunächst.
Ich kam gar nicht auf die Idee, mich zu wundern, warum er so gar keinen Widerstand leistete – aber das war ja auch drei Monate, bevor ich im Radio jene Stimme hörte, die alles verändern sollte, weil ich endlich etwas Grundlegendes über mich erfuhr. Bis dahin hatte ich lediglich gewusst, dass irgendetwas nicht stimmte. Und ich dachte, vielleicht könnte ich das durch diese Wanderung in Ordnung bringen.
Also: Minehead am letzten Samstag im August. Ich bin in Somerset, nicht in Devon, und die Landschaft, nach der ich mich sehne, befindet sich am anderen Ende des Weges – gut siebenhundert Kilometer von hier entfernt, schätze ich. Ich habe mir einen Plan gemacht, nach dem ich in achtzehn Monaten dort ankommen werde. Das ist noch lange hin, aber egal. Jetzt bin ich hier, und ich atme tief durch, inhaliere die nach Kiefernwald, Essigchips und Salzwasser duftende Luft. In der Ferne sehe ich die graublaue Küste von Wales.
Jetzt habe ich Zeit für mich allein. Jetzt beginnt mein Abenteuer. Vielleicht bringt es mich wieder auf Kurs.
2
Von Minehead nach Foreland Point, August
Ich verlasse Minehead Richtung Westen und stelle schnell fest, dass meine Sorgen bezüglich womöglich nicht ganz ausreichender körperlicher Fitness absolut begründet waren.
Die ersten drei Kilometer geht es bergauf durch den Wald. Der Pfad ist so steil, wie er nur sein kann, ohne dass eine Leiter nötig wird. Ich frage mich, wieso ich das auf der Wanderkarte nicht bereits gesehen hatte, wir haben doch früher in Erdkunde mal was über Höhenlinien gelernt. Schnaufend schleppe ich mich also da hinauf und bleibe an jeder Biegung kurz stehen, um mir die Schuhe fester zu schnüren oder mir die Haare gründlicher zusammenzubinden. Ich schaffe das nicht. Ich weiß, dass ich das nicht schaffe. Ich bin einfach nicht fit genug. Ich habe keine Kraft mehr.
Als ich vor Berts Geburt den zweiten Tag in den Wehen lag, führte H mich über genau solche Pfade. Im einzigen Ratgeber, den wir gelesen hatten, stand, es würde helfen, sich vorzustellen, irgendwo anders zu sein, an einem vertrauten, schönen Ort. Die Schmerzen polterten los, und in seiner Verzweiflung beschrieb H mir die Route von Sharpitor nach Bolt Head in Süddevon, einen schmalen Pfad, der auf eine offene, schroffe Landzunge führte, wo die Grasnelken im Wind raschelten und ein Turmfalke rotbraun zwischen die Klippen schoss. H improvisierte, so gut er konnte, versuchte, in den ermatteten, entrückten Pausen zwischen den Wehen mit diesen Erinnerungen alle meine Sinne abzulenken. Dieser Schmerz ist völlig anders als alles, was du kennst, erklärte ich ihm. Er ist wie eine Flutwelle, als hätte etwas Fremdes von mir Besitz ergriffen.
Als die nächste Wehe heranrollte, führte H mich wieder auf den Pfad, und dieses Mal sah ich überall reife Brombeeren an den dornigen Ranken und spürte den warmen Septemberwind. Mit jedem Ausflug auf den Pfad wurde das Erlebte heller und strahlender. Gleichzeitig war es entsetzlich unangenehm, anstrengend und furchtbar, aber der Zauber des Küstenwegs und die intime Nähe eines Menschen, der wusste, dass das jetzt genau das Richtige für mich war, machte es erträglich.
Heute, in Norddevon, beschleicht mich zwischendurch der Gedanke, ob es mir leichter fallen würde, diesen schier endlosen Aufstieg zu schaffen, wenn ich mich nun umgekehrt zurückversetzte in die damalige Situation bei Berts Geburt. Ich bezweifle es. Dieses Mal habe ich mich immerhin sehr bewusst für die Qualen entschieden, und ich könnte sie jederzeit abstellen, wenn ich wollte.
Nach drei, vier Kilometern (und rund zweihundertfünfzig Höhenmetern) erreiche ich das Plateau von Exmoor, eine komplett andere Landschaft. Ich hätte gedacht, dass der Übergang zum Moor allmählich vonstattengehen würde, aber er ist jäh, als würde man durch eine Tür von einem Raum in einen anderen treten. Der Boden hier buckelt rechts und links des Weges unter einer grauen Wolkendecke. Heidekraut und Ginster breiten lila und gelbe Schleier über alles, grüner Farn sticht daraus hervor. An den Brombeersträuchern hängen herbstschwarze Früchte. In der Luft schwirren unzählige Vögel. Ich habe das Gefühl, sehr weit weg von Minehead zu sein, und ich fühle mich frei. Ich bin allein, es ist still und wunderschön hier, aber alles andere als sanft: Die Farben kreischen, der Himmel droht. Ich bin begeistert. Die Eindrücke fluten meinen Kopf und verdrängen alles andere.
Auf der flachen Hochebene kann ich einen Zahn zulegen. Ich mache so lange Schritte, wie meine Beine es erlauben, und lasse die Luft über meine nackten Arme gleiten. Die Sonne hatte den Zenit schon überschritten, als ich Minehead hinter mir ließ, nun steht sie tief am Himmel, wärmt aber immer noch. Ich laufe und laufe. Es hat keinen Zweck, in dieser immensen Einsamkeit ein schlechtes Gewissen zu haben, es hat keinen Zweck, umzukehren und wieder nach Hause zu gehen. Ich kann nur weitergehen, vorwärts. Vorwärts ist alles, was ich habe. Ich treffe kaum eine andere Seele, abgesehen von einem Mann, der mich im Plauderton anspricht, als ich ihn überhole. Ich drossele nicht das Tempo. Ich habe einen Lauf. Ich ziehe an ihm vorbei und mache mich an den Abstieg bei Hurlestone Point, der so steil und felsig ist, dass meine Oberschenkel vor Schmerz krampfen. Unten angekommen, bin ich fix und fertig. Mir ist, als wäre ein Schalter umgelegt: Meine Beine haben begriffen, wie viele Kilometer sie zurückgelegt haben, und meine Fußsohlen brennen. Ich träume von einer Tasse Tee, einer heißen Dusche und der Gelegenheit, jemandem zu erzählen, dass ich es geschafft habe, ganz allein.
Aber ich habe noch drei Kilometer vor mir. Ich umrunde die Bucht bei Bossington und erreiche Porlock Marsh. Sechs Uhr. Das Feuchtgebiet ist voller Wildblumen, zwischen denen sich Baumskelette in den Himmel recken. Ich wünschte, ich könnte den Duft vermitteln: scharf und grün, wie früh morgens in einem Blumenladen. Hier begegnen mir nun doch ein paar Menschen, manche sind mit ihrem Hund unterwegs, andere mit ihren Kindern, und ich bin plötzlich eine Kuriosität auf wackligen Beinen und mit schweißnassen Haaren. Ich schleppe mich über den riesigen Kiesstrand von Porlock, was meine Füße mir extrem übelnehmen. Ich hätte gute Lust, an Ort und Stelle die Stiefel aufzuschnüren und meine glühenden Füße ins sanfte, kalte Wasser zu stecken, aber ich weiß, dass ich sie danach nicht wieder in die Stiefel hineinbekommen würde, und außerdem ist das Ende ja in Sicht, in wenigen Schritten bin ich bei meinem Mann und meinem Sohn.
Als ich den Garten von Miller’s Hotel erreiche, kann ich über nichts anderes reden als über die Marsch, über den Geruch dort, über das Gelb und Lila auf dem Moor, über das Meer, die Wolken, den Wind. Ich komme mir vor wie eine Überlebende nach einem shakespearianischen Schiffbruch, die seetangbehangen an Land taumelt und von einer magischen Insel erzählt, auf der die Natur unergründlich ist. Ich bin ganz beseelt.
Doch dann fördert Bert eine kaputte Schaufel aus dem Sandkasten zutage, und im Handumdrehen bin ich wieder ganz die gereizte Alte. Nicht den Sand essen! Nicht damit herumschmeißen! Ich glaube, du hast genug gespielt für heute!
Gut vierzehn Kilometer habe ich heute geschafft. Für morgen sind neunzehn geplant. Wenn ich doch nur jetzt schon loskönnte.
Am Abend meiner ersten Etappe gehen wir früh ins Bett, weil wir nicht wissen, was wir sonst tun sollen, schließlich teilen wir uns das Zimmer mit einem Dreijährigen. Ich bin sowieso hundemüde und darum insgeheim dankbar, schon um halb zehn schlafen zu dürfen. Zwei Stunden später wache ich zum ersten Mal auf. Mein ganzer Körper schmerzt: Füße, Waden, Knie, Oberschenkel und Hüften reagieren auf den Stress, den ich ihnen aus heiterem Himmel zugemutet habe. Sogar Arme und Schultern tun weh, nachdem sie den ganzen Tag einen Rucksack tragen mussten. Ich versuche, einfach wieder einzuschlafen, aber sämtliche Körperteile schieben sich mir brennend ins Bewusstsein und hindern mich daran. Schließlich stehe ich auf, suche meine Handtasche und krame zwischen den Krümeln und Haarnadeln ein paar Ibuprofen hervor.
So kann ich wenigstens wieder einschlafen. Aber als wir am nächsten Morgen davon aufwachen, dass Bert lautstark aus dem Bett plumpst, bin ich völlig steif und kann nur dabei zusehen, wie H unseren Sohn vom Boden aufhebt und in die Mulde zwischen uns legt. Ich brauche ewig, bis ich es endlich schaffe, aufzustehen, mich anzuziehen und auf dem harten Stuhl am Frühstückstisch Platz zu nehmen.
»Meinst du, du schaffst das heute?«, fragt H.
»Klar«, sage ich und versorge mich mit so vielen Kalorien wie möglich. »Geht mir bestimmt schnell besser, wenn ich erst mal in Bewegung bin.«
Meine steifen Beine sind heute nicht meine größte Sorge: Der Wetterbericht ist nicht gut. Trotzdem ziehe ich mir die Wanderstiefel an, fährt H mich nach Porlock Weir, verabreden wir uns zum Mittagessen an einem Parkplatz in Exmoor.
Heute fühle ich mich etwas einsamer. Es ist kälter und grauer, und meine Füße tun weh. Im Auto läuft Marlena Shaw, als H mich absetzt, und ohne sie ist es plötzlich so still. Meine Muskeln werden überraschend schnell warm, als ich den Aufstieg nach Culbone antrete, vorbei an einer mit einem Tor gesperrten, noch immer in Betrieb befindlichen mautpflichtigen Straße und einer winzigen, abgelegenen Kirche. Ich stapfe durch einen Wald, wo ein Schild mich an die Borreliosegefahr erinnert, und lese mir durch, wie man eine Zecke entfernt, falls man dummerweise von einer befallen wird.
Es läuft eigentlich ganz gut. Ich genieße die großartige Moorlandschaft mit untersetzten, zotteligen Ponys, deren Fell das struppige Gras zu imitieren scheint. Problemlos finde ich den kurzen, zur Straße führenden Pfad zu meinem Treffpunkt mit H. Ich bin beeindruckt, wie gut ich heute die Karte lesen kann. Und fürchte sogar, zu früh dran zu sein.
Doch dann entpuppt sich dieser auf der Karte so kurze Pfad als ein steiler Zickzackanstieg, für den ich fast eine Stunde brauche. Nach zehn Minuten fängt es an zu regnen, und es regnet sich so richtig ein, sodass ich schließlich anhalte und mir meinen Anorak überziehe. Dann klettere ich weiter, keuchend neige ich mich Richtung Hang. Der Regen schießt in glitschigen Bächen den Pfad hinunter. Es ist mörderisch. Mein Gesicht trieft vor Schweiß und Regen. Mir fehlt die Puste für das hier, und die Power in den Oberschenkeln. Mir geht auf, dass ich vor mich hin brummele und leise fluche, während ich weiterkraxele. Der Regen perlt von meinen Lippen.
Vielleicht habe ich Hunger, fällt mir ein. Ich zerre einen Müsliriegel aus dem Rucksack und vertilge ihn, während ich mich weiter den Pfad hinaufkämpfe. Aber es ist bereits zu spät. In meinem Gehirn ist es bereits dunkel und leer geworden, in ihm lärmt einzig eine hilflose Wut auf leblose Materie: Wanderkarten, Felsen, Matsch, Regen. Ich bin wütend auf die Steigung, ich bin wütend auf die Abgeschiedenheit. Ich bin wütend, hier zu sein. Ich bin wütend, weil es meine eigene Entscheidung war. Ich beschließe, meine Schritte zu zählen, damit ich überhaupt weitergehe. Erst immer wieder bis hundert, dann bis fünfzig, und schließlich bis zehn, weil ich mich ohnehin ständig verzähle.
Als ich unser Auto an der verabredeten Stelle stehen sehe, will ich etwas schneller gehen, aber dadurch werde ich noch langsamer. Ich komme mir vor wie ein Zombie in einem schlechten Horrorfilm, als ich mich absurd entkräftet und völlig verwirrt die letzten Meter bis zum Auto schleppe. Ich lasse mich auf den Beifahrersitz plumpsen und stöhne wie eine Untote. Bert sitzt hinten und schläft. Die Fenster sind alle beschlagen.
»Nicht gut?«, sagt H.
»Absoluter Horror«, sage ich.
Wir steuern einen Pub an, um dort zu essen, aber ich habe keinen Appetit. Mir ist einfach nur kalt, und ich bin müde. Es regnet weiter in Strömen. Wir bezahlen und setzen uns wieder ins Auto. Bert sagt – mir unbegreiflich, wie er darauf kommt –, er will jetzt Minigolf spielen. H fährt mich zurück zu dem Parkplatz, an dem er mich eingesammelt hat, und sagt: »Kopf hoch. Solange das Meer rechts von dir ist, hast du dich nicht verlaufen.«
Ich brauche erst mal eine geschlagene halbe Stunde, bis ich wieder zurück auf dem eigentlichen Wanderweg bin, was mich einigermaßen demoralisiert, obwohl es bergab geht. Auf meiner Karte ist ein Pfad verzeichnet, der direkt den Hang hinunterführt, aber im echten Leben ist das eine fast senkrecht abfallende, matschige Böschung voller Brombeerranken und Nesseln. Ich schufte mich die paar Meter, die ich bereits hinabgestiegen war, wieder hinauf und entscheide mich für die längere Route, die ich eigentlich vermeiden wollte.
Kaum habe ich den SWCP wiedergefunden, brauche ich eine Pause. Ich hätte die Route mittags nicht verlassen sollen. Ich hätte Brote mitnehmen und mich nicht von einem warmen, trockenen Pub und einem netten Plausch mit meiner Familie locken und ablenken lassen sollen. Das war eine Schwäche, der ich nicht hätte nachgeben dürfen. Jetzt bin ich schlauer. Der Weg führt nun wieder durch Wald, er ist sehr schmal, gerade mal breit genug für meinen Schritt, und folgt einem zweihundert Meter steil ins Meer abfallenden Abhang. Ich rutsche mehrmals aus und stelle mir vor, wie ich auf dem Weg da runter wie eine Flipperkugel von Baum zu Baum pralle.
Ich überquere einen vom Regen angeschwollenen Wasserlauf, setze mich dann auf einen nassen Baumstamm und leere meine Thermosflasche mit Tee. Danach beschließe ich, das zu tun, was ich im Wald immer gerne mache, nämlich »Frischluft-Pipi«, wie Bert es nennt: So fließt mein eigener kleiner Bach den nassen Hang hinunter. Dann richte ich mich auf und rutsche prompt darin aus. Ich bleibe einen Moment auf dem Boden sitzen und betrachte meine leicht angeschürften Handflächen, so schlimm ist es nicht. Den größten Schaden hat wohl meine Würde genommen, aber außer mir weiß das ja niemand. Ich rappele mich auf. Vorwärts. Weiter.
Ich setze die Füße jetzt etwas vorsichtiger. Ich bin nicht trittsicher, das hat sich auf diesem durchnässten Boden bestätigt, und jetzt habe ich langsam das Gefühl, regelrecht in Gefahr zu sein. Ich überquere noch fünf Wasserläufe und entwickele ein Ritual: Ich halte jedes Mal hinterher meine Hand ins Wasser und benetze meine Stirn damit. Damit danke ich den Strömen dafür, dass ich heil auf die andere Seite gekommen bin. Das ist alles, was ich habe.
Meine Knie schmerzen, sie reagieren auf den Stress, exakt auf dem Pfad bleiben zu müssen. Ein Blick auf die Karte verrät mir, dass ich Desolation Point erreicht habe, ganz in der Nähe eines Weilers namens Desolate, was so viel heißt wie trostlos. Ich gestatte mir ein trockenes Lachen und schreibe H, er soll bitte nach Countisbury statt nach Lynmouth kommen, was für mich ungefähr drei Kilometer näher ist. Die kann ich morgen aufholen. Für heute bin ich erledigt.
H antwortet nicht. Nach einer halben Stunde rufe ich ihn an und hinterlasse eine Nachricht auf seiner Mailbox. Inzwischen habe ich Foreland Point erreicht, eine in den Bristolkanal ragende, felsige Landzunge, die östliche Flanke der Bucht von Lynmouth. Ich marschiere weiter auf einer steil abfallenden Teerstraße und hoffe, dass H bald zurückruft. Tut er aber nicht. Als ich den weißen Leuchtturm erreiche und feststelle, dass ich vom SWCP abgekommen bin und einen Umweg von fast einem Kilometer gemacht habe, brennt die letzte Sicherung bei mir durch, und ich schreibe eine ziemlich wütende Nachricht an H. Ich kann von Glück reden, dass sie gar nicht rausgeht. Ich betrachte eine Weile den Leuchtturm, dann drehe ich mich um und mache mich wieder an den Aufstieg. Die Dämmerung setzt ein, ich hätte jetzt in Lynmouth sein sollen. Erst als ich die hundertzwanzig Höhenmeter bis auf den Rücken der Landzunge fast erklommen habe, klingelt endlich mein Handy. H klingt ganz schön panisch.
»Ich bin gerade nicht gut auf dich zu sprechen«, sage ich.
Er hat stundenlang versucht, irgendwo Handyempfang zu kriegen. Ich bemühe mich, ihm über die schlechte Verbindung zu erklären, wo ich bin, und gehe dann wieder zurück zu der Straße, wo ich mich auf meinen Rucksack setze und warte. Erst da werfe ich wieder einen Blick auf die Karte und stelle fest, dass ich nur zehn Minuten von Countisbury entfernt gewesen war. Und dass ich meine Gesamtstrecke durch den bescheuerten Mittagessensausflug und diverse Schlenker und falsche Abzweigungen wohl um gut drei Kilometer verlängert habe.
Ich dachte, wenn H kommt, dann bin ich stinksauer auf ihn, aber als ich unseren Škoda um die Kurve tuckern höre, weiß ich, dass ich einfach nur dankbar bin. Ich habe ein Team, das mich unterstützt, auch wenn es an der Mobilfunkverbindung hapert.
»Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung«, sagt er, als ich einsteige. »Ist ganz schön gefährlich da draußen.« Erst jetzt sehe ich, dass wir von dichtem Nebel umgeben sind. Keine Ahnung, wann der klammheimlich aufgezogen ist und ob ich auch durch Nebel gewandert bin. Und obwohl mir die letzten drei Kilometer bis zu meinem Tagesziel fehlen, bin ich einfach nur erleichtert.
»Du hast gestern und heute um die zweiunddreißig Kilometer geschafft«, sagt H. »Andere Leute machen noch zehn mehr und nennen es Marathon.«
»Die rennen aber«, sage ich.
»Manche gehen.«
»Und die machen das an einem Tag.«
»Darum geht es nicht.«
»Mann, bin ich schlecht in Form. Ganz schön peinlich.«
»Und weißt du, wie du in bessere Form kommst?«, sagt H. »Indem du genau solche Wanderungen machst. Nächstes Mal wird es dir schon leichter fallen.«
Der hat gut reden. Ich kauere mich in den Sitz und ziehe mir die Kapuze des Anoraks tief ins Gesicht.
3
Von Foreland Point nach Ilfracombe, September
Ich verweigere mich jeglichen Feierlichkeiten zu meinem achtunddreißigsten Geburtstag, bevor ich nicht mein persönliches Duell mit Foreland Point ausgefochten habe.
Wir fahren früh los, Bert lassen wir bei Freunden, die später dazukommen werden. Am späten Vormittag passieren wir Minehead, wo meine Etappe des letzten Monats begann, und schon bald durchqueren wir die markante Landschaft von Exmoor mit gelbem Ginster und lila Heidekraut. H schlägt vor, in Countisbury zu parken, westlich der felsigen Landzunge, die mich letztes Mal in die Knie zwang.
»Nein«, sage ich. »Ich will da einsteigen, wo ich aufgegeben habe.«
»Aber du hast doch durch deine Umwege trotzdem ausreichend Strecke gemacht. Du musst die paar Kilometer nicht nachholen.«
»Ist mir egal.«
»Okay, aber da können wir nicht parken. Wir müssen anderthalb Kilometer laufen, um an die richtige Stelle auf dem Weg zu kommen.«
»Ich werde jetzt nicht, um eine Viertelstunde Marsch zu sparen, einen Teil der Strecke auslassen. Damit fange ich gar nicht erst an.«
Ich hätte nie gedacht, dass gemeinsames Wandern mit H zu den Verlusten gehören würde, die Berts Geburt mit sich brachte, aber es ist sogar einer der größten. Wir fingen mit dem Wandern an, als ich an der Uni war, um die öden Sonntage, an denen alle Läden geschlossen waren, irgendwie sinnvoll zu gestalten. Wir besorgten uns einen Pub-Wanderführer und glaubten ernsthaft, uns nach einer gemütlichen Runde von fünf Kilometern ein paar Bierchen redlich verdient zu haben. H ist kein geborener Wanderer. Er hat Schuhgröße 48, und laut dem Orthopäden, der ihn mal nach dem Bruch eines Mittelfußknochens operierte, ähneln seine Füße »eigentlich eher Flossen« und können »nur gerade so als normal durchgehen«. Das sind herrliche Zitate, mit denen ich H immer mal wieder aufziehen kann, aber de facto bedeutet es, dass H sich bei jedem Spaziergang übelste Blasen zuzieht. Wofür er nichts kann. (Was ich lange Zeit nicht kapierte.)
Wir parken, und er macht eine Wissenschaft daraus, zwei Paar Socken übereinander anzuziehen und die Schnürsenkel mehrmals neu zu binden, bis sie nicht zu stramm und nicht zu locker sind. Nach ein paar Metern wird er ohnehin stehenbleiben und das Ganze noch einmal durchexerzieren, ich kenne das. Aber das Meer ist blassblau und gepunktet von den Schatten der Wolken darüber, und der beim letzten Mal noch grüne Farn lässt jetzt schon alles ein bisschen rostig aussehen.
Erst bewegen wir uns im Zickzack die Straße zum Küstenweg hinunter (H bleibt zweimal stehen), dann machen wir uns daran, die Landzunge zu erklimmen. Ich weiß nicht mehr, wie weit ich letztes Mal kam, an welcher Stelle ich aufgab und umkehrte, aber jetzt wird klar, dass ich das Schlimmste bereits hinter mich gebracht hatte. Hätte ich doch nur mehr Selbstvertrauen gehabt, anstatt an mir und meinen Kräften für diese letzte Anstrengung zu zweifeln. Dann hätte ich es wenigstens bis nach Countisbury geschafft, und das hätte sich wie ein akzeptabler Punkt auf der Strecke angefühlt, besser jedenfalls als der Straßenrand.
Oben auf dem Hochmoor kommen wir an einer Herde grasender Exmoor-Ponys vorbei und müssen immer wieder aufpassen, nicht auf die glänzend schwarzen Käfer zu treten, von denen es auf dem Weg größere Ansammlungen gibt. Durch die Luft schwirren jede Menge Vögel, die ich wahnsinnig gerne bestimmen können würde. Nach anderthalb Stunden gemäßigtem Marsch erreichen wir Lynmouth. Das war ja ein Klacks. Teile der Strecke waren fast ein bisschen langweilig, führten dicht an Straßen entlang und an Sportplätzen vorbei. Wir setzen uns in den Garten des Rock House Hotel, stoßen mit einem Tribute Pale Ale auf meinen Geburtstag an und teilen uns eine Tüte Chips. Kurz darauf kommt Bert über die Fußgängerbrücke auf mich zugerannt und ruft »MummyMummyMummy!«, und alles ist wieder gut.
Nach meiner ersten Etappe grämte ich mich tage- und wochenlang, weil ich in meinen Augen versagt hatte.