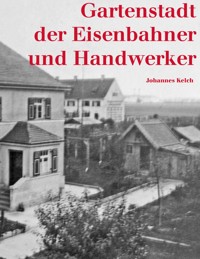7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
August Exter (1858 -1933) war Architekt und Regierungsbaumeister. Bereits im Alter von 25 bis 27 Jahren leitete er ein großes Siedlungsprojekt, das Überschwemmungsopfern einer Kleinstadt ein neues Dach über dem Kopf verschaffte. Auf der Basis seiner Erfahrung begründete er einen neuartigen Siedlungstypus, die Gartenstadt für ein breites Spektrum des Mittelstandes. Um auch Handwerkern, Künstlern und einfachen Kaufleuten die Ansiedlung in einer Gartenstadt zu ermöglichen, bot er Häuser zum günstigen Festpreis an, so dass die Käufer vorab wissen konnten, welche finanzielle Belastung sie zu tragen hatten. Um die von anderen Architekten als unrealistisch und daher unseriös kritisierten Angebotspreise einhalten zu können, rationalisierte Exter den Haus- und Siedlungsbau. Er ermittelte per Experiment, dass Kellerwände und -decken, die mit dem Kies-Sand-Gemisch der Münchner Schotterebene und Zement hergestellt wurden, die benötigte Tragfähigkeit hatten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gliederung
Vorwort
Teil 1: 19. Jahrhundert
Veränderungen in Staat und Gesellschaft
Stadtentwicklung und Siedlungsbau
Teil 2: Exters Projekte bis 1900
Bau der Neustadt in Wörth am Main
Villenkolonie I in Pasing-Obermenzing
Wettbewerb „Das bürgerliche Einfamilienhaus“
Villenkolonie II in Pasing-Obermenzing
Terrain für die Trasse einer Straßenbahn
Das Projekt “Große Genossenschaftsstadt” in Laim
Teil 3: Siedlungsbau 1901 - 1918
Gartenstädte 1901 - 1910
Gartenstädte 1911 - 1918
Teil 4: Projekte Exters von 1901 - 1918
Große Gartenstadt für das Automobilzeitalter
Arbeitersiedlung in Gröbenzell
Gymnasiumskolonie in München-Pasing
Siedlung Blutenburg
Teil 5: Siedlungsbau 1919 bis 1932
Teil 6: Fachfragen
Die ersten Gartenstädte
Terrainspekulation: hohe Risiken und Gewinne
Zweckmäßiges und funktionales Bauen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert
Geometrischer und malerischer Städtebau
Bauliche Hygiene-Fortschritte
Siedlungsgründung in Bayern (vor 1918)
Exters Rationalisierung und Preisreduzierung des Bauens
Teil 7: Zur Person
Biographie
Positionen
Teil 8: Gestaltung und Ideen
Denkmal- und Ensembleschutz
Ein außergewöhnliches Sanierungs- und Denkmalschutzprojekt
Vorschläge, Initiativen für historische Siedlungen
Resümee
Nachwort
Bildnachweis
Vorwort
Heute wohnen viele Leute im eigenen Haus mit Garten. Das war nicht immer so. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gab es für die meisten Menschen keine Chance, der Armut auf dem Lande und in den Städten zu entkommen.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es nur reichen Menschen möglich, Wohneigentum zu bilden. In den wachsenden Großstädten bauten vermögende Unternehmer Mietshäuser und forderten für ihre Wohnungen hohe Mietzinsen. Etwa ab Mitte des Jahrhunderts entstanden erste Arbeiter-, Werks- und Zechenkolonien; doch hier fanden, wenn überhaupt, nur ausgewählte, für Firmen wichtige Arbeiter ein Dach für ihre Familien. Der Bau eines eigenen Hauses in einer Villenkolonie blieb dem Großbürgertum vorbehalten, das sich teuere Einzelbauprojekte leisten konnte.
Abgesehen von sozialistischen und kommunistischen Strömungen ging die Initiative zu einer Veränderung der untragbaren Wohnverhältnisse zunächst von der Genossenschaftsbewegung aus. Victor Aimé Huber, ein Pionier der Wohnungsbaugenossenschaften, verfolgte schon vor der Jahrhundertmitte das Ziel einer „Verwandlung eigentumsloser Arbeiter in arbeitende Eigentümer“.
Neben diesem genossenschaftlichen Entwicklungsstrang gab es jedoch auch eine andere Entwicklungslinie: den privaten Siedlungsbau für den wachsenden neuen Mittelstand. Hier war der Aufstieg aus der Armut ins private Wohneigentum und die Verknüpfung der Vorteile des Stadt- und Landlebens die grundlegende Idee. Im 20. Jahrhundert setzte sich die Schaffung privater Einfamilienhäuser und entsprechender Siedlungen durch, bis heute erfreut sie sich hoher Akzeptanz.
Der Architekt und Regierungsbaumeister August Exter hat in Projekten vor 1900 die für das 20. Jahrhundert typische Einfamilienhaus-Siedlung begründet, in der sich auch weniger betuchte Leute ein Haus leisten konnten. Sein Konzept: Rationalisierung des Haus- und Siedlungsbaus mit Standardplänen, Preisreduzierung durch Verzicht auf Bodenspekulation sowie Bauweise en gros (economy of scale), Siedlungen (“Gartenstädte”) jedoch nicht neben einer Fabrik, sondern im Umland der Großstadt, in der Natur, in der Nähe des Bahnhofs.
München 2022 Johannes Kelch
Teil 1: 19. Jahrhundert
Veränderungen in Staat und Gesellschaft
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts traten in Deutschland neue rechtliche Grundlagen des Bauens und Planens in Kraft. In diesem Bereich setzten sich mehr und mehr Interessen der Kapitaleigner durch. Unternehmer konnten nun Grund erwerben und verwerten. Der Staat sah sich nicht in der Pflicht und Zuständigkeit, Familien Wohnungen zur Verfügung zu stellen.
Nach dem Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation im Jahr 1806 endete zunehmend die Jahrhunderte alte landesfürstliche Planungshoheit. Nach dem Vorbild des Code Civil von 1806 in Frankreich betonten nun auch in Deutschland zivilrechtliche Regelungen mehr und mehr den Grundsatz der Unantastbarkeit des Privateigentums. Damit wurden der freie Bodenhandel und die Baufreiheit begründet (1). Wann, wo und wie sich diese Neuerungen durchgesetzt haben, war nicht Gegenstand dieser Arbeit.
Privateigentum, Bodenhandel und Baufreiheit
Die sich gerade erst bildende neue „öffentliche Hand“ (Gemeinden, Länder, Staaten) gewann die Zuständigkeit für die Planung, private Bauunternehmer und Bauherren konnten nun im Rahmen der öffentlichen Planungshoheit beim Bau von Häusern ihre ureigenen Ziele (Grundstücksverwertung, Gewinne) verwirklichen. Die neue Rollenverteilung klappte nach Darstellung der Professorin für Städtebau, Raumordnung, Landesplanung und Stadtbaugeschichte, Hildegard Schröteler-von Brandt, anfangs nicht: „In den ersten Jahrzehnten der Übergangsphase vom 18. ins 19. Jh. und z.T. bis 1850 taten sich die Baubeamten, die Baumeister und die Landesregierungen in Deutschland schwer, die neuen Bedingungen und Grenzen ihres Einflusses zu erfassen. Zwischen der Planungsidee und der Planungswirklichkeit bzw. –umsetzung lagen oftmals Welten (…)“ (2). So wurden wesentlich weniger Wohnungen gebaut, als notwendig gewesen wären, um der Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden. Die Folgen: Die ohnehin bereits voll belegten Wohnhäuser mussten immer mehr Menschen (Familienmitglieder und „Schlafgänger“) aufnehmen. Rings um die wachsenden Städte entwickelte sich zum Teil eine wilde, slumähnliche Bebauung. Die prekären Wohnverhältnisse insbesondere in den Arbeiterquartieren entwickelten sich bis ins 20. Jahrhundert zu einer Katastrophe mit Seuchen und Krankheiten.
Bevölkerungswachstum
Während des gesamten Jahrhunderts stieg die Zahl der Menschen, die in Deutschland lebten. Welche Faktoren gaben hierfür den Ausschlag? An einer verbesserten Wohnsituation kann es kaum gelegen haben, denn die hygienischen Verhältnisse (Fäkalien auf den Straßen und in den Gewässern) verschlimmerten sich mit der Bevölkerungszunahme.
Medizinische Fortschritte hatten sicher eine wesentliche Bedeutung. Die erste Impfung überhaupt, die obligatorische Pockenimpfung, ermöglichte es, tödliche Pockeninfektionen zu reduzieren oder sogar zu eliminieren. Anderweitige medizinische Verbesserungen setzten sich oft erst nach erbittertem Widerstand durch, so Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern zur Vermeidung von Ansteckungen. Der Chirurg Ignaz Semmelweis wies mit seiner Forschung nach, dass vermehrte Fälle von Kindbettfieber in öffentlichen Kliniken auf mangelnde Hygiene bei Ärzten und Pflegepersonal zurückzuführen sind, und setzte sich für die Einführung klarer Hygieneregeln ein.
Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Bevölkerungswachstum hat sicher die Zuwanderung bewirkt. Aus Polen migrierten im späten 19. Jahrhundert viele Arbeitskräfte in das Ruhrgebiet, auch aus Italien kamen sehr viele Zuwanderer nach Deutschland.
Der alte und neue Mittelstand
Während der Begriff Mittelstand heute vor allem für mittelgroße Unternehmen verwendet wird, wurde im 19. Jahrhundert darunter eine mittlere Klasse oder die spätere „Mittelschicht“ verstanden. Den Mittelstand bildeten am Anfang des Jahrhunderts Menschen, die als Bauern, Handwerker, Kaufleute, auch als Lehrkräfte arbeiteten, wenig - vielleicht etwas mehr Geld als die Arbeiter in Diensten von Unternehmern - verdienten, aber dennoch als staatstragend galten. Neben diesem alten Mittelstand wuchs etwa ab Mitte des Jahrhunderts der „neue Mittelstand“: Da sind an erster Stelle „Beamte“ zu nennen, die beim Staat, den Kommunen und bei den damaligen Staatsbetrieben Bahn und Post Beschäftigung fanden. Auch Angestellte, die in privaten Unternehmen im Dienstleistungsbereich (Finanzen, Einkauf, Verkauf, Werbung, Buchhaltung, Import, Export) eingestellt wurden und vielfach ebenfalls „Beamte“ genannt wurden, gehörten dem neuen Mittelstand an. Diese Beschäftigten waren einerseits aufgrund ihrer Ausbildung und Position etwas besser gestellt als die Arbeiter in den Fabriken. Doch auch sie waren schlechten und teueren Wohnbedingungen in den Mehrfamilienhäusern und der Umweltverschmutzung (Lärm, Staub, Ruß, Fäkalien) der Städte ausgesetzt.
Stadtentwicklung und Siedlungsbau
Im 19. Jahrhundert bauten überwiegend Unternehmer in der Peripherie der Großstädte sogenannte „Vorstädte“ mit Mehrparteienhäusern. Etwas weiter entfernt von den Stadtkernen, in unmittelbarer Nähe von Fabriken und Zechen, errichteten ebenfalls Unternehmer Werks-und Zechensiedlungen. Ebenfalls auf Betreiben von Unternehmern entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sogenannte „Villenkolonien“ mit großen Grundstücken und großartigen Wohngebäuden. Das Ziel dieser Siedlungen, die teilweise nur im Sommer bewohnt wurden, lag darin, dem Großbürgertum ein repräsentatives und exklusives Wohnen zu ermöglichen. Doch schon vor Ende des Jahrhunderts kündigte sich ein klarer Trend hin zu Siedlungen für den Mittelstand an, der sich nach der Jahrhundertwende durchsetzte.
Stadterweiterungen: Vorstädte
Stadterweiterungen entstanden teilweise bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Beispiel München: Neben der Altstadt wurde die „Maxvorstadt“ mit einem geometrischen (schachbrettartigen) städtebaulichen Grundrissplan bebaut. Kronprinz Ludwig, später König Ludwig I., engagierte sich mit Grundstücksgeschäften und Druck auf die Stadt, Grund für öffentliche Bauten (zum Beispiel Universität und Staatsbibliothek) zur Verfügung zu stellen. Gelegentlich plante nicht die öffentliche Hand, sondern ein Privatmann.
Vor allem ab 1880 kam es verstärkt in den Städten zum Bau von „Vorstädten“ oder anders benannten Stadtteilen. Sie ersetzten zum Teil eine wilde, ungenehmigte Bebauung mit primitiven Produktions- und Wohngebäuden. Neben Häusern für wohlhabende Familien entstanden sogenannte „Mietskasernen“ auf wenig Raum: „Ein Vorderhaus, zwei Seitenflügel und ein oder mehrere Hinterhäuser bildeten in sehr enger Bauweise einen Baublock. Im Hof befand sich oft noch ein Gewerbebetrieb. Mietskasernen wurden zum Synonym für menschenunwürdiges Wohnen, sie galten den Zeitgenossen als die ‚modernen Ungeheuer der Großstadt‘“ (3).
Paternalistischer Werkswohnungsbau
Im Bau neuer Siedlungen engagierten sich verstärkt nach 1850 vor allem Unternehmer. Zahlreiche Fabrikanten bauten nun in der Nähe ihrer Fertigungsstätten Arbeitersiedlungen und vermieteten Wohnungen oder Häuser an ausgewählte Arbeiter. Die sogenannten Arbeiter-, Zechen- und Werkskolonien dienten vor allem dem Zweck, fähige Arbeitskräfte an die Fabrik zu binden und für Qualität und Kontinuität in der Produktion zu sorgen. Die Wohnverhältnisse in den einfachen Häusern waren alles andere als komfortabel. Die Siedlungshäuser waren klein, oft hauste eine Familie in einem Arbeiterhäuschen auf 50 bis 60 Quadratmetern und nahm noch „Schlafgänger“ und „Kostgänger“ auf.
Eine der ersten Siedlungen des von Unternehmern initiierten „paternalistischen“ Werkswohnungsbaus war die 1845 gegründete Arbeiterkolonie „Eisenheim“ in der Stadt Oberhausen. Zwischen 1860 und 1887 errichtete der Stahlunternehmer Alfred Krupp in unmittelbarer Nähe zu seinen Fabriken mehrere Arbeiterkolonien. „Allerdings war es nicht die damalige Firmenleitung, sondern der Unternehmer Alfred Krupp (1812– 1887) persönlich, der dieses Siedlungsprogramm bereits Ende der 1850er Jahre anregte und bis zu seinem Tod 1887 über mehrere Jahre hinweg systematisch vorantrieb.“ (4)
Wie desolat die Wohnverhältnisse in den Werkskolonien sein konnten, illustriert das Beispiel der Arbeitersiedlung „Döhrener Jammer“ in Hannover, die 1869 neben einer Wollwäscherei und –kämmerei gegründet wurde: „Die kleinen einstöckigen Backstein-Reihenhäuser nahmen pro Familie sechs bis acht Arbeiterinnen als sogenannte ‚Aftermieter’auf. Die in der Regel fünfköpfige Familie lebte im Erdgeschoss auf 28 m2, während im Dachgeschoss meist sieben weitere Arbeiterinnnen Quartier fanden, auf zwei Kammern verteilt.“ (5)
Gelegentlich engagierten sich Fabrikanten, um ihren Arbeitern mehr als das Existenzminimum zu sichern. Ein Unternehmer, der eine Baumwollspinnerei in der Gemeinde „Kuchen“ - nahe Geislingen an der Steige in Baden-Württemberg - leitete, bot nicht nur Wohnungen, sondern auch Kultur-, Freizeit-, Versorgungs- und Gesundheitseinrichtungen. „Die Arbeitersiedlung Kuchen hatte einen experimentellen Charakter, verschiedene Baustile kommen zur Geltung. Das erste Arbeiterwohngebäude mit fünf Wohnungen wurde 1858 erbaut. Vor diesem Gebäude wurden Blumen- und Gemüsegärten mit genauen Nutzungsvorschriften angelegt. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts kamen weitere Gebäude hinzu, so beispielsweise das Stiegenhaus mit dem Speise- und Festsaal. Hier kamen auch erstmals wasserdampfbetriebene Aufwärmapparate zur Erwärmung des mitgebrachten Essens zum Einsatz.“ (6).
Philanthropische Arbeiterdörfer
Die erste Arbeitersiedlung in Stuttgart, das „Postdörfle“, entstand zwischen 1869 und 1871als Wohngebiet für die einfachen Arbeiter der Bahn und der Post. Auch diese Siedlung bot mehr als eine kleine und karge Unterkunft: Gemeinschaftshäuser mit Bad- und Speiseanstalt (7).
Für Siedlungen, die den Arbeiterinnen und Arbeitern etwas mehr Komfort und Lebensqualität als eine Miniwohnung zu bieten hatte, bürgerte sich die Qualifizierung „philanthropisch“ ein. Dieses Prädikat wurde den Unternehmern Isaac und Napoleon Leumann aus der Schweiz verliehen, die ab 1877 im etwa zehn Kilometer von Turin entfernten Collegno (Endstation der Straßenbahn) die Baumwollfabrik Cotonificio Leumann betrieben und daneben das Arbeiterdorf „Villagio Leumann“ bauten. Diese Siedlung glänzte mit einer Klinik, einer Wäscherei, einer Kirche, Speisesaal, Kindergarten, Gymnasium, Badehaus und Lebensmittelladen, auch einer Pension für junge Arbeiter sowie mit Gartenparzellen (8). Ein wesentliches Motiv zur Siedlungsgründung war hier, die vom Lande zuziehenden Arbeitskräfte, vielfach junge Frauen, zu gewinnen, zu halten und vor Gefahren der Großstadt Turin zu schützen. Arbeiter-, Werks- und Zechenkolonien blieben Eigentum der Unternehmer, die für ihre Geschäftstätigkeit Arbeitskräfte benötigten. Arbeiter hatten allenfalls nach Stilllegung eines Betriebs die Chance, ein Häuschen oder eine Wohnung zu erwerben.
Stiftung Meyer’sche Häuser
Nur selten wurde durch den uneigennützigen Einsatz privaten Kapitals versucht, die Wohnungsnot des Proletariats zu lindern. Ein herausragendes Beispiel für unternehmerische Uneigennützigkeit ist das Engagement des Verlegers Hermann Julius Meyer („Bibliographisches Institut“, Herausgeber von „Meyers Konversationslexikon“). Meyer gründete in Leipzig in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts den „Verein zur Erbauung billiger Wohnungen“ und investierte zwei Mio. Mark Startkapital. Die ersten Wohnhäuser wurden 1888/89 in Leipzig-Lindenau errichtet. Die im Jahr 1900 in die „Stiftung „Meyer’sche Häuser“ umgewandelte Organisation überlebte Nationalsozialismus und DDR und bietet heute noch mehr als 2500 Wohnungen. Kennzeichen der Wohnanlagen sind große Innenhöfe, wuchtige Baublöcke mit einer deutlichen Fassadengliederung durch hervorgehobene Treppenaufgänge und Türme.
Die Stiftung würdigt Meyers Engagement mit diesen Worten: “Er machte sich am Ende des 19. Jahrhunderts um eine Reform des Mietwohnungsbaus für Arbeiter und kleine Angestellte verdient. Sein Credo lautete ‘Wohltat, nicht Wohltätigkeit!’. Das bedeutete: niedrigere Mieten als auf dem freien Markt, einfache - jedoch zweckmäßige und gesunde Wohnungen mit grünen Innenhöfen und Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. eigene Kindergärten!) sowie bestimmte Elemente der Selbstverwaltung (z.B. Vertrauensleute der Mieterschaft).“ (9)
Villenkolonien am Rande von Städten
Ganz anders stellte sich die Lage der Eigentümer prosperierender Firmen dar, die neben ihren Fabriken die eigenen Arbeitersiedlungen und oft weiteres Eigentum, zum Beispiel Aktienpakete, ihr Eigen nannten. Meist wohnten sie in einer Unternehmervilla neben ihrer Fabrik. Doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekamen sie am Rande weniger Großstädte oder eines größeren Industriestandorts die Chance, in bester Lage an einem See oder auf einem anderen attraktiven Areal eine große, repräsentative, manchmal weithin sichtbare Villa zu errichten. Solche Villenkolonien entstanden auf Initiative eines Investors, der größere Ländereien aufkaufte und dann der zahlungskräftigen Kundschaft aus Unternehmerkreisen Grundstücke für ihr Einzelbauprojekt veräußerte. Hier wurde sodann eine großartige Villa nach Belieben, meist historischen Vorbildern wie Burgen oder Schlössern errichtet.
Marienthal, eine der ersten Villenkolonien in Deutschland, entstand ab 1857 am Rande von Hamburg. Der Investor war hier der Kaufmann und Immobilienentwickler Johann Anton Wilhelm von Carstenn. Er erwarb ein großes Gut und gab dem Baugebiet den Namen. Carstenn begründete auch im Zeitraum von 1860 bis 1880 die Berliner Villenkolonien Lichterfelde, Wilmersdorf und Friedenau. Die Bebauung zog sich über Jahrzehnte hin.
Eine der ersten Sommervillenkolonien entstand als „Colonie Alsen“ am Wannsee in Berlin ab 1863. Begründet wurde diese „Landhauskolonie“ von dem Berliner Bankier Wilhelm Conrad. Eine großzügige Parkanlage, das Leben in der Natur und am Wasser zog in den Sommermonaten Industrielle, Bankiers, Geschäftsleute, Künstler und Wissenschaftler an den See, der damals noch weit entfernt von der Großstadt Berlin lag.
Kolonie und Kurort
Dresden, im 19. Jahrhundert eines der Zentren der industriellen Entwicklung Deutschlands, bekam 1872 „eine Colonie der Villen und Sommerfrischen“ namens „Weißer Hirsch“, gegründet von dem Seifenfabrikanten Ludwig Küntzelmann, der sich hier als Immobilienentwickler betätigte. Durch ein Sanatorium wurde die Kolonie zusätzlich ein „Kurort“.
Zu den ersten Städten mit Villenkolonien zählte auch die thüringische Stadt Eisenach. Im heutigen Südviertel entstanden ab 1862 auf den überwiegend auf Anhöhen gelegenen Gebieten Karthäuserhöhe, Marienhöhe, Marienthal und Predigerberg malerisch in der Landschaft platzierte Villen. Die ursprüngliche Bebauung ist weitgehend erhalten.
Millionärskolonie Grunewald
In Berlin setzte sich die Villenkolonie Grunewald gegen Bedenken und Ablehnung in der Bevölkerung durch. Karl-Heinz Metzger hat die Entstehung kritisch beleuchtet: „Wahrscheinlich war die Villenkolonie Grunewald als ‚Millionärskolonie‘ die spektakulärste Wohnsiedlung Berlins. Sie zog Staunen, Verwunderung, Neid, Hass oder Verachtung auf sich, kalt ließ sie niemanden. Schon der Gassenhauer, der ihre Entstehung begleitete, bringt die ambivalenten Reaktionen der Berliner zum Ausdruck: ‚Im Grunewald, im Grunewald ist Holzauktion‘. Auch damals war es bereits höchst unpopulär, für eine Siedlung Bäume zu fällen, der Grunewald war als Erholungsgebiet für die gesamte Bevölkerung wichtig.“ (10)
Villenkolonie-Gründer in Kalamitäten
Die Finanzierung des Grundstückskaufssowie der Planung und des Baus der Infrastruktur von Villenkolonien stellte die Gründer und Immobilienentwickler von Villenkolonien vor erhebliche Probleme. Ein Beispiel dafür ist die Villenkolonie Marienburg in Köln, die ab 1867 entstand. Der Gründer Ernst Leybold, ein Unternehmer, musste nach einiger Zeit den Gutshof Marienburg verpachten und in eine Mietswohnung ziehen. Erst um und nach der Jahrhundertwende, Jahrzehnte nach der Gründung, erlebte die Villenkolonie durch die Bebauung mit palastähnlichen Wohngebäuden einen enormen Aufschwung.
Auch der oben genannte Gründer von Villenkolonien in Hamburg und Berlin, Johann Anton Wilhelm von Carstenn, geriet in finanzielle Schwierigkeiten: „Carstenn hatte 1870 das Gelände des ehemaligen Wilmersdorfer Rittergutes gekauft und ließ hier die heutige Bundesallee anlegen. Carstenn, der als Initiator privater Stadtplanung galt, wollte hier eine Landhaussiedlung errichten. Er ließ erste Bebauungskonzepte erstellen und lieferte auch die Planungen für die dazugehörige Infrastruktur. Im Zusammenhang mit dem Gründerkrach 1873 musste er allerdings Insolvenz anmelden, wodurch das Gebiet und die bereits angelegten Straßen weitgehend unbebaut blieben. Die Zeit überdauert haben die beiden Carstenn-Figuren als geometrisches System von Straßen und Plätzen im nördlichen und südlichen Abschnitt der heutigen Bundesallee.“ (11)
Der Kunsthistoriker Julius Posener charakterisierte Carstenn als „Spekulanten und Geschäftsmann, der in seinen Geschäften jedoch dem Gedanken an den Nutzen für die Gesamtheit einen gewissen Platz einräumte: einen Typ, der unter den großen Unternehmern der Zeit nicht ganz selten gewesen ist.“ (12)
Völlig verspekulierte sich auch der Unternehmer Heinrich Quistorp, der das Terrain der Villenkolonie Westend 1868 übernahm und mit einer selbst finanzierten Pferdeeisenbahnlinie an Charlottenburg anband. In die Insolvenz führte Quistorp jedoch eine sehr eigenwillige Investition: ein Wasserturm-Gaststätten-Projekt, das mit einem Café und dem hochgepumpten Wasser für Einnahmen sorgen sollte, jedoch so groß angelegt war, dass es lediglich unendliche Ausgaben erzeugte. Nach der Insolvenz des Erbauers Quistorp konnte der “Germaniaturm’ nur mit einer Ladung Sprengstoff wieder beseitigt werden (13).
Genossenschaften: „arbeitende Eigentümer“
Victor Aimé Huber, ursprünglich Mediziner, dann Reiseschriftsteller, Lehrer und Professor, gilt als Pionier der deutschen Wohnungsgenossenschaften. Dreh- und Angelpunkt seiner Ideen war die paternalistische Vorstellung, dass die besser gestellten Menschen den Arbeitern mit Wohnungsgenossenschaften aus der Misere helfen sollten.
Die erste überhaupt in Deutschland und von Huber gegründete Wohnungsgenossenschaft entstand ab 1847 in Berlin. Seine Idee: „die Verwandlung eigentumsloser Arbeiter in arbeitende Eigentümer“ (14). Deutlich erkennbar wird an dieser bei der Grundsteinlegung des ersten Hauses geäußerten Idee der Wille, Arbeitern mit genossenschaftlichem Wohneigentum ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Genossenschaftspioniere der Jahrhundertmitte hatten keineswegs nur die Vorstellung von Mehrfamilienhäusern. Eine 1849 in Bayern erschienene Publikation „Die materielle Noth der unteren Volksklassen und ihre Ursachen“ warb auch dafür, „daß für jede Familie womöglich ein eigenes Haus mit Garten und einem kleinen Grundstück zum Anbau von Kartoffeln u. dgl. allmählich entstehe, wie es z.B. in Lechhausen bei Augsburg, und in der Vorstadt Au, bei vielen Tagelöhnerfamilien der Fall ist.“ (15) Weiter heißt es in der Veröffentlichung: „Freilich wird immer nur ein kleiner Theil der Arbeiter ein so glückliches Loos erreichen, allein die Regierung kann und soll auf jede Weise ein solches System einführen und durch verschiedene Begünstigungen befördern.“ (16)
Meilenstein: Schutz von Hab und Gut
Ein ganz wesentlicher Meilenstein für die Genossenschaftsbewegung war ein 1889 eingeführtes Genossenschaftsgesetz mit einer begrenzten Haftungspflicht für die Mitglieder bei einer Insolvenz. Ein Genosse konnte nun nicht mehr mit seinem gesamten „Hab und Gut“ für die Außenstände der Genossenschaft haftbar gemacht werden. Nach Darstellung des VdW Bayern in seiner „Geschichte des sozialen Wohnens“ führte das reformierte Genossenschaftsgesetz zu zahlreichen Neugründungen, 1888 habe es in Deutschland 28 eingetragene Genossenschaften gegeben, 1898 bereits 192 und 1908 insgesamt 848 (17).
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, wer Wohnungsbaugenossenschaften gegründet hat. Das waren nur selten Arbeiter. „Die Initiative zur Gründung von Wohnungsbaugesellschaften ging kaum von Arbeitern aus. Der weitaus größere Teil der Gründungsväter entstammte bürgerlichen Kreisen. …Ihre Idee bestand darin, dass durch eine Verbesserung der Wohnverhältnisse und eine Erziehung zu gesundem Wohnen‘ auch die Gesellschaft verbessert werden könnte“. (18)
Genossenschaften für den Mittelstand
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden auch die Probleme des „Mittelstands“, adäquate Wohnungen zu finden, immer größer. Auch Angehörige des Mittelstands wollten per Wohnungsgenossenschaft zum „Eigentümer“ werden. So entstand in München kurz vor der Jahrhundertwende die Baugenossenschaft der Verkehrsbeamten 1898 eG. Andere Eisenbahner-Genossenschaften folgten.
Privates Wohneigentum für den Mittelstand
Ein anderer, am individuellen Wohneigentum orientierter Entwicklungsstrang führte am Ende des Jahrhunderts zu Siedlungskonzepten, die sich an den wachsenden neuen Mittelstand richteten und kleinere Anwesen (auch Reihenhäuser) im Vergleich zu Einzebauprojekten in Villenkolonien zu günstigen Preisen vorsahen.
Der Unternehmer Jakob Heilmann baute in München nicht nur Villenkolonien, sondern auch ab 1892 die „Familienhäuser-Colonie Nymphenburg-Gern“ mit historistisch gestalteten Reihenhäusern, die deutlich günstiger (7500Mark für vier Zimmer bis 25000 Mark für acht Zimmer) als alleinstehende Villen angeboten wurden. Der Grundstücksanteil war relativ schmal und klein. Aufgrund rascher Preissteigerungen entwickelten sich die ersten Reihenhäuser schon bald zu Spekulationsobjekten (19).
Von 1892 bis 1900 realisierte August Exter in München (Pasing-Obermenzing) die Villenkolonien I und II. Freistehende Einfamilienhäuser wurden hier von Exter zwischen 8000 Mark (drei Zimmer) und 25000 Mark (sechs Zimmer) offeriert. Zielgruppe: ein breites Spektrum des Mittelstands. Die Komplettangebote mit Festpreis umfassten Grundstück, Gebäude und Einfriedung.
Mit Heilmann und Exter engagierten sich im Wohnungsbau zwei Unternehmer und Investoren, die im Vergleich zu den ersten Siedlungsunternehmern über fachliche Kompetenz auf den Gebieten Architektur und Siedlungsbau verfügten und zudem in der Lage waren, die finanzielle Seite von Siedlungsprojekten betriebswirtschaftlich zu kalkulieren.
Möglicherweise gab es bereits vor der Jahrhundertwende im deutschsprachigen Raum weitere private Siedlungsbauprojekte für ein breites Spektrum des Mittelstands. Bei den Recherchen zu diesem Buch wurden jedoch keine anderen Projekte dieser Art ausfindig gemacht.
Es ist übrigens kein Zufall, dass in der Peripherie Münchens die ersten Siedlungen dieser Art entstanden sind. In der Residenz- und Landeshauptstadt existierten vor der Jahrhundertwende nur wenige Großunternehmen, ein prosperierendes Großbürgertum mit immensem Reichtum fehlte und damit die Kundschaft für repräsentative und üppig gestaltete große Villen. Dagegen befand sich der gesamte Mittelstand, der sich aus Angestellten, Handwerkern, kleineren und mittleren Kaufleuten, Ärzten und Apothekern, Professoren und Künstlern zusammensetzte, im Wachsen.
Quellen
(1) Hildegard Schröteler-von Brandt, Stadtbau- und Stadtplanungsgeschichte, Eine Einführung, Stuttgart 2008, S. 82 f
(2) A.a.O., S. 85
(3) VdW Bayern, Die Geschichte des sozialen Wohnens, München 2009, S. 8
(4) Steffen Krämer, Deutsche Unternehmer und ihre Arbeiterkolonien im 19. und frühen 20. Jahrhundert, https://archiv.ub.uniheidelberg.de/artdok/6678/1/Kraemer_Deutsche_Unternehmer_und_ihre_Arbeiterkolonien_2012.pdf, S. 181, aufgefunden am 31.05.2021
(5) https://de.wikipedia.org/wiki/Döhrener_Jammer, aufgefunden am 31.05.2021
(6) https://de.wikipedia.org/wiki/Historische_Arbeitersiedlung_Kuchen, aufgefun den am 31.05.2021
(7) https://de.wikipedia.org/wiki/Postd%C3%B6rfle_(Stuttgart)#/media/Datei:Das_Quartier_der_Staatsverkehrsbediensteten_in_Stuttgart, _Vogelperspek tive,_1872.jpg aufgefunden am 01.06.2021
(8) Vgl. https://www.erih.de/da-will-ich-hin/site/leumann-siedlung, aufgefunden am 01.06.2021
(9) https://www.meyersche-haeuser.de/
(10) https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ueber-denbezirk/geschichte/artikel.181129.php, aufgefunden am 01. Juni 2021
(11) https://de.wikipedia.org/wiki/Carstenn-Figur
(12) zitiert nach Dorle Gribl, Villenkolonien in München und Umgebung, München 1999, S. 15
(13) vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Germaniaturm, aufgefunden am 18.05.2022
(14) VdW Bayern, a.a.O., S. 18
(15) VdW, a.a.O., S. 18, Lechhausen ist heute ein Stadtteil von Augsburg, mit der Vor stadt Au ist die „Au“ rechts der Isar in München gemeint, seit langer Zeit eingemeindet in die Großstadt München, Mitte des 19. Jahrhun derts eine Siedlung mit kleinen Häusern
(16) A.a.O., S. 18
(17) A.a.O., S. 20
(18) A.a.O., S. 18
(19) Dorle Gribl, Villenkolonien in München und Umgebung, München 1999, S. 34
Teil 2: Exters Projekte bis 1900
Neuwörth, die Neustadt von Wörth am Main
Bau der Neustadt in Wörth am Main
Von 1883 bis 1885 war August Exter in Wörth am Main verantwortlich für die Errichtung einer Neustadt mit Straßen, Wasserleitungen, Schule, Armenhaus und knapp 120 Anwesen, die aus der Altstadt „verlegt“, im Klartext neu zu bauen waren. Exter realisierte damit eines der wenigen Projekte im Siedlungsbau, das vom Königreich Bayern im 19. Jahrhundert mit staatlichen Mitteln gefördert wurde. Das Projekt war ein Vorläufer der staatlichen Wohnungsbauförderung. Hier sammelte der 25- bis 27-jährige Architekt wichtige Erfahrungen für Siedlungsprojekte, die er später in München initiierte, plante und ausführte.
Nach einer dreiwöchigen Überschwemmung der eng bebauten und von etwa 1500 Menschen bewohnten Altstadt im November und Dezember 1882 regten die Bürger von Wörth in einer Petition an die bayerische Regierung den Neubau einer Siedlung auf hochwasserfreiem Gebiet an. Der aus Franken stammende bayerische Innenminister, Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch, sowie der Regierungspräsident Unterfrankens, Friedrich Graf von Luxburg, plädierten für die „Ideallösung“ einer kompletten Verlegung von Wörth (Abriss der Altstadt und Neubau der Stadt auf höher gelegenem Terrain). Bereits 1784, 1845, 1862 und 1876 hatte Hochwasser die Gebäude des kleinen Städtchens massiv in Mitleidenschaft gezogen. Der Verlust von „Viktualien“ hatte zu Hungerjahren geführt, die hygienischen Zustände waren lebensgefährlich. Nun wollte man die Lebensverhältnisse der Einwohner ein für allemal wesentlich verbessern (1).
Die radikale „Ideallösung“ wurde jedoch nie realisiert, auch heute verfügt Wörth über eine nahe am Main gelegene Altstadt mit Fachwerkhäusern aus dem Mittelalter. Diese Altstadt wird heute mit Mauern und bei Bedarf geschlossenen schweren Stahltoren vor Überschwemmungen geschützt. In der Regel stehen die Stahltore offen, sie lassen sich jedoch bei höheren Pegelständen und drohenden Überschwemmungen schließen. Das war in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts noch nicht möglich. Die ursprünglich geplante Neustadt mit dem Rathaus bildet heute mit der Altstadt (Römermuseum!) das Stadtzentrum.
Damals brachte der Neubau von Anwesen auf höher gelegenem Terrain für zahlreiche Einwohner eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse. Die neuen Anwesen boten wesentlich mehr Wohnraum für die Bewohner (bei kleinen Häusern drei Zimmer, bei größeren mit erstem Stock entsprechend mehr) und zusätzlich Nebengebäude: Ställe und Scheunen, Werkstätten, Holzlege oder eine Remise – je nach Bedarf der Einwohner, die ihren Lebensunterhalt mit einer kleinen Landwirtschaft bestritten oder aufbesserten. Zahlreiche nach den Überschwemmungen abgerissene Häuser in der Altstadt waren nach alten Ansichten außerordentlich klein und sehr eng zusammengebaut.
Vorentscheidungen der öffentlichen Hand
Schon vor der Arbeitsaufnahme Exters in Wörth am Main hat die öffentliche Hand (in Gestalt des Regierungspräsidiums Unterfranken, des Bezirksamtes Obernburg und des Landbauamtes Aschaffenburg) bestimmt, dass als Basis für die Bauaktivitäten wenige Vorlagen für typische Arbeiterhäuser und Nebengebäude als „Normalpläne“ zu verwenden sind. Auf diese Weise bekamen die Planer und Zeichner Vorgaben, mit anderen Worten, sie konnten die Planung stark vereinfachen (dies war dringend erforderlich, denn die Häuser sollten ja so schnell wie möglich gebaut und von den Überschwemmungsopfern bezogen werden). Die bauwilligen Personen konnten nur aus den Normalplänen auswählen und diese durch Modifikationen (zum Beispiel Keller ja oder nein) verändern und ihr Projekt durch Lagepläne positionieren und konkretisieren lassen. Alternativen dazu waren nicht im Angebot, Zuschüsse und Darlehen an die Normalpläne gebunden.
Ebenfalls bereits vor dem Arbeitsbeginn Exters in Wörth begannen die Aktivitäten zum Ankauf der Grundstücke, die für die Neustadt benötigt wurden. Manche Eigentümer von Gartengrundstücken wollten nicht verkaufen, ein Eigentümer war bereits nach Amerika ausgewandert, daher zog sich der Ankauf von Grundstücken hin. Aus den Akten geht nicht hervor, dass Exter mit dieser Aufgabe befasst war. Dies gilt auch für die Bauleitplanung. Die Anordnung der Straßen in einem rechtwinkeligen Baugebiet war bereits durch vorhandene Wege und erste frühere Bebauung vorgezeichnet, eine rechtwinkelige Anlage des Straßenrasters zwischen Bahnhof und Altstadt mit einem Zentrum (Marktplatz/Schule, heute Rathaus) in der Mitte bot sich an (2).
Projektleitung vor Ort
Nach einem Brief des Bezirksamtmanns Weber vom Bezirksamt Obernburg hat das „hohe Regierungspräsidium“ in Würzburg mit einer „Entschließung“ dem Baupracticanten Exter die „technische Oberleitung“ übertragen (3). August Exter übernahm gleich nach dem erfolgreich abgelegten Staatsexamen (4in Verbindung mit 5)– wahrscheinlich im Mai 1883 – die Bauleitung in Wörth. Warum einem 25 Jahre alten Architekten und „Baupracticanten“, der Regierungsbaumeister werden wollte, die Leitung eines derart großen Bauprojekts übertragen wurde, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht zweifelsfrei ermittelt werden.
Eine Erklärung könnte sein, dass andere Architekten es sich nicht zutrauten, in einem neuen Arbeitsgebiet (Siedlungsbau, Straßenbau, Kanalisation, Wasserleitung) fachlich einwandfreie Resultate abzuliefern. Möglicherweise wollten andere Fachleute nicht nach Obernburg oder Wörth umziehen, da sie familiär und örtlich gebunden waren. Eventuell war der an der Technischen Universität München und im Landbauamt Aschaffenburg ausgebildete Architekt aufgrund umfassender Qualifikation schlicht und einfach der ideale Kandidat und Bewerber.
Anwesen in Neuwörth aus der Bauzeit 1883 bis 1885, kleines Wohnhaus, großes Wirtschaftsgebäude im Hintergrund
Zuckerbrot und Peitsche
Vor Ort stieß die Idee der staatlich verordneten und gelenkten „Anwesenverlegung“ nicht sofort und uneingeschränkt auf Gegenliebe, ganz im Gegenteil. Sowohl die Gemeinde als auch eine große Zahl der Bürger von Wörth hatten kein Geld für Bauprojekte, die sie selbst zum Teil finanzieren sollten. Die Armut in der gesamten Region war so groß, dass während des 19. Jahrhunderts viele Einwohner ihr Glück in der Auswanderung nach Amerika suchten. Der Chronist der Stadt Wörth, Werner Trost, schreibt im ersten Band seines vierbändigen Werks, das Königreich Bayern habe damals „Zuckerbrot und Peitsche“ (6) eingesetzt, einerseits baupolizeiliche Abbruchanordnungen erlassen, andererseits unentgeltliche Bauplätze, Zuschüsse in Form von einmaligen Zahlungen sowie günstige Darlehen in Aussicht gestellt. Die Lage war für die arme Gemeinde und die vom Hochwasser betroffene Bevölkerung Anfang 1883 sehr undurchsichtig, so dass Anfang März lediglich 13 Familien sich als Bauwillige zu erkennen gaben.
Überzeugungsarbeit
Welche Rolle Exter im Zusammenhang mit der Überzeugungsarbeit vor Ort spielte, ist nicht ganz einfach zu ermitteln, da hierzu kaum Informationen aufzufinden waren. Der ebenfalls aus äußerst bescheidenen Verhältnissen stammende Architekt konnte sich wohl gut in die Lage der armen, vom Hochwasser betroffenen Bürger in Wörth einfühlen und ihnen die Vorteile eines neuen, größeren, sicheren und geplanten Hauses mit gemauerten Wänden (anstelle von feuchtem Fachwerk und äußerst beengten Wohnverhältnissen) nahebringen. Als Architekt sowie sachkundiger Beirat der Gemeinde in allen Bauangelegenheiten konnte er auf die beachtlichen staatlichen Hilfen (kostenloses Grundstück, Abbruchprämien, einmalige Zuschüsse als „Liebesgaben“ sowie günstige Darlehen) verweisen. Die Baukosten der Häuser beliefen sich auf 2000 bis 6200 Mark, die einmaligen Bauprämien („Liebesgaben“) variierten zwischen 600 und 1600 Mark (7).
Die Zahl der Bauwilligen erhöhte sich nach der Arbeitsaufnahme Exters deutlich. Am 2. Juni wurden 107 Bauwillige gezählt, am 1. Juli 152, aber zuletzt blieben 119 Familien übrig, die sich endgültig für einen Neubau ihres Anwesens entschieden. Exter war auch für die „Anwesenverlegung“ in anderen Orten des Bezirks Obernburg zuständig, zum Beispiel in Obernburg und Kleinwallstadt. Da er später von 160 verlegten Anwesen berichtet, könnte es sein, dass an anderen Orten 40 weitere Anwesen neu gebaut wurden.
Planungsleistung
Dass Exter die sechs „Normalpläne“ nicht selbst angefertigt hat, geht aus den Plänen im Archiv der Stadt Wörth zweifelsfrei hervor. Etwa bis Oktober 1883 unterzeichnete der Projektleiter die Pläne mit „vidi“ und der Information „W“ mit einem Datum. Das lateinische „Vidi“ heißt auf Deutsch „Ich sah“ (oder: „Ich habe zur Kenntnis genommen“ und indirekt „von mir nicht erstellt“), das große W in Verbindung mit einem Datum war mit Sicherheit das Kürzel für „Wiedervorlage“ (8).
Später, ab etwa November 1883, unterschrieb der Projektleiter direkt neben, oberhalb oder unterhalb der Unterschrift eines Bauzeichners, so wie ein Vorgesetzter, der mit seiner Unterschrift dokumentiert, dass er für die Arbeit seiner Mitarbeiter mitverantwortlich zeichnet. Exter nahm sehr wahrscheinlich in der Zusammenarbeit mit den Bauwilligen die Aufgabe wahr, anhand von „Normalplänen“ für größere und kleinere Gebäude deutlich zu machen, wie das künftige Anwesen aussehen könnte, die Kosten diverser Varianten aufzuzeigen, Zuschüsse in einer bestimmten Höhe in Aussicht zu stellen und die monatliche Belastung zu errechnen, die die Bauherren und –frauen künftig für das Darlehen zu schultern hätten. Sicher wurden auch Details besprochen, etwa die bedarfsgerechte Ausgestaltung des Nebengebäudes. Dann hat ein Bauzeichner die von den Bauherren oder –frauen ausgewählte, gewünschte und von ihnen finanzierbare Lösung zu Papier gebracht und unterschrieben. Exter dokumentierte schließlich mit seiner Unterschrift, dass er dieses Ergebnis mitverantwortet (9).