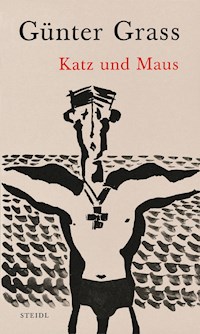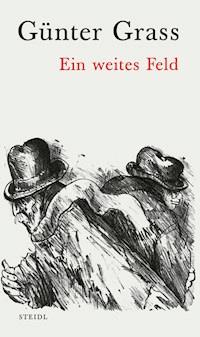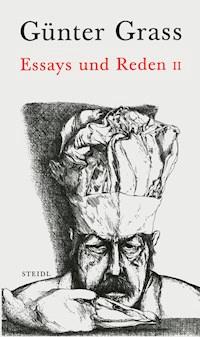Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Längst gehört der Wahlkampf von 1969 der Geschichte an. Viele Schriftsteller und Intellektuelle haben damals Partei ergriffen und Wählerinitiativen angeregt u001e allen voran Günter Grass. Jahre später hat er seine damaligen Tagebuchnotizen dazu benützt, seinen Kindern das Engagement für die SPD, für seinen Freund, den Emigranten Willy Brandt, und gegen den damaligen Bundeskanzler und ehemaligen Nationalsozialisten Kiesinger zu erklären.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Grass
1
Liebe Kinder, heute haben sie Gustav Heinemann zum Präsidenten gewählt. Zwar wollte ich auf Anhieb von Zweifel erzählen, der mit Vornamen Hermann und mit Nachnamen Ott hieß, aber Gustav Gustav geht vor. Es dauerte drei Wahlgänge lang, bis er gewählt war.
(Weil er zweimal Doktor ist, wird er von Hinterbänklern, die im Wirtshaus Rheinlust Wahlen gegen Bierrunden verwetten und sich Kanalarbeiter nennen, doppelt Gustav genannt.) Doch wenn ich genau rechne und jede Verzögerung - nicht nur die Panne beim ersten Auszählen - in mein Sudelbuch schreibe, dann wurde dieser Tag zwanzig Jahre lang vorbereitet, auch wenn er, Gustav Gustav, kaum ahnte, wofür man ihn garkochte und wie zäh in Deutschland nicht nur das Rindfleisch ist.
Der Ort: die Ostpreußenhalle am Funkturm. Draußen gestaffelte Absperrungen gegen Proteste der Außerparlamentarischen Opposition, APO genannt. Drinnen haben sich Christdemokraten und Neonazis zwinkernd als Kumpane erkannt: ihr Kandidat heißt Schröder. (Gustav Gustav, der die parlamentarische Hinterbank kennt und gerne mit juckendem Daumen Skat spielt, ging oft zu den Kanalarbeitern, ohne in ihrem Dunstkreis bierärschig zu werden.) Es riecht unbestimmt. Kugelschreiber in Lauerstellung. Gerüchte wollen wissen, wie viele Liberale käuflich seien. Gerüchte lesen die Stufenfolge der gegenwärtigen Berlinkrise aus blindlings geworfenen Salzstangen. In der Vorhalle fördert Zugluft Gerüchte um den Abgeordneten Gscheidle, den man mit Kopfverband zur Abstimmung rollt. Das Fernsehen hält drauf. Vorahnungen schwellen scheu. Das nicht zu beeilende Aufrufen Abstimmen Auszählen: von Abelein bis Zoglmann…
Ich saß auf der Gästebank. (Nahbei zerknüllte Frau Heinemann ihr Taschentuch.) Als ich, wie immer, wenn was auf der Kippe steht, Sehschlitze machte, gelang es mir, die Halle zu räumen: auch die Bestuhlung zog ab ohne Murren.
Ich kann das, Kinder, mir deutlich was ausdenken.
Noch vor ihrem Auftritt, ihr Eigengeräusch: schaumiges Knistern. Dann sah ich sie unterwegs in der leeren Ostpreußenhalle. Ich versuchte, meinen Atem ihrer Eile anzupassen, mußte atemlos aufgeben.
Oder ähnliche Vorgänge auf Kriechsohlen: wenn sich Anna und ich unsere Ehe rückwirkend auszahlen.
Sie schob sich durchs Bild, war nie mit einem Blick zu fassen, blieb auch im Ausschnitt Teil eines Willens, der vor dem Willen zu weiterem Willen lag und durch Wille gedrängt, auf Breitwand den Raum dehnte.
Vier Kinder, selten alle auf einem Foto versammelt: gegensätzlich geratene Zwillinge, Franz und Raoul, elf - ein Mädchen, Laura in Hosen, acht - und Bruno, immer motorisiert, vier, der wider Erwarten als Dreijähriger nicht aufhören wollte zu wachsen.
Als die Schnecke, Fühler voraus, die Zielmarkierung ahnte, zögerte sie: sie wollte nicht ankommen, wollte unterwegs bleiben, wollte nicht siegen.
Ihr redet mit Anna Schweizerdeutsch - »Mer müend langsam prässiere« - und berlinert mit mir: »Was issen nu wieda los?«
Nur eine Nacktschnecke. Mein langwieriges Prinzip. Erst als ich ihr versprach, ein neues Ziel zu stecken, als ich ihr Zukunft als Fraß scheibenweis schnitt, schob sie sich über die gedachte Linie und verließ die Ostpreußenhalle, ohne den Beifall der sogleich wieder anwesenden Mehrheit, ohne das Schweigen der Minderheit abzuwarten. (Und das sind die Zahlen: Mit den 512 Stimmen der Sozialdemokraten und Freidemokraten gegen die 506 Stimmen der CDU CSU NPD hat am 5.März 1969, bei fünf Stimmenthaltungen, die Bundesversammlung Dr. Dr. Gustav W. Heinemann zum Bundespräsidenten gewählt.)
Seitdem rückt er unsere verrutschte Geschichte und deren Feiertage zurecht. (Als er am Vorabend zu uns in die Niedstraße kam, brachte er zwar Gelassenheit mit, zog aber trotzdem die Brieftasche, zeigte den Haß seiner Gegner: brüchig gewordene Zeitungsausschnitte: die alten Juckwunden.) Ohne Haus. Ich sagte es schon: Nur eine Nacktschnecke…
Sie siegt nur knapp und selten. Sie kriecht, verkriecht sich, kriecht mit ihrem Muskelfuß weiter und zeichnet in geschichtliche Landschaft, über Urkunden und Grenzen, zwischen Baustellen und Ruinen, durch zugige Lehrgebäude, abseits schöngelegener Theorien, seitlich Rückzügen und vorbei an versandeten Revolutionen ihre rasch trocknende Gleitspur.
»Und was meinste mit Schnecke?«
»Die Schnecke, das ist der Fortschritt.«
»Und was issen Fortschritt?«
»Bißchen schneller sein als die Schnecke…«
…und nie ankommen, Kinder. Als wenig später die Testveranstaltungen zugesagt und die Flüge gebucht waren, als der Student Erdmann Linde unser Büro in Bonn bezogen hatte und mit Buntköpfen die Wahlreisen abzustecken begann, als das erste Redenpapier mit mittelfristigem Krimskrams beschrieben war und unser Wahlziel (ungefähr) feststand, als ich zwischen Berlin-Tempelhof und Köln-Wahn zu pendeln anfing, mit kleinem Gepäck ging und mit geschwollener Reisetasche (Mitbringsel) kam, als ich mal weg, mal da und wenn da, doch unterwegs, ein mobiler, regional zerstreuter, kaum faßbarer Vater war, wurde ich von euch, von jedem extra besonders, von allen gleichzeitig viermal vor Fragen gestellt und mit Fragen ins Taxi zum Flughafen abgeschoben: Wann, warum, wie lange und gegen wen?
Bruno hat nachgedacht und weiß, gegen wen. Bevor ich »Also macht’s gut!« sage, sagt er: »Paß aber auf, der Wahlkampf, der frißt dich.« - Denn vom Montag bis zum Freitag sieht Bruno und zeichnet er seinen Vater an Bord eines Walfängers. Breitbeinig im Ölzeug. Mit einer Harpune bewaffnet am Bug: »Da bläst er! Da bläst er!« Im Kampf mit dem Wal, weit weg in Gefahr und knapp gerettet zurück…
»Und wohin gehste jetzt wieder?«
»Und was machste da wirklich?«
»Für wen stehste denn da?«
»Und was bringste mit?«
Was nach dem Start, gesechzehntelt von Schienenstößen oder eingespurt auf der Autobahn sein Datum bekommt und Reizwörter treibt: danach hat alles Bedeutung. - Der Vorwahlkampf begann für mich bei Nieselregen am Niederrhein. In der Stadthalle Kleve sprach ich über »Zwanzig Jahre Bundesrepublik«, eine Rede, die fortan hier schrumpfte, dort tagespolitisch fett wurde und nie ihren Punkt fand. Wenige Tage nach Kleve, am 27.März, traf ein Brief der Stadt Nürnberg ein, der von einem Stadtrat im Kulturdezernat, Dr. Hermann Glaser, unterschrieben war. (Es mag sein, daß er mich beeinflußt hat, Zweifel, der eigentlich Ott hieß, mit Vornamen Hermann zu nennen.) Aus Glasers Brief erfuhr ich, wie rechtzeitig man in Nürnberg mit den Vorbereitungen für das Dürerjahr 1971 begonnen hatte. Ich wurde gebeten, in einer Reihe von Vorträgen einen Vortrag zu halten. Am 24.April dankte Dr. Glaser für die Zusage. Er hoffe, las ich, der Wahlkampf möge mich auch nach Nürnberg führen. Später kamen wir nach Erlangen, Röthenbach und Roth. Aber Nürnberg wurde von uns gemieden, weil wir nur wenige große Städte und in der Regel Kleinstädte (wie Kleve) abklapperten; auch, Kinder, weil Drautzburg, der unseren VW-Bus fuhr, einer ehemaligen Verlobten wegen, die in Nürnberg wohnt, die Dürerstadt scheute und mehrmals Umwege vor sich und mir rechtfertigte.
Glaser im Ohr: solange der Wahlkampf dauerte, stritt ich mit ihm, der wie Zweifel mit Vornamen Hermann heißt. Auch zwischen Pausen, stehend der eigenen Rede hinterdrein oder auf Sitzschwielen in Diskussionen verzettelt, zitierte ich Dürers Tagebücher: der Pfennigfuchser; wies Glaser mit Zweifels Fingerzeigfinger auf Pirckheimer hin. Also sah ich, während wir einer Drahtstraße im Hüttenwerk Oberhausen folgten, strenge und selbst im Faltenwurf steife Grafik; auch als wir in Calveslage bei Vechta den Geflügelzuchtbetrieb Kathmann und in Konstanz den Fummelkram der AEG besichtigten, besuchte ich beiläufig ein mitreisendes Kupferstichkabinett. (Seine in Stein gehauene, an Geäst Wurzeln Hausgalgen baumelnde Signatur. Sein in der Holzschnittpassion zumeist im Vordergrund spielender wedelnder schlafender Pudel. Sein Spaß an Muskeln, am weiblichen Doppelkinn.) Erste Notizen in Gladbeck: Grauwacke Nieswurz Mondstaub. Ab Dinslaken die Umschreibung: Engel im Nachthemd. In Gießen Tintenrezepte: die schwarze Galle. Ich hatte mich schon entschieden, während ich noch zu suchen glaubte; denn eine blanke Kunstpostkarte trug ich durch Oberschwaben und Niederbayern, nach Friesland und Franken nahm ich sie mit; doch erst wenige Tage nach dem 28. September (als Willy schon dran war und nicht mehr unschlüssig mit Streichhölzern spielte) schrieb ich an Dr. Glaser: »In meinem Vortrag werde ich mich mit Dürers Kupferstich Melencolia I beschäftigen.«
»Was issen das?«
»Kriegt man das, wenn man Bücher schreibt?«
»Tut das schlimm weh?«
»Is das wie Espede?«
»Und wir?«
»Dürfen wir das auch schon kriegen?«
Da die Stichworte zum Dürervortrag in meinem Sudelbuch zwischen Notizen stehen, die Hermann Ott oder Zweifel meinen, eure und meine Ausrufe konservieren, fortlaufend die Bewegungsart der Landlungenschnecken festzuhalten versuchen und die Absonderungen des Wahlkampfes als Miefkürzel sammeln, gleiten Zweifel in seinem Keller, ihr, die wachsenden Kinder, Anna und ich mehr und mehr der Melancholie ins Wappen: schon beginne ich mir graugewichtig zu werden; schon spielt ihr einen Sonntag lang Schwermut und »Nix is los!«, schon hat Anna einen verzweigten Blick, schon verhängen Dürers Schraffuren als Dauerregen den Horizont; schon wird der Stillstand im Fortschritt akut; schon hat die Schnecke in den Kupferstich gefunden: es wächst sich die Niederschrift eines Vortrages, den ich, dank Dr. Glasers vorausgezahlter Zeit, erst in zwei Jahren halten muß, zum Tagebuch einer Schnecke aus.
Habt Geduld. Meine Eintragungen ergeben sich unterwegs. Da ich in Gedanken, Worten und Werken, ja, selbst in einer Super one-eleven kategorisch am Boden hafte und nur uneigentlich fliege, gelingt es keinen, auch den Umständen des Wahlkampfes nicht, mich oder Teile von mir zu beschleunigen. Deshalb bitte ich euch, Zurufe wie »Schneller!« und »Spring schon!« zu unterlassen. Ich will auf Umwegen (Abwegen) zu euch sprechen: manchmal außer mir und verletzt, oft zurückgenommen und nicht zu belangen, zwischendrein reich an Lügen, bis alles wahrscheinlich wird. Manches möchte ich umständlich verschweigen. Einen Teil vom Teil nehme ich vorweg, während ein anderer Teil erst später und auch nur teilweise vorkommen wird. Wenn sich also mein Satz windet, sich nur allmählich verjüngt, dann zappelt nicht und kaut keine Nägel. Wenig, glaubt mir, ist bedrückender, als schnurstracks das Ziel zu erreichen. Wir haben ja Zeit. Die haben wir: ziemlich viel Zeit.
Es gibt Kutteln, die ich gestern, nach meiner Rückkehr aus Kleve und während ich die Rede für Castrop-Rauxel abmagern, fett werden ließ, vier Stunden lang mit Kümmel und Tomaten auf kleiner Flamme weich kochte. Die späte Beigabe Knoblauch. Anna und ich mögen das; die Kinder sollen das auch mögen. Lappig hängen die Magenwände der Kuh beim Metzger am Haken und werden allenfalls für den Hund verlangt: der Pansen oder zu oft gewaschene Frottierhandtücher.
Zu daumenlangen Streifen geschnitten.
Jetzt dampfen sie in der Schüssel.
Streit schwimmt jetzt in der Suppe.
Franz Raoul Laura Bruno. Dieser Knoten, in unserem Bett geknüpft: etwas, das um sich greift.
Vierstufig steigt die Rakete, während die Kutteln in ihrem Sud schon eine Haut ziehen und gerührt werden wollen.
Einander geübt ins Wort fallen.
Kein Knöpfchen, diesen Ton abzustellen.
Nur noch Zeichensprache.
Denn gleichzeitig zu laut, weil keiner und jeder zuerst, damit niemand als erster, als letzter, siegt steil über Kutteln und dem verschütteten Gänsewein mehrmals der Schrei: »Hol du doch den Lappen!«
Jetzt zerrt die Familie am fehlenden Tischtuch und kann die Stimmen, dieses zu dichte Gewebe, kann auch den Anlaß - war es verschüttetes Wasser? - nicht von der Wirkung, den Kutteln, die wieder hochwollen, trennen: plötzlich Erkenntnis.
»Sau!«
»Selber eine.«
»Und du erst.«
»Obersau!«
(Niemand will milde mit Annas Sprache - »Du bischt doch es Säuli« -, alle reden dem Vater nach.)
Plärr. Brüll. Stink. Tropf.
Harmonie - oder der Wunsch, friedlich Kutteln essen und sich erinnern zu dürfen an gewesene Kuttelnessen, bis nichts mehr im Topf blieb und wir mit Freunden sanft unser Leid grasten: pazifistische Kühe…
Wo entstehen die Kriege?
Wie wird das Unglück benannt?
Wer will noch reisen, wenn doch zu Hause?
(Und keiner boshaft oder aus Laune, sondern nur, weil das Glas kleiner war als das Wasser oder der Gänsewein oder der Durst - und weil die Kutteln in ihrem Sud: Gründe.)
»So. Jetzt darf Laura was sagen.«
»Erst Laura, dann Bruno.«
»Und wohin willste morgen schon wieder?«
»Nach Castrop-Rauxel.«
»Und was machste denn da?«
»Redenreden.«
»Immer noch Espede?«
»Fängt ja erst an.«
»Und was bringste mit diesmal?«
»Teilweise mich…«
…und die Frage, warum die Tapete nicht dichthalten wollte. (Was mit den Kutteln hochkommt und den Gaumen mit Talg belegt.)
Denn manchmal, Kinder, beim Essen, oder wenn das Fernsehen ein Wort (über Biafra) abwirft, höre ich Franz oder Raoul nach den Juden fragen:
»Was war denn los mit denen?«
Ihr merkt, daß ich stocke, sobald ich verkürze. Ich finde das Nadelöhr nicht und beginne zu plaudern: Weil das und zuvor das, während gleichzeitig das, nachdem auch noch das…
Schneller, als sie nachwachsen, versuche ich Faktenwälder zu lichten. Löcher ins Eis schlagen und offenhalten. Den Riß nicht vernähen. Keine Sprünge dulden, mit deren Hilfe die Geschichte, ein schneckenbewohntes Gelände, leichthin verlassen werden soll…
»Wie viele waren das denn genau?«
»Und wie hat man die gezählt?«
Es war falsch, euch das Ergebnis, die vielstellige Zahl zu nennen. Es war falsch, den Mechanismus zu beziffern; denn das perfekte Töten macht hungrig nach technischen Details und löst Fragen nach Pannen aus.
»Hat das denn immer geklappt?«
»Und was war das für Gas?«
Bildbände und Dokumente. Antifaschistische Mahnmale, gebaut in stalinistischem Stil. Sühnezeichen und Wochen der Brüderlichkeit. Gleitfähige Worte der Versöhnung. Putzmittel und Gebrauchslyrik: »Als es Nacht wurde über Deutschland…«
2
Über Brillenberge, weil sie anschaulich sind?
Über Goldzähne, weil sie wägbar sind?
Über Einzelgänger und deren private Schrullen, weil vielstellige Zahlen nicht empfindlich machen?
Über Ergebnisse und Streit hinterm Komma?
Nein Kinder.
Nur über die Gewöhnung in ihrem friedfertigen Sonntagsputz.
Es stimmt: Ihr seid unschuldig. Auch ich, halbwegs spät genug geboren, gelte als unbelastet. Nur wenn ich vergessen wollte, wenn ihr nicht wissen wolltet, wie es langsam dazu gekommen ist, könnten uns einsilbige Worte einholen: die Schuld und die Scham; auch sie, zwei unentwegte Schnecken, nicht aufzuhalten.
Ich bin, wie ihr wißt, in der Freien Stadt Danzig geboren, die nach dem Ersten Weltkrieg vom Deutschen Reich getrennt worden war und mit den umliegenden Landkreisen der Aufsicht des Völkerbundes unterstand.
Artikel 73 der Verfassung sagte: »Alle Staatsangehörigen der Freien Stadt Danzig sind vor dem Gesetze gleich. Ausnahme-Gesetze sind unstatthaft.«
Artikel 96 der Verfassung sagte: »Es besteht volle Glaubens- und Gewissensfreiheit.«
Doch wohnten (laut Volkszählung vom August 1929) zwischen den über vierhunderttausend Bürgern des Freistaates (zu denen, knapp zweijährig, ich gezählt wurde) 10448 mitgezählte Juden, unter ihnen nur wenige getaufte.
Wechselnd bildeten die Deutschnationalen und die Sozialdemokraten Koalitionsregierungen. 1930 entschied sich der Deutschnationale Dr. Ernst Ziehm für eine Minderheitenregierung. Fortan war er auf die zwölf Stimmen der Nationalsozialisten angewiesen. Zwei Jahre später rief die NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) zu einem Umzug auf, der vormittags durch die Innenstadt und nachmittags durch den Vorort Langfuhr zog, bis er unter Transparenten und Fahnen müde wurde und das Gartenlokal Kleinhammerpark füllte. Die Schlußkundgebung stand unter dem Motto »Die Juden sind unser Unglück«: Zeitungen nannten sie eindrucksvoll.
Zwar protestierte der sozialdemokratische Abgeordnete Kamnitzer im Namen der Danziger Staatsbürger jüdischen Glaubens, aber der Senator des Inneren sah keinen strafrechtlichen Tatbestand, obgleich ihm ein Foto der Transparentinschrift »Tod den Schiebern und Gaunern« vorlag. (Da es unter den Juden Schieber und Gauner gäbe, wie es unter Christen und Atheisten Schieber und Gauner gäbe, betreffe die Todandrohung, so sagte man, nicht nur die jüdischen Schieber und Gauner, sondern auch Schieber und Gauner anderer Konfessionen.)
Nichts Besonderes: ein Aufmarsch mit Ziel zwischen Aufmärschen mit anderen Zielen. Keine Toten, Verletzten, kein Sachschaden. Nur gesteigerter Bierkonsum und Fröhlichkeit nahe dem Schunkeln. (Was man damals sang: »Kornblumenblau« - was man jetzt singt: »So ein Tag, so wunderschön wie heute…«) Viel blankgeputzte Jugend und geblümte Sommerkleider: ein Volksfest. Da jeder Unglück kennt, fürchtet und meiden möchte, war jedermann froh, endlich das Unglück beim Namen genannt zu hören, endlich zu wissen, wo all die Teuerung, Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und das private Magengeschwür ihren Ursprung haben. Im Kleinhammerpark, unter Kastanienbäumen, sprach sich leicht alles laut aus. Einen Kleinhammerpark gab (gibt) es überall. Deshalb hieß es auch nicht: Die Danziger Juden sind unser Unglück. Überall, überhaupt. Wo immer dem Unglück ein passender Name gesucht wurde, wurde es auch benannt: in Frankfurt und Bielefeld, in Leipzig und Karlsruhe, in Danzig und in Kleve, wo ich kürzlich bei Regen ankam und mich im Rathaus ins Goldene Buch eintrug.
Ein Städtchen nahe der holländischen Grenze, das, satt an Geschichte und Schwanenkunde, kurz vor Kriegsende zerstört wurde und selbst heute noch, kleinwinklig wieder aufgebaut, planlos auseinanderzufallen droht. (Wenig Industrie - Kinderschuhe und Margarine. Daher viele Pendler. Wir kletterten, als es soweit war, von 25,9 auf 30,1 Prozent: eine Gegend mit Zukunft…)
Als ich am Nachmittag mit Schülerinnen der Realschule diskutieren wollte, besetzten verkleidete Gymnasiasten aus Erkelenz oder Kevelaer das Podium, erklärten sich mit Hilfe einfacher Bewußtseinsspaltung zur Mehrheit und brachten (inmitten schulischem Bohnerwachsgeruch) den Sprechchor: »Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!«
Nach der Diskussion - ich versuchte, üblichen Geschichtsklitterungen den Leim abzuklopfen - baten mich einige der Scharfrichter um Autogramme.
Abermals nichts Besonderes: kurzes Gerangel. Besitzansprüche aufs Mikrofon. Der sonst sanfte Erdmann Linde langte dazwischen. Ein Espede-Kassierer stürzte. (Soll sich die Hand gebrochen haben.) Bleibt nur der Sprechchor: »Wer hat uns verraten…« - denn die Frage nach den Verrätern ist so alt wie der Wunsch, das Unglück beim Namen genannt zu hören.
In Kleve, dem niederrheinischen Städtchen, sowie in den Nachbargemeinden Kalkar, Goch und Uedem, lebten im Jahr 1933, vereint in der Synagogengemeinde Kleve, 352 Juden. Soviel Unglück wollten die Bürger der Stadt nicht ertragen.
Damit, Kinder, beginnt es: Die Juden sind. Die Fremdarbeiter wollen. Die Sozialdemokraten haben. Jeder Kleinbürger ist. Die Neger. Die Linken. Der Klassenfeind. Die Chinesen und die Sachsen glauben haben denken sind…
Wegweiser mit wechselnden Aufschriften bei gleichbleibendem Ziel: vernichten entlarven bekehren zerschlagen abschaffen befrieden liquidieren umerziehen isolieren ausmerzen…
Meine Schnecke kennt diese rostfreie Sprache, die doppelt gehärteten schnittigen Worte, den Freislerfinger an Lenins Hand.
Wie harmlos oder beängstigend sind die wechselnden Sprecher nahe am Mikrofon, wenn sie das Kleingeschriebene des Würgeengels - hart total ganz rein scharf - aufzählen und sich zu dem bekennen, was ohne auskommt: zur bedingungslos unversöhnlichen, ausnahmelos unbeirrten, zur unaufhaltsamen Verbesserung der Welt ohne Gnade?
Ich höre jetzt täglich davon (manchmal betroffen). Dicht kommen sie heran. Und ich entdecke, in welch irrlichterndem Ausmaß der Haß in jungen Gesichtern Schönheit anstiftet. Etwas für Fotografen. Es sind nur wenige, denen die Mehrheit beklommen und süchtig zuschaut. Sie wollen abschaffen, irgendwas, das System, ersatzweise mich.
Später, beim Bier, sind sie nett und auf nölige Art sogar höflich. Haben es eigentlich nicht so gemeint, finden alles - »Na diesen ganzen Dreh« - und sich selbst auch langweilig oder komisch. Sie schmollen, weil nirgends was los ist. Sind traurig für sich. Ohne Zuhause, weil aus zu gutem Hause. Vergrämte Streichelkinder, die ihre Schwierigkeiten zur Litanei knüpfen: die Eltern, die Schule, die Verhältnisse, alles. (Auffallend, daß ihr Wortführer, sobald er ohne Mikrofon spricht, gehemmt ist und stottert.) Ihre sanfte Wehleidigkeit macht mich spöttischer, als ich sein will. Ich rede, rede daneben, versage redend, höre mich reden, bis sie vor mir müde werden und ihren Überdruß heimtragen.
Wohin werden sie sich verlaufen? Welcher Kreuzzug wird sie vergattern? - »Was soll ich denn machen, Franz! Sag mal, Raoul, was?« - Einfach schlucken? Immer den gleichen Quark schlucken.
Später, in Delmenhorst, nannte mich eine hübsch geratene Studentin mehrmals, indem sie sich steigerte, bis sie fleckig und glanzäugig wurde: »Sozialfaschist!« - Aber meine Schnecke ist nicht zu beleidigen. Wenn sie von Umzügen, die sich rhythmisch bewegen, überholt wird, beschleunigt sie nie; kürzlich hat sie einen Protestzug samt Fahnen und Transparent hinter sich gelassen, indem sie ihn zurückdatierte.
Im März dreiunddreißig, als in Danzig die Aufmärsche der SA-Standarten und Jungvolkfähnlein schon alltäglich waren, stand im Blatt der Synagogengemeinde ein Festbeitrag, gewidmet ihrem fünfzigjährigen Bestehen. Sein Verfasser erzählte aus der Zeit vor 1883, als es in Langfuhr und auf Mattenbuden, in den Siedlungen Schottland und Weinberg sowie in Danzig fünf isolierte Gemeinden gegeben hatte. Erst dem Vorsteher der Schottländer Gemeinde, Gustav Davidsohn, gelang es, die Zerstreuten zu sammeln und mit dem Bau der Großen Synagoge zu beginnen, einem Gebäude, das sich dem historischen Baustil Danzigs erschreckend anpaßte. Weil jedoch eine Minderheit orthodoxer Gemeindemitglieder die neuerbaute Orgelsynagoge lästerlich fand, blieb die Synagoge Mattenbuden offen. Auch in Zoppot und Langfuhr wurden Synagogen gebaut: die Gemeinde war reich und zerstritten. Denn selbst als die Danziger Juden noch wohlangesehen gewesen waren, hatte es nie an offenem Streit zwischen getauften und emanzipierten, zwischen zionistischen und deutschnationalen Juden gefehlt. Man unterschied sich: gutsituierte und auf Anpassung bedachte Bürger schämten sich der Armut, die aus Galizien, Pinsk und Bialystok nachwuchs, ungehemmt jiddisch sprach und trotz allgemeiner Wohltätigkeit peinlich auffällig blieb.
Nachdem Judenverfolgungen im revolutionären Rußland tägliche Praxis geworden waren, wanderten bis 1925 etwa sechzigtausend Juden aus der Ukraine und dem Südosten Polens über Danzig nach Amerika aus. Auf dem Troyl, einer vom Holzhandel als Lagerfläche genutzten Insel im Hafengebiet, warteten die Auswanderer in einem Auffanglager, bis ihre Zertifikate eintrafen. Dreitausend Juden, zumeist polnischer Staatsangehörigkeit, blieben in Danzig und ahnten nicht, wie ihnen werden sollte.
»Und Zweifel?«
»Was is mit Zweifel?«
»Hatte der Brüder oder ne Schwester?«
»Haste dir den nur so ausgedacht?«
Auch wenn ich ihn erfinden muß, es hat ihn gegeben. (Eine Geschichte, die mir Ranicki als seine Geschichte vor Jahren erzählt hat, blieb bei mir liegen und lebte behutsam für sich; geduldig besteht sie auf einem gesuchten Namen, auf gesichertem Herkommen, auf einem Keller für spätere Zuflucht.)
Erst jetzt, Kinder, kann Zweifel aufkommen, überwiegen, bestehenbleiben, die Stimmung trüben, Hoffnung ansäuern, sich mutig und lustig betragen, unter Verbot stehen, kann endlich von Hermann Ott die Rede sein.
Geboren 1905 als einziger Sohn eines Ingenieurs beim Prauster Dampfschöpfwerk, macht er auf Sankt Johann pünktlich sein Abitur und studiert seit dem Sommer 1924 nicht an der Technischen Hochschule in Danzig (zum Beispiel Hydraulik), sondern Biologie und Philosophie, weit weg in Berlin. Nur während der Semesterferien sieht man ihn in der Langgasse flanieren und in der Heiligengeistgasse das Schopenhauerhaus besuchen. Weil er seinen Unterhalt selbst verdienen muß - der Vater, Simon Ott, wollte nur für Hydraulik zahlen -, hat er Büroarbeit im jüdischen Auswandererlager auf dem Troyl übernommen. Hier wird er zum erstenmal Zweifel oder Dr. Zweifel genannt, weil der Student Hermann Ott mit dem Wort Zweifel so gebräuchlich umgeht, als hantiere er mit Messer und Gabel. Er ist der Lagerleitung und dem Rabbiner Robert Kaelter behilflich, indem er Ein- und Ausgänge bucht und den täglich veränderten Bedarf an Lebensmitteln kalkuliert; doch zwischendurch verkündet er den Zweifel als neuen Glauben. Seine Zuhörer sind galizische Handwerker, denen er mit seinem kategorischen Warum, das sogar das Wetter und die Auserwähltheit des Volkes Israel in Frage stellt, Spaß macht und Zeit vertreibt. (»Och Zweifelleben, wie bekim ich blojs a daitscheches Visum?« sagt der Schneider aus Lemberg. »Ich bezweifle«, sagt Hermann Ott, »daß Ihnen ein deutsches Visum, auf Dauer gesehen, von Nutzen sein kann.«)
Das Auswandererlager auf dem Troyl wurde 1926 aufgelöst; der Spitzname Zweifel blieb, obgleich Hermann Ott, dessen Familie aus dem Werderdorf Müggenhahl stammte, seine streng mennonitische Herkunft nachweisen konnte. (Die Großmutter Mathilde, geborene Claasen, verwitwete Kreft, Duwe, Niklas und Ott, soll sich um das Entwässerungssystem der Weichselniederung verdient gemacht haben; doch über tätige Großmütter habe ich schon zu oft geschrieben.)
3
Vieles flüchtet nur in mein Sudelbuch: Fundsachen, genagelte Augenblicke, Stotterübungen und ausrufwütige Pausenzeichen.
In Kleve, zum Beispiel, wo ich die Gräberfelder im nahen Reichswald hatte sehen wollen, notierte ich: Die Insel Mauritius, von der noch erzählt werden muß, ist durch eine Briefmarke bekannt geworden. - Unbedingt Zweifel beschreiben. - Autogramme auf Bierdeckel. - Bettina, geduldig bei den Kindern, ist, weil ihr Freund sie politisiert hat, neuerdings streng mit mir.
Oder in Rauxel, wo man Wert darauf legt, echter Castroper zu sein: Wenn die Zwillinge im September zwölf werden, werde ich Raoul keinen Plattenspieler kaufen. - Wie sah Zweifel aus? Lang hager gebeugt? - Hier ist es die Aula des Adalbert-Stifter-Gymnasiums. - Bettina liest Hegel im Kollektiv.
Oder in Gladbeck: Zweifel war mittelgroß und neigte zur Korpulenz. - Im Saal Meinungsforscher mit Fragebögen, die testen wollen, wie ich wo und besonders bei Frauen ankomme. - Es reicht, wenn unten ein Plattenspieler für alle steht. - Einfahrt in die Zeche »Graf Moltke«. Wieder übertage, bekomme ich auf der Hängebank ein Döschen Schnupftabak geschenkt. Muß das Schnupfen fürs Fernsehen dreimal wiederholen. In der Waschkaue nicht an Zweifel gedacht. - Hackepeter und Korn mit Betriebsräten. - Bettina spricht nur noch sachlich mit mir.
Oder in Bocholt, wo die Textilkrise (Erhards Wort »gesundschrumpfen«) Diskussionen füttert: Zweifels Aussehen läßt sich nicht nachweisen. - Im Arbeitervereinshaus St.Paulus holen Schüler die roten Fahnen raus. Nur noch Grauwerte nennen! - Außerdem hat Bettina unseren alten Plattenspieler, den Raoul sich leihen kann. Das Hotel heißt »Erzengel«. Die Pokale der Schützenvereine hinter Glas aufbewahrt. Das Wort Schneckenmief. Ein katholischer Betriebsrat nimmt mich zur Seite. »Will ich nicht mehr! Sozialausschüsse, alles Schwindel! Hat uns verschaukelt, der Katzer…«, sagt er und ist alt müde fertig verbraucht.
Und in Marl, bekannt durch verschachtelte Architektur: Zweifel sah anders aus: schütter blond. Eine Eisenfraßschnecke züchten. Muß leiser sprechen, um durchzukommen, weil überall Lautsprecher. Zwischendurch Jurymitglied bei einem Plakatwettbewerb für Schüler: trotz steigender Grauwerte verspricht das nächste Jahrzehnt farbig zu werden. Kostümverleih Zweifel.
Und in Oberhausen, wo die 1.-Mai-Vorfeier den ortsansässigen Sozialdemokraten zum »Bunten Abend« mißrät. Vormittags im Hüttenwerk. Große Rumreiche. Am Steuerpult der Brammenstraße. Ofenabstich, oft im Kino gesehen. Aber die Arbeit, ein im Lärm verstummter Vorgang, der gerne motorisch dargestellt wird, gehorcht keiner Ästhetik. - Ich bilde mir Schnelles ein, will Beschleunigung, denke in Dreisprüngen; aber noch zögert die Schnecke, beschleunigt und sprunghaft zu sein.
Hier steht noch: Erbsensuppe mit Vater Meinike. (Wenn ich Altsozialdemokraten zuhöre, lerne ich, ohne sagen zu können, was.) Wie er vor sich hin poltert, nach vorne weist, vorwärts sagt, unentwegt damals beschwört, verstummt, wäßrig blinzelt, plötzlich den Tisch haut, damit sein Sohn betroffen ist.
Es bleibt dabei, Raoul: kein Plattenspieler. Zweifel trug, wenn er auf den Wällen der ehemaligen Befestigungsanlage Bastion Kaninchen spazierenging, karierte Knickerbocker. Auch Bettina sagt Wir, wenn sie Ich meint. In den Bonner Ministerien mehrere Selbstmorde: Beamte und Sekretärinnen. Barzel dementiert Kiesinger. Ob Dr. Glaser in Nürnberg ein Verhältnis zur Melencolia hat? Zweifel trug keine Brille…
»Kennste den denn?«
»Is dassen Freund von dir?«
»War der auch immer weg?«
»Sah der aus, wie er hieß?«
»Na irgendwie traurig. - Na irgendwie komisch…«
Sah traurig komisch nach nichts aus. Stellt euch Zweifel als jemand vor, an dem alles schief war: die rechte Schulter hing, das rechte Ohr stand ab, gleichfalls rechts kniff sein Auge und hob den rechten Mundwinkel. In solch verzogenem und aller Symmetrie feindlichem Gesicht herrschte eine fleischige, von der Wurzel weg nach links ausscherende Nase. Mehrere Haarwirbel verhinderten einen Scheitel. Nur wenig, immer zum Rückzug bereites Kinn. Ein in sich verrutschtes Kerlchen, zum Zappeln und Kniewippen neigend, sonderlich und reich an schnarrenden Nebengeräuschen, schwach auf der Brust.
Oder - Kinder - stellt euch Zweifel lieber nicht mickrig und zwinkernd vor. Auf Fotos, die das Lehrerkollegium des Kronprinz-Wilhelm-Gymnasiums abbilden, überragt er, der auf dieser Schule im März dreiunddreißig als Studienassessor zu unterrichten begann, den mittelgroß zu nennenden Lehrkörper nahezu peinlich. Man möchte ihn, der Deutsch und Biologie gab, für den ungeschlachten Turnlehrer halten, obgleich Zweifel - abgesehen von Radtouren ins Werder und durch die Kaschubei - keine sportliche Disziplin übte. Jemand, der über Körperkräfte verfügte, ohne sie zu gebrauchen: auch als ihn später eine Horde Hitlerjugend zusammenschlug, fiel ihm kein Widerstand ein. Jemand, der nur beim Händeschütteln Schmerzen bereitet. Jemand, der sich beim Hinsetzen um den Stuhl besorgt. Eine schüchterne Kraft auf Zehenspitzen. Ein betulicher Riese.
Oder - Kinder - stellt euch Zweifel überhaupt nicht vor. Er bestand ja aus Widersprüchen, sah niemals eindeutig aus. (Vielleicht trug der hebearmbestückte Körper eines Transportarbeiters das verquere und beim Denken grimassierende Köpfchen eines Stubenhockers.) Selbst mir, der ich seit Jahren mit ihm umgehe, will es nicht gelingen, sein Aussehen zu begrenzen, seine Nase gestupst, sein linkes Ohrläppchen angewachsen, seine Hände nervig nervös zu nennen.
Stellt euch Zweifel beliebig vor. Sagt: Von streng asketischer Blässe. Sagt: Eckig verschlossen. Sagt: Bäurisch gesund. Sagt: Unauffällig.
Nur soviel gilt: er humpelte nicht. Er trug keine Brille. Kein Kahlkopf. Kürzlich noch, unterwegs zwischen Gladbeck und Bocholt, als ich den Schnupftabak der Zeche »Graf Moltke« ohne Fernsehen und nur zur eigenen Erleuchtung probierte, sah ich ihn und war sicher, daß Zweifels Skepsis grauäugig blickt.
Blickt also noch immer und zwinkert womöglich doch. Zweifel nicht auszuräumen.
Ich kenne ihn länger als mich: wir haben den gleichen Kindergarten vermieden.
Als Zweifel sich aufzuheben versuchte, nahm ich ihn unter Vertrag: abhängig schreibt er mir vor.
Manchmal besucht er meine Veranstaltungen: neulich der Zwischenrufer in Bocholt; der lärmige Schweiger in Marl. Jetzt wird es still in meinem Hotelzimmer: Zweifel kommt auf…
Ich weiß nicht, ob jener in sich zurückgezogene Mann, den ich Willy nenne und dessen Vergangenheit nicht aufhören kann, sein Spiel mit den Streichhölzern demnächst (möglichst bald) unterbrechen und die Strecke von Bebel bis heute um ein Schneckenmaß mehr Gerechtigkeit verlängern wird. (Fast möchte ich meinen, es habe Zweifel, als er später im Keller saß, dieses akkurate Zurechtrücken verschachtelter Refugien als Spiel gegen die Zeit erfunden.) Bonn, Kiefernweg. Heute saß ich bei ihm eine Stunde und hätte ihm die Streichhölzer, weil sein Spiel abgeguckt und zur lähmenden Mode wird, klauen mögen. (Ihn vormittags wortkarg nennen hieße, ihn redselig erlebt zu haben.) Er hörte zu, machte Notizen, ließ von den Streichhölzern nicht ab, und ich begriff, daß dieser Mann erst kämpfen wird, wenn sich sein Zustand abgenutzt hat. (Was läßt ihn zögern? Der Haß seiner Gegner, die Ansprüche der Macht?) Bevor ich ging, gelang es mir, ihn durch weißnichtmehrwas zum Lachen zu bringen: zwischen der Melancholie und der Sozialdemokratie ergeben sich manchmal Kurzschlüsse verzweifelter Komik.
Schon vor den Neuwahlen, als im März dreiunddreißig der Festaufsatz zum fünfzigjährigen Bestehen der Synagogengemeinde mit dem Goethe-Zitat »Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten« abschloß, war der achtundzwanzigjährige Studienassessor Hermann Ott als Lehrer tätig; gleichfalls zeichnete er als zweiter Sekretär der Schopenhauer-Gesellschaft, einer mehr lokalpatriotischen als wissenschaftlichen Versammlung älterer und aus Prinzip konservativer Herren. Zu Otts Aufgaben gehörte es, Gäste von auswärts zum Geburtshaus des Philosophen in der Heiligengeistgasse zu führen. Dort mischte er Daten und Zitate und erläuterte (beiläufig) die Verteilung der Schwermut als Erbmasse einer hanseatischen Kaufmannsfamilie.
Neben dem jüdischen Gemeindeblatt gab es in Danzig eine zionistische Monatszeitschrift, die auch in Dirschau und Gdingen Leser fand. »Das jüdische Volk« wurde von Isaak Landau redigiert. Und gleichzeitig mit dem Festaufsatz der Synagogengemeinde, der sich, bis auf das Goethe-Zitat, aller politischen Anspielungen enthielt, brachte Landau einen Artikel über den Beginn der Judenverfolgungen unter dem Titel: »Die Lage in Deutschland«.
Deshalb wurde die Zeitschrift auf drei Monate verboten. Durch anonyme Drohungen verschreckt, verließ Isaak Landau auf einem Fahrrad, das ihm der Studienassessor Ott geliehen hatte, den Freistaat: bei Klein-Katz radelte er über die grüne Grenze nach Polen und schickte von Putzig aus, bevor er nach Palästina weiterzog, das Rad per Bahn zurück. Landau schrieb eine Ansichtspostkarte, die den Leuchtturm der Halbinsel Hela zum Motiv hatte. Zwischen Grüßen stand der Wunsch, es möge in Zukunft an Leuchttürmen nicht fehlen.
»Ich bezweifle«, sagte Hermann Ott, »daß es bei dieser vereinzelten Flucht bleiben wird.«
Bald darauf mußten die ersten jüdischen Studenten ihr Studium an der Technischen Hochschule abbrechen, weil ihnen die Arbeit an den Zeichentischen und in den Laboratorien von SA-Studenten unmöglich gemacht wurde…
»Was heißt, unmöglich gemacht?«
»Durch Schikanen verhindert.«
»Was für Schikanen denn?«
»Tinte auf technische Zeichnungen gießen.«
»Also nur Quatsch machen?«
»Kann sein, daß einige SA-Studenten glaubten, nur Quatsch zu machen.«
»Und wenn die Studenten heute? Würden die auch?«
»Ich weiß nicht.«
»Sag mal ehrlich, würden die?«
»Einige, vielleicht.«
»Auch die für Mao sind?«
»Es kann gut sein, daß einige studierende Maoisten glauben, nur Quatsch zu machen.«
»Aber wenn sie dagegen und für Gerechtigkeit sind?«
Ich will das nicht engführen. Die Gewalttätigen und die Gerechten hören schlecht. Nur soviel, Kinder: seid nicht allzu gerecht. Man könnte eure Gerechtigkeit fürchten, vor ihr die Flucht ergreifen…
Nachdem ein jüdischer Hochschulassistent gezwungen worden war, seinen Arbeitsplatz zu räumen - er wurde als Reichsdeutscher nach Marienburg abgeschoben und in ein Lager gebracht - das Wort Kazett war noch ungebräuchlich-, erschreckte den Studienassessor Ott eine extrem konsequente Flucht. In der Turnhalle des Kronprinz-Wilhelm-Gymnasiums erhängte sich - und zwar am hohen Reck - ein siebzehnjähriger Gymnasiast, nachdem ihn seine Mitschüler in der Toilette (nur so aus Quatsch) gezwungen hatten, seine beschnittene Vorhaut zu zeigen.
Einige Schüler wurden von der Schule gewiesen; dennoch blieb Hermann Ott vor versammeltem Lehrerkollegium skeptisch: »Ich bezweifle, daß der Verweis von Schülern irgend etwas bewirkt, solange es einige Lehrkräfte für richtig halten, verallgemeinernde Aussagen - wie etwa: ›Die Juden sind unser Unglück‹ - zum Aufsatzthema zu erheben.«
Zweifel hingegen lehrte vor Obersekundanern, die später in Nordafrika, an der Eismeerfront und als U-Boot-Fahrer keine Gelegenheit hatten, älter als dreißig und skeptisch zu werden, des Pudelfreundes Schopenhauer »Skeptische Ansicht«. (Von der Moral und der Würde blieben nur Kragenstäbchen und Puderquasten.) »Ich bezweifle«, sagte Ott zu seinen Obersekundanern, »daß Sie mir zuhören.«
Im April dreiunddreißig löste die Minderheitsregierung Ziehm den Volkstag auf. Bei den Neuwahlen am 28.Mai gewannen die Nationalsozialisten die knappe Mehrheit von 50,03 Prozent. (Im Reich hatten im März nur 43,9 Prozent der Wähler für Hitler gestimmt.)
Jemand, der Rauschning hieß, wurde in Danzig Senatspräsident. Schon hatte man die Gewerkschaften, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen, mit der nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation gleichgeschaltet; ein Versagen, das dem Deutschen Gewerkschaftsbund bis heutzutage brave Niewiedersprüche und gewundene Schuldbekenntnisse eingibt, besonders am 1.Mai…
»Haben die nicht gestreikt?«
»Kein Generalstreik.«
»Und würden die jetzt, wenn sowas wie damals?«
»Ich weiß nicht.«
»Sag mal ehrlich, würden die diesmal?«
»Weiß wirklich nicht…«
…und bringe am Wochenende in meiner Reisetasche nur wenig Gewißheit mit: miefgesättigte Hemden und diese Grubenlampe aus Gladbeck, Zeche Graf Moltke, die mir der Betriebsratsvorsitzende Dziabel, außer dem Schnupftabak, geschenkt hat.
Vorwärts - so heißt eine sozialdemokratische Wochenzeitung. Einen General, Blücher hieß der, nannten Schullesebücher: Marschall Vorwärts. Bei der Hitlerjugend wurde gesungen, habe ich mitgesungen: »Vorwärts, vorwärts, schmettern die hellen Fanfaren…«
Ein dummes Wort, das oft genug den Rückschritt beschleunigt hat. Ein geblähtes, deshalb rasch abschlaffendes Wort, dem die Begeisterung als Luft und der Glaube als Pumpe dienen. Ein über Gräber und Massengräber springendes, in alle Sprachen übersetztes, jedem Lautsprecher geläufiges Fingerzeigwort, das erst im nachhinein (Flüchtlingsgespräche) geprüft wird. Mal sehen, ob vorwärts schon hinter uns liegt. Die Befragung schiefgelaufener Schuhabsätze. Eindeutige Beschlüsse, aber die Wegweiser widersprechen sich. Mitten im Fortschritt ertappen wir uns im Stillstand. Die ausgegrabene Zukunft. Statistische Mystik. Gotisch verschnörkelte Zündschlüssel. Autos um Bäume gewickelt…
Später mal, Franz, wenn du enttäuscht bist,
wenn du den Kehrreim des Liedchens »Zwecklos«,
der die Zeile »Hatjadochkeinenzweck« wiederholt,
mühsam gelernt, in Gesellschaft gesungen,
aus Trotz vergessen
und auf Abendschulen neu gelernt hast,
später mal, Franz,
wenn du siehst,
daß es so und auch so und selbst so nicht geht,
wenn es dir schiefzugehen beginnt
und du die Mitgift Glauben verzehrt,
die Liebe im Handschuhfach liegengelassen hast,
wenn sich die Hoffnung, ein gutwilliger Pfadfinder,
dessen Kniestrümpfe immerfort rutschen,
ins Aschgraue verloren hat,
wenn dir das Wissen beim Kauen schaumig wird,
wenn du fertig bist,
wenn man dich fix und fertig gemacht hat:
flachgeklopft entsaftet zerfasert -
jemand kurz vorm Aufgeben -
wenn du am Ziel - zwar Erster -
den Beifall als Täuschung,
den Sieg als Strafe erkannt hast,
wenn dir die Schuhe mit Schwermut
besohlt worden sind
und Grauwacke deine Taschen beutelt,
wenn du aufgegeben, endlich aufgegeben,
für immer aufgegeben hast, dann - Fränzeken -
nach einer Pause, die lang genug ist,
um peinlich genannt zu werden,
dann stehe auf und beginne dich zu bewegen,
dich vorwärts zu bewegen…
…denn als wir uns - lauter viereckige Männer - in der Niedstraße vor einem Jahr zu treffen begannen, um unseren langen Tisch zu belagern und einander unbequem zu sein, setzten wir zwischen überforderten Aschenbechern einen winzigen, von Anbeginn hinkenden Anfang, dem jedermann versicherte, daß er sich versuchsweise zu verstehen habe, weil sich jeder am Tisch, wenn auch jeweils anders gefärbt, mit der Absicht trug, eigentlich und demnächst aufzugeben, oder schon lange, spätestens nach Abschluß der Großen Koalition, aufgegeben hatte; nur Jäckel d.Ä. sprach einig mit sich als Historiker und nannte die Lage normal.
Schwierig, einander aussprechen zu lassen. Dieses gelangweilte Stochern in Pfeifen mit Zubehör. Ausflüchte in die Vorhöfe professoraler Intrigen. Komplimente für Anna, die kurz und eher abwesend »mal reinschaut«. Absicherndes Ausklammern und Aufforderungen, endlich zur Sache zu kommen.
Also päppelten wir den winzigen Anfang. Papier und Scharfsinn in Parenthesen bekam er zu fressen. Auf knapp drei Seiten bescheinigten wir den Sozialdemokraten (distanzbewußt) üblichen Kleinmut, internen, die Partei lähmenden Streit, kommunale Selbstgefälligkeit, diffuse Selbstdarstellung, Ämterhäufung und Kompetenzsucht, rechten Opportunismus und linke Arroganz, eine in Zaudern und Ehrgeiz zerfallene Führung, zwar Fleiß und Können, aber auch mangelnden Willen, die bevorstehende Bundestagswahl zu gewinnen. Der Anstoß - so unser Allheilmittel - müsse von außen kommen. Einer Vielzahl kleiner, aber aktiver Wählergruppen könne es unter Umständen (die noch zu schaffen seien) gelingen, die ermüdete, schon der Resignation verfallene Partei zu beunruhigen. Stachel sein. Schrittmacher spielen. Ein Vorfeld bereiten. Wählerinitiativen (sozialdemokratische) gründen. Die Protestwelle auffangen, umleiten…
Unser Hochmut war reich an zynischen Nebengeräuschen. Verzweifelte Langstreckenläufer, die sich um Witzeslänge zu überholen bemühen. Japsend auf der Schnauze liegen und nur noch aus Krabbeltrieb Startlöcher suchen. Einer Schnecke Pfeffer unter die Kriechsohle reiben.
Ich will jetzt keine Stimmung auspinseln und Strichmännchen kritzeln, obgleich sich draußen, während die Stühle uns steif werden ließen, Pathos auf Breitwand auslebte. Dutschke voran, lief der Studentenprotest enggekoppelt, auf Reibung bedacht, heroisch und schön (im fotografierten Ausschnitt) gegen uns, die unansehnlichen Revisionisten; für uns, zum Nutzen der Revision. Lärmgewohnt saßen wir am Rand: sprachfleddernde Pedanten, die alles genau, sogar das Vage genau benannt haben wollten.
Nachdem Gaus seinen Streit gehabt hatte, Sontheimer keiner Entscheidung fähig gewesen war, Baring nicht sich, aber seinen Beitrag für unerheblich gehalten hatte, ich penetrant stur gewesen war und alle einmal, Gaus mehrmals recht gehabt hatten, sprach Jäckel d.Ä. als Historiker und nannte den Wahltermin ein Ziel, auf das man sich zubewegen müsse: und zwar Schritt für Schritt vorwärts.
4
…oder wollen wir Leine ziehen? Einfach ab? Alles verscherbeln und auswandern - gleich wohin? - »Mein Visum ist da!« rief die Schnecke und nahm ihr Haus mit.
Auch Hermann Ott soll damals das Auswandern erwogen haben: nach Kanada (zu mennonitischen Verwandten) nach Australien (ohne Gründe zu nennen) nach London (wegen der insularen Skepsis). Zweifel plante mehrere neue Existenzen, die einander aufhoben: also blieb er und plante sein Bleiben.
Wir planten, in Bonn ein Büro zu eröffnen, in dem der Aufbau von örtlichen Wählerinitiativen geplant und meine Zeit sinnvoll verplant werden sollte: ab März bis Ende September, mit Pausen nach Plan.
Einer der drei Büroräume wurde als Redaktion der geplanten (noch unbenannten) Wahlzeitschrift eingeplant. Wir planten Groß- und Kleinanzeigen und als erstes Lebenszeichen eine Pressekonferenz in Bonn, die am Montag den 25.März im Restaurant Tulpenfeld stattfand und sich, wie geplant, ausreichend öffentlich rumsprach.
Für Mitte April planten wir Sontheimers Rede auf dem Godesberger Parteitag. (Steht im Protokoll. Wurde mit Beifall aufgenommen.) Wir planten Poster, Flugblätter, mittlere Kettenreaktionen und ein Linsenessen mit Presse und Wischnewski. (Schlug sich, weil Linsen eine Nachricht sind, in fünfzig Zeitungen nieder.)
Auch Namen (Baudissin, Lenz, Böll - wen noch alles?) planten wir ein und mußten - was jeder echte Planer eingeplant hat - Abstriche machen, neuplanen oder alte Pläne eindampfen und geschönt vorlegen.
Unser buntes Würfelspiel wurde abgelehnt (zu teuer), bevor es als politisches Planspiel entwickelt werden, Spaß machen konnte. Nichts wurde aus der fürs Ruhrgebiet geplanten Brieftaubenaktion. Natürlich hatten wir auch einen Film geplant und wollten außerdem…
Hör zu, Raoul, dein Plan gefällt mir, auch wenn er nicht aufgeht. Laß ihn doch liegen. Sei nicht gleich so geladen. Zerspringe langsam. Und sage nicht: »Immer mir, nur mir passiert das, klar doch.«
Ich habe dir erklärt, daß deine kleinen und schlimmeren Unfälle nicht bedeuten, daß die Welt oder Friedenau gegen dich ist.
Dich und deine Löcher im Kopf habe ich sonntags zum Arzt getragen.
Ich habe dir gezeigt, wie man eine Hammelkeule mit Knoblauch spickt.
Oft sehe ich dich mit voreiligen Schritten kommen und fange dich auf, wenn du springst.
Ich beuge dir vor, nehme dir Dampf weg. (Deine Mutter und du, ihr seid euch ähnlicher, als es die Nähe am Tisch zulassen will.)
Halte dich vorher, bevor dich die Wut federleicht macht, zum Beispiel an mir fest; ich bremse (und werde von Zweifel gebremst).
Wie höflich du nachsichtig bist, wenn ich zerstreut bin und »Ja« sage, obgleich ich schon mehrmals »Es gibt keinen Plattenspieler« gesagt habe.
Deine Ordnung ist ein Chaos, in dem viel Arbeit steckt.
Auch wenn er überschwappt, ich mag es, wenn du mir Wein eingießt.
Deine Pläne gefallen mir. Komm, laß uns Pläne machen! Zum Spaß, wie mein Begräbnis geplant sein soll: So lustig wie hinterhältig.
Wen wir einladen wollen?
Nicht nur Freunde.
Was es danach (bevor ich vom Tonband spreche und - wie wir geplant haben - meine Leichenschmausgäste begrüße) zu essen geben wird?
Hammelkeule mit Knoblauch gespickt - wie es dein Vater gelehrt hat…
Aber noch lebe ich ziemlich. Meine Pläne kochen auf Sparflamme. Vorläufig bin ich mit dem Verhindern beschäftigt. Der Rest gilt kleinen Gewinnen. Die Schwärze graustichig werden lassen. Das Abklappern schwarz in der Wolle gefärbter Wahlkreise: katholisch-heidnische Bilderbuchgegenden, in denen dem Aufbau von Wählerinitiativen - du kennst unseren Plan - Angst um das Ansehen und die Kundschaft, Angst vor dem Pfarrer, dem Schulrat, den Nachbarn, biedere Angst in ihrer Trachtenjacke entgegensteht.
Oder wenn ich am Nachmittag (nach Fabrikbesichtigungen) zwischen Betriebsräten sitze und zuhöre, wie mir die Arbeit und ihre Bedingungen als ein gleichförmig auf Fließband gesetzter Fluch erklärt wird: das tarifrechtlich geschützte Unrecht.
Oder auf Diskussionen, sobald die Söhne der Bürger sich freizusprechen beginnen, indem sie die Welt mit Hilfe eines Mikrofons zu erlösen versuchen. Wenn ich den deutschen Idealismus, der dem Spitzwegerich gleicht, mißmutig jäte; doch unentwegt wächst er nach. Wie sie immerfort eine Sache - und sei es die Sache des Sozialismus - um ihrer selbst willen betreiben…
Oder die Gläubigen unter den Käseglocken, wie sie sich frisch halten. - Raoul, laß uns Ketzer bleiben. Komm, laß uns Pläne machen. Jetzt suchen wir Zweifel…
Er hat die Schule gewechselt. Das weiß ich von Dr. Lichtenstein, der in Tel Aviv wohnt und alles, was aktenkundig wurde, gesammelt hat: trockne Erlasse und Senatsprotokolle, die gestelzten Verharmlosungen eines Verbrechens, das von Beginn an Wachstum versprach und die Zukunft für sich hatte. (Als wir vom 5. bis 18.November 1971 in Israel waren und ich mein Manuskript schon in letzter Fassung bei mir trug, sagte Erwin Lichtenstein, daß seine Dokumentation »Der Auszug der Juden aus der Freien Stadt Danzig« demnächst bei Mohr in Tübingen als Buch erscheinen werde. Frau Lichtenstein, geborene Anker, sagte zu Anna: »Damals waren wir frisch verheiratet.«)
Ab März 1933 wurden in Danzig die jüdischen Geschäfte boykottiert, wurden jüdische Justizbeamte ohne Begründung in untergeordnete Positionen abgeschoben, wurden selbst dort, wo sie als Spezialisten nicht zu ersetzen waren, jüdische Ärzte entlassen und nicht mehr im Hartmannbund geduldet, durften bei den Zoppoter Waldfestspielen keine jüdischen Künstler beschäftigt werden, wurde den jüdischen Mitarbeitern beim Landessender Danzig gekündigt, durfte der Turnverein Bar Kochba keine städtischen Turnhallen mehr benutzen, wurde es für jüdische Schüler auf städtischen Schulen unerträglich: sie mußten gesondert sitzen. Bei der Entbietung des »deutschen Grußes« mußten sie Haltung annehmen, durften aber nicht, wie es ihre Mitschüler taten, den rechten Arm heben; gleiches galt für jüdische Lehrer.
Erwin Lichtenstein sagte in Israel: »Damals war ich ein junger Dachs und Syndikus der Synagogengemeinde. Wir wollten keine jüdische Schule. Nur die zionistische Volkspartei stellte seit Jahren Anträge. Nun drängte auch der Senat…«
Im März 1934 mußte die Synagogengemeinde eine achtklassige Volksschule einrichten. Anfangs standen Räume in der Volksschule Rittergasse zur Verfügung. Später zog die Schule in die Heiligengeistgasse um. Als sogar Schüler aus Praust, Tiegenhof und Zoppot kamen, wurden private Räume in der Brotbänkengasse dazugemietet. (Der Mittelschullehrer Samuel Echt leitete die jüdische Volksschule bis kurz vor Kriegsbeginn, als sie, durch Auswanderung geschrumpft, wieder in die Rittergasse zurückverlegt und - nach Echts Auswanderung - von Aron Silber geleitet wurde.) Gleichzeitig begann der Aufbau der höheren Privatschule.