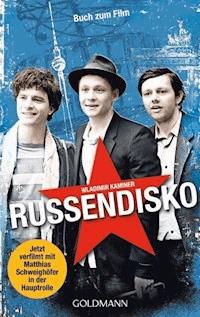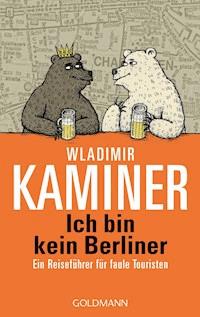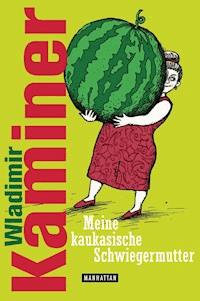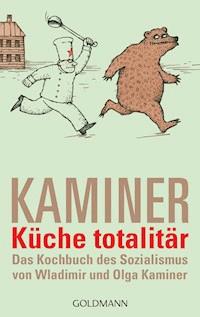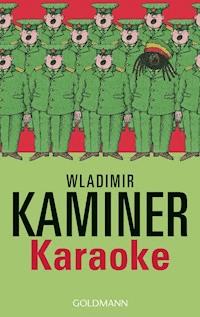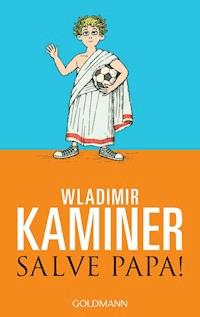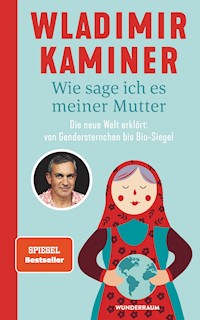12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Täglich beobachtet Wladimir Kaminer, wie der Zuzug von Flüchtlingen Deutschland verändert. Und wie das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Kulturen zahllose Geschichten hervorbringt. Diese erzählt Wladimir Kaminer voll Humor und echter Neugier, aber ohne falsches Pathos. Er berichtet vom syreralistischen Komitee zur Rettung der Welt, das in seinem Dorf in Brandenburg gegründet wurde; von einem Zuckerbäcker aus Damaskus, der mit seinen Kreationen auf Rügen scheitert, von schockierten muslimischen Asylbewerbern, die Wladimirs Sohn mit leckeren Schweineöhrchen beschenken will, oder von Syrern, die in Babelsberg als Komparsen für die Serie »Homeland« abgelehnt werden, weil Albaner »syrischer« aussehen als sie. Und am Ende fragt er: Haben wir es geschafft?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Täglich beobachtet Wladimir Kaminer, wie die Flüchtlingswelle Deutschland durcheinanderwirbelt. Und er sieht, wie das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Kulturen zahllose Geschichten hervorbringt. Diese erzählt Wladimir Kaminer voll Humor und echter Neugier, aber ohne falsches Pathos. Er berichtet vom syreralistischen Komitee zur Rettung der Welt, das in seinem Dorf in Brandenburg gegründet wurde; von einem Zuckerbäcker aus Damaskus, der mit seinen Kreationen auf Rügen scheitert, von Syrern, die in Babelsberg als Komparsen für die Serie »Homeland« abgelehnt werden, weil Albaner »syrischer« aussehen als sie; oder von schockierten muslimischen Asylbewerbern, die Wladimirs Sohn mit leckeren Schweineöhrchen beschenken will. Und am Ende fragt er: Haben wir es geschafft?
Weitere Informationen zu Wladimir Kaminer sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches sowie unter www.wladimirkaminer.de.
WLADIMIR
KAMINER
Ausgerechnet Deutschland
Geschichten unserer neuen Nachbarn
Ein albanischer Witz über Zigeuner, in einem Flüchtlingsheim von einem tschetschenischen Flüchtling einem Flüchtling aus dem Irak erzählt:
Ein Zigeuner stirbt und wird von Gott auf die Waage gestellt, die Gut gegen Schlecht abwägt.
»Du hast nichts richtig Schlimmes getan«, sagt Gott, »aber auch nichts besonders Gutes. Du hast die Wahl: Willst du in die Hölle oder ins Paradies?«
»Gibt es hier kein Deutschland?«, fragt der Zigeuner enttäuscht zurück.
Inhalt
Europas besserer Teil
Sprachkompetenz
Syrer packen aus
Vegetarier an der Bushaltestelle
Das syreralistische Komitee zur Rettung der Welt
Hölderlin und Hoffmann
Das Leben ist Bewegung
Die Ewigkeit hat uns immer im Blick
Rhabarber-Syrer
LaGeSo
Halle 36
Deutscher Pavillon
Woran denken die Syrer?
Syrer im Schnee
Drei Könige ohne Begleitung
Die Milchbauernintegration
Müllers Ruh
Syrer in der Traumfabrik
Der Integrationslehrer
Gott muss ein Zuckerbäcker sein
Ein Haus am See
Projektwoche Flüchtlingshilfe
Schöne Frau, alles gut
Was lesen die Syrer?
Verfehltes Paradies
Syrisches
Der Tunnel im Garten
Allgäu, die Himmelspforte
Die Gender-Theorie und ihre Präsenz im Alltag
Der orientalische Friseur
Die Cottbuser Zukunft
Durchfall und Husten
Zahntechnikeremigration
Haben wir es geschafft?
Epilog
Europas besserer Teil
Am Anfang war das Wort, vielleicht zwei. Europa nimmt Flüchtlinge auf, aber nur von dort, wo Krieg herrscht, und auch nicht ganz Europa, sondern nur Europas besserer Teil. Aber wo war der bessere Teil? Man konnte eigentlich nur vor Ort herausfinden, wie er hieß und wo er sich befand. Die Europäer selbst würden es sicher nicht erzählen, sie würden ihr bestes Stück nicht verraten, sie waren ja nicht dumm. Dann kriegen wir es halt selbst heraus, dachten die Völker der Welt und machten sich auf die Suche.
Nach einer gefährlichen und abenteuerlichen Reise landeten die Völker der Welt in der Eingangshalle des Wiener Westbahnhofs. Dort in der Schlange zum Infopoint habe ich sie zum ersten Mal getroffen und kennengelernt. Um 9.00 Uhr früh machte am Bahnhof der Flüchtlingshilfe-Infopoint auf, und mein alter persischer Freund Ali, der die Sprachen der meisten Völker der Welt kann, gab unermüdlich Auskunft. Zwischendurch schimpfte er furchtbar über die Ankömmlinge. Nach seiner Theorie bestanden alle Völker der Welt aus lauten, ungebildeten und ahnungslosen Idioten. Das schien mir jedoch ziemlich unwahrscheinlich.
»Können so viele Menschen irren?«, fragte ich Ali.
»Ja und wie!«, schimpfte er. »Weißt du, was sie mich alle als Erstes fragen? ›Was ist das beste Land in Europa? Und wo kriegt man den Zug dorthin?‹ Wir haben hier am Bahnhof für alle Essen und Unterkünfte besorgt, außer für die neuen, die gerade ankommen. Aber die meisten wollen den Bahnhof gar nicht verlassen, sie haben Angst, den Zug in ein besseres Europa zu verpassen. Sie leben im Bahnhof, schauen auf die Tafeln, laufen zum Infopoint und fragen mich gehetzt ›Was ist Hamburg?‹, ›Was ist Bremen?‹«
Jeden Tag holt die Flüchtlingshilfe Minderjährige ohne Begleitung aus den Zügen. Neulich war es ein zwölfjähriger Afghane, der hartnäckig darauf bestand, dass er nach Finnland weiterreisen wolle. Als er erfuhr, dass es in Finnland noch kälter war als in Wien, wollte er es nicht glauben. Er hatte von Finnland ein völlig falsches Bild. Nach einem halbstündigen Gespräch mit dem jungen Finnlandfan haben die Helfer herausgefunden, wohin der Afghane in Wahrheit wollte: Sein gelobtes Land hieß eigentlich Angry Birds, die Heimat der zornigen Vögel und fliegenden Schweinchen, die in Finnland erfunden worden waren.
»Sollten die Schweine nicht eher abschreckend wirken? Moslems mögen doch kein Schweinefleisch«, wunderten sich die Flüchtlingshelfer.
»Neulich kam ein höflicher Perser zum Infopoint«, erzählte Ali weiter, »und fragte mich: ›Wann fährt der Zug nach Island?‹ Ich war vor Lachen beinahe vom Stuhl gefallen. Du, Perser«, regte sich Ali auf, »weißt du überhaupt, wo Island liegt? Wenn du hier in die Unterführung gehst, dann die halbe Erde durch, am Nordpol raus und unten links, da ist Island. Da wächst nichts und summt nichts, da leben auch keine Menschen, nur Elfen im Gestein. Warum, zum Teufel, willst dorthin?«
Das Wort habe ihm gut gefallen, gestand der Perser: »Island« – das Land des Essens.
Die Infopoint-Leute taten allesamt so, als wüssten sie nicht, wo der bessere Teil Europas sei. Aber die Glückssucher glaubten ihnen nicht. Deswegen war um den Infopoint herum eine kriminelle Struktur entstanden, ein alternativer Infopoint: Ganoven, die mit geschultem Blick feststellen konnten, wer in der Schlange Geld hatte, denn viele Glückssucher waren nicht mit leeren Händen auf die Reise gegangen. Der alternative Infopoint flüsterte den Reichen ein, die Ehrenamtlichen von der Flüchtlingshilfe hätten den falschen Globus und falsche Karten, um den Zug in ein besseres Europa geheim zu halten. Der alternative Infopoint wisse aber Bescheid und könne für tausend Euro in bar seine geheimen Kenntnisse weitergeben. Viele gingen zu einer Western-Union-Filiale, um Geld aus Libyen oder Syrien zu empfangen, scheiterten jedoch beim Ausfüllen des Formulars. Man musste dort nämlich seine libysche beziehungsweise syrische Postleitzahl eintragen, die sie nicht kannten, weil sie vielleicht nie Post bekommen hatten.
Manche waren erschöpft von der Glückssuche und gaben auf. »Zum Teufel mit dem besseren Europa, wir bleiben erst mal hier«, sagten sie.
Eine Freundin von mir hat in München einer Familie aus Syrien bei sich zu Hause Asyl gewährt, einem Mann mit Frau und fünf Kindern. Der Mann hat ihr in einem vertraulichen Gespräch gestanden, er wisse, dass es kein besseres Europa gäbe, nur dieses hier. In Damaskus war er Stofffabrikant gewesen, nun wartete er, bis der Krieg zu Ende war, und wollte dann nichts wie weg – zurück in die Heimat.
Doch die meisten gaben nicht auf. Während die Männer Glücksstrecken auskundschafteten, spazierten die Frauen am Bahnhof hin und her und inspizierten die Geschäfte. Bis auf die Nase in Tücher gewickelt, blieben sie am liebsten vor den Kosmetikgeschäften stehen und betrachteten tausend Lippenstifte und Augentuschen in den verschiedensten Farben. Ihre Nasen leuchteten. So mussten die Menschen im besseren Europa aussehen: wie die Models in der Kosmetikwerbung. Und wer weiß, vielleicht waren solche Träume gar nicht schlecht:
Einmal hatte sich in meiner Heimatstadt Moskau eine Selbstmordattentäterin der Polizei gestellt. Sie trug eine Bombe bei sich, zündete sie aber nicht. Bei ihrer Befragung gab sie zu Protokoll, sie sei auf dem Weg in den Tod an einem großen Schaufenster mit Brautkleidern vorbeigekommen und habe sich überlegt, wenn sie die Bombe jetzt zünde, würde sie nie im Leben ein so schönes Kleid tragen. Manchmal können also ein bisschen Romantik und Eitelkeit Leben retten.
Die Zugereisten froren am Bahnhof. Die Frage, wann endlich der richtige Zug in das bessere Europa kam, blieb ungeklärt. Die Einheimischen, die an den Zugereisten vorbeigingen, wussten: Es gab kein besseres Europa außerhalb von diesem hier. Das bessere Land war immer das, welches wir dazu machten. Unsere Gegenwart ist die Produktionsstätte der Zukunft. Nur das, was wir heute tun, wird morgen die Zukunft sein.
Sie hatten lange gesucht und doch nichts Gescheites gefunden, also reisten die Völker der Welt schließlich nach Deutschland. Sie sind gefahren, geschwommen und zu Fuß gelaufen, über natürliche Hürden und künstliche Staatsgrenzen. Sie haben sich über jedes Land wie ein orientalischer Teppich ausgebreitet, und sie waren auf einmal überall. Auf meinen Lesereisen durch unzählige Dörfer und Kleinstädte Deutschlands sagte ich nicht mehr wie früher »Wie geht’s?« zur Begrüßung, sondern: »Wie geht’s den Syrern?« Die Neuankömmlinge, egal woher sie kamen, wurden in Deutschland allgemein als »Syrer« bezeichnet. Jedes kleine verschlafene Nest machten sie zum Spielort der Weltpolitik. Flüchtlinge waren die Newsmaker der neuen Zeit.
Wer waren sie wirklich? Wahrscheinlich waren es am Anfang tatsächlich syrische Familien, die sich auf den weiten Weg gemacht hatten. Ihr Land wurde von einem Dutzend anderer Länder zerbombt, es musste ein diktatorisches Regime, zwölf Geheimdienste und mehrere radikale religiöse Sekten ertragen, die alle bis an die Zähne bewaffnet waren. Die Anzahl der Kriege, die in Syrien gleichzeitig geführt wurden, war selbst für die Einheimischen unübersichtlich geworden. Letzten Endes war es gar nicht so wichtig, wer gegen wen kämpfte. Die Friedliebenden, die Unbewaffneten gingen wie immer als Erste drauf. Alle, die laufen konnten und keine Lust auf Krieg hatten, nahmen ihre Kinder und gingen los – auf der Suche nach einer besseren, zumindest einer sichereren Welt.
Die anderen Völker, die Libyer und Afghanen, die Iraker, Pakistani, Äthiopier, Algerier und Jemeniten, alle schauten ihnen hinterher. Wo wollen denn die Syrer hin? Die Syrer sagten es nicht, vor allem, weil sie es selbst nicht wussten. Geheimtipp!, dachten die anderen: Die Syrer wissen irgendetwas und sagen es nicht weiter. Vielleicht kennen sie ein Land, in dem die Sonne immer scheint, die Menschen immer freundlich und nett zueinander sind und wo einem die Gurken ins Maul wachsen. »Wir lassen die Syrer nicht einfach so wegziehen, wir kommen mit!«, sagten die Völker der Welt und liefen den Syrern hinterher.
Nach einer Weile landeten sie alle hier, ausgerechnet in Deutschland, einem Land der Ordnung und des Fleißes. Die Deutschen schauten ziemlich komisch aus der Wäsche, als der unerwartete Besuch da war. Die ganze Welt war plötzlich hier zu Gast und das, ohne anzuklopfen. Das letzte Mal hatten sie die ganze Welt zehn Jahre zuvor zu Gast gehabt, bei der Fußballweltmeisterschaft 2006, die unter dem Motto »Die Welt zu Gast bei Freunden« stattgefunden hatte. Schon damals hatten nicht alle Einheimischen diesen Slogan verstanden. Wer sollten diese geheimnisvollen Freunde sein, bei denen die ganze Welt zu Gast war? Damals war allerdings allen klar, die Welt würde nur für kurze Zeit hier vorbeischauen, sich ein wenig amüsieren, ein paar Bierchen trinken, die Gastgeber materiell entlohnen und sich dann wieder verabschieden. Bei der Fußball-WM ging es mehr um eine oberflächliche Bekanntschaft mit der Welt, nicht um eine Pflicht-Freundschaft.
Diesmal sah die Welt, die kam, auch ganz anders aus. Es waren unrasierte Männer mit müden Gesichtern, Jugendliche mit Bärten, Frauen in Kopftüchern, Kinder mit traurigen Augen. Begrüßen oder abschrecken? Die öffentliche Meinung teilte sich. Die einen begrüßten die Ankömmlinge am Bahnhof und brachten ihnen ihre alten Decken, die anderen zündeten die Flüchtlingsunterkünfte an und demonstrierten gegen die Fremden. Die einen sagten, wir dürfen nicht zu gastfreundlich sein, sonst kommt auch noch die andere Hälfte der Welt zu uns und untergräbt Deutschland. Die anderen sagten: Nur wenn wir den anderen helfen, können wir als Gesellschaft bestehen. Jedes Menschenleben ist gleich viel wert, niemand darf draußen in der Kälte bleiben.
Schnell wurden die »Syrer« zum festen Bestandteil deutscher Politik, zu einem gewichtigen Argument in den Gesprächen über die Zukunft der Städte und Gemeinden, zum Alltagsthema in Kneipen und an Küchentischen. Für Jugendliche wurden die Flüchtlingsunterkünfte zu einer interessanten Alternative für das Freiwillige Soziale Jahr. Wer keine Lust auf Altersheim oder Kindergarten hatte, konnte Flüchtlingen helfen.
»Na, was machen die Syrer?«, fragte ich meinen Sohn, wenn er von der Schule nach Hause kam. In der Schule meines Sohnes, einem Sprachgymnasium mit Latein als Schwerpunkt, lebten die Syrer in der Turnhalle. Deswegen fiel für alle Klassen ein Jahr lang der Sportunterricht aus. Alle freuten sich und spielten lieber am Freitagabend hinter der Turnhalle Bierball. Bierball ist eine in Mode gekommene deutsche Sportart, bei der man sehr viel Bier trinken und mit Flaschen auf Flaschen werfen muss. Die jungen Syrer aus der Turnhalle spielten erstaunlicherweise mit, obwohl sie doch Moslems waren.
»Dürfen Moslems Bier?«, fragten die neugierigen Schüler.
»Kommt darauf an«, antworteten die jungen Syrer ausweichend. Sie haben sich tapfer geschlagen, konnten sich gut auf Englisch verständigen und wurden später von den älteren Syrern aus der Turnhalle erwischt und verdroschen.
Für mich als Geschichtensammler waren die Syrer eine große Bereicherung. Auf einmal lieferten mir die Kleinstädte und Dörfer, in denen früher nie etwas los gewesen war, tolle Geschichten. Wie beispielsweise diese hier aus einer Stadt in Ostwestfalen. Dort wollte der CDU-Bürgermeister die von der Schließung bedrohte alte Oberschule nicht aufgeben, auf jeden Fall nicht so schnell. Er war konservativ und mochte keine Veränderungen. Der Bürgermeister war früher Oberst bei der Bundeswehr gewesen, er rasierte sich die Haare gerne kurz, trug Tarnanzüge und war Vorsitzender im Schützen- und Reservistenverein. Die alte Schule hatte schon lange kurz vor dem Aus gestanden, die Stadt schrumpfte, es gab nicht genug Kinder für zwei Schulen. In der neuen, modernen waren die Klassen nur halb voll, in der alten halb leer. Jedem war klar, früher oder später musste die alte Schule geschlossen werden. Ja, sagte der Bürgermeister, aber nicht jetzt.
Dann kamen die Syrer. Die letzten zwei Dutzend Schüler wurden sofort in die neue Schule verlegt, und aus den Klassenräumen des alten Gebäudes wurden Flüchtlingsunterkünfte. Am Wochenende beschloss der Bürgermeister, den Syrern einen Besuch abzustatten, um nach dem Rechten zu schauen und zu kucken, ob die Neuankömmlinge mit ihrem Alltag klarkamen. Er pfiff seine Freunde aus dem Reservistenverein zusammen, und gemeinsam gingen sie zu der alten Schule, die sich etwas außerhalb des Zentrums befand, wobei sie eine Abkürzung übers Feld nahmen.
Die Syrer saßen gerade auf dem Hof, wo die Herbstsonne den geflüchteten Südländern ihre letzte Wärme spendete. Plötzlich sahen sie, wie mehrere Männer in Tarnanzügen aus allen Richtungen ihren Hof umzingelten. Vorneweg der Bürgermeister: »Na, alles klar?« Die kriegserprobten Syrer fielen sofort auf den Boden, Gesicht nach unten, Hände hinter dem Kopf, eine hochschwangere Frau bekam Wehen. Der Bürgermeister rief im Krankenhaus an, aber die Hilfe kam zu spät, der Reservistenverein musste in einem Akt der Solidarität kollektiv die Hebamme ersetzen. Die Ortszeitung erschien am nächsten Tag mit der skandalösen Überschrift: »Bürgermeister bekommt syrisches Kind.«
Eine andere bemerkenswerte Geschichte ereignete sich in Franken: »Das war ein schöner Überfall!«, freute sich dort ein Buchhändler. »Die Syrer haben mich gerettet. Bereits vor Weihnachten hab ich sage und schreibe dreihundert deutsche Lehrbücher verkauft, dazu Hefte, Stifte und Kugelschreiber. Sie müssen ja alle Deutsch lernen, Erwachsene wie Kinder. Sie haben Lust, die Sprache zu lernen, und sie bekommen das ganze Lernzeug erstattet.«
Die Syrer waren in der Stadt in einem verlassenen Kloster einquartiert worden, dicke Mauern, saubere Böden. Wir gingen mit dem Buchhändler durch die Stadt, es war Sonntag, alles wirkte wie ausgestorben. Oben in den Bergen lag Schnee, unten nieselte ein kalter Regen. Und plötzlich sah ich sie. Die Syrer drückten sich an die Wände der geschlossenen Stadtbibliothek, sie klebten mit ihren Händen buchstäblich an der Hausmauer, als wollten sie die Bibliothek umarmen. So etwas hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen.
»Warum umarmen die Syrer die Stadtbibliothek, noch dazu an einem Tag, wo sie geschlossen ist?«, fragte ich vorsichtig den Buchhändler. »Ist das die Lust, die deutsche Sprache zu lernen, die sie so verrückt macht?«
Der Buchhändler lachte. »Natürlich nicht«, meinte er. »Die Bibliothek ist das einzige Haus mit WLAN, bei dem das Signal durch die Wände geht. Wenn du dein Handy ganz fest an die Hausfassade presst, hast du Internet. Und die Syrer leben im Internet, es ist ihre einzige Verbindung nach draußen, zur Heimat.«
Wir gingen an der umarmten Bibliothek vorbei. Sollte die Menschheit dem Internet irgendwann ein Denkmal setzen, stelle ich es mir genau so vor.
Auch mein Freund Norbert hat seine ganz persönliche Syrer-Geschichte erlebt. Norbert hat den tollsten Musikclub in ganz Hessen. Das finde nicht nur ich: Er wurde vor Kurzem sogar in einem bundesweiten Wettbewerb für die beste Musikeinrichtung ausgezeichnet. Der einzige Haken dabei: Sein Club befindet sich in einem leer stehenden Haus mitten in der Stadt, einer Ruine aus den Siebzigerjahren, sechs Stockwerke hoch mit kleinen Fenstern, die wie Schießscharten aussehen. Ein Haus aus der Nachkriegszeit, ein Kind des Kalten Krieges – die Angst vor einer neuen Auseinandersetzung ist ihm quasi in die Fassade geschrieben. Lange Zeit fand sich kein Investor für das Haus. Irgendwann wurde es schließlich an eine Wohnbaugesellschaft übertragen, die mit dem Haus das Beste vorhatte: Sofort plattmachen und an seiner Stelle etwas Moderneres bauen.
Der Club im Erdgeschoss, der angeblich beste Musikclub Hessens, wehrte sich gegen diese Pläne. Der Kampf lief nach dem Drehbuch eines Mafiakrieges. Zuerst kamen die Feuerwehrmänner in den Club, stellten erhebliche Mängel beim Brandschutz fest und monierten fehlende Fluchtwege: Der Club hätte durch die notwendigen Umbauten die Hälfte aller Plätze eingebüßt. Mein Freund beschwerte sich beim Bürgermeister.
»Das geht so nicht!«, sagte er. »Die Feuerwehr wird benutzt, um uns rauszumobben. Die Wohnbaugesellschaft glaubt wohl, sie sei die Cosa Nostra, aber sie haben sich geirrt. Wir gehen nicht!«
Die Cosa Nostra atmete tief durch und brachte ein neues, zeitgemäßes Argument ins Spiel: die Syrer. In dem leer stehenden Haus sollten Flüchtlinge einquartiert werden. Als Kriegsgeschädigte durfte keine laute Musik in ihrer Nähe gespielt werden, denn alles über 90 Dezibel könnte bei ihnen zu traumatischen Psychosen führen, wie ein mafianaher Psychiater bestätigte. »Drehen Sie die Bässe ab!«, verlangte die Cosa Nostra und rieb sich schon die Hände. Sie wusste genau, dass moderne Musik ohne Bässe nicht möglich war.
Der Club gab jedoch nicht klein bei. Die Jungs suchten und fanden eine bessere Unterkunft für die Flüchtlinge in der Nähe der Stadtgrenze in der Natur, wo man keine Bässe und keine Höhen, sondern nur das Zwitschern der Vögel und Bellen der Hunde hören würde. Dort wurden die Flüchtlinge einquartiert. Sie kamen jetzt zu den Konzerten in den Club. Anscheinend zogen Bässe gerade Kriegsgeschädigte an.
In unserem brandenburgischen Dorf hatte man keine Flüchtlinge erwartet. Es gibt bei uns keine Schule, keine Integrationsmöglichkeit, es gibt nicht einmal eine Gaststätte oder Bäckerei. Es gibt gar nichts. Nur eine alte Kirche, die immer geschlossen ist, einen Friedhof und die freiwillige Feuerwehr. Der nächste Supermarkt befindet sich fünf Kilometer entfernt in einer Kleinstadt, in der bereits zwei Demos gegen die Flüchtlinge stattgefunden hatten.
»Wir können keine Syrer aufnehmen«, argumentierten die Bürger. »Wir haben nur einen Supermarkt für drei Dörfer. Wenn die Syrer kommen, essen sie uns den leer.«
Einige hatten auch Angst um ihre Kinder, die sich erschrecken könnten, wenn sie jeden Tag an Flüchtlingen vorbeigingen.
In unserem kleinen Dorf standen jedoch zwei Wohnungen leer, und als der Bürgermeister wie befohlen den Leerstand meldete, hatten wir, zack, Syrer im Dorf. Wir mussten sie selbst vom Bahnhof abholen. Es sollte eine typische syrische Familie sein – oder zwei: ein Mann, zwei Frauen, fünf Kinder, und keiner von ihnen verstand irgendeine Sprache außer Arabisch. In unserem Dorf konnte keiner Arabisch.
»Wie sollen sie hier leben? Sie schaffen es nicht einmal bis zum Supermarkt«, meinte Elke, eine Nachbarin von mir.
»Ach komm, Oma«, sagte ihr Mann Günther. »Sie haben es durch die halbe Welt hierher geschafft, also schaffen sie auch die letzten fünf Kilometer bis zum Netto.«
Das Oberhaupt der Syrer war nach dem langen Weg offensichtlich etwas verwirrt und checkte gar nichts mehr. Wir unterhielten uns per Google-Übersetzer, der mit strenger weiblicher Stimme zu uns sprach. Das Ganze funktionierte so: Wir gingen zur Kirche, weil nur dort der Empfang gut war, und der Syrer zischte irgendetwas auf Arabisch ins Handy, woraufhin die strenge Stimme es uns auf Deutsch mitteilte: Als Erstes ließ er uns wissen, ihm gefalle es hier bei uns in Brandenburg ganz gut. Das hat uns alle verblüfft. Unser Dorf hatte ja, wie gesagt, keine Sehenswürdigkeiten zu bieten, und der Mann war gerade einmal zwei Stunden da.
»Was genau hat ihm denn gefallen? Kannst du bitte nachhaken?«, bat mich Elke und schaute sich um.
Was genau ihm in Brandenburg gefiel, konnten wir nicht herauskriegen, denn das Internet machte sogar auf dem Kirchplatz alle drei Minuten schlapp.
Die Syrer hatten kein Geld. Wir riefen beim zuständigen Sozialamt in der Bezirkshauptstadt an: »Tagchen, die Syrer sind da. Sie haben allerdings kein Geld, dabei müssten sie doch irgendetwas von Ihnen bekommen.«
»Wat für Syrer?«, fragte das Amt. »Hier kann keiner Arabisch. Wat soll’n wir mit Syrern und überhaupt: Sie rufen außerhalb der Sprechzeiten an, ick darf gar nich mit Ihnen reden. Rufen Sie uns an Dienstagen und Donnerstagen zwischen 9.00 und 12.00 Uhr an, und wir machen einen Termin mit den Syrern aus. Aber nur wenn jemand dabei ist, der Arabisch spricht«, sagte das Amt und legte auf.
Also spendete Matthias, unser Dorfältester, dem Syrer hundert Euro und fuhr mit ihm in den nächsten Ort, den Supermarkt leer kaufen. Die Frauen hatten dem Syrer einen Einkaufszettel mitgegeben. Er las die arabischen Kringel vom Zettel laut ab, und das Telefon spuckte daraufhin Lebensmittelnamen aus: »Salz«, sagte Google, »Pfeffer«, »Olivenöl«. Wie das Menü an dem Abend aussehen würde, war unklar. Es stand auf jeden Fall ein großes Kochen bevor.
Sprachkompetenz
Der Google-Übersetzer ist in diesem Jahr zur wichtigsten App Deutschlands geworden. Noch nie war die Notwendigkeit des Übersetzens so groß. Es gab in Deutschland bei Weitem nicht so viele Arabisch-Übersetzer wie nötig, um sich mit den Flüchtlingen zu verständigen. In letzter Zeit waren der Arabistik nämlich viele Studenten verloren gegangen. Ich habe selbst einmal einen arbeitslosen Arabischlehrer in Berlin kennengelernt, der gerade dabei war, eine Umschulung zum Steuerberater zu machen.
»Eine Sprache wird gern gelernt, wenn es in dieser Sprache genug Interessantes zu lesen gibt«, erklärte er mir die Misere seines Faches. »Und was hat uns die arabische Welt außer alten Schriften anzubieten? Spannende Literatur? Großartige Filme? Wichtige wissenschaftliche Aufsätze? Philosophische Traktate? Nein, diese Länder kommen in den Nachrichten fast ausschließlich unter den Rubriken ›Politik‹ oder ›Religion‹ vor. Und nicht alle Menschen interessieren sich für Politik oder Religion«, hatte der Arabischlehrer damals gemeint. Jetzt konnte er sicher nicht mehr über Arbeitsmangel klagen.
Inzwischen vertraute ganz Brandenburg dem Google-Übersetzungsprogramm. Es wurde auf dem Sozialamt benutzt, in dem Supermarkt hatte die Kassiererin es immer zur Hand, und die Apothekerin bedankte sich überschwänglich bei Matthias, als er der älteren Frau half, die App herunterzuladen, und ihr zeigte, wie man damit umging.
»Vielleicht steckt Google hinter dieser humanitären Katastrophe«, meinte unser Ortsbürgermeister. »Das Programm wurde ja in Amerika entwickelt. Die ganze Welt weiß, wie hinterlistig die Amerikaner sind. Was ist, wenn es falsch übersetzt? Wenn es das eine sagt und etwas anderes meint? Auf diese Weise könnten die Amerikaner das friedliche Zusammenleben in Brandenburg, ach was, in ganz Deutschland beeinflussen«, meinte er. Matthias hielt dagegen. Er glaubte nicht an die Hinterhältigkeit der Amerikaner. Warum sollten sie so etwas wollen?
Tatsächlich versagte das Programm oft. Das lag jedoch nicht an den Amerikanern, sondern an der Vielfalt des Arabischen. Manchmal gab es für ein und denselben Gegenstand viele Ausdrücke. Außerdem führte Google unter »Arabisch« gleich ein Dutzend Varianten: Arabisch-Libanesisch, Arabisch-Irakisch, Arabisch-Jemenitisch. Aber Arabisch-Syrisch gab es zum Beispiel nicht. Nach mehreren Menschenversuchen stellte der Verein »Sport und Kultur e.V.« fest, dass die zu uns gekommenen Syrer am besten auf Arabisch-Jordanisch reagierten. Der Verein hatte die Schirmherrschaft über beide bei uns ansässigen syrischen Familien übernommen.
»Die Syrer sind unglaublich langsam, vielleicht sind sie aber auch einfach nur müde nach dem langen Marsch«, meinte der Vorsitzende Matthias. »Wenn man bei ihnen anklopft, dauert es eine halbe Stunde, bis die Tür aufgeht, schließlich müssen ja erst einmal alle Frauen eingehüllt werden. Wenn ich die Wohnung betrete, beschlägt mir sofort die Brille.«
Die Syrer froren nämlich in Brandenburg. Sie machten alle Fenster zu und heizten volle Pulle. Dabei trugen sie schon drei Pullover übereinander, trotzdem war ihnen kalt. Kurz vor Weihnachten schaute endlich einen halben Tag lang die Sonne durch die Wolken.
»Die Sonne ist bei uns in dieser Jahreszeit ein seltener Gast«, sagte ich zu den Syrern. »Macht die Fenster auf! Sonne ist wichtig für die Kinder. Wenn ihr die Sonne seht, geht raus aus der Wohnung, zieht die Kinder warm an, und ab auf den Spielplatz!«
Die Syrer lächelten freundlich, nickten, blieben aber im Haus. Sie wollten nicht auf den Spielplatz. Vielleicht waren sie in der letzten Zeit zu viel draußen gewesen und wollten jetzt zur Abwechslung lieber drinbleiben?
Die Vereinsmitglieder grübelten über erste mögliche Annäherungsversuche.
»Am besten wäre es, wenn sie für uns syrisch kochen, und wir bringen im Gegenzug etwas Deutsches zu essen mit und backen Weihnachtskekse mit den Kindern. Dabei können sie schon ein bisschen Deutsch lernen«, meinte Matthias.
»Bis sie Deutsch gelernt haben, wird das Essen kalt«, meinte seine Frau. »Und wie soll man den Syrern bitte schön erklären, dass sie kochen sollen? Kann der Google-Übersetzer ›Weihnachtsgebäck‹ ins Arabische übersetzen? Gibt es das überhaupt?«
Arabisch-Jordanisch ist eine unglaublich lange Sprache. Ysuf, der Familienvater, redete ellenlange Sätze ins Telefon, und auf Deutsch kam dabei nur »weiße Bohnen« raus.
»Und ich dachte, Deutsch sei die umständlichste Sprache der Welt«, lachte ich.
»Helfen Sie Flüchtlingen, vervollständigen Sie unser Wörterbuch!«, stand auf der Google Seite.
Syrer packen aus
»Was ist, bitte schön, ein Event-Konditor?«, fragte ich Anna, eine gute Bekannte, die für diesen komisch klingenden Beruf eine Lehre in Berlin machte In meiner Vorstellung war ein Event-Konditor jenes Mädchen, das bei besonderen Anlässen aus der Torte sprang und Happy Birthday sang – vielleicht auch ein Mann. Auf jeden Fall jemand, den man in einer Konditorei zum Kuchen dazubestellte.