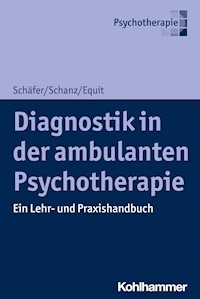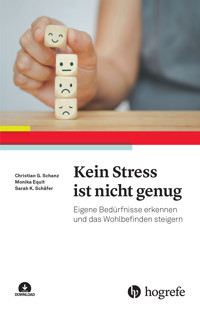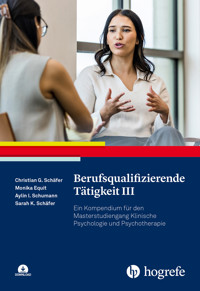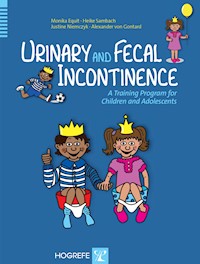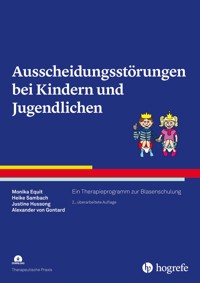
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ausscheidungsstörungen (Einnässen oder Einkoten) kommen bei Kindern und Jugendlichen häufig vor und sind emotional belastend. Gerade Betroffene mit komplexen Formen, wie multiplen Ausscheidungsstörungen und/oder komorbiden psychischen Störungen, sind mit den diagnostischen und therapeutischen Standards jedoch oft nicht erfolgreich zu behandeln. Für diese Gruppe wurde das vorliegende Manual entwickelt. Das gruppentherapeutische Programm zur Behandlung von Ausscheidungsstörungen richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Elemente des Trainings lassen sich auch gut in eine Einzeltherapie integrieren; daneben werden Möglichkeiten für die Anwendung bei Jugendlichen vorgestellt. Die vorliegende 2., überarbeitete Auflage berücksichtigt den aktuellen Forschungsstand zu den Störungsbildern und geht auf die Diagnostik und Anamnese ein. Anschließend wird das therapeutische Vorgehen praxisnah beschrieben. In 7 bis 9 Sitzungen werden Themen wie Anatomie und Physiologie, Pathophysiologie der Störung, Blasen- und Körperwahrnehmung, gesunde Ernährung, gesundes Trink- und Miktionsverhalten kindgerecht behandelt. Psychotherapeutische Elemente, wie z.B. Wahrnehmungsübungen und Stressmanagement, ergänzen das Programm, und die spielerische Umsetzung der einzelnen Komponenten erleichtert den häufig schambehafteten Umgang mit der Thematik. Die zahlreichen farbig illustrierten Materialien wurden für die 2. Auflage um Inhalte zur Enuresis nocturna (Einnässen nachts) erweitert. Die Materialien können nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Website heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Monika Equit
Heike Sambach
Justine Hussong
Alexander von Gontard
Ausscheidungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen
Ein Therapieprogramm zur Blasenschulung
2., überarbeitete Auflage
Prof. apl. Dr. Monika Equit, geb. 1978. Psychologische Psychotherapeutin. Seit 2014 Leitung der Psychotherapeutischen Universitätsambulanz in der Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität des Saarlandes. Seit 2015 Supervisorin (Verhaltenstherapie) und Co-Leitung des Weiterbildungsinstitutes für Psychotherapie Saarbrücken an der Universität des Saarlandes (WIPS GmbH).
Heike Sambach, geb. 1980. Kinderkrankenschwester. Seit 2005 tätig in der Spezialambulanz für funktionelle Störungen der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg. Seit 2010 Kontinenztrainerin/Urotherapeutin und Dozentin für Kontinenzschulungen.
Dr. Justine Hussong, geb. 1985. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Seit 2010 tätig in der Spezialambulanz für funktionelle Störungen der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg.
Prof. Dr. Alexander von Gontard, geb. 1954. Facharzt für Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin. 2003 – 2019 Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums des Saarlandes und dort Leiter der Spezialambulanz für Ausscheidungsstörungen. Seit 2023 Co-Chefarzt der Abteilung Eltern-Kind und Jugendliche, Hochgebirgsklinik Davos, Schweiz.
Die Vorauflage ist erschienen unter dem Titel „Ausscheidungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Ein Therapieprogramm zur Blasen- und Darmschulung“.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Satz: Sina-Franziska Mollenhauer, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Idee für das Pipi-Prinzen-Paar: Sigrid Bach, Kirkel
Illustrationen Pipi-Prinzen-Paar: Esther Rohmann, Göttingen
Format: EPUB
2., überarbeitete Auflage 2025
© 2013 und 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3158-1; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3158-2)
ISBN 978-3-8017-3158-8
https://doi.org/10.1026/03158-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Übersicht
Cover
Titel
Über die Autor:innen
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Inhalt
Hinweise zu den Online-Materialien
5Inhaltsverzeichnis
Ausscheidungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen
Vorwort
Einleitung
Teil I: Theoretische Grundlagen
Kapitel 1: Ausscheidungsstörungen im Kindes- und Jugendalter
1.1
Enuresis nocturna
1.1.1
Definition und Klassifikation
1.1.2
Subformen
1.1.3
Prävalenz
1.1.4
Differenzialdiagnosen und Komorbiditäten
1.1.4.1
Organische Differenzialdiagnosen und Komorbiditäten
1.1.4.2
Komorbide psychische Symptome und Störungen
1.1.5
Ätiologie
1.1.5.1
Genetische Faktoren
1.1.5.2
Neurobiologische und neuroendokrinologische Faktoren
1.1.5.3
Psychische und psychosoziale Faktoren
1.2
Funktionelle Harninkontinenz
1.2.1
Definition und Klassifikation
1.2.2
Subformen
1.2.3
Prävalenz
1.2.4
Organische Differenzialdiagnosen und Komorbiditäten
1.2.5
Komorbide psychische Symptome und Störungen
1.2.6
Ätiologie
1.2.6.1
Genetische Faktoren
1.2.6.2
Neurobiologische und neuroendokrinologische Faktoren
1.2.6.3
Psychische Faktoren
1.3
Stuhlinkontinenz
1.3.1
Definition und Klassifikation
1.3.2
Subformen
1.3.2.1
Funktionelle Obstipation mit Stuhlinkontinenz
1.3.2.2
Nicht retentive Stuhlinkontinenz
1.3.2.3
Weitere Störungsbilder
1.3.3
Prävalenz
1.3.4
Differenzialdiagnosen und Komorbiditäten
1.3.4.1
Organische Differenzialdiagnosen und Komorbiditäten
1.3.4.2
Komorbide psychische Symptome und Störungen
1.3.4.3
Komorbide somatische Störungen
1.3.4.4
Komorbides Einnässen
1.3.5
Ätiologie
1.3.5.1
Genetische Faktoren
1.3.5.2
Neurobiologische und neuroendokrinologische Faktoren
1.3.5.3
Gastrointestinale Funktionsbefunde
1.3.5.4
Lerntheoretische Faktoren
1.3.5.5
Psychosoziale Faktoren, Sauberkeitserziehung und Bewegung
Kapitel 2: Diagnostik
2.1
Standardmäßiges diagnostisches Vorgehen
2.1.1
Störungsspezifische Anamnese
2.1.2
Weitergehende Eigenanamnese des Kindes und Familienanamnese
2.1.3
48-Stunden-Miktionsprotokoll und 14-Tage-Protokoll
2.1.4
Körperliche Untersuchung
2.1.5
Ultraschall und Urinstatus
2.2
Erweiterte Diagnostik bei komplexen Ausscheidungsstörungen
2.2.1
Uroflowmetrie
2.2.2
Bakteriologie
2.2.3
Weitere kinderärztliche und urologische Diagnosemaßnahmen
2.3
Testpsychologische Untersuchungen
Kapitel 3: Therapie von Ausscheidungsstörungen
3.1
Allgemeine Behandlungsprinzipien
3.2
Therapie der Stuhlinkontinenz
3.3
Therapie der funktionellen Harninkontinenz
3.3.1
Dranginkontinenz
3.3.2
Harninkontinenz bei Miktionsaufschub
3.3.3
Detrusor-Sphinkter-Dyskoordination
3.4
Therapie der Enuresis nocturna
3.5
Urotherapie zur Behandlung von komplexen Ausscheidungsstörungen
3.5.1
Definition
3.5.2
Wissenschaftliche Befunde
Teil II: Therapiemanual
Kapitel 4: Beschreibung und Aufbau des Therapiemanuals
4.1
Entwicklung des Therapiemanuals
4.2
Formale Hinweise zur Anwendung
4.3
Inhalte der Sitzungen
4.4
Einbeziehung der Eltern
4.5
Anwendung als Einzelschulung
4.6
Anwendung bei Jugendlichen
Kapitel 5: Durchführung der einzelnen Sitzungen
5.1
Erste Sitzung: Einführung, Problem- und Zielanalyse
5.2
Zweite Sitzung: Anatomie und Physiologie
5.3
Dritte Sitzung: Pathophysiologie des Einnässens und Umgang mit Stress
5.4
Vierte Sitzung (fakultativ bei Enkopresis und/oder Obstipation): Pathophysiologie des Einkotens und der Verstopfung, Darmmanagement
5.5
Fünfte Sitzung: Trinken
5.6
Sechste Sitzung: Toilettengang, Körperhygiene
5.7
Siebte Sitzung: Gefühle, Körper- und Blasenwahrnehmung
5.8
Achte Sitzung (fakultativ bei Enuresis nocturna): Pathophysiologie des nächtlichen Einnässens und Therapiemöglichkeiten
5.9
Neunte Sitzung: Wissensüberprüfung, Zielerreichung, Ausblick
Kapitel 6: Evaluation des Behandlungsprogramms
6.1
Stichprobe
6.2
Methode
6.3
Ergebnisse
6.4
Fazit
Literatur
Anhang
Hinweise zu den Online-Materialien
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Therapieablauf und Platzierung der Blasenschulung
Abbildung 2: Stimmungsbarometer
Abbildung 3: Gefühlskärtchen (Version „Carlotta“)
Abbildung 4: Die 3 W’s (in Anlehnung an Konsensusgruppe Kontinenzschulung im Kindes- und Jugendalter e. V., 2010, Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Pabst Science Publishers)
Abbildung 5: Arbeitsblatt „Körperbild“ (Version für Jungen)
Abbildung 6: Bildmaterial – Miktionsaufschub beim Spielen
Abbildung 7: Bildmaterial – Harninkontinenz bei Detrusor-Sphinkter-Dyskoordination
Abbildung 8: Arbeitsblatt zum Thema Stress
Abbildung 9: Arbeitsblatt „Wie entsteht eine Verstopfung?“
Abbildung 10: Arbeitsblatt „Wie kommt es zum Einkoten?“ (Seite 1)
Abbildung 11: Arbeitsblatt „Wie kommt es zum Einkoten?“ (Seite 2)
Abbildung 12: Regeln für einen gesunden Darm
Abbildung 13: Toilettentrainingsplan
Abbildung 14: Das Trinkspiel
Abbildung 15: Arbeitsblatt „Ablauf eines Toilettengangs“
Abbildung 16: Arbeitsblatt für die Wahrnehmungsübung (in Anlehnung an Konsensusgruppe Kontinenzschulung im Kindes- und Jugendalter e. V., 2010, Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Pabst Science Publishers)
Abbildung 17: Bildmaterial zur Erklärung der Vorgänge beim Einnässen nachts
Abbildung 18: Bildmaterial zur Verwendung eines Klingelgeräts
Abbildung 19: Zielanalyse (in Anlehnung an Konsensusgruppe Kontinenzschulung im Kindes- und Jugendalter e. V., 2010, Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Pabst Science Publishers)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Klassifikation der Enuresis nach ICD-10 (WHO, 1993; WHO/Dilling et al., 2015), ICD-11 (WHO, 2019) und DSM-5 (APA, 2013, 2022)
Tabelle 2: Formen des nächtlichen Einnässens (nach von Gontard, 2018)
Tabelle 3: Klassifikation der Stuhlinkontinenz nach (WHO/Dilling et al., 2015), ICD-11 (WHO, 2019) und DSM-5 (APA, 2013, 2022)
Tabelle 4: ROME-IV-Kriterien der funktionellen Obstipation und der nicht retentiven Stuhlinkontinenz (nach Hyams et al., 2016)
Tabelle 5: Überblick über Themen und Ziele der Gruppentherapie
Tabelle 6: Möglicher Aufbau einer Einzelschulung
5
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
101
103
104
9Vorwort
Ausscheidungsstörungen sind häufige, emotional belastende Störungen bei Kindern und Jugendlichen und werden oftmals von weiteren psychischen Symptomen oder Störungen begleitet. Ausscheidungsstörungen umfassen das nächtliche Einnässen (Enuresis nocturna), das Einnässen tagsüber (funktionelle Harninkontinenz) und das Einkoten (Enkopresis/Stuhlinkontinenz1). Für jede dieser Störungen stehen wirksame, evidenzbasierte Behandlungen zur Verfügung, die für die meisten Kinder vollkommen ausreichen. Diese Standardtherapien sollten immer zuerst durchgeführt werden und werden in den aktuellen S2k-Leitlinien (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie [DGKJP] & Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin [DGKJ], 2021; Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung [GPGE] & Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie [DGKJP], 2022) sowie bei von Gontard (2018) ausführlich beschrieben. Allerdings gibt es trotz Befolgung aller diagnostischen und therapeutischen Standards eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die mit diesen Behandlungsmaßnahmen nicht trocken und sauber wird, d. h. nicht die Kontinenz als Behandlungsziel erreicht. Oft handelt es sich dabei um sog. „komplexe“ Ausscheidungsstörungen. Was versteht man darunter?
Zum einen handelt es sich um Kinder mit multiplen Ausscheidungsstörungen, d. h. sie nässen z. B. nicht nur nachts ein, sondern leiden möglicherweise unter einer kombinierten Enuresis nocturna, einer Harninkontinenz tagsüber und vielleicht sogar zusätzlich unter einer Stuhlinkontinenz mit oder ohne Obstipation (Verstopfung). Zum anderen sind es Kinder mit psychischen Begleitstörungen wie einer Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Störung des Sozialverhaltens (von Gontard et al., 2011; Niemczyk et al., 2015). Werden diese Störungen nicht erkannt und behandelt, kann dies die Mitarbeit der Kinder und damit den Therapieerfolg bei der Behandlung von Ausscheidungsstörungen negativ beeinflussen (Crimmins et al., 2003). Zudem gibt es eine Gruppe von Kindern ohne offensichtliche Risikofaktoren, die schwerer zu behandeln ist oder zu Rückfällen neigt, wie bevölkerungsbezogene Langzeitstudien gezeigt haben (Heron et al., 2008). Möglicherweise liegen genetische oder andere anlagebedingte Dispositionen vor, die das Risiko eines Rückfalls oder persistierenden Verlaufs erhöhen. Diese Subgruppe von chronisch inkontinenten Patient:innen weist die Problematik vom Kindes- über das Jugend- bis zum Erwachsenenalter auf – oft verbunden mit hohem Leidensdruck, Selbstwertproblemen, Hoffnungslosigkeit oder Resignation. Darüber hinaus gibt es familiäre Problemkonstellationen, die die Behandlung behindern können. Oft sind Eltern motivierter als ihre Kinder. Man beobachtet in diesen Familien z. T. oppositionelles Verhalten der Kinder und eskalierende Auseinandersetzungen. Andererseits können elterliche Schuldgefühle vorhanden sein mit der Überzeugung, etwas „falsch“ gemacht zu haben und direkt für das Einnässen oder Einkoten ihrer Kinder verantwortlich zu sein. Und zuletzt attribuieren manche Eltern das Einnässen/Einkoten als willkürliche Provokation und reagieren mit strafendem Verhalten, was ebenfalls mit dysfunktionalen Interaktionen verbunden ist.
Allen diesen Gruppen ist gemeinsam: Sie sind therapieresistent gegenüber den Standardbehandlungsverfahren. Dies ist für Kinder und auch Eltern besonders belastend: Ein Therapieversagen trotz korrekter Behandlung wird als persönliche Niederlage erlebt. 10Für diese Kinder und Jugendlichen wurde das vorliegende Manual entwickelt mit dem Ziel, ein wirksames, strukturiertes und zeitlich begrenztes Behandlungsangebot zur Verfügung zu stellen.
Die Behandlung von Ausscheidungsstörungen kann grundsätzlich ambulant durchgeführt werden. Eine stationäre oder teilstationäre Behandlung ist in den allermeisten Fällen nicht notwendig. Die Kinder verbleiben in ihrem sozialen Umfeld und können dort neu erworbene Kompetenzen und Hilfen erproben. Die Gruppentherapie richtet sich an Kinder und Jugendliche mit dem Ziel, ihre Motivation für eine neue „Runde“ der Behandlung zu stärken und neue Zugänge und Perspektiven zu eröffnen. Dadurch lernen Kinder wieder, Selbstverantwortung für ihre Ausscheidungsprobleme zu übernehmen und die Verantwortlichkeiten nicht z. B. an die Eltern zu delegieren. Eltern werden informiert und beraten, sind jedoch nicht die Hauptadressaten der Therapie. Im Gegenteil, viele Eltern lernen wieder, ihren Kindern das Hauptengagement für eine erfolgreiche Behandlung zurückzugeben. Das klar umrissene, zeitlich überschaubare Therapieangebot wird von Kindern und Jugendlichen in der Regel sehr positiv angenommen.
Die hier vorliegende 2., überarbeitete Auflage des Manuals fokussiert die Psychoedukation über körperliche Vorgänge und Ätiologie des Einnässens/Einkotens, die Reflexion des eigenen Trink- und Miktionsverhaltens, Zusammenhänge und Umgang mit Stressfaktoren und enthält als Neuerung zusätzliche edukative Materialien für Kinder mit einer Enuresis nocturna (Einnässen nachts). Das Manual richtet sich an alle Therapeut:innen, die sich mit Kindern und Jugendlichen mit Ausscheidungsstörungen beschäftigen, d. h. Kinder- und Jugendärzt:innen, Kinder- und Jugendpsychiater:innen, Psychologische Psychotherapeut:innen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen, Urotherapeut:innen, Physio- und Ergotherapeut:innen sowie Mitarbeitenden in pflegerischen und pädagogischen Berufen und Beratungsstellen. Zuletzt war es ein Ziel der Autor:innen, eine Behandlung zu entwickeln, die Kindern (und auch Therapeut:innen) Spaß macht. Es ist ausdrücklich gewünscht, dass die Sitzungen entspannt und humorvoll verlaufen, um den sonst sehr schambehafteten Umgang mit dieser Thematik zu erleichtern. Entsprechend wurden viele Komponenten dieses Manuals spielerisch ausgerichtet.
Danken möchten wir allen Kindern, Jugendlichen und Eltern, von denen wir im Laufe der Jahre viel gelernt haben – und es täglich immer wieder tun. Danken möchten wir den Mitarbeitenden des Hogrefe Verlags, die unseren Vorschlag zu einem Manual sofort positiv aufgenommen und uns während des gesamten Prozesses aktiv unterstützt haben. Unser Dank gilt besonders Alice Velivassis. Wir würden uns sehr freuen, wenn diese Ansätze möglichst breit in Praxen und Kliniken umgesetzt werden würden.
Homburg, Saarbrücken und Davos, Frühjahr 2025
Monika Equit Heike Sambach Justine Hussong Alexander von Gontard
1
Im Folgenden wird der Begriff „Stuhlinkontinenz“ für Einkoten verwendet. Im DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013, 2018, 2022) sowie in der ICD-10 (World Health Organization [WHO], 1993; WHO/Dilling et al., 2015) bzw. ICD-11 (WHO, 2019, 2022) wird der Begriff „Enkopresis“ verwendet, in den ROME-IV-Kriterien (Hyams et al., 2016) sowie den nationalen Behandlungsleitlinien (DGKJP & DGKJ, 2021; GPGE & DGKJP, 2022) wird „Enkopresis“ durch „Stuhlinkontinenz“ ersetzt.
11Einleitung
Zu den funktionellen Ausscheidungsstörungen gehören das nächtliche Einnässen (Enuresis nocturna), das Einnässen tagsüber (funktionelle Harninkontinenz) und das Einkoten (Stuhlinkontinenz). Ausscheidungsstörungen sind heterogen in ihren klinischen Symptomen, d. h. es lassen sich verschiedene Subformen unterscheiden. Sie sind heterogen bezüglich ihrer Ätiologie – bei manchen überwiegen genetische Faktoren (wie bei der Enuresis nocturna), bei anderen Umweltfaktoren (wie bei der Harninkontinenz bei Miktionsaufschub). Und schließlich unterscheiden sie sich bezüglich ihrer Behandlung. Um eine wirksame Therapie anbieten zu können, ist eine genaue Diagnostik deshalb unerlässlich.
Im Vergleich zu vielen anderen psychischen Störungen sind Ausscheidungsstörungen ausgesprochen gut zu behandeln. Die allermeisten Ausscheidungsstörungen sind in ihrer Pathogenese funktionell, d. h. nicht durch organische Faktoren bedingt. Obwohl psychische Störungen komorbid vorkommen können, ist die Ätiologie nicht wie früher angenommen rein psychogen, d. h. zum Beispiel auf einen intrapsychischen oder interpersonellen Konflikt zurückzuführen. Eher handelt es sich um eine multifaktorielle Ätiologie mit dem Zusammenwirken von genetischen Dispositionen und modulierenden Umweltfaktoren. Das Ziel der Behandlung ist immer die Kontinenz, d. h. das Trocken- oder Sauberwerden. Sind die Kinder und Jugendlichen kontinent geworden, verbessern sich in der Regel der Leidensdruck, das Selbstwertgefühl und häufig auch begleitende emotionale oder Verhaltenssymptome.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind einfache, aber spezifisch abgestimmte, symptomorientierte Maßnahmen am wirksamsten. Hierzu zählen Beratung, Informationsvermittlung und kognitive sowie verhaltenstherapeutische Therapiekomponenten. Bei entsprechender Indikation können sie sinnvoll mit einer Pharmakotherapie oder einer apparativen Therapie kombiniert werden. Weder chirurgische Interventionen noch jahrelange Psychotherapien sind in den allermeisten Fällen notwendig. Ein weiterer Vorteil ist, dass fast immer eine ambulante Therapie möglich ist – stationäre und teilstationäre Behandlungen sind nicht notwendig. Nach unserer Erfahrung sind sie die absolute Ausnahme und meist durch komorbide psychische Störungen indiziert.
Zusammengefasst lassen sich die meisten Kinder und Jugendlichen mit genauer Diagnose und spezifischer Therapie ambulant in Einzeltherapie mit Elternberatung gut behandeln. Dies sind für uns die sog. „einfachen“ Ausscheidungsstörungen. Für diese einfachen Störungen reichen die Standardbehandlungen aus, die in den S2k-Behandlungsleitlinien (DGKJP & DGKJ, 2021; GPGE & DGKJP, 2022) empfohlen werden.
Jedoch gibt es auch Kinder und Jugendliche, die trotz differenzierter Diagnostik und abgestimmter Therapie nicht ausreichend auf die Standardtherapie ansprechen. Dies sind in der Regel Kinder und Jugendliche mit sog. „komplexen“ Ausscheidungsstörungen. Der Behandlung dieser Störungen ist dieses Manual gewidmet. Neben der Therapieresistenz sind „komplexe“ Ausscheidungsstörungen oft durch Komorbidität gekennzeichnet, d. h. mehrere Ausscheidungsstörungen können mit weiteren psychischen Störungen koexistieren. Solche schwer zu behandelnden Kinder und Jugendliche wurden in der Vergangenheit häufig therapeutisch „fallen gelassen“, da sie auch bei Therapeut:innen Frustrations- und Insuffizienzgefühle auslösen; oder es wurden unnötige Kur- oder Klinikaufenthalte empfohlen oder insgesamt eine „Therapiepause“ eingelegt, was zur Demotivation und Hilflosigkeitsgefühlen bei Patient:innen und Bezugspersonen führen kann.
Mit diesem Manual werden nun neue Therapieoptionen eröffnet – mit neuen Inhalten und mit der Möglichkeit anderer Formate (z. B. im Individual- oder Gruppensetting). Im Einzelsetting kann individuell 12mit dem Kind an seinen Bedürfnissen orientiert gearbeitet werden, alternativ ermöglicht das Gruppenformat einen Schritt aus der Isolierung zu einem gemeinsamen, optimistischen Austausch von neuen Möglichkeiten.
Das vorliegende Manual besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil vermittelt einen kurzen Überblick über den Stand der Forschung zur Enuresis und funktionellen Harninkontinenz und zu Stuhlinkontinenz. Für detailliertere Informationen sei auf die die jeweiligen aktualisierten nationalen Behandlungsleitlinien (DGKJP & DGKJ, 2021; GPGE & DGKJP, 2022); Zusammenfassung von Gontard & Claßen (2023), von Gontard & Kuwertz-Bröking (2023), die Zusammenfassungen der Leitlinien sowie die Bände zur „Standardtherapie“ (von Gontard, 2018, 2024) verwiesen. Der zweite Teil widmet sich der konkreten Einzel- bzw. Gruppentherapie. Nach allgemeinen Hinweisen zur Indikation und Durchführung wird jede einzelne Sitzung detailliert und praxisnah beschrieben: die 7 Sitzungen zur „Blasen- (und Darm-)schulung“ für Kinder mit funktioneller Harninkontinenz und die zwei Zusatzsitzungen für Kinder mit begleitender Stuhlinkontinenz und/oder Obstipation sowie für Kinder mit zusätzlicher Enuresis nocturna.
Die in Farbe gestalteten Materialien zur Durchführung der Therapie stehen als Online-Material zum Download zur Verfügung (Hinweise zum Download siehe S. 103) und können zum Gebrauch in der Praxis direkt ausgedruckt werden.
13Teil I: Theoretische Grundlagen
15Kapitel 1:Ausscheidungsstörungen im Kindes- und Jugendalter
1.1 Enuresis nocturna
1.1.1 Definition und Klassifikation
Gemäß den beiden Klassifikationssystemen ICD-10 (World Health Organisation [WHO], 1993; WHO/Dilling et al., 2015) und DSM-5 (American Psychiatric Association [APA], 2013, 2018, 2022) bezeichnet Enuresis einen unwillkürlichen Harnabgang ab einem Alter von 5 Jahren nach Ausschluss organischer Ursachen. Nach den Diagnosekriterien der ICD-10 muss das Einnässen in einem Zeitraum von 3 Monaten mindestens zweimal im Monat (bei einem Alter von 5 bis 7 Jahren) bzw. einmal pro Monat (ab einem Alter von > 7 Jahren) vorkommen. Nach DSM-5 muss das Einnässen mindestens zweimal pro Woche über einen Zeitraum von 3 Monaten auftreten, um die Diagnose stellen zu können (vgl. Tab. 1).
In beiden Klassifikationssystemen werden jeweils die Subformen Enuresis diurna und Enuresis nocturna unterschieden. Diese Differenzierung entspricht jedoch nicht dem wissenschaftlichen/klinischen Standard und sollte vermieden werden. Stattdessen sollte eine Klassifikation der Subtypen anhand der Kriterien der International Children’s Continence Society (ICCS; Austin et al., 2016) erfolgen. Danach wird zunächst zwischen einer seltenen, fast immer organisch bedingten kontinuierlichen Harninkontinenz (d. h. Harnträufeln) und einer häufigen, meist funktionellen intermittierenden Harninkontinenz (mit trocknen Intervallen) unterschieden. Bei der intermittierenden Harninkontinenz wird zwischen der Enuresis nocturna und der nicht organischen oder funktionellen Harninkontinenz tagsüber differenziert. Ein chronologisches Mindestalter von 5 Jahren, eine Häufigkeit von mindestens einmal pro Monat und einer Dauer von 3 Monaten sind weitere Voraussetzungen für eine Diagnose.
Nach der ICCS-Klassifikation, die derzeit die Grundlage nationaler und internationaler klinischer Forschungsarbeit darstellt, versteht man deskriptiv unter Enuresis (oder Enuresis nocturna) jede Form des Einnässens im Schlaf2(d. h. auch während des Mittagsschlafs) – unabhängig von möglichen Begleitsymptomen oder angenommenen Ursachen (Austin et al., 2016). Diese Klassifikation wird auch in den nationalen Behandlungsleitlinien (DGKJP & DGKJ, 2021) aufgegriffen.
In der ICD-11, die bereits 2019 von der Weltgesundheitsversammlung (WHO) verabschiedet wurde (WHO, 2019), wird Enuresis zukünftig unter 6C00 klassifiziert. Leider wurde auch hier die derzeitige Klassifikation der Subtypen nicht überarbeitet und an die Kriterien der ICCS (Austin et al., 2016) angepasst. Es wird auch weiterhin zwischen Enuresis nocturna, diurna und nocturna und diurna unterschieden. Es erfolgt jedoch zumindest eine Differenzierung des primären vs. sekundären Subtyps der Enuresis, jedoch ohne, dass diese unterschiedlich kodiert werden können (vgl. Tab. 1).
Im Folgenden erfolgt die Differenzierung der Subtypen gemäß der ICCS-Klassifikation (Austin et al, 2016).
1.1.2 Subformen
Enuresis nocturna kann entsprechend der ICCS-Klassifikation in unterschiedliche Subformen eingeteilt werden (Austin et al., 2016). Tabelle 2 zeigt einen Überblick.
16Tabelle 1: Klassifikation der Enuresis nach ICD-10 (WHO, 1993; WHO/Dilling et al., 2015), ICD-11 (WHO, 2019) und DSM-5 (APA, 2013, 2022)
ICD-10
ICD-11
DSM-5
Beschreibung
wiederholter willkürlicher/unwillkürlicher Harnabgang
wiederholter, willkürlicher/unwillkürlicher Harnabgang
wiederholter willkürlicher/unwillkürlicher Harnabgang
Häufigkeit
< 7 Jahre: 2-mal/Monat
≥ 7 Jahre: ≥ 1-mal/Monat
nicht angegeben
≥ 2-mal/Woche (o. klinisch bedeutsames Leiden u. Beeinträchtigungen [sozial, schulisch/beruflich])
Dauer
≥ 3 Monate
nicht angegeben
≥ 3 Monate
Alter
chronologisches u. geistiges Alter: ≥ 5 Jahre
Entwicklungsalter: ≥ 5 Jahre
≥ 5 Jahre
Ausschluss
nicht als Folge epileptischer Anfälle, nicht neurologisch bedingt/anatomisch bedingt, keine Folge einer anderen nicht psychiatrischen, medizinischen Erkrankung
Erkrankungen des zentralen Nervensystems, muskuloskelettale Erkrankungen, kongenitale und erworbene Anomalien des Urogenitaltrakts
nicht Folge einer physiologischen Wirkung einer Substanz/eines medizinischen Krankheitsfaktors
Subformen
F98.0 Nicht-organische Enuresis
F98.00 Enuresis nocturna: im Schlaf
F98.01 Enuresis diurna: im Wachzustand
F98.02 Enuresis nocturna und diurna: Kombination der o. g. Subformen
6C00.0 Enuresis nocturna
6C00.1 Enuresis diurna
6C00.2 Enuresis nocturna et diurna
Enuresis nocturna: im Schlaf
Enuresis diurna: im Wachzustand
Enuresis nocturna und diurna: Kombination der o. g. Subformen
Tabelle 2: Formen des nächtlichen Einnässens (nach von Gontard, 2018)
Längstes trockenes Intervall < 6 Monate
Längstes trockenes Intervall > 6 Monate
Keine Blasenfunktionsstörungen tagsüber
primäre monosymptomatische Enuresis nocturna (PMEN)
sekundäre monosymptomatische Enuresis nocturna (SMEN)
Blasenfunktionsstörungen tagsüber* vorhanden
primäre nicht monosymptomatische Enuresis nocturna (PNMEN)
sekundäre nicht monosymptomatische Enuresis nocturna (SNMEN)
Anmerkung: * Zeichen von Drang, Aufschub, Dyskoordination, Einkoten; d. h. ähnlich wie bei der funktionellen Harninkontinenz, mit und ohne Harninkontinenz tagsüber
Primäre Enuresis nocturna (PEN) bezeichnet das Einnässen im Schlaf (nächtlicher Schlaf, Mittagsschlaf) von Kindern, die noch nie länger als 6 Monate fortlaufend trocken waren. Hierbei werden wiederum zwei Subformen unterschieden:
Die primäre monosymptomatische Enuresis nocturna (PMEN) beschreibt nächtliches Einnässen ohne ein längeres trockenes Intervall über 6 Monate und ohne Zeichen einer Blasenfunktionsstörung (wie Drangsymptome, Miktionsaufschub oder Dyskoordination, vgl. Kap. 1.2). Kinder mit dieser Form der Enuresis nocturna nässen häufig große Urinmengen ein und sind schwer erweckbar. Tagsüber liegen keine Auffälligkeiten beim Wasserlassen vor. Die Miktionshäufigkeit dieser Kinder ist normal (fünf- bis siebenmal pro Tag), die Urinmengen tagsüber sind altersadäquat. Es besteht kein heftiger Harndrang, die Kinder halten den Urin nicht zurück, können die Blase problemlos entleeren und koten nicht ein.
17Die primäre nicht monosymptomatische Enuresis nocturna (PNMEN) beschreibt nächtliches Einnässen ohne ein längeres trockenes Intervall von 6 Monaten mit Zeichen einer Blasenfunktionsstörung. Beispielsweise leiden diese Kinder unter Drangstörungen, Miktionsaufschub oder Detrusor-Sphinkter-Dyskoordination.
Kinder mit sekundärer Enuresis nocturna nässen nachts ein, waren aber schon einmal 6 Monate oder länger fortlaufend trocken. Auch hier unterscheidet man zwei Subformen:
Die sekundäre monosymptomatische Enuresis nocturna (SMEN) wird definiert als ein nächtliches Einnässen nach einer trockenen Periode von üblicherweise 6 Monaten, ohne Anzeichen einer Blasenfunktionsstörung tagsüber.
Die sekundäre nicht monosymptomatische Enuresis nocturna (SNMEN) bezeichnet nächtliches Einnässen nach einem trockenen Intervall von mindestens 6 Monaten mit den gleichen Zeichen der gestörten Blasenfunktion wie bei der primären nicht monosymptomatischen Enuresis nocturna (PNMEN).