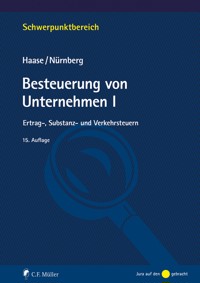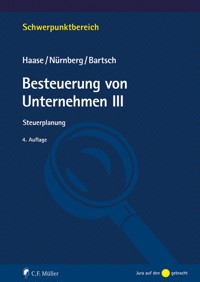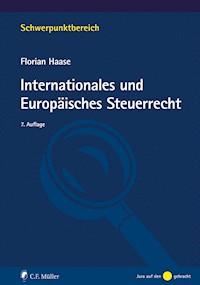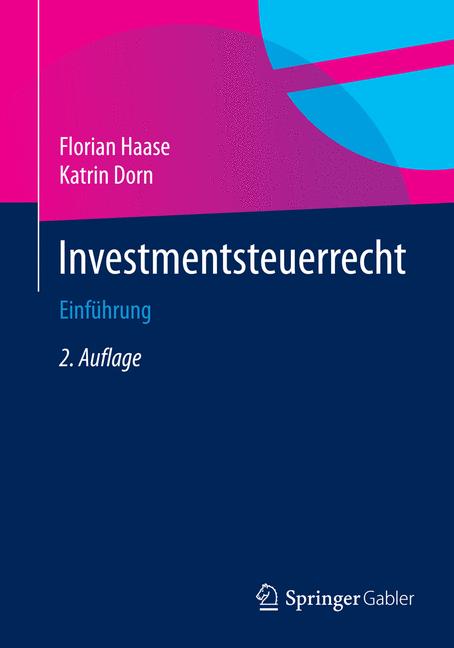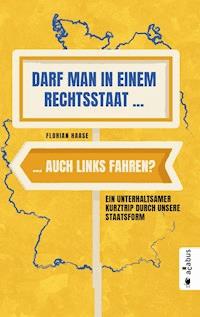218,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Für die Beurteilung eines internationalen Steuersachverhalts kommt es neben dem nationalen Steuerrecht nicht nur auf die genaue Anwendung des AStG, sondern auch auf die Kenntnis der DBA an. Dieser Heidelberger Kommentar bietet mit seiner systematischen, praxisnahen Kommentierung des AStG und des OECD-MA 2017 in einem Band einen präzisen ersten Zugriff auf die Instrumente des internationalen Steuerrechts und somit Entlastung in der Steuerpraxis. Im 1. Teil, der Kommentierung des AStG, liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung praxisrelevanter Probleme der Unternehmen, wie z.B. Verrechnungspreise oder Hinzurechnungsbesteuerung. Der 2. Teil enthält die Kommentierung des OECD-MA 2017 mit den wichtigsten Besonderheiten und Abweichungen der mit anderen europäischen Staaten, USA, Japan und China geschlossenen DBA vom OECD-MA. Die Neuauflage berücksichtigt u.a.: - die Neukommentierung des AStG i.d.F. des ATADUmsG; - den neuen Anwendungserlass zum AStG; - neue Entwicklungstendenzen auf OECD-Ebene; - neueste Rechtsprechung (z.B. zur Dienstleistungsbetriebsstätte).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Außensteuergesetz Doppelbesteuerungsabkommen
Herausgegeben von
Prof. Dr. Florian HaaseRechtsanwalt / SteuerberaterFachanwalt für SteuerrechtMaster of International Taxation (M.I.Tax)Professor für Deutsches, Internationales und Europäisches Steuerrecht
Bearbeitet von
Dipl.-Kfm. Gerrit Bartsch, M.I.Tax. · Dr. Isabel Bauernschmitt · Dr. Jochen Ettinger · Fabian G. Gaffron · Dr. Ronald Gebhardt · Prof. Dr. Florian Haase, M.I.Tax Dipl.-Finanzw. (FH) Matthias Hofacker, M.I.Tax · Armin Hilse Dipl.-Kfm. Florian Kaiser · Dr. Benedikt Keilen · Dr. Florian Kloster, LL.M. · Dipl.-Kfr. Dr. Melanie Köstler · Dipl.-Kfr. Dr. Claudia Krebs · Dr. Robert Kroschewski · Sebastian Krüger · Dr. Alexander Linn, MBR · Dr. Bernadette Mai, LL.M. oec. Dr. Dagmar Möller-Gosoge · Dr. Daniela Nehls · Dipl.-Finanzw. (FH) Philip Nürnberg, M.I.Tax · Benedikt Pignot · Bastian Ruge, LL.M. Dipl.-Finanzw. (FH) Thomas Rupp · Dipl.-Wirtsch.-Juristin (FH) Nina Schütte, LL.M. · Nina Weber · Prof. Dr. Martin Wenz · Dominik Wichmann
4., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-5816-1
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598
www.cfmueller.de
© 2024 C.F. Müller GmbH, Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Wir freuen uns, dass wir fast 15 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen unseres „Praxiskommentars des ersten Zugriffs“ die 4. Auflage vorlegen können. Dafür sei den geneigten Leserinnen und Lesern herzlich gedankt. Die vergleichsweise lange Zeit seit der 3. Auflage ist abermals dem Umstand des geduldigen Wartens geschuldet: Warten auf den unionalen Steuergesetzgeber, der mit den Anti-Tax-Avoidance-Richtlinien I-III mehr als bisher auf die Harmonisierung der nationalen Steuerrechte Einfluss genommen hat bzw. nehmen könnte. Warten auf den nationalen Steuergesetzgeber, der die Sekundärrechtsakte in nationales Recht umzusetzen hatte. Und zuletzt Warten auf den durch das Bundesfinanzministerium ins Werk gesetzten, für die Praxis so wichtigen Anwendungserlass zum AStG, ohne den die 4. Auflage unvollständig geblieben wäre.
Insbesondere das AStG ist infolgedessen in weiten Teilen überarbeitet bzw. neu kommentiert worden. Gerichtliche Entscheidungen gibt es freilich noch keine, Praxiserfahrungen wenige. Insofern ist es hilfreich, dass die Autorinnen und Autoren allesamt Kenner ihres Fachs sind und aus ihrer Praxiserfahrung der Vergangenheit Hilfestellungen für alte und neue Probleme des AStG geben können. Das OECD-Musterabkommen, nunmehr vorliegend in der Version 2017, ist hingegen seitens der OECD nur einer moderaten Revision unterzogen worden.
Gewichtiger nehmen sich gegenwärtig die Arbeiten der OECD aus, die vom Rande her Einfluss auf OECD-MA und AStG zeitigen werden, nämlich die Arbeiten an der „neuen Weltsteuerordnung“ in Gestalt von Pillar 1 und Pillar 2. Pillar 2, also die globale Mindestbesteuerung, ist bereits Realität, ein deutsches Umsetzungsgesetz liegt vor und arbeitet mit einem flächendeckenden Treaty Override. Für Pillar 1 wird ein MLI 2.0 erwartet, das Eingang in die Neuauflage des bereits in dieser Kommentarreihe erscheinenden Band zum Multilateralen Instrument (aus 2018) finden wird. Bereits heute ist absehbar: Das OECD-MA wird auch künftig wichtig für die Arbeit mit internationalsteuerlichen Sachverhalten bleiben, aber die zunehmende Fülle an unilateralen, bilateralen, multilateralen und nunmehr auch unionalen Überschreibungen verkehrt die eigentliche Regel im internationalen Steuerrecht mehr und mehr zur Ausnahme.
Das Werk ist auf dem Rechtsstand vom Juni 2024.
Anregungen sind jederzeit willkommen und bitte zu richten an [email protected].
Hamburg, im Juli 2024
Florian Haase
Bearbeiterverzeichnis
Kapitel I Außensteuergesetz
Einleitung:
Prof.Dr. Florian Haase, M.I.TaxRechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Rödl & Partner / IU Internationale Hochschule, Hamburg
§ 1:
Dipl.-Finanzwirt (FH) Matthias Hofacker, M.I.TaxRechtsanwalt, Steuerberater, SOE Hofacker Rechtsanwaltsgesellschaft, Bremen
§ 1a
Dipl.-Finanzwirt (FH) Philip Nürnberg, M.I.TaxSteuerberater, Rödl & Partner, Hamburg
§ 2:
Dipl.-Kfm. Florian KaiserSteuerberater, Rödl & Partner, Nürnberg
§ 4:
Dr. Jochen EttingerRechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Dissmann Orth, München
§ 5:
Dipl.-Kfm. Florian KaiserSteuerberater, Rödl & Partner, Nürnberg
§ 6:
Dr. Dagmar Möller-Gosoge / Dr. Benedikt KeilenSteuerberaterin, PricewaterhouseCoopers, München / Steuerberater, PricewaterhouseCoopers, München
§§ 7–8:
Dipl.-Finanzwirt (FH) Philip Nürnberg, M.I.TaxSteuerberater, Rödl & Partner, Hamburg
§ 9:
Dr. Daniela NehlsReferentin Steuern, DATEV, Nürnberg
§§ 10–12:
Dipl.-Kfr. Dr. Isabel Bauernschmitt / Nina WeberSteuerberaterin, Rödl & Partner, Nürnberg / Steuerberaterin, Rödl & Partner, Nürnberg
§ 13:
Dr. Roland Gebhardt / Sebastian KrügerSteuerberater, PricewaterhouseCoopers, Hamburg / Steuerberater, Fachberater Internationales Steuerrecht, PricewaterhouseCoopers, Hamburg
§ 15:
Prof. Dr. Martin Wenz / Dr. Florian Kloster LL.M.Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Internationales und Liechtensteinisches Steuerrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz / Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht, APCIT, CONFIDA, Treuhand, Unternehmens- und Steuerberater AG, Vaduz
§ 16:
Bastian Ruge, LL.M.Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Ruge Fehsenfeld, Hamburg
§§ 17–18:
Dr. Daniela NehlsReferentin Steuern, DATEV, Nürnberg
§ 20:
Dipl.-Finanzwirt (FH) Thomas RuppFinanzministerium Baden-Württemberg, Stuttgart
§ 21:
Prof. Dr. Florian Haase, M.I.TaxRechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Rödl & Partner, IU Internationale Hochschule, Hamburg
§ 22:
Dr. Jochen EttingerRechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Dissmann Orth, München
Kapitel II OECD-Musterabkommen
Einleitung und Präambel:
Prof. Dr. Florian Haase, M.I.TaxRechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Rödl & Partner, IU Internationale Hochschule, Hamburg
Art. 1:
Dr. Alexander Linn, MBR / Benedikt PignotSteuerberater, Deloitte, München / Rechtsanwalt, Deloitte, München
Art. 2:
Dr. Bernadette Mai, LL.M. oec.Richterin am Finanzgericht, Münster
Art. 3:
Fabian G. GaffronRechtsanwalt, Steuerberater, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Hamburg
Art. 4:
Dr. Alexander Linn, MBR / Benedikt PignotSteuerberater, Deloitte, München / Rechtsanwalt, Deloitte, München
Art. 5–6:
Prof. Dr. Florian Haase, M.I.TaxRechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Rödl & Partner / IU Internationale Hochschule, Hamburg
Art. 7:
Dipl.-Finanzwirt (FH) Philip Nürnberg, M.I.TaxSteuerberater, Rödl & Partner, Hamburg
Art. 8:
Dr. Robert KroschewskiRechtsanwalt, Steuerberater, Esche Schümann Commichau, Hamburg
Art. 9:
Arnim HilseRegierungsdirektor, Bonn
Art. 10:
Fabian G. GaffronRechtsanwalt, Steuerberater, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Hamburg
Art. 11:
Prof. Dr. Martin Wenz / Niklas Kaiser, M.Sc.Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Steuerrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz / Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Internationales und Liechtensteinisches Steuerrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz
Art. 12:
Dipl.-Kfr. Dr. Claudia Krebs / Nina WeberSteuerberaterin, Rödl & Partner, Nürnberg / Steuerberaterin, Rödl & Partner, Nürnberg
Art. 13:
Dipl.-Wirtsch.-Juristin (FH) Nina Schütte, LL.M.Steuerberaterin, BRL Boege Rohde Luebbehuesen, Hamburg
Art. 15 und 16:
Prof. Dr. Florian Haase, M.I.TaxRechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Rödl & Partner / IU Internationale Hochschule, Hamburg
Art. 17:
Dipl.-Kfr. Dr. Melanie KöstlerSteuerberaterin, Rödl & Partner, Nürnberg
Art. 18 und 19:
Prof. Dr. Florian Haase, M.I.TaxRechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Rödl & Partner / IU Internationale Hochschule, Hamburg
Art. 20:
Bastian Ruge, LL.M.Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Ruge Fehsenfeld, Hamburg
Art. 21:
Dipl.-Wirtsch.-Juristin (FH) Nina Schütte, LL.M.Steuerberaterin, BRL Boege Rohde Luebbehuesen, Hamburg
Art. 22:
Dipl.-Kfr. Dr. Melanie KöstlerSteuerberaterin, Rödl & Partner, Nürnberg
Art. 23A:
Dipl.-Finanzwirt (FH) Philip Nürnberg, M.I.TaxSteuerberater, Rödl & Partner, Hamburg
Art. 23B–24:
Prof. Dr. Florian Haase, M.I.TaxRechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Rödl & Partner / IU Internationale Hochschule, Hamburg
Art. 25:
Dominik WichmannRegierungsdirektor, Bonn
Art. 26:
Dr. Alexander Linn, MBR / Benedikt PignotSteuerberater, Deloitte, München / Rechtsanwalt, Deloitte, München
Art. 27:
Dr. Bernadette Mai, LL.M. oec.Richterin am Finanzgericht, Münster
Art. 28:
Prof. Dr. Florian Haase, M.I.TaxRechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Rödl & Partner / IU Internationale Hochschule, Hamburg
Art. 29:
Dipl.-Kfm. Gerrit Bartsch, M.I.TaxWirtschaftsprüfer, Steuerberater, Wedel
Art. 30:
Prof. Dr. Florian Haase, M.I.TaxRechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Rödl & Partner / IU Internationale Hochschule, Hamburg
Art. 31:
Fabian G. GaffronRechtsanwalt, Steuerberater, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Hamburg
Art. 32:
Bastian Ruge, LL.M.Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Ruge Fehsenfeld, Hamburg
Zitiervorschlag
Haase/Hofacker AStG/DBA, § 1 AStG Rn. 3
Haase/Gaffron AStG/DBA, Art. 3 MA Rn. 3
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Bearbeiterverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Kapitel IGesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen
Einleitung zum Außensteuergesetz
Erster TeilInternationale Verflechtungen
§ 1Berichtigung von Einkünften
§ 1aPreisanpassungsklausel
Zweiter TeilWohnsitzwechsel in niedrig besteuernde Gebiete
§ 2Einkommensteuer
§ 3(aufgehoben)
§ 4Erbschaftsteuer
§ 5Zwischengeschaltete Gesellschaften
Dritter TeilBehandlung einer Beteiligung im Sinne des § 17 des Einkommensteuergesetzes bei Wohnsitzwechsel ins Ausland
§ 6Besteuerung des Vermögenszuwachses
Vierter TeilBeteiligung an ausländischen Zwischengesellschaften
§ 7Beteiligung an ausländischer Zwischengesellschaft
§ 8Einkünfte von Zwischengesellschaften
§ 9Freigrenze bei gemischten Einkünften
§ 10Hinzurechnungsbetrag
§ 11Kürzungsbetrag bei Beteiligung an ausländischer Gesellschaft
§ 12Steueranrechnung
§ 13Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften
§ 14(weggefallen)
Fünfter TeilFamilienstiftungen
§ 15Steuerpflicht von Stiftern, Bezugsberechtigten und Anfallsberechtigten
Sechster TeilErmittlung und Verfahren
§ 16Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen
§ 17Sachverhaltsaufklärung
§ 18Gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
Siebenter TeilSchlussvorschriften
§ 19(aufgehoben)
§ 20Bestimmungen über die Anwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
§ 21Anwendungsvorschriften
§ 22Neufassung des Gesetzes
Kapitel IIOECD-Musterabkommen 2017 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen
Einleitung zum OECD-Musterabkommen
Präambel
Abschnitt I
Art. 1Unter das Abkommen fallende Personen
Art. 2Unter das Abkommen fallende Steuern
Abschnitt II
Art. 3Allgemeine Begriffsbestimmungen
Art. 4Ansässige Person
Art. 5Betriebstätte
Abschnitt III
Art. 6Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen
Art. 7Unternehmensgewinne [MA 2008]
Art. 8Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt und Luftfahrt
Art. 9Verbundene Unternehmen
Art. 10Dividenden
Art. 11Zinsen
Art. 12Lizenzgebühren
Art. 13Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen
Art. 14(aufgehoben)
Art. 15Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit
Art. 16Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen
Art. 17Künstler und Sportler
Art. 18Ruhegehälter
Art. 19Öffentlicher Dienst
Art. 20Studenten
Art. 21Andere Einkünfte
Abschnitt IV
Art. 22Vermögen
Abschnitt V
Art. 23ABefreiungsmethode
Art. 23BAnrechnungsmethode
Abschnitt VI
Art. 24Gleichbehandlung
Art. 25Verständigungsverfahren
Art. 26Informationsaustausch
Art. 27Amtshilfe bei der Erhebung von Steuern
Art. 28Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen
Art. 29Anspruch auf Vergünstigungen
Abschnitt VII
Art. 30Ausdehnung des räumlichen Geltungsbereichs.
Art. 31Inkrafttreten
Art. 32Kündigung
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
aA
andere/r Ansicht
aaO
am angegebenen Ort
abgedr
abgedruckt
Abh
Abhandlungen
Abk
Abkommen
abl
ablehnend
ABl
Amtsblatt
ABlEG
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
ABlEU
Amtsblatt der Europäischen Union (ab 1.2.2003)
Abs
Absatz
Abschn
Abschnitt
abw
abweichend
aE
am Ende
AE
Anwendungserlass
AEAStG
Grundsätze zur Anwendung des Außensteuergesetzes
ÄndG
Änderungsgesetz
aF
alte Fassung
AG
Amtsgericht, Aktiengesellschaft, Ausführungsgesetz
allg
allgemein
Alt
Alternative
aM
anderer Meinung
amtl
amtlich
Anh
Anhang
Anm
Anmerkung
AOA
Authorized OECD Approach
APA
Advance Pricing Agreement
ARGE
Arbeitsgemeinschaft
Art
Artikel
AS
Abgeltungsteuer
AStG
Außensteuergesetz
ATAD
Anti-Tax Avoidance Directive
ATADUmsG
Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtline (ATAD-Umsetzungsgesetz)
Aufl
Auflage
ausf
ausführlich
ausl
ausländisch/e/r
Az
Aktenzeichen
BB
Betriebs-Berater
Bd
Band
BeckOK AStG
Mann/Staats, Beck‘scher Online-Kommentar Außensteuergesetz
Bearb, bearb
Bearbeiter, Bearbeitung, bearbeitet
Begr
Begründung; Begriff
Beil
Beilage
Bek
Bekanntmachung
BEPS
Base Erosion and Profit Shifting
ber
berichtigt
bes
besonders, besonderen/es/er
Beschl
Beschluss
bestr
bestritten
betr
betreffend/e/es/er/en
BFH
Bundesfinanzhof
BFHE
Sammlung der Entscheidungen des BFH
BFH/NV
Sammlung amtlich nicht veröffentlichter Entscheidungen des BFH
BGBl
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHSt(Z)
Amtliche Sammlung der Entscheidungen des BGH in Strafsachen (Zivilsachen)
BMF
Bundesministerium der Finanzen
BMWK
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
BR
Bundesrat
BR-Drucks
Bundesratsdrucksache
BReg
Bundesregierung
B/K/L/M/R
Brezing/Krabbe/Lempenau/ Mössner/Runge, AStG-Kommentar
BsGa
Betriebsstättengewinnaufteilung
BsGaV
Betriebsstättengewinnaufteilungs-Verordnung
Bsp
Beispiel
bspw
beispielsweise
BTag
Bundestag
BT-Drucks
Bundestagsdrucksache
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des BVerfG
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE
Entscheidungen des BVerwG
bzgl
bezüglich
BZSt
Bundeszentralamt für Steuern
bzw
beziehungsweise
ca
circa
DB
Der Betrieb
DBA
Doppelbesteuerungsabkommen
Dbest
Doppelbesteuerung
ders
derselbe
dh
das heißt
dies
dieselbe/n
Diss
Dissertation
Dividendenbegr
Dividendenbegriff
DJZ
Deutsche Juristen-Zeitung
DRiZ
Deutsche Richter-Zeitung
DStJG
Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft
DStZ
Deutsche Steuer-Zeitung
dt
deutsch/e/er/en
DVO
Durchführungsverordnung
EFG
Entscheidungen der Finanzgerichte
EG
Einführungsgesetz, Europäische Gemeinschaften
Einf
Einführung
EGV
Einigungsvertrag
Einl
Einleitung
Entsch
Entscheidung
entspr
entsprechend
Erg, erg
Ergänzung, Ergebnis, ergänzend
Erl
Erläuterung
ESt
Einkommensteuer
EStG
Einkommensteuergesetz
EStH
Einkommensteuer-Hinweise
etc
et cetera
EuGH
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
EU-SBR
Europäische Streitbeilegungsrichtlinie
EU-SK
Europäische Schiedskonvention
evtl
eventuell
f
folgende (Seite)
FA
Finanzamt
ff
folgende (Seiten)
FG
Finanzgericht
F/G/N/W
Fuhrmann/Geurts/Nientimp/Wilmanns, Außensteuergesetz Kommentar
FinMin
Finanzministerium
FinSen
Finanzsenator
FinVerw
Finanzverwaltung
Fn
Fußnote
FR
Finanz-Rundschau
FVerlV
Funktionsverlagerungsverordnung
FVG
Finanzverwaltungsgesetz
F/W/B/S
Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, Außensteuerrecht
F/W/K
Flick/WassermeyerKempermann, DBA-Schweiz
GBl
Gesetzblatt
gem
gemäß
Ges
Gesellschaft(en)
GeschO
Geschäftsordnung
gg
gegen, gegenüber
ggf
gegebenenfalls
glA
gleicher Ansicht/Auffassung
G/K/G
Gosch/Kroppen/Grotherr, DBA-Kommentar
GmbHR
GmbH-Rundschau
grdl
grundlegend
grds, Grds
grundsätzlich, Grundsatz
GRUR
Gewerbliches Rechtsschutz- und Urheberrecht
GVBl
Gesetz- und Verordnungsblatt
hA
herrschende Ansicht
Hdb
Handbuch
HFR
Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung
H/H/R
Herrmann/Heuer/Raupach, EStG-Kommentar
H/H/S
Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO-Kommentar
hL
herrschende Lehre
hM
herrschende Meinung
HR
Handelsregister
Hrsg
Herausgeber
HS
Halbsatz
ICCLR
International Company and Commercial Law Review
idF
in der Fassung
idR
in der Regel
IDW
Institut der Wirtschaftsprüfer
iE
im Ergebnis
ieS
im engeren Sinne
iF
im Fall
IHK
Industrie- und Handelskammer
iHv
in Höhe von
inkl
inklusive
insb
insbesondere
int
international
IPR
Internationales Privatrecht
iRd
im Rahmen der/des
iRe
im Rahmen eines
iRv
im Rahmen von
iSd
im Sinne des
IStR
Internationales Steuerrecht
iSv
im Sinne von
iÜ
im Übrigen
iVm
in Verbindung mit
IWB
Internationale Wirtschaftsbriefe
iwS
im weiteren Sinne
Jb
Jahrbuch
JbFSt
Jahrbuch für Fachanwälte für Steuerrecht
JStG
Jahressteuergesetz
Justiz
Die Justiz
JW
Juristische Wochenschrift
JZ
Juristenzeitung
Kap
Kapitel
KapGes
Kapitalgesellschaft(en)
KG
Kammergericht, Kommanditgesellschaft
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Kj
Kalenderjahr
Komm
Kommentar
krit
kritisch
KStH
Körperschaftsteuer-Hinweise
KStR
Körperschaftsteuer-Richtlinien
LG
Landgericht
lit
Buchstabe
Lit
Literatur
LoB
Limitation-on-Benefits
LS
Leitsatz
lt
laut
MA
Musterabkommen
Mat
Materialien
maW
mit anderen Worten
MDR
Monatsschrift für Deutsches Recht
mE
meines Erachtens
MEMAP
Manual on Effective Mutual Agreement Procedures
MK
Musterkommentar
MLI
Multilaterales Instrument
mN
mit Nachweisen
MS
Mitgliedstaaten
MTR
Mutter-Tochter-Richtlinie
mwN
mit weiteren Nachweisen
nF
neue Fassung
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR
NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht
Nr
Nummer
NStZ
Neue Zeitschrift für Strafrecht
NWB
NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht
oa
oben angegeben
oÄ
oder Ähnlich/e
OECD
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OFD
Oberfinanzdirektion
OFH
Oberfinanzhof
og
oben genannte/n
OLG
Oberlandesgericht
OLGE
Rechtsprechung der Oberlandesgerichte
OLGZ(St)
Entscheidungen der OLG in Zivilsachen (Strafsachen)
PersGes
Personengesellschaft(en)
PIStB
Praxis Internationale Steuerberatung
PPT
Principal-Purpose-Test
ProgressVorb
Progressionsvorbehalt
Prot
Protokoll
RdErl
Runderlass
RefE
Referentenentwurf
RegE
Regierungsentwurf
RegE Begr
Regierungsentwurf Begründung
REIT
Real Estate Investment Trust
Rev
Revision
RFH
Reichsfinanzhof
RG
Reichsgericht
RGBl
Reichsgesetzblatt
RGSt(Z)
Amtliche Sammlung der Entscheidungen des RG in Strafsachen (Zivilsachen)
RIW
Recht der Internationalen Wirtschaft
rkr
rechtskräftig
RL
Richtlinie
Rn
Randnummer
Rpfleger
Der Deutsche Rechtspfleger
Rs
Rechtssache
Rspr
Rechtsprechung
RStBl
Reichssteuerblatt
RT-Drucks
Reichstagsdrucksache
S
Seite, Satz, siehe
SchiedsV
Schiedsverfahren
S/D
Schönfeld/Ditz, DBA-Kommentar
SG
Sozialgericht
S/K/K
Strunk/Kaminski/Köhler, Kommentar zum AStG und DBA
so
siehe oben
sog
so genannte/r/n
SolZ
Solidaritätszuschlag
SolZG
Solidaritätszuschlaggesetz
Sondernr
Sondernummer
StBJb
Steuerberater-Jahrbuch
StBp
Die steuerliche Betriebsprüfung
SteuK
Steuerrecht kurzgefasst
StPfl
Steuerpflicht/ige/iger
str
streitig
stRspr
ständige Rechtsprechung
StuW
Steuer und Wirtschaft
stv
stellvertretend
su
siehe unten
sublit
Doppelbuchstabe
SV
Sachverständiger
SWI
Steuer und Wirtschaft international
teilw
teilweise
Tz
Teilziffer
ua
unter anderem, und andere
uÄ
und Ähnliche/s
Ubg
Die Unternehmensbesteuerung
uE
unseres Erachtens
umstr
umstritten
unstr
unstreitig
Unterabs
Unterabs
UntStRefG
Unternehmensteuerreformgesetz
unzutr
unzutreffend
Urt
Urteil
usw
und so weiter
uU
unter Umständen
V
von, vom
VA
Veranlagungszeitraum
va
vor allem
Var
Variante
V/B/E
Vögele/Borstell/Engler, Handbuch der Verrechnungspreise
Verf
Verfasser, Verfassung
vern
verneinend
VerstV
Verständigungsverfahren
VerwG
Verwaltungsgrundsatz
VG
Verwaltungsgericht
vGA
verdeckte Gewinnausschüttung
vgl
vergleiche
VLL
Verrechnungspreisleitlinien
VO
Verordnung
Vorb
Vorbemerkung
VZ
Veranlagungszeitraum
wiss
wissenschaftlich
Wj
Wirtschaftsjahr
WM
Wertpapier-Mitteilungen
W/S/G
Wöhrle/Schelle/Gross, AStG-Kommentar
WÜRV
Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge
WVK
Wiener Vertragsrechts-Konvention
zB
zum Beispiel
ZIP
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zit
zitiert
zT
zum Teil
zust
zustimmend
zutr
zutreffend
zw
zweifelhaft
zz
zurzeit
Literaturverzeichnis
BeckOK AStG, Online Kommentar
Brandis/Heuermann EStG, KStG, GewStG, Loseblatt
Brezing/Krabbe/Lempenau/Mössner/Runge AStG-Kommentar, Loseblatt
Dötsch/Pung/Möhlenbrock Körperschaftsteuergesetz, Loseblatt
Erle/Sauter Körperschaftsteuergesetz, 3. Aufl 2010
Ernst & Young Körperschaftsteuergesetz, Loseblatt
Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld Außensteuerrecht, Loseblatt
Flick/Wassermeyer/Kempermann DBA-Schweiz, Loseblatt
Frotscher Internationales Steuerrecht, 5. Aufl 2020
Frotscher/Geurts Einkommensteuergesetz, Loseblatt
Fuhrmann/Geurts/Nientimp/Wilmanns Außensteuergesetz Kommentar, 4. Aufl 2023
Glanegger/Güroff Gewerbesteuergesetz, 11. Aufl 2023
Gosch Körperschaftsteuergesetz, 4. Aufl 2020
Gosch/Kroppen/Grotherr/Kraft DBA-Kommentar, Loseblatt
Greil/Hummel AStG Kommentar, 2024
Haase Internationales und Europäisches Steuerrecht, 7. Aufl 2023
Haase/Nürnberg Die Hinzurechnungsbesteuerung, 3. Aufl 2021
Herrmann/Heuer/Raupach Einkommensteuergesetz und Körperschaftsteuergesetz, Loseblatt
Hübschmann/Hepp/Spitaler Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, Loseblatt
Jacobs Internationale Unternehmensbesteuerung, 9. Aufl 2023
Kirchhof/Seer Einkommensteuergesetz, 23. Aufl 2024
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff Einkommensteuergesetz, Loseblatt
Klein Abgabenordnung, 17. Aufl 2023
Kluge Das internationale Steuerrecht, 4. Aufl 2000
Koenig Abgabenordnung, 5. Aufl 2024
Kraft AStG, 2. Aufl 2019
Lademann Einkommensteuergesetz, Loseblatt
Lenski/Steinberg Gewerbesteuergesetz, Loseblatt
Lübbehüsen/Kahle Brennpunkte der Besteuerung von Betriebsstätten, 2. Aufl 2019
Mann/Staats Beck‚scher Online-Kommentar Außensteuergesetz
Mössner/Lampert ua Steuerrecht international tätiger Unternehmen, 6. Aufl 2023
Musil/Weber-Grellet Europäisches Steuerrecht, 2. Aufl 2022
Reith Internationales Steuerrecht, 2004
Rupp/Knies/Ott/Faust Internationales Steuerrecht, 3. Aufl 2014
Schaumburg Internationales Steuerrecht, 5. Aufl 2022
Schmidt Einkommensteuergesetz, 43. Aufl 2024
Schönfeld/Ditz DBA-Kommentar, 2. Aufl 2019
Schwarz/Pahlke/Keß Abgabenordnung, Loseblatt
Strunk/Kaminski/Köhler Kommentar zu AStG – DBA, Loseblatt
Tipke/Kruse Abgabenordnung – Finanzgerichtsordnung, Loseblatt
Vogel/Lehner DBA-Kommentar, 7. Aufl 2021
Vögele/Borstell/van der Ham Verrechnungspreise, 6. Aufl 2024
Wassermeyer DBA Kommentar, Loseblatt
Wilke/Weber Lehrbuch Internationales Steuerrecht, 16. Aufl 2022
Wöhrle/Schelle/Gross AStG-Kommentar, Loseblatt
Kapitel I
Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen
Außensteuergesetz
vom 8.9.1972BGBl. I 1972, 1713,
zuletzt geändert durch Art. 10 G vom 27.3.2024BGBl. I 2024 Nr. 108
Einleitung zum Außensteuergesetz
Boos/Rehkugler/Tucha Internationale Verrechnungspreise – Ein Überblick, DB 2000, 2389; Burmester Zur Systematik internationaler Minderbesteuerung und ihrer Vermeidung, in: Burmester/Endres, Außensteuerrecht, Doppelbesteuerungsabkommen und EU-Recht im Spannungsverhältnis, FS Debatin, 1997, S 55; Cordewener Europäische Grundfreiheiten und nationales Steuerrecht, 2002; Dörfler/Ribbrock Keine neuen Erkenntnisse zur Vereinbarkeit der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung mit Gemeinschaftsrecht, BB 2008, 205; dies Grenzüberschreitende Verluste, Wegzugsbesteuerung sowie Koordinierung von steuerlichen Regelungen im Binnenmarkt – eine Bestandsaufnahme, BB 2008, 304; Englisch Zur Dogmatik der Grundfreiheiten des EGV und ihren ertragsteuerlichen Implikationen, StuW 2003, 88; Haase Zum „Rechtsreflex“ des Treaty Override in § 20 Abs. 2 AStG zugleich Anmerkung zu Kaminski/Strunk, IStR 2011, 137 und 338; Haase/Nürnberg Die neue Hinzurechnungsbesteuerung, 3. Aufl, 2021; Hahn Gemeinschaftsrecht und Recht der direkten Steuern, DStZ 2005, 507; Kaminski/Strunk/Haase Anmerkung zu § 20 Abs 2 AStG in der Entwurfsfassung des Jahressteuergesetzes 2008, IStR 2007, 726; Kaminski/Strunk § 20 Abs. 2 AStG i.d.F. des JStG 2010: (Nicht-)Freistellung von Betriebsstätteneinkünften in DBA-Fällen, IStR 2011, 137; Kellersmann/Treisch Europäische Unternehmensbesteuerung, 2002; Kessler/Spengel Checkliste potenziell EG-rechtswidriger Normen des deutschen direkten Steuerrechts – Update 2008, DB 2008, Beil 2 Heft 9; Köplin/Sedemund Das BMF-Schreiben vom 8.1.2007 – untauglich, die EG-Rechtswidrigkeit der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung nach Cadbury Schweppes zu beseitigen!, BB 2007, 244; Lehner Wettbewerb der Steuersysteme, StuW 1998, 158; Renger Durchleitung inländischer Einnahmen durch eine ausländische Basisgesellschaft als Gestaltungsmissbrauch, BB 2008, 1379; Rödder/Schönfeld Mündliche Verhandlung vor dem EuGH in der Rechtssache „Cadbury Schweppes“: Wird sich der Missbrauchsbegriff des EuGH verändern?, IStR 2006, 49; Sedemund Europarechtliche Bedenken gegen den neuen § 8 Abs 2 AStG, BB 2008, 696; Seer „Unfairer“ und „fairer“ Steuerwettbewerb in der EU, IWB 2006/7 Fach 11, Gruppe 2, 725; Selling Deutschland im Steuerwettbewerb der Staaten, IStR 2000, 226; Thömmes EuGH, Urteil v 6.12.2007 – Rs C-298/05, Columbus Container Services BVBA & Co/Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, IWB 2008/1 Fach 11a, 1169; Wassermeyer Der Scherbenhaufen „Hinzurechnungsbesteuerung“, EuZW 2000, 531; Wassermeyer/Schönfeld Die Niedrigbesteuerung iSd § 8 Abs 3 AStG vor dem Hintergrund eines inländischen KSt-Satzes von 15 %, IStR 2008, 496.
A.Generalia
I.Historie des AStG/Revisionsbemühungen
1
Das Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (sog Außensteuergesetz – AStG) ist abgesehen von den im EStG, KStG und GewStG sowie in der AO verstreuten Einzelnormen die zentrale Quelle nationalen Gesetzesrechts, die Regelungen für grenzüberschreitende Sachverhalte enthält.[1] Forderungen in der Literatur, sämtliche steuerlichen Normen mit internationalem Bezug in einem gesonderten „Internationalen Steuerrechtsgesetzbuch“ zusammenzufassen,[2] sind bislang ungehört verhallt, haben aber angesichts der Vielzahl von teils versteckten Einzelregelungen inzwischen mehr Relevanz denn je. Das AStG gehört zum sog Außensteuerrecht der Bundesrepublik Deutschland (dazu Einl MA Rn 39) und war zugleich Anfang der 1970er Jahre Teil einer umfassenden gesetzgeberischen Offensive zur Reform der dt Außenbesteuerung, die auf Vorarbeiten einer eigens eingesetzten Expertenkommission zurückging.[3] Im Zuge dieser Reform zeitgleich eingeführt wurden etwa § 9 Nr 7 GewStG oder die §§ 90 Abs 2, 138 Abs 2 AO.
2
Es gab im dt Steuerrecht kein historisches Vorbild, welches bei der Normierung des AStG Pate gestanden hätte, obwohl erste Ansätze der Steuerflucht seit jeher zu beobachten waren. Derartigen Bestrebungen der StPfl wurde zuvor im Wesentlichen im Verwaltungswege begegnet.[4] Das AStG datiert v 8.9.1972[5] und hat als Art 1 des „Gesetzes zur Wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei Auslandsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen Wettbewerbslage bei Auslandsinvestitionen“ Gesetzeskraft erlangt. Es ist seitdem lange Zeit zwar fortwährend, jedoch nur punktuell geändert worden (zuletzt durch G v 22.12.2014[6]), ohne dass auch nur im Ansatz eine Gesamtrevision[7] stattgefunden hätte oder beabsichtigt gewesen wäre, bis endlich aufgrund der unionsrechtlichen Vorgaben durch die ATAD I und das entspr Umsetzungsgesetz[8] größere konzeptionelle Änderungen vorgenommen wurden (dazu ausführlicher unten unter IV.).
3
Es ist unmittelbar einsichtig, dass die bisherige anlassbezogene Überarbeitungspraxis des Gesetzgebers unweigerlich zu Systembrüchen und Verwerfungen führen musste. So wurde bspw schon vor längerer Zeit durch das UntStRefG 2008[9] in Gestalt des § 32d EStG die sog Abgeltungsteuer ua für Dividendenerträge eingeführt, ohne dass dies in § 10 Abs 2 S 3 bei den Regelungen über die Besteuerung des Hinzurechnungsbetrags berücksichtigt worden wäre. Erst durch das JStG 2008[10] erfolgte hier die notwendige Korrektur. Der Lapsus wirkte sich praktisch zwar nicht aus, weil § 32d EStG erst auf Kapitalerträge anwendbar war, die dem Gläubiger nach dem 31.12.2008 zugeflossen sind (§ 52a Abs 1 EStG). Er zeigt aber, dass die Steuergesetze gerade bei int Bezügen eine Komplexität erreicht haben, die praktisch kaum zu handhaben ist.
4
Zuweilen scheint der Gesetzgeber auch von der durch ihn selbst initiierten Fortentwicklung des Steuerrechts eingeholt bzw gar überholt zu werden. Es kann nur als Signal einer beginnenden Resignation bezeichnet werden, wenn die Grenze für die Niedrigbesteuerung für ausl Zwischengesellschaften in § 8 Abs 5 über rund 15 Jahre bei 25 % belassen, zugleich aber der für inländische KapGes geltende Körperschaftsteuersatz auf 15 % gesenkt wurde (dies auch bereits im Jahr 2008, siehe § 23 Abs 1 KStG).[11] Erst mit Inkrafttreten von Pillar 2 wollte der Gesetzgeber nicht mehr an dieser Grundentscheidung festhalten . Die Entsch hierfür führte nicht nur zu einem widersinnigen Erg, sondern hatte auch lange Zeit eine Renaissance von Betriebsstätten und PersGes in Niedrigsteuerländern zur Folge. Wurden diese von einer inländischen KapGes etabliert, konnten StPfl wegen § 9 Nr 2 bzw 3 GewStG gefahrlos das Risiko der Anwendung des § 20 Abs 2 erproben, weil ihnen maximal nur eine Belastung mit dem inländischen Körperschaftsteuersatz droht. Durch das BFH-Urt v 11.3.2015[12] indes ist die Unterscheidung zwischen ausl Körperschaften und Betriebsstätten in der Hinzurechnungsbesteuerung bezüglich der Auswirkungen auf die Gewerbesteuer freilich nicht mehr so virulent wie früher, § 7 S 8 und 9 GewStG sorgen hier mittlerweile für einen Gleichklang.
II.Funktion und Kritik
5
Im Inland ansässige StPfl sind in ihrer (unternehmerischen) Entsch prinzipiell frei, ob sie sich steuerrechtlich relevant im Inland oder Ausland betätigen möchten. Da die inländische Gesamtsteuerbelastung von natürlichen Personen und Unternehmen als im int Vergleich zu hoch und Steuern ohnehin prinzipiell als Last empfunden werden, sind StPfl häufig versucht, ihre steuerrechtlich relevanten Aktivitäten im niedrig(er) besteuernden Ausland vorzunehmen. Das Ziel wird am einfachsten erreicht über einen steuerlichen Wegzug, jedoch ist dies mit Veränderungen des persönlichen Umfelds verbunden, und die Praxis zeigt, dass StPfl selten bereit sind, den Wegzug in letzter Konsequenz regelkonform durchzuführen. Dies gilt insb, wenn es um die Aufgabe der dt Staatsangehörigkeit geht, was als bes starkes Indiz für die Aufgabe auch des steuerlichen Wohnsitzes bzw eines gewöhnlichen Aufenthalts gelten darf.
6
Im Extremfall wird daher der StPfl im Inland ansässig bleiben wollen und sich nur einer ausl, sog zwischengeschalteten KapGes oder bspw einer Stiftung bedienen, aus der heraus die jeweilige Aktivität vorgenommen wird. Da die ausl KapGes bzw Stiftung ein gegenüber dem inländischen StPfl selbstständiges Steuersubjekt ist, würden auf diese Weise erhebliche Gewinne dem inländischen Besteuerungszugriff vorenthalten und in das Ausland verlagert werden können. Daneben haben sich in der Praxis vielfältige Strategien herausgebildet, vermittels derer insb int Konzerne Gewinnverlagerungen in das Ausland vornehmen.[13] Diese rücken zunehmend in den Blickpunkt der FinVerw und auch der Öffentlichkeit.
7
Diesen nur beispielhaft beschriebenen Ausweichbewegungen der StPfl sucht das AStG durch punktuell ansetzende Regelungen (vgl Rn 35) zu begegnen. Das Gesetz wendet sich – pauschal betrachtet – gegen die int Steuerflucht in ihren diversen Ausprägungen, die am Steuersubjekt[14] oder am Steuerobjekt ansetzen können. Der strafrechtlich relevante Bereich (int Steuerhinterziehung) wird dabei nicht zwangsläufig berührt. In der Praxis sind vielfach auch legale Gestaltungen anzutreffen, die sich lediglich das int Steuergefälle oder Qualifikationskonflikte (dazu Einl MA Rn 44) zunutze machen.
8
Insofern mag die Feststellung des BFH als Ausgangspunkt der Betrachtungen dienen, dass der StPfl vorbehaltlich wirtschaftlicher Gründe sowie vorbehaltlich der Nichtfeststellung einer gesetzlichen Missbilligung im Einzelfall nicht zur Zahlung von Steuern verpflichtet ist, sondern im Gegenteil den der Besteuerung zugrunde liegenden Sachverhalt (vgl § 38 AO) so gestalten darf, dass eine geringere oder gar keine Steuerbelastung entsteht (Steuervermeidung).[15] Zwischen diesen beiden Extremen, der Steuervermeidung und der Steuerhinterziehung, steht die sog Steuerumgehung als Versuch, die Erfüllung steuerlicher Tatbestände durch „rechtsmissbräuchliche Gestaltungen“ zu verhindern. Sie wird in erster Linie durch spezielle Missbrauchsvermeidungsvorschriften (dazu Einl MA Rn 146 ff) wie zB die §§ 7 ff und in zweiter Linie über die allg Missbrauchsnorm des § 42 AO sanktioniert.
9
Die Kritik am AStG ist mannigfaltig. Sie richtet sich zunächst gegen dessen unsystematischen Ansatz, dem „ungleichartig ansetzende Einzelmaßnahmen“ zugrunde liegen. Sodann werden – auch nach der Novellierung durch die ATAD I – seine Einseitigkeit und Kompliziertheit beklagt,[16] was sich an sich auch auf die Effizienz der Gesetzesanwendung[17] auswirken müsste. Jedoch ist zu konstatieren, dass es im Anwendungsbereich des AStG nur vergleichsweise wenig Gerichtsentscheidungen gibt, wenn wohl bezogen auf dessen einzelne Regelungsbereiche (vgl Rn 35) auch aus unterschiedlichen Gründen.
10
IRd § 1 bspw wird man sagen müssen, dass die meisten Steuerfälle in der Betriebsprüfung bereinigt und daher gar nicht erst gerichtlich anhängig werden. IRd §§ 7 ff hingegen ist die geringe Zahl gerichtlicher Entsch mE auf die starke Abschreckungswirkung der Hinzurechnungsbesteuerung einerseits sowie andererseits auf die Tatsache zurückzuführen, dass Fälle der Hinzurechnungsbesteuerung seitens der StPfl und auch seitens der FinVerw weitgehend unerkannt bleiben. Insb bei den sog Mitwirkungstatbeständen des § 8 entscheiden häufig nicht rechtliche, sondern tatsächliche Gegebenheiten über das Vorliegen passiver Einkünfte. Wie aber ein theoretischer, ggf mit Hilfe eines Beraters aufgesetzter Sachverhalt dann vom StPfl tatsächlich im Ausland „gelebt“ wird, lässt sich aus dem Inland heraus meist nur schwer oder gar nicht nachvollziehen, was zu einer gewissen Grauzone bei der Gesetzesanwendung führt.
11
Weitere Kritik am Gesetz entzündet sich insb an der Frage seiner Unionsrechtswidrigkeit,[18] namentlich hinsichtlich des § 1 und der §§ 7 ff. Während § 2 insoweit in seiner Grundkonzeption längere Zeit unangetastet geblieben war, wurde § 6 bereits durch das JStG 2007[19] zwingenden unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. Beide Vorschriften sind durch das ATADUmsG abermals reformiert worden. Der Frage der Unionsrechtswidrigkeit im Allgemeinen indes ist durch das Inkrafttreten der ATAD I nunmehr weitgehend der Boden entzogen worden – es verbleibt allenfalls die Frage, inwieweit es unionsrechtswidriges Sekundärrecht geben kann. Bereits ca 10 Jahre nach dem Inkrafttreten des AStG war vielfach postuliert worden, das Gesetz nach einer Phase der praktischen Erprobung krit zu überprüfen und ggf zu reformieren.[20] Seither auf den Weg gebrachte, umfassend ansetzende Reformversuche sind allerdings weitgehend ungehört verhallt (vgl ausf Rn 56 ff).
III.BEPS-Projekt der OECD
12
Die Bemühungen der OECD beim Kampf gegen internationale Gewinnverlagerungen sind in jüngerer Zeit mit dem sog BEPS-Projekt neu aufgegriffen und erweitert worden. 2014 hatte die OECD erste Empfehlungen vorgelegt, um mithilfe internationaler Koordination gegen legale Steuervermeidung in multinationalen Unternehmen vorzugehen. Damit entsprach sie dem Mandat der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure, die die OECD im November 2012 beauftragt hatte, Maßnahmen gegen die sog Aushöhlung der Steuerbemessungsgrundlage und die Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) zu erarbeiten. Das BEPS-Projekt wollte Regierungen dabei unterstützen, ihre Steuerbasis zu schützen und mehr Sicherheit für Steuerzahler zu schaffen, dabei aber auch Dbest und Einschränkungen für grenzüberschreitende Wirtschaftsaktivitäten zu vermeiden. Die 15 konkreten Aktionspunkte sind indes für Deutschland allenfalls in Bezug auf Verrechnungspreise bei immateriellen Wirtschaftsgütern relevant. Die meisten anderen Vorgaben hatte Deutschland bereits erfüllt, auch wenn die FinVerw dies an einigen Stellen abweichend beurteilt.
13
Bezüglich der Hinzurechnungsbesteuerung ist insb auf den Aktionspunkt 3 des BEPS-Projekts der OECD hinzuweisen.[21] Hierzu ist zu bemerken, dass Deutschland die dort genannten Vorgaben in den §§ 7 ff AStG bereits im Wesentlichen umgesetzt hatte. Nachdem die ATAD (dazu sogleich) allerdings zwingend in nationales Recht umzusetzen war, wurde die Hinzurechnungsbesteuerung in einigen wenigen Punkten aufgrund der Richtlinienvorgaben verschärft, während lange bekannte Missstände und überschießende Tendenzen unter Hinweis auf den Mindeststandard beibehalten wurden.
14
Das BEPS-Projekt beinhaltete in den Aktionspunkten 8 und 13 ferner wesentliche Neuerungen zu den Verrechnungspreisen. Der Aktionspunkt 8 verfolgt insb das Ziel der Zusammenführung des Einkommens aus immateriellen Wirtschaftsgütern mit der Wertschöpfung im Konzern. Denn nach Auffassung der OECD kann durch die Verlagerung von immateriellen Wirtschaftsgütern in Niedrigsteuerländer eine Trennung zwischen dem steuerlichen Gewinnausweis und der realen wirtschaftlichen Aktivität erreicht werden. Im Fokus steht die Vermeidung von Gewinnzuweisungen an funktionsarme Prinzipalgesellschaften. Eigens hierfür sollten auch die OECD-Verrechnungspreisleitlinien angepasst werden, was Anfang 2022 dann endlich geschehen ist.
15
Inhaltlich regelt der Aktionspunkt 8 sowohl die Definition des immateriellen Wirtschaftsguts als auch die Zusammenführung von Wertschöpfung und Gewinnausweis. Die Definition des immateriellen Wirtschaftsguts ist dabei losgelöst von Definitionen wie im IAS 38 oder Art 12 OECD-Musterabkommen. Als Beispiele werden insb Patente, Markenrechte, vertragliche Rechte, staatliche Lizenzen und Konzessionen genannt. Bei der Zusammenführung von Wertschöpfung und Gewinnausweis ist zum einen nach der Zuordnung von Erträgen aus dem immateriellen Wirtschaftsgut und zum anderen nach der Verrechnungspreismethode zu unterscheiden. Für die Zuordnung der Erträge bildet das zivilrechtliche Eigentum am immateriellen Wirtschaftsgut den Ausgangspunkt. Das allein ist jedoch für eine entspr steuerliche Zuordnung noch nicht ausreichend. Hierfür muss der rechtliche Eigentümer alle wesentlichen Funktionen selbst ausüben, entspr Wirtschaftsgüter einbringen und die wesentlichen Risiken tragen. Als Verrechnungspreismethode soll grundsätzlich die Gewinnaufteilungsmethode – in Sonderfällen auch die Preisvergleichsmethode – zur Anwendung kommen.
16
Der Aktionspunkt 13 beinhaltete eine umfassende Erweiterung der Dokumentationspflichten betreffend die Verrechnungspreise internationaler Unternehmen. Dabei soll die Verrechnungspreisdokumentation aus folgenden 3 Stufen bestehen: Master File, Local File und Country-by-Country Reporting. Das Master File soll einen Überblick über die weltweiten Aktivitäten des Unternehmens, die Geschäftstätigkeit und Verrechnungspreispolitik geben. Dagegen beinhaltet das Local File die relevanten Geschäftstätigkeiten in einem bestimmten Land. Die dritte und immer noch meist diskutierte Stufe ist das sog Country-by-Country Reporting (CbCR). Hierbei handelt es sich um eine zu erstellende Übersicht von ausgewählten Unternehmensdaten, wobei die OECD ein standardisiertes Muster vorsieht mit Angaben bspw zu Erträgen, Steuern, Mitarbeiterzahlen und Geschäftstätigkeiten (zB Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing), verteilt auf die betroffenen Staaten.[22]
17
Das CbCR soll zur allgemeinen Risikoabschätzung der Verrechnungspreisgestaltung von international vertretenen Unternehmensgruppen und zur Vermeidung von BEPS dienen. Insofern sind für jedes Steuergebiet, in dem die Unternehmensgruppe tätig ist, aggregierte Informationen zur Einkünfteverteilung (externe Dritte, verbundene Unternehmen), zu Vorsteuergewinnen, zu bereits gezahlten und noch zu zahlenden Ertragsteuern, zur Zahl der Beschäftigten, zum ausgewiesenen Kapital, bezüglich einbehaltener Gewinne und zu materiellen Vermögenswerten auszuweisen. Folglich wird das CbCR den Steuerbehörden eine breite Einsicht ermöglichen, in welchen Ländern ua die Wertschöpfungstreiber allokiert sind und in welchen Jurisdiktionen maßgeblich Steuern bezahlt und geschuldet werden.
18
Inzwischen hat das CbCR Weiterungen erfahren, und zwar zum einen im Hinblick auf den Austausch mit Drittstaaten[23] und zum anderen in Form des öffentlichen CbCR.[24] Letzteres war innerhalb der EU lange umstritten, hat sich aber letztlich durchsetzen können.
IV.Anti-Tax-Avoidance Directives
19
Parallel zu den Arbeiten der OECD hatte auch die EU-Kommission ähnliche Problemfelder des internationalen Steuerrechts adressiert. Am 17.6.2016 erreichten die Mitgliedstaaten im ECOFIN eine politische Einigung über die Anti-Tax-Avoidance Directive (sog ATAD I), die die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis Ende 2018 bestimmte Missbrauchsverhinderungsmaßnahmen umzusetzen. Die EU-Kommission hatte zuvor am 28.1.2016 den ersten offiziellen Entwurf einer Richtlinie gegen BEPS vorgestellt. Obwohl grundsätzlich die gleichen Themen wie im OECD-Aktionsplan gegen BEPS behandelt wurden, gab es in einigen Fällen abweichende Umsetzungen. Es handelte sich um eine de minimis-Richtlinie, es steht den Mitgliedstaaten also grundsätzlich frei, strengere Regeln zu erlassen. Am 17.6.2016 einigten sich die ECOFIN-Minister entspr auf den Entwurf einer Richtlinie „mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts“.
20
Die Richtlinie ist auf alle StPfl – einschließlich Betriebsstätten von Unternehmen aus Drittstaaten – anwendbar, wenn diese in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Körperschaftsteuer unterliegen. Die Richtlinie enthält Vorgaben an die Mitgliedstaaten, in folgenden Bereichen Missbrauchsverhinderungsvorschriften zu erlassen: Zinsabzugsbeschränkungen, Wegzugsbesteuerung (Exit Tax), Allgemeine Missbrauchsvermeidungsvorschrift (General Anti-Abuse Rule, GAAR), Hinzurechnungsbesteuerung, Hybride Gestaltungen (ohne doppeltansässige Ges). Bei diesen Vorgaben handelt es sich um Mindeststandards, die Mitgliedstaaten dürfen also strengere Vorschriften erlassen bzw beibehalten. Hierbei sind allerdings die Vorgaben des Primärrechts, namentlich die EU-Grundfreiheiten zu beachten. Dort wo nationale Vorschriften hinter den Vorgaben zurückbleiben, sind die Mitgliedstaaten nach Art 288 AEUV allerdings verpflichtet, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen; die hierfür vorgesehene Umsetzungsfrist endete am 31.12.2018.
21
Zu den in der internationalen Steuergestaltung durchaus relevanten sog hybriden Gestaltungen wurde alsbald eine weitere Richtlinie von der EU-Kommission erarbeitet und zwischenzeitlich verabschiedet. Mit der Richtlinie (EU) 2017/952 v 29.5.2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen mit Drittländern (ABlEU v 7.6.2017, L 144/1), kurz auch als ATAD II bezeichnet, werden weitere Einschränkungen bei der steuerlichen Anerkennung von hybriden Gestaltungen geregelt, die bis zum 31.12.2019 von den EU-Mitgliedstaaten umzusetzen waren.
22
Am 22.12.2021 veröffentlichte die EU-Kommission zusammen mit dem bereits viel beachteten Richtlinienentwurf zur Einführung einer effektiven Mindestbesteuerung (siehe oben) einen Richtlinienentwurf zur missbräuchlichen Nutzung sog Briefkastenfirmen oder „Shell Entities“, die in der EU ansässig sind (UNSHELL-Initiative oder ATAD III).[25] Diese Initiative wurde bereits im Frühjahr 2021 im Rahmen der Mitteilung über die Unternehmensbesteuerung für das 21. Jahrhundert angekündigt. Der Richtlinienentwurf zielt darauf ab, einen EU-weiten Rechtsrahmen einzuführen, der bei der Identifizierung von EU-Unternehmen unterstützt, die zwar in der EU ansässig sind und eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, aber über keine Substanz verfügen und aufgrund dessen Steuervorteile erlangen (sog EU-Briefkastenfirmen). Darüber hinaus sollen auch solche zwischengeschalteten Unternehmen aufgedeckt werden, die lediglich zur Verschleierung der wahren Eigentümerstruktur für hochwertige Immobilien und anderer Wertgegenstände dienen.
V.Pillar 1 und 2
23
Am 1.7.2021 haben 130 Staaten des Inclusive Framework on BEPS eine politische Einigung über die vieldiskutierte Reform der internationalen Unternehmensbesteuerung erzielt.[26] Diese Reform sieht einerseits im Ausgangspunkt eine Neuverteilung der internationalen Besteuerungsrechte (sog Pillar 1) angesichts der Besonderheiten und Herausforderungen der Digitalwirtschaft vor, und andererseits parallel (oder auch nach dem Willen mancher Staaten alternativ) dazu die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung (sog Pillar 2).[27]
24
Pillar 1 sieht allerdings inzwischen eine Neuverteilung von Besteuerungsrechten bei Geschäftsmodellen vor, die weit über die Digitalwirtschaft hinausgehen. Es sollen neben hochautomatisierten digitalen Geschäftsmodellen wie Suchmaschinen auch jegliche Verkäufe an Endkunden unabhängig vom Vertriebsweg (sog „consumer-faced“-Geschäftsmodelle) erfasst werden. Während die Ziele des Pillar 1 dem Grunde nach noch eine Verknüpfung zum ursprünglichen Gedanken des OECD-BEPS-Prozesses aufweisen, verfolgt Pillar 2 mit der Absicht einer „globalen Mindestbesteuerung“ ein weit darüber hinausgehendes Ziel. Letzteres hat sich auch die EU auf die Fahne geschrieben und einen Richtlinienentwurf zur Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung veröffentlicht.[28]
25
In der Folgezeit schritten die Arbeiten an Pillar 2 deutlich zügiger voran als bei Pillar 1, auch wenn sich eine Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft zunächst am 8.10.2021 auf die wichtigsten Eckpunkte zum Zwei-Säulen-Projekt insgesamt geeinigt hatte.[29] In Bezug auf Pillar 2 legte das Inclusive Framework on BEPS sodann am 20.12.2021 mit der Einigung auf weitere Einzelheiten der sog GloBE-Regelungen[30] in den „Model Rules“[31] nach und damit den heute im Grunde immer noch gültigen Arbeitsstand vor, auf dem auch der erste Richtlinienvorschlag der EU basieren sollte.
26
Am 15.12.2022 veröffentlichte die OECD ein Papier zu Safe Harbour-Regeln sowie zu Erleichterungen bei Sanktionen,[32] am 2.2.2023 wurde das lange erwartete „GloBE Implementation Framework“ finalisiert.[33] Letzteres soll in eine Überarbeitung des erst im vergangenen März 2022 veröffentlichten OECD Kommentars zu den Model Rules eingehen und im Laufe des Jahres 2023 publik werden. Es bleibt daher zu hoffen, dass die nationalen Umsetzungsgesetze den EU-Mitgliedstaaten genügend Raum und Flexibilität geben, um auf etwaige spätere Änderungen und vor allem Erleichterungen der OECD Model Rules reagieren zu können.
27
Auf europäischer Ebene war schon während der Vorarbeiten der OECD steuerpolitisch ein Dissens über das Vorhaben der Mindestbesteuerung offenbar geworden – jedenfalls war klar, dass es aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips kein „Selbstgänger“ werden würde. Gleichwohl hatte die EU-Kommission bereits am 22.12.2021, also sehr kurze Zeit nach der finalen Beschlussfassung auf OECD-Ebene, einen ersten Richtlinienentwurf vorgelegt.[34]
28
Bei aller Kritik im Grundsätzlichen wird man konzedieren müssen, dass im Verlauf des dann folgenden Jahres sehr intensiv an einer Einigung gearbeitet wurde. Mehrfach verweigerten einzelne Mitgliedstaaten, ua Ungarn und Polen, der Richtlinie bei Abstimmungen die Gefolgschaft, teilw begleitet von Zwischenrufen seitens der USA. Als der Prozess im Herbst 2022 abermals stockte, erklärten Deutschland und vier weitere EU-Mitgliedstaaten öffentlich, die nationale Umsetzung der effektiven Mindestbesteuerung in jedem Fall und notfalls unilateral vorzunehmen.[35] Nach weiteren politischen Vorstößen und intensiven Gesprächen[36] wurde die Richtlinie rund ein Jahr nach dem ersten Richtlinienvorschlag einstimmig verabschiedet.[37]
29
In Bezug auf Pillar 1 wird bis Mitte des Jahres 2024 ein Vorschlag für ein weiteres Multilaterales Übereinkommen erwartet, welches der Umsetzung der Vorschläge für die Besteuerung der Digitalwirtschaft dient und im Jahr 2025 in Kraft treten soll. Erst dann wird sich zeigen, ob die in den letzten Jahren von manchen Staaten vorgeschobene politische Verquickung von Pillar 1 und 2 auch tatsächlich rechtlich umgesetzt werden wird.
VI.Anzeigepflichten für Steuergestaltungen
30
Kurz vor Weihnachten 2019 hatte der Bundesrat mit Sitzung v 20.12.2019 dem – mit Beschlussfassung des Finanzausschusses des Bundestags v 11.12.2019 noch leicht geänderten – Regierungsentwurf für ein „Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen“ v 9.10.2019 zugestimmt. Am 30.12.2019 erfolgte die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt.[38]
31
Im Wesentlichen basiert das Gesetz (umgesetzt in den §§ 138d AO ff.) auf der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates v 25.5.2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über mitteilungspflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (sog „DAC 6“). Diese geht zurück auf die Arbeiten der OECD zu BEPS-Aktionspunkt 12 (Mandatory Disclosure Rules). Durch die Mitteilungspflicht soll die FinVerw in die Lage versetzt werden, Steuervermeidungspraktiken und Gewinnverlagerung zeitnah zu identifizieren und diese „ungewollten Gestaltungsspielräume durch Rechtsvorschriften oder durch geeignete Risikoabschätzungen und die Durchführung von Steuerprüfungen zu schließen“. Auf diese Weise soll die „Erosion des deutschen Steuersubstrats“ verhindert werden.
32
Damit die FinVerw möglichst umfassend über grenzüberschreitende Modelle informiert wird und ggf gesetzgeberisch gegen diese vorgehen kann, enthält das Gesetz einen Katalog generisch gehaltener Kennzeichen (sog Hallmarks) von mitteilungspflichtigen Geschäftsaktivitäten. Sofern solche Geschäftsaktivitäten als grenzüberschreitende Steuergestaltungen qualifizieren und in den Anwendungsbereich eines dieser Kennzeichen fallen, sind sie grundsätzlich mitteilungspflichtig.
33
Die mitteilungspflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltungen sind ab dem 1.7.2020 grundsätzlich durch den Intermediär innerhalb von 30 Tagen beim Bundeszentralamt für Steuern zu melden, und zwar nach Ablauf des Tages, an dem erstmals die Gestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird, der Nutzer der Gestaltung zu deren Umsetzung bereit ist oder der erste Schritt der Umsetzung der Gestaltung gemacht wurde. Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen sollen mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 EUR geahndet werden.
34
Um EU-übergreifend sicherzustellen, dass die Finanzbehörden der Mitgliedstaaten umfassende und relevante Informationen über gesetzlich nicht vorgesehene Steuergestaltungen erhalten, sieht das Gesetz entspr der 6. AHRL zusätzlich vor, dass die dt Finanzbehörden die erlangten Informationen in einem zweiten Schritt mit den Finanzbehörden der anderen Mitgliedstaaten automatisch austauschen.
VII.Überblick über die Regelungsbereiche des AStG
35
In der Beratungspraxis lohnt sich stets ein Blick in das AStG, wenn ein Sachverhalt im Hinblick auf die Person des StPfl, im Hinblick auf von ihm verwendete Investitionsvehikel oder im Hinblick auf Einkunftsquellen eine Auslandsbeziehung aufweist. Dies gilt auch hinsichtlich der Erbschaft- und Schenkungsteuer, vgl § 4. Die Normen des AStG sind im Einzelnen zuweilen auch „gestandenen Beratern“ unbekannt, können aber für den StPfl unliebsame Konsequenzen zur Folge haben. Vorsicht ist namentlich dann angezeigt, wenn ein StPfl sich – in welcher Weise auch immer – eine ausl niedrige Besteuerung oder Nullbesteuerung zunutze machen möchte. Dies vorausgeschickt, gilt: Das AStG hat im Wesentlichen vier Regelungsbereiche, die sich zwar sämtlich gg die int Minderbesteuerung[39] richten, iÜ aber konzeptionell gänzlich unterschiedliche Stoßrichtungen verfolgen:
-
Einkunftsberichtigung bei verbundenen Unternehmen (§ 1);
-
Sog erweiterte beschränkte StPfl bei natürlichen Personen (§§ 2–5);
-
Vermögenszuwachsbesteuerung bei KapGesanteilen (§ 6);
-
Hinzurechnungsbesteuerung inkl Familienstiftungen (§§ 7–15).
36
§ 1 und § 1a betreffen den in der Praxis immens wichtigen Bereich[40] der sog Verrechnungspreise. Die Preise, die verbundene Unternehmen miteinander für konzerninterne Lieferungen und Leistungen vereinbaren, müssen marktüblich und angemessen sein. Dieses Prinzip findet seine Rechtfertigung darin, dass bei verbundenen Unternehmen kein natürlicher Interessengegensatz wie zwischen fremden Dritten besteht. Steuerrechtlich relevante Vereinbarungen zwischen einander nahestehenden Personen müssen daher dem sog Fremdvergleichsgrundsatz (dazu § 1 Rn 172) standhalten, um auch für Zwecke der Besteuerung von der FinVerw anerkannt zu werden.
37
Neben den zentralen, insb betriebswirtschaftlichen Fragen der Bestimmung der Angemessenheit der Verrechnungspreise (dazu § 1 Rn 167 ff) geht es hier auch um das Verhältnis des § 1 zu anderen bekannten Korrekturnormen bzw Rechtsinstituten wie zB der verdeckten Einlage oder der vGA (dazu § 1 Rn 34 f). Die Thematik der Verrechnungspreise hat eine weitere Dimension erlangt durch die durch das JStG 2008[41] in das Gesetz eingestellten Regelungen über sog Funktionsverlagerungen (§ 1 Abs 3 S 9 ff; dazu § 1 Rn 304 ff). Die tatsächlichen Auswirkungen dieser Novität sind erst jetzt zutr einschätzen lassen, weil die ersten Steuerfälle die Betriebsprüfungen erreicht haben. Ein Gleiches gilt für die Umsetzung des AOA in § 1 Abs 5 und der dazu ergangenen Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung.
38
Bei der erweiterten beschränkten StPfl handelt es sich um ein bes Besteuerungsregime, das der Vermeidung der Steuerflucht dient und das an die Aufgabe der dt unbeschränkten StPfl aufgrund eines Wegzugs anknüpft. Der erweiterten beschränkten StPfl unterliegt eine natürliche Person, die in den letzten zehn Jahren vor dem Ende ihrer unbeschränkten StPfl als Deutsche(r) insgesamt mindestens fünf Jahre unbeschränkt einkommensteuerpflichtig war (dazu § 2 Rn 55 ff), die in keinem oder in einem ausl Gebiet ansässig ist, in dem sie mit ihrem Einkommen nur einer niedrigen Besteuerung unterliegt (dazu § 2 Rn 70 ff), und die sog wesentliche wirtschaftliche Interessen (dazu § 2 Rn 108 ff) im Geltungsbereich des AStG hat.
39
§ 2 ist in der Praxis bes sorgfältig zu prüfen, weil sich eine natürliche Person allein durch den Wegzug aufgrund der genannten Regelung uU für lange Zeit (10 Jahre!) nicht der dt Besteuerung entziehen kann. Die Vorschrift wird flankiert durch eine erbschaft- und schenkungsteuerliche Sonderregelung (§ 4) sowie durch eine Sonderregelung für zwischengeschaltete Ges (§ 5).
40
In § 6[42] ist die sog Wegzugsbesteuerung (Vermögenszuwachsbesteuerung bei KapGesanteilen) bei natürlichen Personen geregelt.[43] Es handelt sich um eine lex specialis zu § 17 EStG. Die Vorschrift ordnet die Besteuerung einer fiktiven Veräußerung von Anteilen an KapGes iSd § 17 EStG an, wenn die unbeschränkte StPfl durch Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts oder ähnlich wirkende Ereignisse endet und zu diesem Zeitpunkt iÜ die Voraussetzungen des § 17 EStG erfüllt sind.
41
Die sog Hinzurechnungsbesteuerung, das Herzstück des AStG, soll der durch die Beteiligung an ausl, meist in der Rechtsform einer KapGes organisierten und niedrig besteuerten (dazu § 8 Rn 162 ff) Basisgesellschaften[44] (das AStG spricht von Zwischengesellschaften) bewirkten Verlagerung von Besteuerungssubstrat in das Ausland vorbeugen, wenn die KapGes schädliche, sog passive Einkünfte (dazu § 8 Rn 21 ff) erzielt. Die ATAD I hat konzeptionell einige zentrale Änderungen mit sich gebracht, so insb die Hinwendung vom Konzept der Inländerbeherrschung hin zu einem allgemeinen Beherrschungskonzept.[45]
42
Regelungstechnisch erfolgt dies über eine Durchbrechung der Abschirmwirkung der KapGes (Trennungsprinzip) in der Weise, dass bestimmte von der ausl Ges erzielte Einkünfte den inländischen Gesellschaftern als fiktive Gewinnausschüttungen[46] und eigene Einkünfte zugerechnet werden (dazu § 10 Rn 1, 9). Der Sachverhalt wird so besteuert, als ob die Basisgesellschaft nicht existent wäre. Nahezu alle Steuerrechte der Industrieländer verfügen über ähnliche Regelungen über die Besteuerung sog controlled foreign companies, und in der Tat hatte die mit der Ausarbeitung des AStG betraute Expertenkommission (vgl Rn 1) weit reichende Anleihen bei den cfc-Regeln des US-amerikanischen Internal Revenue Code genommen.[47] Die §§ 7 ff werden begleitet durch eine Sonderregelung über Familienstiftungen (§ 15), die strukturell ähnlich ausgestaltet ist, sowie durch eine Sonderregelung für ausl Betriebsstätten und PersGes, für die § 20 Abs 2 ceteris paribus eine der Hinzurechnungsbesteuerung vergleichbare Wirkung herbeiführt.
43
Die §§ 16–18 schließlich runden die vorstehend genannten Regelungen in verfahrensrechtlicher Hinsicht ab. Sie erweitern die allgemeingültigen Normen der AO (Mantelgesetz) in dreierlei Hinsicht. § 16 stellt § 160 AO in einen int Kontext, § 17 gibt den StPfl bestimmte Mitwirkungs- und Aufklärungspflichten auf und der FinVerw uU die Möglichkeit der Steuerschätzung, und § 18 bestimmt die (einheitliche und) gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für Zwecke der Hinzurechnungsbesteuerung.
B.Einzelfragen
I.Internationaler Steuerwettbewerb
44
Nie war es einfacher als heute, binnen Sekunden erhebliche Vermögenswerte in das Ausland zu transferieren. Auch die Mobilität der StPfl hat ein kaum gekanntes Ausmaß angenommen. Hinzu kommt, dass die Staaten, die sich in der Staatengemeinschaft als gleichberechtigte Rechtssubjekte gegenüberstehen, miteinander in einen Steuerwettbewerb[48] eingetreten sind, dessen Ende noch immer nicht absehbar ist. All dies führt dazu, dass die Staaten um wirtschaftlich rege und finanzkräftige StPfl konkurrieren, weil sich der stetig steigende Finanzbedarf anders nicht mehr hinreichend decken lässt.
45
Es nimmt daher nicht Wunder, dass die int Steuerplanung in den vergangenen Jahren stark an Attraktivität gewonnen hat. Ihre Bedeutung wird in der Zukunft noch weiter zunehmen. Die fortschreitende Regelungsdichte, das Nebeneinander nationaler Steuerhoheiten, die Verteilung von Besteuerungsansprüchen zwischen den Staaten durch DBA und auch rein faktische Schwierigkeiten (etwa Sprachbarrieren oder unterschiedliche Kulturen) haben dabei zu einer Komplexität geführt, die auch von dem Kundigen nicht immer leicht zu durchschauen ist.
46
Hinzu kommt, dass die int Beweglichkeit von StPfl und Einkunftsquellen gegenläufige Reaktionen der FinVerw hervorruft, die nicht eben zur Vereinfachung des Steuerrechts und einer praxistauglicheren Anwendung führen. Oftmals entstehen dadurch weitere administrative und sonstige Belastungen der StPfl, wie es bspw für Verrechnungspreise seit 2003 im Bereich der sog erweiterten Mitwirkungspflichten bei Auslandssachverhalten gem § 90 Abs 3 AO zu beobachten ist. Auch die Regelungen des AStG sind größtenteils Ausdruck des Bemühens, den StPfl dazu zu bewegen, nicht dem Lockruf des int Steuerwettbewerbs zu erliegen.
47
Doch die int Steuerplanung ihrerseits gibt den Staaten (insb den sog Oasenstaaten,[49] dh Staaten mit einer Null- oder Niedrigbesteuerung) weitere Anreize, Maßnahmen zu ergreifen, die die StPfl mitunter gezielt an Investitionen in anderen Staaten hindern. Die OECD hat längst erkannt, dass die unzureichende Angleichung der nationalen Steuersysteme und der sich daraus ergebende hohe Grad an Steuerwettbewerb der Mitgliedstaaten untereinander ein Ausmaß erreicht hat, das sich als schädlich erwiesen hat und das möglicherweise verhindert, dass die Vorteile, die der Binnenmarkt in Bezug auf Wachstum und Beschäftigung bringen kann, aufgrund der höheren Steuerbelastung der Arbeitskraft gegenüber der größeren Mobilität des Kapitals in ihr Gegenteil verkehrt werden können.
48
Der allseits beklagte Mangel an steuerlicher Harmonisierung und das Übermaß an Wettbewerb haben einen allmählichen Souveränitätsverlust der Mitgliedstaaten in ihrer Steuerpolitik und somit über ihre steuerpolitischen Instrumente verursacht, was auf eine potenzielle Steuererosion und den Verlust an Steuereinnahmen durch den unkontrollierten Steuerwettbewerb zurückzuführen ist.
49
Die OECD und auch die Europäische Kommission sehen es daher als notwendig an, die Entwicklung der nationalen Steuersysteme zu koordinieren und ein gewisses Ausmaß an steuerlicher Harmonisierung zu erzielen, und zwar insb in jenen Bereichen, in denen ein schädlicher Steuerwettbewerb negative Auswirkungen haben könnte (indirekte Steuern, Unternehmenssteuern, Besteuerung mobiler Faktoren wie bspw Kapital, steuerliche Behandlung von gebietsfremden Personen und Ges, Energie- und Umweltsteuern, steuerliche Behandlung von Grenzgängern, etc).
50
1998 hat die OECD einen Report vorgelegt, der sich mit der Bekämpfung von schädlichem Steuerwettbewerb und schädlichen Steuerpraktiken beschäftigte (dazu Einl MA Rn 60). Zur Bekämpfung des schädlichen Steuerwettbewerbs bzw der schädlichen Steuerpraktiken hat die OECD insgesamt 19 Empfehlungen ausgesprochen. So soll bspw ein unfairer Steuerwettbewerb durch die Ausnutzung bestehender DBA bekämpft werden können (Empfehlungen 10 ff). Zentral sind ferner die Empfehlungen, die sich auf die Beseitigung von Bankgeheimnissen und bestehenden Informationssperren beziehen (Empfehlungen 7, 8, 12, 14). Als äußerst wirkungsvoll hat sich insb die Empfehlung 16 erwiesen. Die Veröffentlichung einer Liste mit Steueroasen führte dazu, dass die meisten der dort aufgeführten 35 Steueroasen eine Verpflichtungserklärung abgaben, von unfairen Steuerpraktiken nach klar aufgestelltem Zeitplan abzusehen.[50]
51
Diese Bemühungen der OECD sind in jüngerer Zeit mit dem sog BEPS-Projekt neu aufgegriffen und erweitert worden. 2014 hatte die OECD erste Empfehlungen vorgelegt, um mithilfe int Koordination gegen legale Steuervermeidung in multinationalen Unternehmen vorzugehen. Damit entsprach sie dem Mandat der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure, die die OECD im November 2012 beauftragt hatte, Maßnahmen gegen die sog Aushöhlung der Steuerbasis und die Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) zu erarbeiten. Das BEPS-Projekt will Regierungen dabei unterstützen, ihre Steuerbasis zu schützen und mehr Sicherheit für Steuerzahler zu schaffen, dabei aber auch Dbest und Einschränkungen für grenzüberschreitende Wirtschaftsaktivitäten zu vermeiden. Die 15 konkreten Aktionspunkte sind indes für Deutschland allenfalls in Bezug auf Verrechnungspreise bei immateriellen Wirtschaftsgütern relevant. Die meisten anderen Vorgaben hat Deutschland bereits erfüllt, auch wenn die FinVerw dies an einigen Stellen abweichend beurteilt.
52
Die Steuerpolitik der Europäischen Kommission hat in den vergangenen Jahren weitgehend auf Vorarbeiten der OECD zurückgegriffen. Hier ist eine deutliche Konvergenz zu beobachten, wenn es um Maßnahmen zur Vermeidung schädlichen Steuerwettbewerbs geht. Die Steuerpolitik der Europäischen Kommission ist jedoch im Wesentlichen auf das Unternehmenssteuerrecht konzentriert und orientiert sich eng am Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip. Die Kommission erkennt damit – anders als der EuGH – die Steuerrechtssouveränität der Mitgliedsstaaten im Grundsatz an. Etwa seit dem Jahr 1990 zeigt sie sich gegenüber einer Harmonisierung im Binnenmarkt „um jeden Preis“ zurückhaltend[51] und verfolgt offenbar das Konzept eines „gesunden Steuerwettbewerbs“,[52] bei dem Wettbewerbsverzerrungen in enger Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten punktuell abgebaut werden sollen.
53
Die Diskussion um den schädlichen Steuerwettbewerb hat sich innerhalb der letzten 30 Jahre inhaltlich zweidimensional geändert. Die erste Dimension betrifft die Adressaten der Regeln gegen schädlichen Steuerwettbewerb. Während früher die Staaten im Vordergrund standen, die sich in einem „race to the bottom“ gefangen sahen, hat die Diskussion zwischenzeitlich einen anderen Zungenschlag angenommen und konzentrierte sich nunmehr nicht mehr so sehr auf die Staaten, sondern eher auf die multinationalen Unternehmen, die insb über Verrechnungspreise und steuerliche Präferenzregime weltweit betrachtet zu teils in der Tat nahezu „unanständigen“ Konzernsteuerquoten im niedrigen einstelligen Bereich gelangten.
54
Angefacht auch durch unseriöse mediale Berichterstattung gerieten so zunächst vor allem US-amerikanische Internet-Konzerne in den Fokus der Öffentlichkeit, und infolgedessen entdeckte die EU-Kommission das Rechtsinstitut der verbotenen Beihilfe für das Steuerrecht für sich ganz neu und setzte es seitdem zumindest eine Zeit lang recht erfolgreich ein. Vor allem sog IP-Boxen, die bes günstige Steuersätze für die Ausbeutung von geistigem Eigentum (Beispiel: Markenrechte; Patente) gewähren, aber auch andere präferenzielle Steuerregime und insb damit im Zusammenhang stehen-de, va im Ausland praktizierte sog „advance rulings“ (verbindliche Vorabsprachen mit einer Finanzbehörde) gehörten daher unter dem Gesichtspunkt unionsrechtswidriger Beihilfen in Europa plötzlich der Vergangenheit an oder wurden jedenfalls in ihrer Wirkung deutlich zurückgedrängt.
55
Die zweite Dimension betrifft die inhaltliche Ausrichtung bzw die Grenzen der Regeln gegen schädlichen Steuerwettbewerb. Früher stand der Kampf gegen Gewinnverlagerungen ganz oben auf der Agenda, dem beispielsweise durch die (gescheiterte) Vereinbarung über eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage innerhalb der EU Rechnung getragen worden wäre. Wenn die Gewinne innerhalb einer Unternehmensgruppe nach einem bestimmten Schlüssel verteilt werden, erübrigt sich die Frage nach einer Gewinnverlagerung. Mehr noch: Seinerzeit war man sich einig, dass der dann nur noch verbleibende reine Wettbewerb nach Steuersätzen ein „gesunder Steuerwettbewerb“ zwischen den Staaten sein würde, der aufgrund der Gleichordnung und Souveränität der Staaten hinzunehmen sei. Pillar 2 ignoriert diese Erkenntnis und greift „nur noch“ den Steuersatz an.
II.AStG und DBA/Unionsrecht
56
Die Grundsätze, die für das Verhältnis des nationalen dt Steuerrechts zum Abkommensrecht gelten (dazu Einl MA Rn 61 ff), werden auch durch das AStG nicht außer Kraft gesetzt. Es bedarf daher einer speziellen gesetzlichen Anordnung, wenn das Vorrangverhältnis der DBA ausnahmsweise aufgehoben werden soll. Auch im Anwendungsbereich des AStG darf die Bundesrepublik Deutschland daher einen int Sachverhalt nur besteuern, wenn ihr durch das jeweilige DBA das Besteuerungsrecht zugewiesen wird, es sei denn, es wird ausdrücklich ein treaty override (dazu Einl MA Rn 66 ff) angeordnet. Nach einer Vorlage durch den I. Senat des BFH hat das BVerfG durch Beschl v 15.12.2015 erkannt, dass eine Überschreibung eines DBA durch innerstaatliches Gesetz verfassungsrechtlich zulässig ist. Der Gesetzgeber sei auch dann nicht am Erlass eines Gesetzes gehindert, wenn dieses zu völkerrechtlichen Verträgen iSv Art 59 Abs 2 S 1 GG im Widerspruch stehe.
57
IRd § 1 wird man daher das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik idR an einer dem Art 9 MA vergleichbaren Vorschrift zu messen haben (dazu Art 9 MA Rn 8). IRd § 2 ist strikt das Prinzip zu beachten, dass die Vorschrift keine Anwendung findet, wenn und soweit das jeweilige DBA dem Zuzugsstaat des StPfl das ausschließliche Besteuerungsrecht für der erweiterten beschränkten StPfl unterliegende Einkünfte zuweist (dazu § 2 Rn 18 ff). Ein Beispiel für eine DBA-Regelung, die den §§ 2 ff zur Geltung verhilft, ist Art 4 Abs 4 DBA Schweiz.
58
§ 6 nimmt eine gewisse Sonderstellung ein. Nach hM gilt die fiktive Veräußerungsbesteuerung gewissermaßen als letzte Ausprägung der unbeschränkten StPfl vor dem Wegzug, die nicht durch das DBA eingeschränkt werde (dazu § 6 Rn 23 ff). Einen Verstoß der Regelung gegen das Abkommensrecht verneint der BFH ebenso wie deren Unionsrechtswidrigkeit.[53]
59
Für die §§ 7 ff (ein Gleiches gilt entspr für § 15 und Familienstiftungen) schließlich ist es systemimmanent, dass die Rechtsfolge einer dem Art 7 Abs 1 S 1 MA vergleichbaren Vorschrift (Besteuerung nur im Ansässigkeitsstaat des Unternehmens, wenn keine Betriebsstätte im Inland) durch die Hinzurechnungsbesteuerung durchbrochen und eine Besteuerung bei den inländischen Gesellschaftern vorgenommen wird (§ 20 Abs 1).[54] Auch für ausl Betriebsstätten und PersGes wird insoweit in § 20 Abs 2 ein (ausdrücklicher) treaty override (dazu § 20 Rn 72 ff) angeordnet.
60
Was das Verhältnis der Normen des AStG zum Europarecht anbelangt, so ist ohnehin festzustellen, dass nahezu jede Vorschrift des Gesetzes im Verdacht steht, mit unionsrechtlichen Vorgaben unvereinbar zu sein.[55] Für die §§ 7 ff[56] und § 15 etwa hat der Gesetzgeber jüngst – unzureichend – versucht, der Unionsrechtswidrigkeit zunächst verwaltungsseitig[57] und sodann durch § 8 Abs 2[58] bzw § 15 Abs 6 zu begegnen (dazu § 8 Rn 123 ff und § 15 Rn 142 ff). Das dt Steuerrecht steht hier vor der Herausforderung, einerseits berechtige Besteuerungsansprüche zu wahren und durchzusetzen, des Missbrauchs durch StPfl und des schädlichen Steuerwettbewerbs Herr zu werden und sich andererseits potenziell unionsrechtswidriger Vorschriften zu entledigen. Wiederum andererseits führen Steuerverlagerungen im Gemeinschaftsgebiet zu Wettbewerbsstörungen im Gemeinsamen Markt und gefährden die Wettbewerbsneutralität der Besteuerung in den EU-Mitgliedsstaaten.[59] Aufgrund der durch die ATAD I sekundärrechtlich fundierten Rechtssetzung in diesem Bereich ist die Frage der Unionsrechtswidrigkeit mittlerweile allerdings kaum noch von Relevanz.
61
Der ursprüngliche Ansatz der EG,[60] das Problem der Steueroasen durch die nationalen Steuerrechte der Mitgliedsstaaten regeln zu lassen, scheint daher überholt. Mittlerweile hat sich auch die Europäische Kommission des Problems des schädlichen Steuerwettbewerbs angenommen.[61] Sie setzt sich für mehr Transparenz und einen verstärkten Informationsaustausch über die Unternehmensbesteuerung ein, damit die Steuersysteme den komplizierten Unternehmensstrukturen besser gerecht werden können. Sie möchte va sicherstellen, dass die EU eine kohärente Politik gegenüber Offshore-Finanzzentren verfolgt und die betr Länder zu Transparenz und Beteiligung an einem wirksamen Informationsaustausch auffordert.[62]
62
Wie das Spannungsfeld zwischen AStG und Unionsrecht vor dem Hintergrund der jüngeren EuGH-Rspr (insb Rs Cadbury Schweppes[63] und Rs Columbus Container Services[64]) aufzulösen ist, ist gegenwärtig noch nicht absehbar. Dies gilt insb im Hinblick auf die Problematik der Steuerverlagerung und von rechtsmissbräuchlichen Gestaltungen. Nach der inzwischen gefestigten Rspr des EuGH begründet die Abwehr von Steuerumgehungen einen anerkannten Rechtfertigungsgrund[65] für die Beeinträchtigung der Europäischen Grundfreiheiten.
63
Jedoch ist zu beachten, dass an den Tatbestand der Steuerumgehung seitens des Gerichtshofs hohe Anforderungen gestellt werden. Die Ausübung einer Grundfreiheit (Beispiel: Gründung einer Tochtergesellschaft in einem anderen Mitgliedsstaat: Niederlassungsfreiheit, Art 49 und 54 EAUV) führt noch nicht für sich genommen zu der Annahme einer Steuerumgehung. Es gilt der an sich selbstverständliche Grundsatz, dass aufgrund der bloßen Ausübung einer Grundfreiheit kein Missbrauch derselben vorliegen kann, zumal sich der StPfl nach der grenzüberschreitenden Betätigung regelmäßig dem Steuerregime eines anderen Mitgliedsstaates unterworfen sieht. Insb führt insoweit auch allein die Tatsache, dass der StPfl in einem anderen Mitgliedsstaat ggf einen niedrig(er)en Steuersatz zu zahlen hat, nicht zur Annahme eine Steuerumgehung, mag der StPfl auch subjektiv die Steuerersparnis anstreben.[66]
64
Der Rechtfertigungsgrund der Abwehr von Steuerumgehungen weist noch Unschärfen auf, die der weiteren Präzisierung durch die Rspr bedürfen. So existiert bereits kein allg anerkannter Begriff der „Steuerumgehung“. Der EuGH versteht darunter – generalklauselartig – in einem sehr weiten Verständnis „künstlich geschaffene, der Umgehung des Steuerrechts dienende Sachverhalte“[67] und misst hieran den zu beurteilenden Einzelfall. Auf den Einzelfall stellt der Gerichtshof auch bei der allg Verhältnismäßigkeitsprüfung ab. So hat er bislang in vielen Fällen die Rechtfertigung über den Rechtfertigungsgrund der Abwehr von Steuerumgehungen daran scheitern lassen, dass es sich bei den in Rede stehenden Missbrauchsvermeidungsvorschriften um typisierte Regelungen handelte.[68]
65
Wichtig ist daher für die Beratungspraxis die Erkenntnis, dass allg Missbrauchsvermeidungsvorschriften, die nicht auf den konkreten Einzelfall rekurrieren und nicht den Missbrauch im konkreten Fall erfassen wollen, vom EuGH nicht als für eine Rechtfertigung für die Beeinträchtigung der Europäischen Grundfreiheiten hinreichend angesehen werden.[69] Auch die Nutzung vorteilhafter Rechtsvorschriften ist für sich genommen nicht ausreichend, um eine missbräuchliche Ausnutzung einer Grundfreiheit anzunehmen.[70]
66
Der EuGH hat sein Verständnis von einem Steuermissbrauch inzwischen immer weiter ausgeformt.[71] Man wird sich auf die folgenden Grundsätze einigen können: (1) Die Inanspruchnahme der Grundfreiheiten setzt eine tatsächliche Ansiedlung im jeweiligen Mitgliedsstaat und die Ausübung einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit in diesem Mitgliedsstaat voraus.[72] (2) Der zwischenstaatliche Auskunftsaustausch ist die Grundlage für die Prüfung dieser Voraussetzungen.[73] Kann danach im Grundsatz die jeweilige Grundfreiheit von einem StPfl in Anspruch genommen werden, liegt dennoch ein Missbrauch vor, wenn es sich (3) um eine rein künstliche Gestaltung mit dem Zweck der Steuerumgehung handelt (jedoch kein Motiv-Test)[74] und (4) eine Beeinträchtigung der Ausgewogenheit der Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse droht.[75]
67