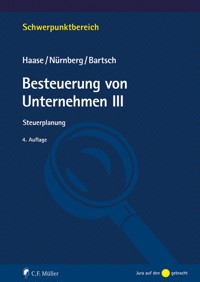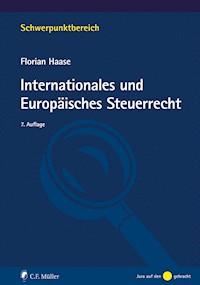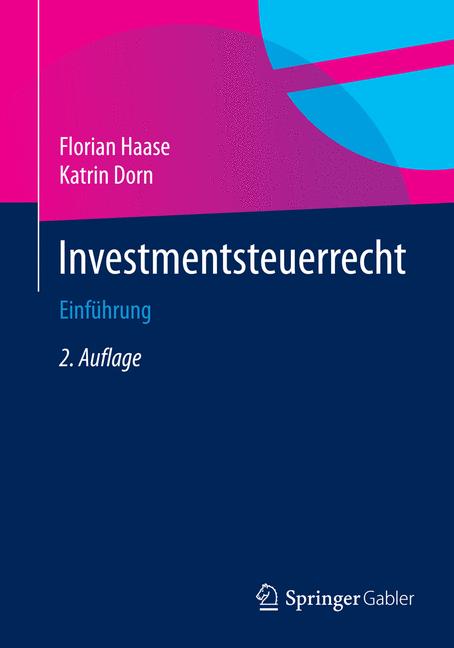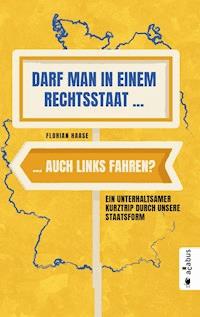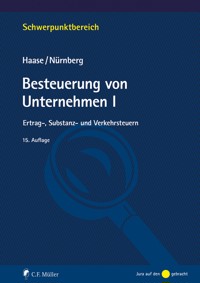
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Aus "Scheffler" wird jetzt "Haase/Nürnberg": Der vorliegende Band "Besteuerung von Unternehmen I" gibt einen Überblick über die wichtigsten Regelungen der einzelnen Ertrag-, Substanz- und Verkehrsteuern. Bei der Neuauflage wurde die Grundkonzeption des Buches beibehalten. Im Detail wurden jedoch zahlreiche Überarbeitungen und Aktualisierungen an die seit der letzten Auflage geänderte Rechtslage vorgenommen. Praktische Berechnungsbeispiele, übergreifende Betrachtungen und eine übersichtliche Darstellung ermöglichen dem Leser den Zugang zu schwierigen steuerrechtlichen Fragestellungen. Der Band wendet sich insbesondere an Studierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an Universitäten, (Dualen) Hochschulen, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien. In Band II: Steuerbilanz werden die steuerliche Einkunftsermittlung (Ertragsteuern) und Vermögensbewertung (Erbschaft- und Schenkungsteuer) vorgestellt. In Band III: Steuerplanung wird auf den Einfluss der Besteuerung auf ausgewählte betriebliche Entscheidungen eingegangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Besteuerung von Unternehmen I
Ertrag-, Substanz- und Verkehrsteuern
von
Dr. jur. Florian Haase, M.I.TaxProfessor für Deutsches, Europäisches und Internationales Steuerrecht an der IU Internationale Hochschule, Bad Honnef Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht, Rödl & Partner, Hamburg
und
Dipl. Finw. (FH) Philip Nürnberg, M.I.TaxSteuerberater, Rödl & Partner, Hamburg
15., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Schwerpunkte
Eine systematische Darstellung der wichtigsten Rechtsgebiete anhand von Fällen Begründet von Professor Dr. Harry Westermann †
Autoren
Florian Haase, Jahrgang 1974, Studium der Rechtswissenschaften und Rechtsreferendariat in Hamburg, Masterstudium im Internationalen Steuerrecht an dem Interdisziplinären Zentrum für Internationales Finanz- und Steuerwesen (IIFS) an der Universität Hamburg (Master of International Taxation (M.I.Tax), Promotion im Aktienrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Professor für Deutsches, Internationales und Europäisches Steuerrecht an der IU Internationale Hochschule, Bad Honnef. E-Mail: [email protected]
Philip Nürnberg, Jahrgang 1994, Studium zum Diplom-Finanzwirt (FH) in der bremischen Finanzverwaltung, Masterstudium im Internationalen Steuerrecht an dem Interdisziplinären Zentrum für Internationales Finanz- und Steuerwesen (IIFS) an der Universität Hamburg (Master of International Taxation (M.I.Tax), Steuerberater, Dozent für Internationales Steuerrecht, Umsatzsteuerrecht und Erbschaftsteuerrecht sowie Bewertungsrecht in der Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen. E-Mail: [email protected]
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-6662-3
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598
www.cfmueller.de
© 2025 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Im Band Besteuerung von Unternehmen I: Ertrag, Substanz- und Verkehrsteuern werden steuerartenbezogen die wichtigsten Vorschriften zur Steuerpflicht, zum Steuergegenstand, zur Bemessungsgrundlage, zum Tarif und zur Steuererhebung erläutert. Im Band II: Steuerbilanz (steuerliche Gewinnermittlung) werden die Regelungen zur Ermittlung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb vorgestellt. Zusammen geben die beiden Bände einen prägnanten und dennoch umfassenden Überblick über die von Unternehmen zu beachtenden steuerrechtlichen Normen. Im Band III: Steuerplanung wird ein Perspektivenwechsel vorgenommen: Die gesetzlichen Vorschriften werden nicht im Hinblick auf ihre rechtliche Stellung beurteilt, sondern nach den Kriterien gruppiert, inwieweit sie für betriebliche Entscheidungen zu beachten sind und in welcher Weise sie sich auf unternehmerische Aktivitäten auswirken. Die steuerartenbezogene Betrachtung in den beiden Bänden I und II wird also im Band III durch eine steuerplanerische Analyse erweitert. Aufbauend auf den ersten beiden Bänden wird gezeigt, wie die zahlreichen steuerrechtlichen Regelungen die Steuerbelastung von Unternehmen beeinflussen.
Betrachtet werden Entscheidungen, die für die Steuerplanung eines Unternehmens besonders bedeutsam sind:
•
Entscheidung über die Rechtsform eines Unternehmens
•
Investitionsentscheidungen (investitionstheoretische Grundlagen, entscheidungsneutrale Besteuerung sowie mehrere Anwendungsfälle)
•
Entscheidungen über die Finanzierung (Eigen- oder Kreditfinanzierung oder Leasing)
•
Steuerbilanzpolitik (Gewinnausweisentscheidung)
•
Entscheidungen über die nationale Standortwahl
•
Ausgestaltung der Entgeltpolitik.
Für die Steuerplanung werden Methoden benötigt, mit deren Hilfe die durch eine betriebliche Entscheidung ausgelösten Steuerzahlungen berechnet werden können. Deshalb werden vorab in einem Grundlagenteil die Vor- und Nachteile der Teilsteuerrechnung sowie der (kasuistischen) Veranlagungssimulation gegeneinander abgewogen.
Bei der Neuauflage wurde die Grundkonzeption des Buches beibehalten. Im Detail wurden jedoch zahlreiche Überarbeitungen und Aktualisierungen an die seit der letzten Auflage geänderte Rechtslage vorgenommen. Mit dieser Neuauflage beginnt eine neue Ära: Band I und II werden fortan von Florian Haase und Philip Nürnberg verantwortet, für Band III kommt sachkundige Unterstützung durch Gerrit Bartsch. Die Bände I bis III sind zum Auftakt der Übernahme sämtlich neu überarbeitet worden und erscheinen zum Sommersemester 2025 erstmals gleichzeitig.
Adressaten des Bandes III sind diejenigen, die sich für den Einfluss der Besteuerung auf betriebliche Entscheidungen interessieren. Hierzu gehören insbesondere Studierende der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften an Universitäten, (Fach-)Hochschulen, Dualen Hochschulen, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien. Vermittelt wird das Grundlagenwissen, das für die Steuerplanung benötigt wird. Die steuerlichen Effekte werden nicht nur mit Hilfe von Formeln abgeleitet, sondern auch durch zahlreiche (relativ einfach strukturierte) Zahlenbeispiele veranschaulicht und ausführlich erläutert.
Hamburg, im Februar 2025
Florian Haase
Philip Nürnberg
Gerrit Bartsch
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Schrifttum (Auswahl)
A.Kommentare
B.Lehrbücher
Erster TeilEinführung
Erster TeilEinführung
Erster AbschnittWichtige Begriffe
A.Steuer2 – 8
B.Steuerarten9 – 11
C.Steuergesetzgebungshoheit12
D.Steuerertragshoheit13
E.Steuerverwaltungshoheit14
F.Steuersubjekt, Steuerschuldner, Steuerzahler, Steuerträger, Steuerdestinatär, Steuergläubiger15 – 21
G.Steuerobjekt, Bemessungsgrundlage22, 23
H.Steuertarif, Steuersatz24 – 29
Zweiter AbschnittMerkmale des deutschen Steuersystems
A.Fehlen einer eigenständigen Unternehmensbesteuerung30
B.Dependenzen und Interdependenzen31
C.Anknüpfung an zivilrechtliche Wertungen32, 33
D.Wertungsabhängigkeit34 – 36
E.Spezielle steuerliche Ungewissheit37
Dritter AbschnittRechtsquellen
Zweiter TeilDie Besteuerung des Erfolgs eines Unternehmens
Zweiter TeilDie Besteuerung des Erfolgs eines Unternehmens
Erster AbschnittÜberblick über die Ertragsteuern und ihre Beziehungen zueinander
A.Gemeinsamkeiten50
B.Unterschiede51
C.Nebeneinander der drei Ertragsteuern52
Zweiter AbschnittEinkommensteuer
A.Überblick53 – 61
I.Allgemeine Charakterisierung53 – 56
II.Ertragshoheit57
III.Aufbau des Einkommensteuergesetzes58
IV.Schema zur Ermittlung der Einkommensteuer59 – 61
B.Persönliche Steuerpflicht (natürliche Personen)62 – 67
I.Unbeschränkte Steuerpflicht63
II.Beschränkte Steuerpflicht64, 65
III.Beginn und Ende der Steuerpflicht66, 67
C.Sachliche Steuerpflicht (Summe der Einkünfte)68 – 222
I.Einkommensbegriff des Einkommensteuergesetzes68 – 75
1.Fehlen einer theoretischen Leitlinie68 – 71
2.Einkunftserzielungsabsicht als Voraussetzung der Steuerbarkeit72 – 75
II.Einkunftsarten76 – 163
1.Bedeutung der richtigen Zuordnung der Einkünfte76 – 87
2.Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft88 – 91
a)Arten der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe88
b)Arten der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft89
c)Abgrenzung gegenüber den Einkünften aus Gewerbebetrieb90
d)Besonderheiten bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft91
3.Einkünfte aus Gewerbebetrieb92 – 104
a)Arten und Merkmale eines Gewerbebetriebs92 – 95
b)Gewerbliche Einkünfte aus laufender Geschäftstätigkeit96 – 99
c)Gewerbliche Einkünfte aus aperiodischen Geschäftsvorfällen100 – 102
d)Besonderheiten bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb103, 104
4.Einkünfte aus selbständiger Arbeit105 – 109
a)Arten der Einkünfte aus selbständiger Arbeit105
b)Abgrenzung gegenüber den Einkünften aus Gewerbebetrieb106 – 108
c)Besonderheit bei den Einkünften aus selbständiger Arbeit109
5.Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit110 – 123
a)Kennzeichen einer nichtselbständigen Arbeit110
b)Umfang der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit111 – 113
c)Abgrenzung gegenüber den Einkünften aus Gewerbebetrieb und den Einkünften aus selbständiger Arbeit114
d)Besonderheiten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit115 – 123
6.Einkünfte aus Kapitalvermögen124 – 140
a)Kennzeichen und Umfang der Einkünfte aus Kapitalvermögen124 – 127
b)Abgrenzung gegenüber den Einkünften aus Gewerbebetrieb128, 129
c)Besonderheiten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen130 – 140
7.Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung141 – 145
a)Kennzeichen und Umfang der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung141, 142
b)Abgrenzung gegenüber den Einkünften aus Gewerbebetrieb und zur Liebhaberei143, 144
c)Besonderheiten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung145
8.Sonstige Einkünfte iSd § 22 EStG146 – 156
a)Begriff der sonstigen Einkünfte146
b)Umfang der sonstigen Einkünfte iSd § 22 EStG147 – 155
c)Besonderheit bei den sonstigen Einkünften iSd § 22 EStG156
9.Kriterien zur Abgrenzung zwischen den sieben Einkunftsarten157
10.Nicht steuerbare Einkünfte158
11.Bedeutung des § 24 EStG159
12.Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebeneinkunftsarten160 – 163
III.Einkunftsermittlungsmethoden164 – 222
1.Gemeinsame Prinzipien164 – 167
2.Einteilung der Einkunftsarten nach der Art ihrer Ermittlung168 – 171
3.Gewinnermittlungsmethoden172 – 208
a)Betriebsvermögensvergleich172 – 177
b)Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben178 – 182
c)Gewinnermittlung bei Handelsschiffen im internationalen Verkehr183
d)Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen184
e)Schätzung nach § 162 AO185
f)Anwendungsbereich der Gewinnermittlungsmethoden186 – 188
g)Gewinnermittlungszeitraum189, 190
h)Betriebliche Erträge und Aufwendungen (Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben)191 – 208
4.Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten209 – 222
a)Einkunftsermittlung209, 210
b)Einnahmen211 – 213
c)Werbungskosten214 – 222
D.Bemessungsgrundlage (zu versteuerndes Einkommen)223 – 277
I.Konzeptionelle Überlegungen223 – 230
1.Ausgangspunkt: persönliche Interpretation des Leistungsfähigkeitsprinzips223 – 225
2.Zielsetzungen beim Abzug von Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen226 – 229
3.Abgrenzung gegenüber dem Verlustabzug230
II.Sonderausgaben231 – 264
1.Allgemeines231 – 233
2.Unbeschränkt abziehbare Sonderausgaben234 – 239
3.Beschränkt abziehbare Sonderausgaben240 – 262
4.Sonderausgaben-Pauschbetrag und Vorsorgepauschale263, 264
III.Außergewöhnliche Belastungen265 – 274
1.Allgemeines265 – 268
2.Typisierte außergewöhnliche Belastungen269, 270
3.Nicht typisierte außergewöhnliche Belastungen271 – 274
IV.Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter275 – 277
E.Behandlung von Verlusten278 – 299
I.Verlustausgleich279 – 286
II.Verlustabzug287 – 299
F.Steuertarif (tarifliche und festzusetzende Einkommensteuer)300 – 338
I.Normaltarif301 – 312
II.Progressionsvorbehalt313, 314
III.Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen315
IV.Ermäßigter Steuersatz nach § 34 Abs. 1 EStG (Multiplikator-Mischtarif)316 – 318
V.Ermäßigter Steuersatz nach § 34 Abs. 3 EStG319 – 324
VI.Ermäßigter Steuersatz nach § 34b EStG325
VII.Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne326 – 331
VIII.Steuerermäßigungen332 – 338
1.Überblick332
2.Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb333 – 338
G.Steuerzahlung339 – 345
H.Veranlagung346 – 353
I.Alterseinkünfte354 – 364
J.Familienleistungsausgleich365 – 372
I.Kindergeld367
II.Kinderfreibetrag und Freibetrag für die Betreuung, Erziehung und Ausbildung des Kindes368 – 371
III.Weitere steuerliche Maßnahmen der Familienförderung372
Dritter AbschnittKörperschaftsteuer
A.Überblick373 – 380
I.Allgemeine Charakterisierung373 – 377
II.Ertragshoheit378
III.Aufbau des Körperschaftsteuergesetzes379
IV.Schema zur Ermittlung der Körperschaftsteuer380
B.Persönliche Steuerpflicht (juristische Personen)381 – 385
I.Unbeschränkte Steuerpflicht382
II.Beschränkte Steuerpflicht383
III.Steuerbefreiungen384
IV.Beginn und Ende der Steuerpflicht385
C.Sachliche Steuerpflicht und Bemessungsgrundlage (zu versteuerndes Einkommen)386 – 398
I.Einkommensbegriff des Körperschaftsteuergesetzes386 – 389
II.Abziehbare Aufwendungen390 – 392
1.Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesellschafter einer KGaA391
2.Abziehbare Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge)392
III.Nichtabziehbare Aufwendungen393 – 397
1.Aufwendungen zur Erfüllung von Satzungszwecken394
2.Bestimmte Steuerzahlungen395
3.Geldstrafen und ähnliche Aufwendungen396
4.Hälfte der Aufsichtsratsvergütungen397
IV.Steuerfreie Einnahmen398
D.Behandlung von Verlusten399 – 409
I.Körperschaftsteuerlicher Verlustabzug399 – 402
II.Einschränkungen des Verlustabzugs nach einem Gesellschafterwechsel403 – 409
E.Steuertarif und Steuerzahlung410, 411
F.Körperschaftsteuersystem412 – 443
I.Besteuerung von Gewinnausschüttungen412 – 416
1.Ausschüttungen an eine natürliche Person413, 414
a)Anteile im Privatvermögen: Abgeltungsteuer413
b)Anteile im Betriebsvermögen oder Wahlrecht bei unternehmerischer Beteiligung: Teileinkünfteverfahren414
2.Ausschüttungen an eine Kapitalgesellschaft415, 416
a)Beteiligung mindestens 10%: Dividendenfreistellung415
b)Beteiligung unter 10%: volle Besteuerung416
II.Veräußerungsgewinne und -verluste417, 418
III.Eigene Aufwendungen des Gesellschafters419
IV.Besonderheiten für Banken und Versicherungen420
V.Beurteilung421 – 443
1.Wirkung: Doppelbesteuerung in pauschalierter Form vermieden421 – 425
a)Ausschüttungen an eine natürliche Person (Abgeltungsteuer)423
b)Ausschüttungen an eine natürliche Person (Teileinkünfteverfahren)424
c)Ausschüttungen an eine Kapitalgesellschaft (Dividendenfreistellung)425
2.Nachteile eines Shareholder-Relief-Systems aus betriebswirtschaftlicher Sicht426 – 430
3.Wirkungen bei grenzüberschreitenden Beteiligungsverhältnissen431
4.Vor- und Nachteile gegenüber anderen Körperschaftsteuersystemen432 – 443
a)Klassisches Körperschaftsteuersystem433
b)Körperschaftsteuerliches Anrechnungsverfahren434 – 436
c)Dividendenabzugsverfahren437 – 439
d)Dividendenfreistellungsverfahren440 – 442
e)Ergebnis443
G.Besonderheiten bei Ermittlung der Körperschaftsteuer444 – 464
I.Verdeckte Gewinnausschüttungen444 – 449
1.Begriff445 – 448
2.Steuerliche Behandlung449
II.Verdeckte Einlagen450 – 456
1.Begriff451 – 454
2.Steuerliche Behandlung455, 456
III.Einschränkungen beim Abzug von Zinsaufwendungen (Zinsschranke)457 – 462
IV.Einschränkungen beim Abzug von Aufwendungen für die Rechteüberlassung (Lizenzschranke)463, 464
Vierter AbschnittGewerbesteuer
A.Überblick465 – 475
I.Allgemeine Charakterisierung465 – 471
II.Ertragshoheit472
III.Aufbau des Gewerbesteuergesetzes473
IV.Schema zur Ermittlung der Gewerbesteuer474, 475
B.Steuergegenstand (Gewerbebetrieb)476 – 483
I.Arten von Gewerbebetrieben, Inlandsbezug476 – 478
II.Mehrheit von Betrieben (sachliche Selbständigkeit)479
III.Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht480
IV.Steuerbefreiungen481
V.Besonderheiten bei Arbeitsgemeinschaften482
VI.Steuerschuldner483
C.Bemessungsgrundlage484 – 517
I.Steuerbilanzgewinn als Ausgangsgröße484 – 487
II.Gewerbesteuerliche Modifikationen (Hinzurechnungen und Kürzungen)488 – 517
1.Zielsetzungen488 – 492
2.Aufwendungen für Fremdkapital493 – 502
3.Gewinnanteile und Geschäftsführungsvergütungen von Komplementären einer KGaA503
4.Grundstückserträge504
5.Beteiligung an einer inländischen oder ausländischen Personengesellschaft505
6.Beteiligung an einer inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaft506 – 513
a)Gewinnausschüttungen und Veräußerungsgewinne506 – 512
b)Ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibungen513
7.Beteiligung an einer KGaA514
8.Auf ausländische Betriebsstätten entfallender Gewerbeertrag515
9.Als Betriebsausgaben abgezogene ausländische Steuern516
10.Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge)517
D.Behandlung von Verlusten518 – 522
E.Steuertarif und Steuerzahlung523 – 528
F.Ertragsteuerliche Behandlung529
G.Zerlegung530
Fünfter AbschnittZuschlagsteuern
A.Kirchensteuer532 – 535
B.Solidaritätszuschlag536 – 538
Dritter TeilDie Besteuerung der Übertragung von Unternehmen
Erster AbschnittZielsetzung der Besteuerung des Vermögenstransfers
A.Einordnung in das System der Steuerarten im Hinblick auf die Besteuerungsbasis539
B.Ausgestaltung als Erbanfallsteuer540, 541
C.Konsequenzen aus der Einordnung als Erbanfallsteuer542 – 544
I.Bewertungsmaßstab: gemeiner Wert542
II.Voraussetzung für steuerliche Verschonungsregeln: transparente und folgerichtige Ausgestaltung543, 544
Zweiter AbschnittErbschaft- und Schenkungsteuer
A.Überblick545 – 549
I.Allgemeine Charakterisierung545, 546
II.Ertragshoheit547
III.Aufbau des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes548
IV.Schema zur Ermittlung der Erbschaft- und Schenkungsteuer549
B.Persönliche Steuerpflicht (natürliche und juristische Personen)550 – 552
I.Unbeschränkte Steuerpflicht551
II.Beschränkte Steuerpflicht552
C.Sachliche Steuerpflicht (steuerpflichtige Vorgänge)553 – 558
I.Erwerb von Todes wegen554
II.Schenkungen unter Lebenden555, 556
III.Zweckzuwendungen557
IV.Erbersatzsteuer558
D.Bemessungsgrundlage (steuerpflichtiger Erwerb)559 – 598
I.Zusammensetzung der Bemessungsgrundlage559
II.Bewertungsstichtag560
III.Bewertungsgrundsätze561 – 580
1.Land- und forstwirtschaftliches Vermögen563 – 566
2.Grundvermögen567 – 570
3.Anteile an Kapitalgesellschaften571 – 573
4.Betriebsvermögen574, 575
5.Übrige Vermögenswerte576, 577
6.Abziehbare Belastungen578, 579
7.Kurzbeurteilung580
IV.Sachliche Steuerbefreiungen581 – 598
1.Nichtbesteuerung des Zugewinnausgleichs581
2.Begünstigung für Unternehmensvermögen582 – 590
3.Begünstigung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke591
4.Begünstigung für selbst genutzten Wohnraum und weitere Steuerbefreiungen nach § 13 ErbStG592, 593
5.Kurzbeurteilung594 – 598
E.Steuertarif und Steuerzahlung599 – 613
I.Steuerklassen600
II.Persönliche Freibeträge601, 602
1.Allgemeine Freibeträge601
2.Versorgungsfreibeträge602
III.Steuersatz603, 604
IV.Tarifbesonderheiten605 – 609
1.Tarifbegrenzung bei der Übertragung von Unternehmensvermögen605, 606
2.Berücksichtigung von früheren Erwerben607
3.Mehrfacher Erwerb derselben Vermögenswerte608
4.Besonderheiten für Familienstiftungen und -vereine609
V.Verfahrensrechtliche Regelungen610 – 613
F.Ertragsteuerliche Behandlung614
G.Zusammenhang zwischen Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Einkommensteuer615 – 622
I.Doppelbelastung von Wertsteigerungen615 – 620
II.Steuerermäßigung bei der Einkommensteuer621, 622
Vierter TeilDie Besteuerung der Substanz eines Unternehmens
Erster AbschnittZielsetzung von Substanzsteuern
A.Schwierigkeiten der Rechtfertigung von Substanzsteuern623, 624
B.Entwicklungen im Bereich der Substanzsteuern625 – 627
C.Notwendigkeit einer Grundsteuerreform628
Zweiter AbschnittGrundsteuer
A.Überblick629 – 635
I.Allgemeine Charakterisierung629 – 632
II.Ertragshoheit633
III.Aufbau des Grundsteuergesetzes634
IV.Schema zur Ermittlung der Grundsteuer635
B.Steuergegenstand (Grundbesitz)636 – 644
I.Formen des Grundbesitzes636 – 639
II.Steuerbefreiungen und Erlass der Grundsteuer640 – 642
III.Steuerschuldner643, 644
C.Bemessungsgrundlage (Grundsteuerwert des Grundbesitzes)645 – 650
D.Steuertarif und Steuerzahlung651 – 656
E.Ertragsteuerliche Behandlung657
Fünfter TeilVerkehrsteuern
Erster AbschnittÜberblick über die Verkehrsteuern und ihre Beziehungen zueinander
A.Zielsetzung von Verkehrsteuern658 – 660
B.Aufbau von Verkehrsteuergesetzen661
C.Vermeidung einer verkehrsteuerlichen Doppelbelastung662 – 664
Zweiter AbschnittGrunderwerbsteuer
A.Überblick665 – 668
I.Allgemeine Charakterisierung665
II.Ertragshoheit666
III.Aufbau des Grunderwerbsteuergesetzes667
IV.Schema zur Ermittlung der Grunderwerbsteuer668
B.Steuergegenstand (Erwerbsvorgänge)669 – 674
C.Steuerbefreiungen675
D.Bemessungsgrundlage (Wert der Gegenleistung)676 – 678
E.Steuertarif, Steuerschuldner und Steuerzahlung679 – 683
F.Verhältnis zur Umsatzsteuer und ertragsteuerliche Behandlung684, 685
Dritter AbschnittUmsatzsteuer
A.Überblick686 – 704
I.Allgemeine Charakterisierung686 – 700
1.Besteuerungsziel686
2.Besteuerungskonzept: Allphasen-Nettoumsatzsteuer mit sofortigem Vorsteuerabzug (Mehrwertsteuer)687 – 695
a)Überblick über mögliche Umsatzsteuersysteme687
b)Nachteil einer Bruttoumsatzsteuer: Kumulationswirkung688, 689
c)Merkmale einer Allphasen-Nettoumsatzsteuer mit sofortigem Vorsteuerabzug (Mehrwertsteuer)690 – 695
3.Besteuerungskonzept für grenzüberschreitende Lieferungen und sonstige Leistungen (Grundsatz: Bestimmungslandprinzip)696 – 700
a)Methoden zur Vermeidung einer internationalen Doppelbesteuerung696 – 698
b)Konflikt zwischen dem Verbrauchsteuercharakter der Umsatzsteuer und dem Binnenmarktgedanken699, 700
II.Ertragshoheit701, 702
III.Aufbau des Umsatzsteuergesetzes703
IV.Schema zur Ermittlung der Umsatzsteuer704
B.Unternehmer, Unternehmen und Gebietsbegriffe705 – 720
I.Unternehmer706 – 711
II.Unternehmen712 – 719
1.Überblick713, 714
2.Organisatorischer Aufbau715 – 717
3.Art und Umfang der Tätigkeit718
4.Einordnung von Gegenständen719
III.Gebietsbegriffe720
C.Steuergegenstand (Umsätze)721 – 763
I.Entgeltliche Leistungen722 – 746
1.Leistungen als Oberbegriff722 – 725
2.Lieferungen726 – 737
a)Begriff der Lieferung726 – 728
b)Ort der Lieferung729 – 734
c)Spezielle Formen von Lieferungen735 – 737
3.Sonstige Leistungen738 – 743
a)Begriff der sonstigen Leistung738
b)Ort der sonstigen Leistung739 – 743
4.Sonderfälle744, 745
5.Nicht steuerbare Vorgänge746
II.Unentgeltliche Wertabgaben747 – 755
1.Zwecksetzung747, 748
2.Unentgeltliche Abgabe von Gegenständen749 – 752
3.Unentgeltliche Abgabe von Dienstleistungen753 – 755
III.Einfuhr von Gegenständen im Inland (Einfuhren aus dem Drittlandsgebiet)756 – 758
IV.Innergemeinschaftlicher Erwerb759 – 763
D.Steuerbefreiungen764 – 784
I.Formen und Ziele der Steuerbefreiungen764 – 771
II.Belastungswirkungen von Steuerbefreiungen772 – 784
1.Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug773, 774
2.Steuerfreie Umsätze ohne Optionsrecht775 – 780
3.Steuerfreie Umsätze mit Optionsrecht781 – 784
E.Bemessungsgrundlage (Grundsatz: Entgelt)785 – 793
F.Steuertarif794, 795
G.Vorsteuerabzug796 – 805
I.Persönliche und sachliche Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug796 – 800
II.Ausschlüsse und Einschränkungen beim Vorsteuerabzug801 – 804
III.Berichtigung des Vorsteuerabzugs805
H.Entstehung der Steuer, Steuerschuldner und Haftung für schuldhaft nicht abgeführte Steuer806 – 808
I.Besteuerungszeitraum und Rechnungslegungsverpflichtungen809 – 819
J.Besonderheiten bei Ermittlung der Umsatzsteuer820 – 824
I.Kleinunternehmer820
II.Durchschnittssätze für Land- und Forstwirte821
III.Reiseleistungen822
IV.Wiederverkäufer (Differenzbesteuerung)823
V.Anlagegold824
K.Ertragsteuerliche Behandlung825 – 832
I.Betriebsvermögensvergleich826 – 828
II.Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben829, 830
III.Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten831, 832
Sechster TeilGrundzüge der Konzernbesteuerung
Erster AbschnittAllgemeine Charakterisierung und Beurteilungsmaßstäbe
Zweiter AbschnittKörperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft
A.Voraussetzungen einer ertragsteuerlichen Organschaft837 – 841
B.Besteuerungskonzept842 – 848
I.Körperschaftsteuer: Zurechnungstheorie843 – 846
II.Gewerbesteuer: modifizierte Einheitstheorie847, 848
C.Wirkungen einer Organschaft bei den Ertragsteuern849 – 877
I.Gewinne der Organgesellschaft850 – 860
1.Zuordnung der Erfolge der Organgesellschaft850
2.Mutterkapitalgesellschaft851
3.Mutterpersonenunternehmen852 – 857
4.Von der Rechtsform des Organträgers unabhängige Rechtsfolgen858 – 860
II.Verluste der Organgesellschaft861 – 863
III.Verluste des Organträgers864, 865
IV.Eigene Aufwendungen des Organträgers, Bilanzierung der Beteiligung an der Organgesellschaft866 – 868
V.Zinsaufwendungen, steuerfreie Einkünfte und Beteiligungserträge der Organgesellschaft869 – 872
VI.Innerorganschaftliche Lieferungen und Leistungen873 – 875
VII.Erweiterte Kürzung von Grundstückserträgen876
VIII.Zerlegung des Steuermessbetrags877
D.Zusammenfassung878 – 880
Dritter AbschnittUmsatzsteuerliche Organschaft
A.Voraussetzungen881 – 883
B.Wirkungen884
C.Vorteile885 – 887
Siebter TeilGrundzüge der internationalen Unternehmensbesteuerung
Erster AbschnittDoppelbesteuerung als Kernproblem der internationalen Unternehmensbesteuerung
A.Begriff der internationalen Doppelbesteuerung888 – 891
B.Ursachen der internationalen Doppelbesteuerung892 – 897
I.Überblick892
II.Nebeneinander von unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht als Hauptursache893
III.Weitere Ursachen für internationale Doppelbesteuerungen894 – 897
C.Anrechnungs- und Freistellungsmethode als Grundformen zur Vermeidung der internationalen Doppelbesteuerung898 – 918
I.Im Ausland werden positive Einkünfte erwirtschaftet (Gewinnfall)899 – 910
1.Konzeption der Anrechnungs- und Freistellungsmethode899 – 902
a)Anrechnungsmethode900
b)Freistellungsmethode901
c)Vergleich der beiden Methoden902
2.Belastungswirkungen903 – 906
3.Vergleich der beiden Methoden907 – 910
II.Im Ausland entstehen negative Einkünfte (Verlustfall)911 – 918
1.Im Ausland keine Verlustverrechnung911 – 914
2.Im Ausland Verlustverrechnung möglich915 – 917
a)Im Ausland Verlustrücktrag916
b)Im Ausland Verlustvortrag917
3.Auswertung918
D.Bedeutung von Doppelbesteuerungsabkommen919 – 935
I.Funktion von Doppelbesteuerungsabkommen919 – 922
II.Aufteilung der Besteuerungsrechte in Doppelbesteuerungsabkommen923 – 935
1.Nebeneinander von unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht924 – 931
2.Zweimalige unbeschränkte Steuerpflicht932 – 935
Zweiter AbschnittBesteuerung von deutschen Unternehmen mit internationaler Geschäftstätigkeit
A.Alternativen936
B.Export von Waren937
C.Errichtung einer Betriebsstätte (Niederlassung)938
D.Gründung einer Tochterkapitalgesellschaft939 – 944
I.Finanzierung mit Eigenkapital (Kapitalerhöhung)939 – 942
II.Finanzierung mit Fremdkapital (Gesellschafterdarlehen)943, 944
E.Auswertung945, 946
Dritter AbschnittGrundzüge der zwischenstaatlichen Erfolgszuordnung: Verrechnungspreise
A.Zielsetzung der zwischenstaatlichen Erfolgszuordnung: Zuordnungskonzept947 – 950
B.Auswirkungen von Verrechnungspreisen für die Unternehmen und die beteiligten Staaten951 – 957
I.Positiver oder negativer Steuersatzeffekt951 – 954
II.Negativer Zeiteffekt955 – 957
C.Merkmale des Fremdvergleichs958 – 961
D.Verrechnungspreismethoden962 – 970
I.Standardmethoden962 – 965
1.Preisvergleichsmethode963
2.Wiederverkaufspreismethode964
3.Kostenaufschlagsmethode965
II.Gewinnorientierte Verrechnungspreise966, 967
1.Funktionsorientierte Gewinnzerlegung966
2.Nettomargenmethode967
III.Kostenverteilung (Kostenumlageverträge)968 – 970
Sachverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
aA
anderer Ansicht
Abb.
Abbildung
AbgG
Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz)
AbgSt
Abgeltungsteuer (gesonderter Steuersatz nach § 32d EStG)
Abl.
EU Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.
Absatz
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
aF
alte Fassung
AfA
Absetzungen für Abnutzung
AfaA
Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung
AG
Aktiengesellschaft
AktG
Aktiengesetz
AltZertG
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz
aM
anderer Meinung
AO
Abgabenordnung
AOA
Authorized OECD Approach
ARGE
Arbeitsgemeinschaft
Art.
Artikel
AStG
Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz)
ATAD
Anti Tax Avoidance Directive (Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken)
ATLAS
Automatisiertes Tarif- und Lokales Zollabwicklungssystem
Aufl.
Auflage
BB
Betriebs-Berater (Zeitschrift)
BDI
Bundesverband der Deutschen Industrie eV
BEPS
Base Erosion and Profit Shifting
BetrKV
Betriebskostenverordnung
BewÄndG
Gesetz über die Anwendung und Änderung bewertungsrechtlicher Vorschriften
BewG
Bewertungsgesetz
BewRGr
Richtlinien für die Bewertung des Grundvermögens
BFH
Bundesfinanzhof
BFH/NV
Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (Zeitschrift)
BFHE
Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (vom Bundesfinanzhof herausgegeben)
BFuP
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (Zeitschrift)
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BMF
Bundesministerium der Finanzen
BR-Drucks
Bundesrat-Drucksache
BsGaV
Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung
BStBl.
Bundessteuerblatt
BT-Drucks
Bundestag-Drucksache
Buchst.
Buchstabe
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (vom Bundesverfassungsgericht herausgegeben)
BZSt
Bundeszentralamt für Steuern
bzw
beziehungsweise
ca.
circa
CCA
cost contribution arrangement
CDFI
Cahiers de droit fiscal international
CPLM
cost plus method
CUPM
comparable uncontrolled price method
DB
Der Betrieb (Zeitschrift)
DBA
Doppelbesteuerungsabkommen
DBW
Die Betriebswirtschaft (Zeitschrift)
dh
das heißt
DRS
Deutsche Rechnungslegungs Standards
DStR
Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
DStRE
Deutsches Steuerrecht-Entscheidungsdienst (Zeitschrift)
DStZ
Deutsche Steuer-Zeitung (Zeitschrift)
D-VG
Deutsche Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteuerungsabkommen im Bereich der Steuern vom Einkommen und Vermögen
DWS
Deutsches Wissenschaftliches Institut der Steuerberater eV
E
Ausland
ausländische Einkünfte
EBITDA
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
ECLI
European Case Law Identifier
EFG
Entscheidungen der Finanzgerichte (Zeitschrift)
EF-VO
Verordnung über die Einfuhrabgabenfreiheit von Waren im persönlichen Gepäck von Reisenden (Einreise-Freimengen-Verordnung)
EG
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft idF des Unionsvertrags
E
Inland
inländische Einkünfte
ErbStG
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz
ErbStR
Erbschaftsteuer-Richtlinien
ESt
Einkommensteuer
EStDV
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
ESt
ermäßigt
ermäßigte Einkommensteuer
EStG
Einkommensteuergesetz
EStH
Einkommensteuer-Hinweise
ESt
max
maximal möglicher Einkommensteuersatz
EStR
Einkommensteuer-Richtlinien
EU
Europäische Union
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EÜR
Einnahmen-Überschussrechnung
EUStBV
Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung
EU-UStB
EU-Umsatz-Steuerberater (Zeitschrift)
EUV
Vertrag über die Europäische Union in der Fassung von Lissabon
eV
eingetragener Verein
EWIV
Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung
EWR
Europäischer Wirtschaftsraum
FA
Finanzamt
FAG
Finanzausgleichsgesetz
FB
Finanz-Betrieb (Zeitschrift)
FG
Finanzgericht
FGO
Finanzgerichtsordnung
FMStFG
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz
FR
Finanz-Rundschau (Zeitschrift)
FVG
Gesetz über die Finanzverwaltung
FZulG
Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz)
GATT
General Agreement on Tarifs and Trade (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen)
GdbR
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
GewO
Gewerbeordnung
GewSt
Gewerbesteuer
GewStDV
Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
GewStG
Gewerbesteuergesetz
GewStH
Gewerbesteuer-Hinweise
GewStR
Gewerbesteuer-Richtlinien
GG
Grundgesetz
ggf
gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GmbHR
GmbH-Rundschau (Zeitschrift)
GrEStG
Grunderwerbsteuergesetz
GrStG
Grundsteuergesetz
HFR
Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung (Zeitschrift)
HGB
Handelsgesetzbuch
HK
Herstellungskosten
Hrsg.
Herausgeber
HS
Halbsatz
idF
in der Fassung
idR
in der Regel
ieS
im engeren Sinne
IFRS
International Financial Reporting Standards
ifst
Institut Finanzen und Steuern eV
InvStG
Investmentsteuergesetz
InvZulG
Investitionszulagengesetz
iSd
im Sinne des
IStR
Internationales Steuerrecht (Zeitschrift)
iVm
in Verbindung mit
iwS
im weiteren Sinne
kg
Kilogramm
KG
Kommanditgesellschaft
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KiSt
Kirchensteuer
km
Kilometer
KraftStG
Kraftfahrzeugsteuergesetz
KSt
Körperschaftsteuer
KSt
Ausland
ausländische Körperschaftsteuer
KStG
Körperschaftsteuergesetz
KStH
Körperschaftsteuer-Hinweise
KSt
Inland
inländische Körperschaftsteuer
KStR
Körperschaftsteuer-Richtlinien
KWG
Gesetz über das Kreditwesen
LfSt
Landesamt für Steuern
LKW
Lastkraftwagen
LPartG
Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft
LStDV
Lohnsteuer-Durchführungsverordnung
LStH
Lohnsteuer-Hinweise
LStR
Lohnsteuer-Richtlinien
m.a.W.
mit anderen Worten
min
Minimum
Mio.
Million(en)
Mrd.
Milliarde(n)
mwN
mit weiteren Nachweisen
nBA
nichtabziehbare Betriebsausgabe
Nr
Nummer
NWB
Neue Wirtschafts-Briefe (Zeitschrift)
OECD-MA
Muster der Organization for Economic Cooperation and Development für ein Abkommen zur Vermeidung von internationalen Doppelbesteuerungen
OECD-MC
Commentaries on the Articles of the OECD Model Tax Convention
OFD
Oberfinanzdirektion
OG
Organgesellschaft
OHG
Offene Handelsgesellschaft
OT
Organträger
PKW
Personenkraftwagen
REITG
Gesetz über deutsche Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen
RFH
Reichsfinanzhof
RLEWG
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuer
6. RLEWG
Sechste Richtlinie 77/388/EWG zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern (Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage)
Rn.
Randnummer
RPM
resale price method
RStBl.
Reichssteuerblatt
Rz.
Randziffer
S.
Satz, Seite
s
AbgSt
Abgeltungsteuersatz (gesonderter Steuersatz nach § 32d EStG)
s
Ausland
ausländischer Steuersatz
SE
Europäische Gesellschaft (eine spezielle Form einer Aktiengesellschaft)
s
ErbSt
Steuersatz der Erbschaft- und Schenkungsteuer
s
ESt
Einkommensteuersatz
SEStEG
Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften
SGB
Sozialgesetzbuch
s
Inland
inländischer Steuersatz
s
KSt
Körperschaftsteuersatz
SolZ
Solidaritätszuschlag
SolZG
Solidaritätszuschlaggesetz
Stbg
Die Steuerberatung (Zeitschrift)
StBp
Die steuerliche Betriebsprüfung (Zeitschrift)
SteuerStud
Steuer und Studium (Zeitschrift)
Stmz
Steuermesszahl
stpfl.
steuerpflichtig
StuB
NWB Unternehmensteuern und Bilanzen/Zeitschrift für das Steuerrecht und die Rechnungslegung der Unternehmen/Steuern und Bilanzen (Zeitschrift)
StuW
Steuer und Wirtschaft (Zeitschrift)
SvEV
Sozialversicherungsentgeltverordnung
SWI
Steuer und Wirtschaft International (Zeitschrift)
TNMM
transactional net margin method
TPSM
transactional profit split method
Tz.
Textziffer
ua
unter anderem, und andere
Ubg
Die Unternehmensbesteuerung (Zeitschrift)
UG
Unternehmergesellschaft
UM
Unternehmensbewertung & Management (Zeitschrift)
UmwG
Umwandlungsgesetz
UmwStG
Umwandlungssteuergesetz
UR
Umsatzsteuer-Rundschau (Zeitschrift)
US-GAAP
United States Generally Accepted Accounting Principles
UStAE
Umsatzsteuer-Anwendungserlass (Verwaltungsregelung zur Anwendung des Umsatzsteuergesetzes)
UStDV
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
UStG
Umsatzsteuergesetz
usw
und so weiter
uU
unter Umständen
UVR
Umsatzsteuer- und Verkehrsteuer-Recht (Zeitschrift)
VBL
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VCI
Verband der Chemischen Industrie
VE
Veräußerungserlös
5. VermBG
Fünftes Vermögensbildungsgesetz
VersStG
Versicherungsteuergesetz
Vfg
Verfügung
vgl
vergleiche
VorSt
Vorsteuer
VP
Verrechnungspreis
VVaG
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
VWG BsGa
Verwaltungsgrundsätze Betriebsstättengewinnaufteilung
W
Wertsteigerungen
WEG
Wohnungseigentumsgesetz
WiSt
Wirtschaftswissenschaftliches Studium (Zeitschrift)
WPg
Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift)
WRV
Weimarer Reichsverfassung
zB
zum Beispiel
ZEV
Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (Zeitschrift)
ZfB
Zeitschrift für Betriebswirtschaft (Zeitschrift)
ZfbF
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (Zeitschrift)
zvE
zu versteuerndes Einkommen
Schrifttum (Auswahl)
A.Kommentare
Blümich EStG, KStG, GewStG, Kommentar, München (Loseblattausgabe)
Boruttau Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 21. Aufl., München 2024
Dötsch/Pung/Möhlenbrock Die Körperschaftsteuer, Kommentar, Stuttgart (Loseblattausgabe)
Frotscher/Maas Körperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Umwandlungssteuergesetz, Kommentar, Freiburg (Loseblattausgabe)
Glanegger/Güroff Gewerbesteuergesetz, Kommentar, 11. Aufl., München 2023
Gosch/Kroppen/Grotherr/Kraft DBA-Kommentar, Herne (Loseblattausgabe)
Gürsching/Stenger Bewertungsrecht, Kommentar, Köln (Loseblattausgabe)
Herrmann/Heuer/Raupach Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetz, Kommentar, Köln (Loseblattausgabe)
Kapp/Ebeling Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Kommentar, Köln (Loseblattausgabe)
Kirchhof/Seer Einkommensteuergesetz, Kommentar, 23. Aufl., Köln 2024
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff Einkommensteuergesetz, Kommentar, Heidelberg (Loseblattausgabe)
Kroppen/Rasch Handbuch Internationale Verrechnungspreise, Köln (Loseblattausgabe)
Lademann Kommentar zum Einkommensteuergesetz, Stuttgart/München/Hannover (Loseblattausgabe)
Lenski/Steinberg Kommentar zum Gewerbesteuergesetz, Köln (Loseblattausgabe)
Littmann/Bitz/Pust Das Einkommensteuerrecht, Kommentar, Stuttgart (Loseblattausgabe)
Meincke/Hannes/Holtz Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Kommentar, 18. Aufl., München 2021
Rau/Dürrwächter Kommentar zum Umsatzsteuergesetz, Köln (Loseblattausgabe)
Reimer/Rust Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Kommentar, 4. Aufl., Alphen aan den Rijn 2015
Rössler/Troll Bewertungsgesetz, Kommentar, München (Loseblattausgabe)
Schmidt Einkommensteuergesetz, Kommentar, 43. Aufl., München 2024
Sölch/Ringleb Umsatzsteuergesetz, Kommentar, München (Loseblattausgabe)
Streck Körperschaftsteuergesetz, Kommentar, 10. Aufl., München 2022
Tipke/Kruse Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Kommentar, Köln (Loseblattausgabe)
Troll/Gebel/Jülicher/Gottschalk Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Kommentar, München (Loseblattausgabe)
Vogel/Lehner Doppelbesteuerungsabkommen: DBA, Kommentar, 7. Aufl., München 2021
Vögele/Borstell/Engler Verrechnungspreise, 6. Aufl., München 2024
Wassermeyer Doppelbesteuerung: DBA, Kommentar, München (Loseblattausgabe)
B.Lehrbücher
Beck/Daumke/Perbey/Radeisen Grundriss des deutschen Steuerrechts, 9. Aufl., Berlin 2024
Birk/Desens/Tappe Steuerrecht, 26. Aufl., Heidelberg 2023
Brähler Internationales Steuerrecht, 8. Aufl., Wiesbaden 2014
Breithecker Einführung in die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 17. Aufl., Berlin 2016
Brüggemann/Stirnberg Erbschaftsteuer, Schenkungsteuer, 10. Aufl., Achim 2018
Bruschke Grunderwerbsteuer, Kraftfahrzeugsteuer und andere Verkehrsteuern, 7. Aufl., Achim 2016
Djanani/Brähler/Lösel Ertragsteuern, 5. Aufl., Stuttgart 2012
Endres/Spengel International Company Taxation and Tax Planning, Alphen aan den Rijn 2015
Fetzer Einführung in das Steuerrecht, 5. Aufl., Heidelberg 2019
Fischer/Kleineidam/Warneke Internationale betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 5. Aufl., Berlin 2005
Frotscher Internationales Steuerrecht, 5. Aufl. München 2020
Grefe Unternehmenssteuern, 22. Aufl., Herne 2019
Haase Internationales und Europäisches Steuerrecht, 7. Aufl., Heidelberg 2023
Haase, Außensteuergesetz/Doppelbesteuerungsabkommen, 4. Auflage, Heidelberg 2024
Haase/Nürnberg Besteuerung von Unternehmen, Band II: Steuerbilanz, 10. Aufl., Heidelberg 2025
Haase/Nürnberg/Bartsch Besteuerung von Unternehmen, Band III: Steuerplanung, 4. Aufl., Heidelberg 2025
Hidien/Pohl/Schnitter Gewerbesteuer, 16. Aufl., Achim 2020
Homburg Allgemeine Steuerlehre, 7. Aufl., München 2015
Jacobs Internationale Unternehmensbesteuerung, 9. Aufl., München 2023
Jacobs/Scheffler/Spengel Unternehmensbesteuerung und Rechtsform, 5. Aufl., München 2015
Jäger/Lang/Künze Körperschaftsteuer, 20. Aufl., Achim 2022
Knobbe-Keuk Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl., Köln 1993
Kosmalla/Dürr Lohnsteuer, 16. Aufl., Achim 2017
Kraft/Kraft Grundlagen der Unternehmensbesteuerung, 5. Aufl., Wiesbaden 2017
Kußmaul Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 8. Aufl., München 2020
Kußmaul Steuern, 5. Aufl., Berlin/München/Boston 2023
Lippross Umsatzsteuer, 25. Aufl., Achim 2022
Marx/Kläne/Korff/Schlarmann Unternehmensbesteuerung, 3. Aufl., Herne 2018
Mössner/Lampert Steuerrecht international tätiger Unternehmen, 6. Aufl., Köln 2023
Niemeier/Schnitter/Kober/Nöcker/Stuparu Einkommensteuer, 24. Aufl., Achim 2018
Rose Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 3. Aufl., Wiesbaden 1992
Rose/Watrin Erbschaftsteuer mit Schenkungsteuer und Bewertungsrecht, 13. Aufl., Berlin 2020
Rose/Watrin Ertragsteuern, 21. Aufl., Berlin 2017
Rose/Watrin Internationales Steuerrecht, 7. Aufl., Berlin 2016
Rose/Watrin Umsatzsteuer mit Grunderwerbsteuer und kleineren Verkehrsteuern, 18. Aufl., Berlin 2013
Schaumburg Internationales Steuerrecht, 5. Aufl., Köln 2023
Scheffler Internationale betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 3. Aufl., München 2009
Schneeloch/Meyering/Patek Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Band 1, Grundlagen der Besteuerung, Ertragsteuern, 7. Aufl., München 2016
Schneeloch/Meyering/Patek Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Band 2, Steuerliche Gewinnermittlung, 7. Aufl., München 2017
Schneeloch/Meyering/Patek Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Band 3, Substanzsteuern, Verkehrsteuern, Besteuerungsverfahren, 7. Aufl., München 2017
Schneider Steuerlast und Steuerwirkung, München/Wien 2002
Schreiber Besteuerung der Unternehmen, 4. Aufl., Wiesbaden 2017
Stobbe Steuern kompakt, 16. Aufl., Sternenfels 2019
Tanski/Jungen Steuerrecht, 12. Aufl., Freiburg 2019
Tipke/Lang Steuerrecht, 24. Aufl., Köln 2021
Erster TeilEinführung
Vorbemerkung
1
Im ersten Abschnitt werden die Begriffe erläutert, die für das Verständnis der Ausführungen zu den zahlreichen, für Unternehmen bedeutsamen Steuerarten hilfreich sind. Der zweite Abschnitt skizziert die Merkmale des deutschen Steuersystems aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Auf diese Weise werden die Ursachen für die Komplexität der Unternehmensbesteuerung erkennbar. Der dritte Abschnitt dient dazu, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Besteuerung der unternehmerischen Geschäftstätigkeit, dh die Rechtsquellen, vorzustellen.
Erster AbschnittWichtige Begriffe
A.Steuer
2
Steuern sind definiert als Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein (§ 3 Abs. 1 AO).[1]
Charakteristische Merkmale einer Steuer sind danach:
1.
Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen des Bürgers an den Staat. Sie bewirken einen Abfluss von liquiden Mitteln. Deshalb ist es besonders misslich, wenn Steuern gezahlt werden müssen, obwohl dem Steuerpflichtigen zuvor keine liquiden Mittel zugeflossen sind (z.B. durch einen Verkauf). Keine Steuern sind Naturalleistungen (wie früher der „Zehnte“ der Bauern) oder Dienstleistungen, wie der Wehrdienst, Melde-, Anzeige- und andere Mitwirkungspflichten.
2.
Steuern sind gegenleistungslos. Derjenige, der die Steuern schuldet (Steuerschuldner, das ist im Ertragsteuerrecht meist auch der Steuerpflichtige), erwirbt mit der Abführung von Steuern kein unmittelbares Anrecht auf eine bestimmte Leistung desjenigen, der die Zahlungen vereinnahmt (Steuergläubiger, dh in der Regel der Staat).
3.
Der Steuerbegriff beinhaltet, dass die Geldleistung von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen hoheitlich auferlegt wird. Steuerrecht ist Hoheitsrecht. Zur Erhebung von Steuern sind neben dem Bund und den Ländern insbesondere Gemeinden, Gemeindeverbände und bestimmte Religionsgemeinschaften mit öffentlich-rechtlichem Status berechtigt.
4.
Steuern werden prinzipiell zur Erzielung von Staatseinnahmen erhoben (Fiskalzweck). Mit der Erhebung einer Steuer können aber auch Beeinflussungen des Verhaltens der Steuerpflichtigen (Lenkungszweck, neuerdings auch Nudging genannt) oder eine Änderung der Einkommens- und Vermögensverteilung (Umverteilungszweck) angestrebt werden. Maßnahmen der Wirtschafts- und Sozialpolitik ergänzen den Fiskalzweck.[2]
5.
Steuern dienen der allgemeinen Deckung des öffentlichen Finanzbedarfs. Es gilt prinzipiell ein Verbot der Zweckbindung einzelner Steuern an bestimmte Staatsausgaben (Grundsatz der Non-Affektation). Ob dies für Zuschlagsteuern wie den Solidaritätszuschlag auch gilt, wird demnächst das BVerfG zu entscheiden haben.
6.
Zur Zahlung von Steuern sind nur die Personen oder Institutionen verpflichtet, die mit ihrer Existenz, mit einer Handlung oder mit dem Vorhandensein einer Steuerbemessungsgrundlage einen gesetzlich normierten Tatbestand erfüllen. Der Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit und Tatbestandsbestimmtheit (§ 38 AO) verbietet es, Steueransprüche durch Analogieschluss oder im Nachhinein zu begründen oder durch private Vereinbarung zwischen dem Steuerpflichtigen und den Finanzbehörden zu modifizieren: „nullum tributum sine lege praevia at certa“
3
Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Art. 5 Nr. 20, 21 des Zollkodex der Europäischen Union (Unionszollkodex) sind gleichfalls als Steuern anzusehen (§ 3 Abs. 3 AO). Zölle und andere tarifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse dienen der Warenstromregulierung. Im Vordergrund steht der wirtschaftspolitische Lenkungszweck. Die Erzielung von Einnahmen ist lediglich Nebenzweck. Zölle sind Abgaben, die der Staat nach den Vorgaben des Unionszollkodex bei Warenbewegungen über die Staatsgrenze (Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr) erhebt. Bei Warenbewegungen zwischen den Mitgliedstaaten der EU sind Zölle allerdings bereits seit langem abgeschafft worden (sog. Zollunion).
Abb. 1.1:Öffentlich-rechtliche Lasten
[Bild vergrößern]
4
Zwangsgelder, Säumniszuschläge (für die verspätete Zahlung von Steuern), Verspätungszuschläge (für die verspätete Abgabe einer Steuererklärung), Verzögerungsgelder, Verspätungsgelder, die Zuschläge nach § 162 Abs. 4 AO (bei Verletzung von Mitwirkungspflichten, die speziell für international tätige Unternehmen mit Auslandsbeziehungen bestehen), Zinsen und Kosten sind keine Steuern. Sie werden aber zum Teil als steuerliche Nebenleistungen verfahrenstechnisch wie Steuern behandelt (§ 3 Abs. 4 iVm § 37 Abs. 1 AO).
5
Steuern sind nur eine – wenngleich mit Abstand die wichtigste – Form von öffentlichen Abgaben, mit denen die öffentliche Hand aufgrund ihres Hoheitsrechts Einnahmen für den Unterhalt der staatlichen Infrastruktur erzielt. Weitere Finanzabgaben an öffentlich-rechtliche Institutionen sind Gebühren (konkretes Entgeld für eine staatliche Leistung, z.B. die Ausgabe eines Personalausweises, dazu sogleich), Beiträge (zB IHK-Beitrag, Beitrag zur Handwerkskammer oder Apothekerkammer) und Sonderabgaben.
6
Gebühren und Beiträge unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Gegenleistung. Gebühren sind Zahlungen für besondere Leistungen einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder für die (freiwillige oder erzwungene) tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen. Sie unterteilen sich in Verwaltungsgebühren (zB Ausstellung eines Ausweises oder Passes, Beurkundungen, Erteilung von Bescheinigungen, Genehmigungen, Bauabnahmen oder Einbürgerungen, Pfändungsgebühren, Kosten für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft nach § 89 AO, Kosten bei besonderer Inanspruchnahme der Zollbehörden nach § 178 AO, Kosten für die Durchführung eines Vorabverständigungsverfahrens mit einer ausländischen Finanzbehörde nach § 89a AO) und Nutzungsgebühren (zB Benutzung von Sportanlagen, Krankenhäusern, Friedhöfen, Büchereien, Schlachthöfen, Nutzung von Verkehrseinrichtungen, wie Häfen, Flughäfen oder öffentlichen Parkplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen Versorgungseinrichtungen für Wasser, Strom oder Gas oder für die Entsorgung, wie Abwasser- und Kanalgebühren).
7
Beiträge stellen einen staatlichen Aufwandsersatz für die mögliche Inanspruchnahme einer konkreten Leistung einer öffentlichen Einrichtung dar. Auf den konkreten Vorteil für den betreffenden Beitragszahler kommt es im Gegensatz zu Gebühren nicht an. Für die Erhebung eines Beitrags reicht die bloße Möglichkeit der Inanspruchnahme der Leistung aus. Beispiele für Beiträge sind Straßenanliegerbeiträge und Kurtaxen. Besondere Gruppen bilden die Verbandslasten zur Finanzierung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft durch ihre Mitglieder (Beiträge an die Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer oder Steuerberaterkammer und alle anderen Kammern der sog. freien Berufe) sowie die Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen (Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung). In einer weiten Abgrenzung des Steuerbegriffs können die „Beiträge“ zu den gesetzlichen Sozialversicherungen auch unter den Begriff der Steuern subsumiert werden. Jedenfalls sind sie in gewissem Umfang auch steuerlich abzugsfähig.
8
Sonderabgabe (außersteuerliche Abgabe) ist ein Oberbegriff für ein breites Spektrum öffentlicher Abgaben sui generis (eigener Art).[3] Die mit diesen parafiskalischen Abgaben verbundenen Zielsetzungen sind so unterschiedlich, dass sich keine allgemeine Definition formulieren lässt. Von Steuern unterscheiden sich Sonderabgaben dadurch,
-
dass ihr Aufkommen nicht in den allgemeinen Staatshaushalt eingeht, sondern in einen Sonderfonds, aus dem die vorgegebenen Ziele finanziert werden, und
-
dass sie nur von einer bestimmten Gruppe von Bürgern erhoben werden.
Sonderabgaben sind umstritten, weil die Gefahr besteht, dass durch die Anerkennung einer Abgabenkompetenz außerhalb der Finanzverfassung des Grundgesetzes die Abgabenbelastung unüberschaubar wird. Des Weiteren durchbricht die Parafiskalität der Sonderabgaben den Verfassungsgrundsatz der Vollständigkeit des Haushaltsplans und entzieht die Verwendung des Abgabenaufkommens der parlamentarischen Kontrolle. Die Gefahren sind insoweit vergleichbar mit denen von Sondervermögen, die in jüngerer Zeit in den Fokus des BVerfG gerückt sind: Das BVerfG hat am 15. November 2023 geurteilt, dass das Gesetz über den Zweiten Nachtragshaushalt 2021 verfassungswidrig war.[4] Damit hat sich Karlsruhe erstmals umfassend zu den Ausnahmen von der Schuldenbremse und zum Umgang mit Sondervermögen geäußert. Das Urteil betrifft unmittelbar den Klima- und Transformationsfonds. Bei Übertragung der festgelegten Grundsätze auf die übrigen Sondervermögen sind mittelbar auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds Energie und der Fonds Aufbauhilfe 2021 zur Bewältigung der Folgen der Hochwasserkatastrophe von 2021 betroffen.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts[5] sind Sonderabgaben deshalb nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen zulässig: Sonderabgaben dürfen nur dann erhoben werden, wenn der verfolgte Zweck in einer besonderen Verantwortung der belasteten Gruppe liegt (Sachverantwortung) und nicht in die Gesamtverantwortung des Staates fällt. Sie müssen die Kriterien Homogenität der Abgabepflichtigen (gemeinsame Interessenlage, von anderen Gruppen abgrenzbar), Gruppenverantwortung sowie Gruppennützigkeit (das Aufkommen ist im Interesse der Abgabenpflichtigen zu verwenden) erfüllen. Beispiele für Sonderabgaben, bei denen eher der Finanzierungszweck im Vordergrund steht, sind Beiträge für den Restrukturierungsfonds (Finanzierung künftiger Restrukturierungs- und Abwicklungsmaßnahmen bei systemrelevanten Banken), die Filmabgabe, die Hebammenabgabe, die Abgabe in Weinbaufonds, die Milchausgleichsabgabe und die Naturschutzabgabe. Eine Sonderabgabe mit Lenkungsaufgabe ist beispielsweise die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz.
Die Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Sonderabgaben folgt dem Äquivalenzprinzip. Danach steht die spezielle Entgeltlichkeit der Abgabe im Vordergrund, dh der Grundsatz von Leistung und Gegenleistung. Die Erhebung von Steuern folgt hingegen dem Leistungsfähigkeitsprinzip, dh die Belastung richtet sich nach der Fähigkeit des Steuerpflichtigen, zur Finanzierung der staatlichen Ausgaben beizutragen.
B.Steuerarten
9
Das Steuersystem umfasst die Gesamtheit der in einem Staat erhobenen Einzelsteuern. Das Steuersystem der Bundesrepublik setzt sich aus ca. 40 Steuerarten zusammen.[6] Ihr Aufkommen betrug im Jahr 2023 rund 915,8 Mrd. €. Vom Gesamtsteueraufkommen entfallen auf die fünf bedeutsamsten Einzelsteuern etwa 85%: Einkommensteuer (352 Mrd. €), Umsatzsteuer (293 Mrd. €), Gewerbesteuer (72 Mrd. €), Energiesteuer (36 Mrd. €) und Körperschaftsteuer (43 Mrd. €). Nur weitere fünfzehn Steuerarten haben ein Aufkommen von mehr als 0,5 Mrd. €. Die anderen Einzelsteuern, insbesondere örtliche Verbrauch- und Verkehrsteuern, werden wegen ihrer geringen fiskalischen Bedeutung auch als Bagatellsteuern bezeichnet. Hier stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Kosten und Nutzen in besonderer Weise, wenn Steuerarten, deren Erhebung hohe Verwaltungskosten produzieren, keinen angemessenen Ertrag erwirtschaften.
Die folgende Übersicht zeigt das Steueraufkommen der 20 wichtigsten Steuerarten im Jahr 2023:[7]
Abb. 1.2:Steueraufkommen der 20 wichtigsten Steuerarten im Jahr 2023Steuerart
in Mrd. €
in% des Steueraufkommens
Steuerart
in Mrd. €
in% des Steueraufkommens
Einkommensteuer
352
39
Stromsteuer
6,9
0,9
Umsatzsteuer
293
32
Erbschaft- und
6,1
0,8
Gewerbesteuer
72
8
Schenkungsteuer
Energiesteuer
36
4
Zölle
5,1
0,7
Körperschaftsteuer
43
5
Alkoholsteuer
2,1
0,3
Solidaritätszuschlag
12
1
Rennwett- und
1,8
0,2
Tabaksteuer
15
2
Lotteriesteuer
Grundsteuer
15
2
Kaffeesteuer
1,1
0,1
Versicherungsteuer
16
2
Luftverkehrsteuer
1,1
0,1
Grunderwerbsteuer
12
1
Biersteuer
0,7
0,1
Kraftfahrzeugsteuer
10
1
Feuerschutzsteuer
0,5
0,1
In der Literatur finden sich zahlreiche Gliederungen und Systematisierungen der Steuerarten, von denen zwei von besonderer Bedeutung sind:
1.
Aus juristischer Sicht wird zwischen Personen-, Objekt-, Verkehr- und Verbrauchsteuern unterschieden.
2.
Bezogen auf die Besteuerungsbasis ist eine Einteilung in Steuern auf das am Markt erzielte Einkommen, Besteuerung von Vermögensmehrungen, die unentgeltlich erworben wurden (Erbfall, Schenkungen), Besteuerung des Vermögensbestands (Substanzsteuern) sowie Steuern auf die Einkommensverwendung vorzunehmen.
10
Zu 1. Einteilung nach rechtlichen Kriterien: Gemeinsames Merkmal von Personensteuern (auch gebräuchlich: Personalsteuern) ist, dass sich die Steuerpflicht auf eine natürliche oder eine juristische Person bezieht. Personensteuern werden deshalb auch als Subjektsteuern bezeichnet. Bei der Ermittlung der Steuerschuld werden die persönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen (zB Familienstand, Zahl der Kinder, Alter, Krankheit, außergewöhnliche persönliche Ausgaben) berücksichtigt. Personensteuern sollen die Leistungsfähigkeit des steuerpflichtigen Subjekts erfassen (Leistungsfähigkeitsprinzip). Zu dieser Gruppe gehören die Einkommen-, Körperschaft-, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie die Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag.
Objekt- oder Realsteuern knüpfen an ein bestimmtes Objekt an. Die persönlichen Verhältnisse des Inhabers oder Eigentümers sollen die Höhe der Steuerzahlung nicht beeinflussen. Objektsteuern sind die Gewerbesteuer und die Grundsteuer (§ 3 Abs. 2 AO), bei denen der Gewerbebetrieb bzw der Grundbesitz als Steuergegenstand gilt.
Verkehrsteuern stellen auf Vorgänge des wirtschaftlichen Verkehrs von Gütern und Leistungen ab. Sie belasten Akte oder Vorgänge des Rechtsverkehrs, die Vornahme von Rechtsgeschäften oder wirtschaftliche Vorgänge. Die persönlichen Verhältnisse der Beteiligten wirken sich auf die Höhe der zu zahlenden Verkehrsteuer im Regelfall nicht aus. Zu den Verkehrsteuern gehören die Grunderwerb-, Versicherung-, Feuerschutz-, Rennwett- und Lotteriesteuer sowie die Kraftfahrzeugsteuer.
Verbrauchsteuern belasten den Verbrauch von bestimmten Wirtschaftsgütern (zB Mineralöl, Erdgas, Flüssiggas und Kohle, Strom sowie Alkohol und alkoholhaltige Waren, Bier, Alkopop, Kaffee, Schaumwein, Tabakwaren), ohne auf die persönlichen Verhältnisse des Verbrauchers Rücksicht zu nehmen. Erhoben werden die Verbrauchsteuern nicht direkt beim Verbraucher, sondern indirekt beim Hersteller oder Importeur. Die Auswahl der besteuerten Güter beruht nicht auf einem einheitlichen Konzept, sondern folgt dem Fiskalzweck. Aufgrund der mehr oder weniger willkürlichen Abgrenzung der Steuergegenstände lassen sich Verbrauchsteuern weder mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip noch mit dem Äquivalenzprinzip (Steuern als Gegenleistung für eine bestimmte vom Staat erbrachte Leistung) begründen.
Die Umsatzsteuer kann nicht eindeutig zugeordnet werden. Die Umsatzsteuer ist rechtlich als Verkehrsteuer ausgestaltet. Bezogen auf ihre wirtschaftliche Wirkung ist sie jedoch als Verbrauchsteuer anzusehen.
11
Zu 2. Systematisierung nach der Besteuerungsbasis: Werden die Steuerarten nach der Besteuerungsbasis klassifiziert, sind vier Gruppen zu unterscheiden:
a)
Besteuerung der Einkommenserzielung, dh von Vermögensmehrungen, die am Markt erwirtschaftet wurden, m.a.W. von Vermögensmehrungen, die auf einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen (Ertragsteuern)
-
Einkommensteuer
-
Körperschaftsteuer
-
Gewerbesteuer
-
Zuschlagsteuern zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer (Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag)
b)
Besteuerung von Vermögensmehrungen, die unentgeltlich erworben wurden (Besteuerung des Vermögenstransfers, bei dem kein Leistungsaustausch stattfindet)
-
Erbschaft- und Schenkungsteuer
c)
Besteuerung des Vermögensbestands, der für Konsumausgaben verwendet werden könnte, dh Besteuerung des Besitzes von Wirtschaftsgütern (Substanzsteuern)
-
Grundsteuer
-
Vermögensteuer (Hinweis: Die Vermögensteuer wird seit dem Jahr 1997 nicht mehr erhoben[8].)
d)
Besteuerung der Verwendung von Einkommen und Vermögen, dh der tatsächlichen Verwirklichung von Konsumausgaben (Verkehr- und Verbrauchsteuern)
-
Umsatzsteuer (als allgemeine Verkehrsteuer [rechtliche Sichtweise] bzw allgemeine Verbrauchsteuer [wirtschaftliche Wirkung])
-
spezielle Verkehrsteuern (zB Grunderwerb-, Versicherung-, Feuerschutz-, Rennwett- und Lotteriesteuer sowie Kraftfahrzeugsteuer)
-
spezielle Verbrauchsteuern (zB Energie-, Strom-, Tabak- und Alkohol-, Bier- und Alkopopsteuer).
Die Gliederung dieses Buches orientiert sich an der Einteilung der Steuerarten nach der Besteuerungsbasis. Auf die Charakterisierung der Steuern nach juristischen Gesichtspunkten wird bei den Erläuterungen zu der jeweiligen Steuerart eingegangen.
C.Steuergesetzgebungshoheit
12
Ein Gesetz kann nur erlassen werden, wenn das Grundgesetz einem Gesetzgebungsorgan die Kompetenz zur Gesetzgebung übertragen hat. Die Gesetzgebungshoheit für Steuern ergibt sich in erster Linie aus Art. 105 GG.[9]
Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebungshoheit über die Zölle und Finanzmonopole (Art. 105 Abs. 1 GG). Für alle übrigen Steuerarten hat der Bund die konkurrierende Gesetzgebungshoheit für Steuergesetz im formellen Sinne, sofern folgende Voraussetzungen vorliegen:
-
Das Aufkommen steht dem Bund ganz oder zum Teil zu (Art. 105 Abs. 2 GG).
-
Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Herstellung gleicher Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich (Art. 105 Abs. 2 iVm Art. 72 Abs. 2 GG).
-
Es handelt sich weder um eine örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer noch um den Steuersatz der Grunderwerbsteuer (Art. 105 Abs. 2a GG).
-
Es handelt sich nicht um die Kirchensteuer (Art. 140 GG iVm Art. 137 Abs. 6 WRV).
Die Länder können Gesetze verabschieden, solange und soweit der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungshoheit nicht Gebrauch gemacht hat (Art. 105 Abs. 2 GG). Darüber hinaus haben die Länder die ausschließliche Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, sofern diese nicht mit bundeseinheitlich geregelten Steuerarten gleichartig sind, sowie zur Bestimmung des Steuersatzes der Grunderwerbsteuer (Art. 105 Abs. 2a GG).
Eine Besonderheit gilt bei der Grundsteuer. Der Bund hat zwar für diese Steuerart die konkurrierende Gesetzgebung (Art. 105 Abs. 2 S. 1 GG). Allerdings können die Länder ab dem Jahr 2025 von der bundesgesetzlichen Regelung abweichende länderspezifische Regelungen einführen (Abweichungsgesetzgebung, Öffnungsklausel, Art. 72 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 GG). Dies ist inzwischen in vielfältiger Weise und mit ganz unterschiedlichen Modellen geschehen.
Gemeinden haben kein eigenes Recht zur Steuergesetzgebung. Sie dürfen lediglich die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer festsetzen (Art. 106 Abs. 6 S. 2 GG).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gesetzgebungshoheit im Steuerrecht im Wesentlichen beim Bund liegt. Bundesgesetze über Steuern, deren Aufkommen ganz oder teilweise den Ländern oder den Gemeinden zufließen, dürfen allerdings nur mit Zustimmung des Bundesrats erlassen werden (Art. 105 Abs. 3 GG).
D.Steuerertragshoheit
13
Die Steuerertragshoheit beinhaltet das Recht einer staatlichen Gebietskörperschaft, das Aufkommen einer Steuerart ganz oder teilweise zu vereinnahmen. Die Steuerertragshoheit ist in Art. 106 GG geregelt. Die Norm ist eine zentrale Vorschrift des sog. Finanzverfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland.
Dem Bund stehen folgende Abgaben zu (Art. 106 Abs. 1, 3, 6 GG):
-
Finanzmonopole,
-
Zölle,
-
Verbrauchsteuern, sofern sie nicht den Ländern oder den Gemeinden zustehen, also zB die Energie-, Strom-, Tabak-, Kaffee-, Alkohol-, Alkopop- und Schaumweinsteuer,
-
Kraftfahrzeugsteuer und sonstige auf motorisierte Verkehrsmittel bezogene Verkehrsteuern (zB Luftverkehrsteuer),
-
Versicherungsteuer,
-
einmalige Vermögensabgaben und zur Durchführung des Lastenausgleichs erhobene Ausgleichsabgaben,
-
Ergänzungsabgaben zur Einkommen- und Körperschaftsteuer, zB Solidaritätszuschlag,
-
Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften,
-
ein Anteil an den Gemeinschaftsteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) sowie
-
ein Anteil an der Gewerbesteuerumlage.
Für folgende Steuerarten liegt die Steuerertragshoheit bei den Ländern (Art. 106 Abs. 2, 3, 6 GG):
-
Erbschaft- und Schenkungsteuer,
-
Verkehrsteuern, sofern sie nicht dem Bund oder den Gemeinden zufließen, also zB Grunderwerb-, Feuerschutz- sowie Rennwett- und Lotteriesteuer,
-
Biersteuer,
-
Spielbankabgabe,
-
einen Anteil an den Gemeinschaftsteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) sowie
-
einen Anteil an der Gewerbesteuerumlage.
Die Gemeinden erhalten (Art. 106 Abs. 5–7 GG):
-
Grundsteuer,
-
Gewerbesteuer (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) – mit Abstand die wichtigste Einnahmequalle für die Gemeinden,
-
örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern (nach Maßgabe der Landesgesetzgebung), zB Hunde- und Vergnügungsteuer,
-
einen Anteil an der Einkommensteuer,
-
einen Anteil an der Umsatzsteuer sowie
-
einen Anteil am Länderanteil der Gemeinschaftsteuern, soweit es die Landesgesetzgebung vorsieht.
Zum Ausgleich des Steuergefälles zwischen Ländern mit einem hohen Steueraufkommen und Ländern mit einem geringen Steueraufkommen sind ein (horizontaler) Finanzausgleich zwischen den Ländern sowie Ergänzungszuweisungen des Bundes (vertikaler Finanzausgleich) vorgesehen (Art. 107 GG). Der horizontale Finanzausgleich unterteilt sich in Umsatzsteuer-Ergänzungsanteile (Beteiligung der einzelnen Länder am Länderanteil der Umsatzsteuer) sowie zusätzliche Ausgleichszahlungen zwischen den Ländern („Länderfinanzausgleich“). Die Verfassungen der Länder sehen zur Minderung der Finanzkraftunterschiede zwischen den Gemeinden einen kommunalen Finanzausgleich vor.
Die allgemeinen Regelungen des Grundgesetzes zum bundesstaatlichen Finanzausgleich werden durch das Finanzausgleichsgesetz (FAG) ergänzt. Im FAG werden neben den Grundsätzen für die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens, für den Finanzausgleich zwischen den Ländern sowie für die Gewährung von Bundesergänzungszuweisungen auch die detaillierten Verteilungs- und Ausgleichsregelungen festgelegt. Im Zerlegungsgesetz wird insbesondere die Aufteilung der Körperschaftsteuer sowie der Lohnsteuer (als eine Form zur Erhebung der Einkommensteuer) zwischen den Ländern geregelt.
E.Steuerverwaltungshoheit
14
Bei der Steuerverwaltungshoheit ist der Vollzug der Steuergesetze angesprochen. Die Steuerverwaltungshoheit liegt insbesondere beim Bund und bei den Ländern. Bundesfinanzbehörden sind insbesondere das Bundesministerium der Finanzen (BMF) als sog. oberste Bundesbehörde, das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) als sog. Bundesoberbehörde sowie die Hauptzollämter. Landesfinanzbehörden bilden die Landesfinanzministerien bzw -behörden, die Landesämter für Steuern (LfSt) bzw – soweit nicht inzwischen abgeschafft – die Oberfinanzdirektionen (OFD) und die (örtlichen) Finanzämter. In Teilbereichen übernehmen die Steuerämter der Gemeinden Aufgaben der Steuerverwaltung.
Von den Bundesfinanzbehörden werden die Zölle, Finanzmonopole, bundesgesetzlichen Verbrauchsteuern (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer und Biersteuer), die Kraftfahrzeugsteuer und die sonstigen auf motorisierte Verkehrsmittel bezogenen Verkehrsteuern sowie die Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften verwaltet (Art. 108 Abs. 1 GG).
Im Auftrag des Bundes (sog. Bundesauftragsverwaltung) verwalten Landesfinanzbehörden die Steuern, die ganz oder zum Teil dem Bund zufließen, dh die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, den Solidaritätszuschlag, die Umsatzsteuer und Versicherungsteuer (Art. 108 Abs. 3 GG). Im eigenen Auftrag verwalten die Landesfinanzbehörden die Erbschaft- und Schenkungsteuer, Grunderwerbsteuer, Feuerschutzsteuer, Rennwett- und Lotteriesteuer, Spielbankabgabe, Gewerbesteuer und Grundsteuer (Art. 108 Abs. 2 GG). Von den Steuerämtern der Gemeinden werden die Gewerbesteuer und die Grundsteuer festgesetzt und erhoben. Darüber hinaus kann den Gemeinden die Verwaltung der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern übertragen werden (Art. 108 Abs. 4 GG).
Die Aufgaben der verschiedenen Behörden sind im Gesetz über die Finanzverwaltung (FVG) im Einzelnen geregelt.
Die Abb. 1.3 gibt einen Überblick über die wichtigsten Merkmale des Finanzsystems in Deutschland.
Abb. 1.3:Grundzüge der Verteilung der SteuerkompetenzenSteuerart
Gesetzgebung
Verwaltung
Ertragshoheit
Einkommensteuer
Bund
Länder
Bund
Länder
Gemeinden
Körperschaftsteuer
Bund
Länder
Bund
Länder
Gewerbesteuer
Bund Gemeinden (Hebesatz)
Länder Gemeinden
Gemeinden (Bund, Länder)
Kirchensteuer
Länder
Länder Kirchen
Kirchen
Solidaritätszuschlag
Bund
Länder
Bund
Erbschaft- und Schenkungsteuer
Bund
Länder
Länder
Grundsteuer
Bund Länder (Öffnungsklausel für abweichendes Landesrecht) Gemeinden (Hebesatz)
Länder Gemeinden
Gemeinden
Grunderwerbsteuer
Bund Gemeinden (Steuersatz)
Länder
Länder
Energiesteuer
Bund
Bund
Bund
Stromsteuer
Bund
Bund
Bund
Umsatzsteuer
Bund
Länder
Bund Länder (Gemeinden)
F.Steuersubjekt, Steuerschuldner, Steuerzahler, Steuerträger, Steuerdestinatär, Steuergläubiger
15
Die Begriffe Steuersubjekt, Steuerschuldner, Steuerzahler, Steuerträger, Steuerdestinatär und Steuergläubiger stellen darauf ab, wer die steuerlichen Verpflichtungen erfüllen muss, wer die Steuerbelastung zu tragen hat und wem die Steuereinnahmen zufließen.
16
Steuersubjekt oder Steuerpflichtiger ist derjenige, der eine durch die Steuergesetze auferlegte Verpflichtung zu erfüllen hat (§ 33 AO). Hierzu gehören insbesondere die Verpflichtung zur Steuerzahlung (materielle Steuerpflicht) sowie Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Erklärungs- und Auskunftspflichten (verfahrensrechtliche Verpflichtungen).
17
Steuerschuldner ist ein Unterbegriff des Steuerpflichtigen. Steuerschuldner ist derjenige, der den Tatbestand verwirklicht, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (§ 43 iVm § 37, § 38 AO). Die Steuerschuldnerschaft bezieht sich nur auf die materielle Steuerpflicht. Jeder Steuerschuldner ist gleichzeitig Steuerpflichtiger (Steuersubjekt), aber nicht jeder Steuerpflichtige ist Steuerschuldner.
18
Steuerzahler (Steuerentrichtungsverpflichteter) ist derjenige, der nach dem jeweiligen Steuergesetz die Steuer an den Fiskus zu leisten hat