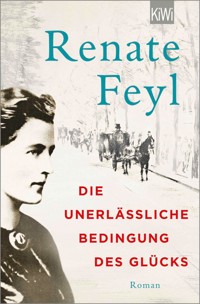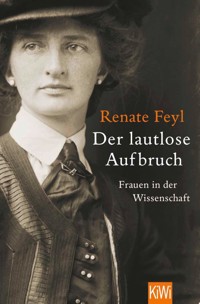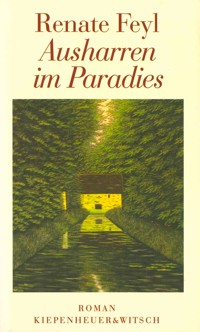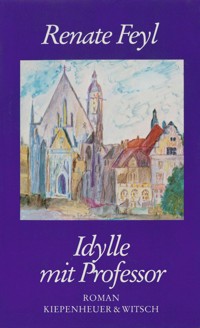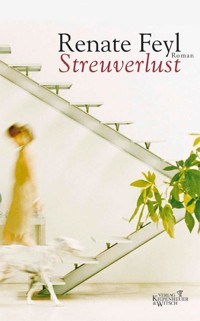9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Königin Sophie Charlotte und Gottfried Wilhelm Leibniz – eine Liebe im GeisteDer letzte Universalgelehrte und die schöngeistige Königin: Mit diesem Buch kehrt Renate Feyl auf das Terrain zurück, auf dem sie mit überaus erfolgreichen Büchern geglänzt hat: die historische Romanbiographie. Sie erzählt die Geschichte einer Beziehung, die aus dem lebendigen Austausch der Gedanken Funken der Leidenschaft schlägt – und die Leibniz die fünf glücklichsten Jahre seines Lebens beschert. Sophie Charlotte, geboren 1668 auf Schloss Iburg im Fürstenbistum Osnabrück, begegnet Leibniz am elterlichen Hofe in Hannover, wo er in kurfürstlichen Diensten steht. Mit sechzehn Jahren heiratet sie Friedrich III., den Sohn des Großen Kurfürsten, und geht mit ihm nach Berlin. Hier besucht sie Jahre später der weithin berühmte Mathematiker und Philosoph, um sie für den Plan zu gewinnen, eine Akademie der Wissenschaften zu gründen. Während ihr Gatte mit großem diplomatischem Geschick das Ziel seiner Krönung zum König in Preußen erreicht, fördert sie die schönen Künste und Wissenschaften. Im Laufe der zahlreichen anregenden und geistreichen Gespräche entwickelt sich eine enge Beziehung, und Leibniz wird zum Gefährten ihrer Gedanken. Sophie Charlotte animiert den universellen und genialen Gelehrten zu einer systematischen Ausarbeitung seiner Ideen, die letztendlich in die berühmte Theodizee mündeten. Renate Feyl erzählt mit großem Gespür für die Sprache des Barock und die leisen Zwischentöne vom Zauber einer »mariage mystique« – einer geistigen Liebe voller Esprit und Dezenz. Und es gelingt ihr, die Atmosphäre des Berlin im Aufbruch, die Zwänge des höfischen Protokolls und die Freiheit des intellektuellen Austauschs in eindrucksvollen Bildern einzufangen – und zugleich das Porträt einer faszinierenden jungen Frau zu zeichnen, die eine eigenständige Rolle sucht und das geistige Klima am Hofe prägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Renate Feyl
Aussicht auf bleibende Helle
Die Königin und der Philosoph
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Renate Feyl
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Renate Feyl
Renate Feyl, geboren in Prag, studierte Philosophie. Sie schreibt Romane und Essays und lebt als freie Schriftstellerin in Berlin.
Weitere Werke von Renate Feyl: http://bit.ly/1zrmz4
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Sophie Charlotte, geboren 1668 auf Schloss Iburg im Fürstentum Osnabrück, begegnet Leibniz am elterlichen Hofe in Hannover, wo er vielseitige in kurfürstlichen Diensten steht. Mit sechzehn Jahren heiratet sie den Kurprinzen von Brandenburg, den künftigen Kurfürsten Friedrich III., und geht mit ihm nach Berlin. Hier besucht sie Jahre später der weithin berühmte Mathematiker und Philosoph, um sie für den Plan zu gewinnen, eine Akademie der Wissenschaften zu gründen. Während ihr Gatte mit großem diplomatischen Geschick das Ziel seiner Krönung zum König von Preußen erreicht, fördert sie die schönen Künste und Wissenschaften. Im Laufe der zahlreichen anregenden und geistreichen Gespräche entwickelt sich eine enge Beziehung, und Leibniz wird zum Gefährten ihrer Gedanken. Sophie Charlotte animiert den universellen und genialen Gelehrten zu einer systematischen Ausarbeitung seiner Ideen, die letztendlich in die berühmte »Theodizee« mündet.
Renate Feyl erzählt mit großem Gespür für die Sprache des Barocks und die leisen Zwischentöne vom Zauber einer »mariage mystique« – einer geistigen Liebe voller Esprit und Dezenz. Und es gelingt ihr, die Atmosphäre des Berlins im Aufbruch, die Zwänge des höfischen Protokolls und die Freiheit des intellektuellen Austauschs in eindrucksvollen Bildern einzufangen – und zugleich das Porträt einer faszinierenden jungen Frau zu zeichnen, die eine eigenständige Rolle sucht und das geistige Klima am Hofe prägt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2006, 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv oben: Sophie Charlotte von Preußen; Porträt von Noel III Jovenet. Mit freundlicher Genehmigung des Bomann-Museums, Celle.
Covermotiv unten: akg images/Erich Lessing; Georges de La Tour, um 1635
ISBN978-3-462-30945-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Sophie Charlotte erwartete in Lietzenburg …
Sophie Charlotte drängte darauf …
Leibniz lag schlaflos …
Sophie Charlotte erwartete in Lietzenburg den Reichsfreiherrn von Leibniz. Sie freute sich auf ihn, denn er kam von zu Hause, vom Hof zu Hannover, brachte Nachrichten von der Mutter und dem Bruder und war zudem ein Mann von Verstand. Letzteres schätzte sie besonders, zumal man sich neuerdings darin gefiel, auf jede Torheit stolz zu sein. Sie kannte Herrn Hofrat Leibniz von Kindheit an. Er war der Ratgeber ihrer Mutter, auch Herzoglicher Bibliothekar, wurmte sich Tag und Nacht durch die Bücher, korrespondierte mit fast allen großen Gelehrten Europas und verbreitete so ein philosophisches Air. Ständig beschäftigte ihn ein gewichtiger Gedanke, und gerne ließ er andere daran teilhaben. Beim Servieren einer Feigentorte hatte er ihr einmal erklärt, weshalb alle Dinge universell verknüpft sind, ein andermal nach einem Kirchgang das Prinzip seiner Rechenmaschine erläutert, die im Gegensatz zur Pascalschen nicht nur addieren und subtrahieren, sondern auch multiplizieren und dividieren konnte. Bei einem Spaziergang im Park von Herrenhausen begründete er auf amüsante Art, warum Bewegung notwendigerweise aus Bewegung entstehen muß, und selbst den Nutzen der Maulbeerbäume hatte er ihr mit geradezu glühendem Eifer ans Herz gelegt.
Seit ihrer Heirat an den Berliner Hof vor 16 Jahren war ihr niemand mehr begegnet, der so unterhaltsam über die schwierigsten Materien zu reden verstand. Überhaupt konnte sie hier mit keinem ein Gespräch führen, das nachwirkte und mehr als nur der übliche Wortwechsel war. Die meisten ließen ihre Gedanken in immer derselben Bahn kreisen und kamen nie über die allgemeine Meinung hinaus. Die Interessen konnten noch so weitgesteckt sein – letztlich ging es doch stets um das persönliche Fortkommen, um Posten, Ämter und Aufstieg. Für jeden höheren Zusammenhang fehlte ihnen der Sinn, vom Urteil ganz zu schweigen.
Ihr Gemahl, der Kurfürst von Brandenburg, hatte zwar das große Reich im Blick, verfolgte akribisch die Beziehungen zwischen den Höfen und war unablässig mit politischen Entscheidungen befaßt, aber er sprach mit ihr nicht darüber aus Angst, es könnten ihre Verwandten in Hannover erfahren. In diesen Dingen schloß er sie bewußt aus und hörte allein auf seine Berater. Am liebsten hätte er mit ihr über die Jagd gesprochen, doch davon wollte sie nichts hören. Ihren hirschgerechten Jäger auch nur mit einer Silbe in seiner Waidmannslust zu ermuntern kam für sie nicht in Frage.
Natürlich fehlte es ihr nicht an Gelegenheiten zu reden. In ihrem Audienzzimmer drängten sich die Besucher. Aber sie trugen immer nur Anliegen vor, verfolgten stets einen Zweck, hatten einen Wunsch, eine Bitte, und immer nahm sie entgegen. Es war eine Pflichtkonversation, im besten Falle ein angeregter Austausch von Worten, aber doch nie ein Gespräch. Nichts Zweiseitiges. Nichts, was ihr das Gefühl gegeben hätte, in der eigenen Lebendigkeit und mit den eigenen Gedanken gefordert zu sein. Nichts, wo sie auch einmal etwas von ihrem Wesen und ihren Vorstellungen hätte einbringen können. Immer war sie nur zugegen, mehr nicht. Von morgens bis abends hatte sie sich im Hofwirbel zu drehen, der ihr kaum eine Möglichkeit ließ, auch einmal das zu tun, was sie wirklich tun wollte. Doch das sollte sich nun ändern. Leibniz hätte zu keinem glücklicheren Zeitpunkt kommen können.
Vor kurzem hatte ihr der Gemahl den kleinen Sommersitz, das Schlößchen in Lietzenburg, bauen lassen. Zwar nicht viel größer als ein Gutshaus, aber es war nur eine Meile von Berlin entfernt, recht hübsch an der Spree gelegen, und sie hatte es ganz nach ihren Wünschen einrichten können. Vom Großgeldverwalter Premier Kolbe war ihr für den Hofstaat ein auskömmlicher Etat bewilligt worden, was ihrer Selbständigkeit wohltat. Hier konnte sie ein anderes Leben führen als im düsteren Stadtschloß mit seinen schweren Augsburger Silberspiegeln, seinen dunklen Räumen und dem steifen Zeremoniell, das jede spontane Regung erstarren ließ. In Lietzenburg war sie frei von diesen Zwängen. Nicht daß sie hier ein besonders lockeres oder gar windig sündiges Leben führen wollte, aber sie kannte nun mal von zu Hause den freien Hannoverschen Geist, war gewöhnt, über die neuesten Bücher zu reden und sich mit den schönen Künsten und der Wissenschaft zu beschäftigen. Sich diesen Themen zu widmen hielt sie für weit nützlicher, als den Pflichten eines prunkvollen Protokolls zu genügen. Zwar sah sie ein, daß der fürstliche Gemahl auf diese Demonstration seiner Macht nicht verzichten konnte und seine Herrschaft auch wirksam nach außen zu vertreten hatte, aber sie fand, er mußte ja nicht alles derart übertreiben und auch noch seine Familie damit behelligen. Doch jetzt konnte sie endlich einmal zeigen, daß es über die prächtige Etikette hinaus noch andere Möglichkeiten gab, um zum Glanz eines Fürstenhauses beizutragen.
Als sie kürzlich ihre Mutter in Hannover besuchte, hatte Hofrat Leibniz ihr die Idee unterbreitet, eine Societät der Wissenschaften ins Leben zu rufen, um die besten geistigen Kräfte des Landes zu bündeln. Der Vorschlag gefiel ihr. Gebündelte Lichtstrahlen besaßen die doppelte Leuchtkraft. Griff sie diese Idee auf, stand ihr Hof bald in dem Ruf, ein Förderer geistiger Kultur zu sein. Mochte der Gemahl in der hohen Politik auch das einzig Wahre und Wichtige sehen und allem anderen wenig Bedeutung beimessen – sie setzte auf den Geist. Auch wenn sich damit keine imposanten Augenblickserfolge erzielen ließen und keine Ländereien zu gewinnen waren –, der Geist schuf seine eigene Größe und eigene Macht und trug vielleicht mehr zum Ansehen eines Landes bei, als sich das drüben im Stadtschloß so mancher Minister vorstellen konnte. Sie sah zwar schon jetzt, wie sie von diesen ausgebrannten Wichtigtuern deswegen still belächelt wurde, aber sie zweifelte keinen Augenblick daran, bei ihrem Gemahl dafür Verständnis zu finden. Schließlich war Kurfürst Friedrich für alles zu haben, was Glanz und Reputation des Hauses Brandenburg vergrößerte. Darum hatte er jüngst auch nicht gezögert, eine Akademie der Künste zu etablieren. Ohne Frage, alles sah hoffnungsvoll aus.
Leibniz fuhr in den Schloßhof ein. Er klappte den Tisch zusammen, den er sich eigens in die Kutsche hatte bauen lassen, um auf längeren Reisen arbeiten zu können. Vor noch nicht allzu langer Zeit hatte er an diesem Tisch auf der Fahrt von Hannover nach Wolfenbüttel das Problem von der Linie des kürzesten Falls gelöst und das Ergebnis dieser Preisaufgabe der Leipziger Gelehrtenzeitschrift Acta eruditorum zu gleicher Zeit wie Newton eingesandt, was ihm bis heute eine große Genugtuung bereitete. Doch diesmal waren es sonnensatte, feuchtheiße Maitage, und die Temperatur in der Kutsche regte nicht gerade zur Arbeit an. Nicht mal ein Brief über das Kontinuitätsprinzip war ihm geglückt. Die Allongeperücke, die grand in-folio, die ihn ein kleines Vermögen gekostet hatte, drückte schwer. Aber ohne Perücke zu erscheinen, wie ein neumodischer honnête homme, der sein eigenes Haar zur Schau trug, eine solche Geschmacklosigkeit mochte er sich und seinen Mitmenschen nicht zumuten. Die Perücke gab dem Mann etwas Würdevolles, und darauf kam es an. Um so mehr, als ihm die Ehre zuteil wurde, von Sophie Charlotte, der Kurfürstin von Brandenburg, zu einem Antrittsbesuch in ihr neues Schloß gebeten zu sein.
Der Wagen hielt. Er stieg aus und erwartete, vom Oberhofmeister empfangen zu werden, doch überraschend stand Sophie Charlotte in Begleitung ihrer Ersten Hofdame vor ihm. Daß sie an die Kutsche kam, war eine ungewöhnliche Gnade und deutete darauf hin, daß sein Besuch unter einem guten Vorzeichen stand. Seit ihrer letzten Begegnung schien ihm die Fürstin noch schöner geworden zu sein. Er war so gefesselt von ihrem Anblick, daß er bei dem überwältigenden Empfang fast vergessen hätte, sie nach burgundischem Zeremoniell untertänigst zu begrüßen. Doch mit einer Geste gab sie ihm zu verstehen, daß sie hier auf das steife Hofprotokoll keinen Wert legte. Er überbrachte die Grüße und einen Brief der Frau Mama, der verehrten Kurfürstin von Hannover, und war sich in diesem Augenblick wieder einmal bewußt, wie glücklich er sich schätzen durfte, das Vertrauen von Mutter und Tochter, zweier so mächtiger Fürstinnen, genießen zu dürfen.
Sophie Charlotte ließ es sich nicht nehmen, ihn persönlich durch das Schloß zu führen. Zwar fehlte noch die Treppe, weil man sich, wie sie amüsiert anmerkte, bislang nicht einigen konnte, ob es eine Pfeiler- oder Freitreppe sein sollte, aber sie freute sich, daß sie es durchgesetzt hatte, ihre Wohnräume nicht ins Obergeschoß, sondern entgegen dem Protokoll ins Erdgeschoß zu legen. Die Möglichkeit, jederzeit in den Park hinaustreten zu können, empfand sie als befreiend; ebenso den Anblick der Bäume, die sich in ihrem Schlafgemach spiegelten. Leibniz war beeindruckt – alles hell und lichtdurchflutet, nirgendwo düstere Renaissance, wie im Schloß in Berlin, nichts Schweres, nichts Strenges, selbst der Schreibschrank bunt lackiert. Es war, als wehte ihn hier eine andere, eine farbige Luft an. Die Anordnung der Gemälde, die Pilaster und Putten, die Tapisserien, die Deckenbilder, die Porzellane und Fayencepyramiden – alles verriet den ganz eigenen Gestaltungssinn und mehr noch – die Durchsetzungskraft der jungen Fürstin.
Sophie Charlotte bat in ihr Audienzgemach, nahm im Lehnstuhl Platz und ließ Kaffee à la turque servieren. Leibniz blieb im gebührenden Abstand stehen, aber sie wies ihm den anderen Lehnstuhl an. Dabei wäre ein schlichter Hocker, ein Tabouret, schon das allerhöchste gewesen, und nun gar einen Lehnstuhl angeboten zu bekommen, wie er nur Personen gleichen Ranges gebührte – das übertraf alle Erwartungen. Überwältigt von soviel Distinktion nahm er Platz. Mit der Kurfürstin auf gleicher Höhe sitzen zu dürfen schien ihm ein so außerordentlicher Gunstbeweis, daß er nicht recht wußte, ob sie ihn ehren wollte oder ob es nur Ausdruck eines neuen Stils war. Melampino, das Hündchen, sprang auf ihren Schoß.
»Ein munteres, liebreizendes Geschöpf«, sagte er und sah, wie wohl ihr diese Bemerkung tat.
»Und da behaupten einige Gelehrte, ein Hund sei nichts anderes als eine lebende Maschine«, entgegnete sie. »Ein Wesen ohne Sinne, das den Gesetzen der Mechanik folgt! Ginge es nach diesen Doktoren, wäre Melampino nicht mehr als ein bellendes, schwanzwedelndes Uhrwerk. Ich vermute, die Herren haben über ihren vergilbten Papieren vergessen, was man guten Tieren alles beibringen kann. Mir jedenfalls ist noch kein Uhrwerk auf den Schoß gesprungen, und ich hatte auch nie das Gefühl, ich müßte Melampino morgens aufziehen lassen. Sie glauben gar nicht, wie gelehrig, ich möchte fast sagen, wie vernünftig er ist!«
Zwar vermied Leibniz einen direkten Widerspruch, denn er wollte gerade bei einer Antrittsvisite keinen Mißton aufkommen lassen, doch er konnte nicht umhin, dezent darauf hinzuweisen, daß die Liebe zu dem Tier sie zu einer falschen Schlußfolgerung verleitet. »Was Sie als gelehrig bezeichnen und worüber Sie sich zu Recht freuen, Madame, hat äußerlich durchaus eine Ähnlichkeit mit der Vernunft. Aber letztlich kommt das, was der Hund tut, nicht aus dem Verstand, sondern beruht auf seiner Erinnerung an das, was ihm Behaglichkeit verschafft oder Schmerz bereitet hat. Das eine wird er wiederholen, das andere in der Regel unterlassen. Was er auch anstellen mag – er handelt nie aus Kenntnis der Ursachen, sondern aus seiner Erfahrung. Ich muß Sie daher enttäuschen: Melampino mag noch so gelehrig sein, Vernunft hat er nicht.«
»Dann wäre nur zu wünschen, daß alle Menschen, die Vernunft haben, ebenso schnell aus ihren Erfahrungen lernen wie er«, sagte sie. »Ich meine, die tabaksfrohen Herren drüben im Stadtschloß trinken, bis ihnen sterbensübel wird, aber kaum haben sie sich etwas erholt, sitzen sie schon wieder vor der Weinkanne. Bei ihnen scheint bereits die Erfahrung zu versagen, von der Vernunft ganz zu schweigen. Melampino, merk dir, was der Herr Hofrat gesagt hat: Im Gegensatz zu diesen Zechgesellen hast du keine Vernunft, aber du bist gescheiter. Trotzdem, lieber Leibniz, wenn Sie ihm schon keine Vernunft zugestehen – eine Seele werden Sie ihm doch wohl nicht absprechen!«
»Ich nicht«, entgegnete er, »aber Sie wissen ja, es gibt genügend Gelehrte, die es in Frage stellen. Der unsinnige Streit erhitzt noch immer die Gemüter.«
»Und wie man hört, sind es die Philosophen, die sich dabei so unrühmlich hervortun. Offenbar ist es bei ihnen mit der Vernunft auch nicht so weit her. Seien Sie froh, daß Sie ein Mathematiker sind!«
»Gott hat jedem Menschen Vernunft gegeben, aber er hat nicht verfügt, ob und wie er sie gebrauchen soll.«
»So wie ich Sie kenne, sind Sie doch bereits zu einem Ergebnis gekommen. Also treffe ich eines Tages Melampino im Himmel wieder oder nicht?«
Leibniz sah diese herausfordernde Wißbegier in ihren Augen und wurde für Momente von einer seltsamen Unruhe erfaßt. Ihre Art zu fragen war ungewohnt und faszinierte ihn. Wen interessierten schon derlei philosophische Materien, und wer wollte darüber eine Auskunft von ihm? Der Kurfürstin antworten zu dürfen ehrte ihn nicht nur – es war ihm ein Vergnügen. »Sehen Sie, Madame, alles ist in Bewegung und alles ist Umformung. Wir wissen heute, daß die Tiere und Pflanzen nicht aus Fäulnis und Chaos entstehen, sondern aus Umbildung jener, die vor ihnen gelebt haben. Der Keim des Neuen ist im Alten bereits angelegt, und dieses unzerstörbare, unvergängliche Prinzip der inneren Tätigkeit nenne ich Seele. Sie ist allem Lebendigen immanent. Beim Menschen allerdings kommt noch die Vernunft hinzu. Dadurch ist er in den Zustand versetzt, sich selber zu reflektieren, sich selbst zu empfinden, erhält moralische Qualitäten, Individualität, kurz gesagt: Persönlichkeit. Darum wird der menschlichen Seele Unsterblichkeit beigelegt. Setzen wir voraus, daß Seele und Persönlichkeit des Menschen zusammengehören, bleibt mit der Unsterblichkeit seiner Seele auch seine Persönlichkeit erhalten. Und das ist der Unterschied: Da den Tieren Vernunft und damit Persönlichkeit fehlt, ist ihre Seele zwar unzerstörbar oder unvergänglich, wenn Sie so wollen, aber nicht unsterblich. Am Tage der Auferstehung werden Sie auf Ihren Melampino verzichten müssen.«
»Dann halte ich es lieber mit den Grönländern«, entgegnete sie. »Man sagt von ihnen, sie wollen nur dann in den Himmel kommen, wenn auch ihre Seehunde dort sind.«
Leibniz verneigte sich lächelnd und nutzte die kleine Gesprächspause, um sich endlich dem Kaffee zu widmen. Dieses Getränk war für ihn der Genuß an sich, und unwillkürlich kam ihm der Gedanke, für ihn müßte es im Himmel Kaffee mit einer gehörigen Portion Zucker geben.
»Aber mal im Ernst, lieber Leibniz, wo sind wir eigentlich, wenn es mit uns vorbei ist?«
»Nach dem Tod, Madame, sind wir wieder dort, wo die ungeborenen Kinder heute sind.« Mit Behagen führte er das Täßchen zum Munde, und Sophie Charlotte stellte zufrieden fest, daß der philosophische Hofrat sich nicht verändert hatte. Noch immer konnte er leicht und mühelos ein Gespräch beginnen. Sie mochte nun mal keine herumdrucksenden Gelehrten, die erst umständlich ihre Komplimente abarbeiteten und dann vor lauter Tiefsinn und Nachdenklichkeit nicht in der Lage waren, einen einfachen Vorgang auch einfach zu erklären. Bei ihnen hatte sie immer den Eindruck, daß die Last der eigenen Bedeutung ihre Gedanken zu sehr niederdrückte.
Kammerfräulein von Pöllnitz reichte ein Billett herein. Sophie Charlotte überflog die Zeilen. Ihr Sohn ließ sich entschuldigen. Ihm fehlte die Zeit, Herrn Hofrat Leibniz zu begrüßen, denn er mußte zur Reiherbeize. Sie ärgerte sich. Es war immer dasselbe mit ihm. Jagen statt lesen. Zwölf Jahre alt und nichts als Flinten im Kopf. Sie durfte gar nicht daran denken, wie das mit ihm noch einmal werden sollte. Aber sie war der Ermahnungen müde. Achtlos legte sie das Billett beiseite und fragte Leibniz, wie weit seine Akademiepläne gediehen waren. Selbstverständlich hatte er alles pünktlich und wunschgerecht ausgearbeitet, nicht nur die Struktur einer solchen Einrichtung beschrieben, sondern darüber hinaus auch gleich noch Regeln für die Wissenschaft entworfen. Mit alleruntertänigster Ergebenheit überreichte er ihr den Plan und verzichtete nicht darauf, das Wichtigste noch einmal zusammenfassend darzustellen. Sie sollte etwas von der Leidenschaft spüren, die er diesem Vorhaben gewidmet hatte. Denn darauf kam es schließlich an: Ihre Kurfürstliche Durchlaucht mußte begeistert werden.
Natürlich erschreckte er Sophie Charlotte nicht gleich mit den Kosten, sondern betonte erst einmal den weitreichenden Nutzen einer Institution, mit der gleichsam ein Kitt für die Sandkörner gefunden war und die Theorie und Praxis miteinander verband. Immerhin ging es hier nicht allein um Kunst und Wissenschaft, sondern auch um die Verbesserung des Feldbaus, der Manufakturen, des Handels und der Gewerbe.
»Mit der Gründung der Societät geben wir dem neuen Jahrhundert einen glanzvollen Anfang und so sicher, wie die Summe aus eins, zwei, drei und vier zehn ergibt, so sicher wird ihr Erfolg sein«, sagte er. »Die Societät wird die Bildung befördern, ein Münz- und Antikenkabinett, ein chemisches Laboratorium und vor allem eine Sternwarte haben. Jährlich werden statistische Berichte über medizinische Angelegenheiten erarbeitet, auch Prämien für Entdeckungen vergeben und wissenschaftliche Reisen unterstützt. Wichtig ist, daß hier alle verstreuten menschlichen Kenntnisse gesammelt, geordnet und publiziert werden. Damit die Buchhändler die Gelehrten nicht zu ihren Lohnsklaven machen, braucht die Societät natürlich einen eigenen Verlag, der zudem für die Reinheit der Sprache zu sorgen hat.«
Sophie Charlotte unterbrach ihn. Angesichts dieser großartigen Aufgaben konnte sie sich nicht vorstellen, daß ihr Gemahl ein solches Projekt ablehnen würde. »Neuerdings hat sich mein Friedrich in den Kopf gesetzt, auch noch König zu werden«, sagte sie und fügte mit einem Anflug von Sarkasmus hinzu: »Wohl ein zusätzlicher Schmuck für seine Krone.«
Leibniz hatte schon davon gehört, doch jetzt war es aus berufenem Munde bestätigt. Allerdings verstand er ihren spöttischen Ton nicht.
»Er schwelgt schon jetzt in Pracht und Prunk, was will er denn noch!?«
Behutsam versuchte er, ihr diesen leicht abfälligen Unterton auszureden. Leibniz sah den Königswunsch des Kurfürsten in einer größeren Dimension. »Was Ihrer Durchlaucht im Moment als ein Werk der Eitelkeit erscheint, kann sich vielleicht später einmal als Meisterwerk der Staatskunst erweisen. Neben Hannover eine zweite protestantische Macht im Norden Deutschlands zu haben, die sich nicht ständig vor dem König von Frankreich und dem Kaiser in Wien ducken muß, scheint mir mehr als wünschenswert zu sein. Ein protestantisches Königreich im Norden Deutschlands kann zum Segen gereichen.«
Sie sollte schon wissen, daß er nichts auf der Welt für sinnloser hielt, als Kriege wegen eines Glaubens zu führen. Die Folgen des letzten, der dreißig Jahre gedauert hatte, waren auch jetzt, nach zweiundfünfzig Jahren, noch überall zu spüren. Nein, ein Gleichgewicht zwischen Katholiken und Protestanten konnte einen erneuten Krieg vielleicht sogar verhindern.
Leibniz bot an, gleich nach Gründung der Societät ein wissenschaftliches Gutachten über die Frage erstellen zu lassen, was nach geltenden völkerrechtlichen Begriffen zum Königtum erforderlich sei. Besser, das war ihm sofort klar, konnte er sich dem Kurfürsten nicht empfehlen. Und nicht nur das. Es war mehr, viel mehr. Es wehte ihn plötzlich eine Ahnung an, und mit einemmal sah er tief in die Zukunft hinein. Es war wie der Ausblick in ein entgegenkommendes Scheinen, der klar die Konturen eines großen Ereignisses umriß und ihm ein unverhofftes Glück verhieß: Er sah die einmalige Möglichkeit, Berater eines Königshauses zu werden.
Beim Abschied fragte ihn Sophie Charlotte, woran er derzeit arbeite. Diese unerwartete Anteilnahme empfand er geradezu als eine Huldigung der Macht an den Geist und sah sich in seinen heimlichen Hoffnungen bestätigt. Hymnisch gestimmt und mit einer tiefen Verneigung erwiderte er, daß er sich mit dem Gedanken trage, ein Traktat über die Sprache der Engel zu schreiben.
»Über die Engel? Wie soll ich mir das vorstellen?«
»Als eine höhere Form der Mathematik, Madame.«
Noch immer schien es Sophie Charlotte nicht vergönnt zu sein, sich einmal in Ruhe den eigenen Gedanken zu widmen, geschweige denn auch nur ein Stündchen Muße zu haben. Sie lebte auf einer Baustelle und hatte allmählich das Gefühl, von einem ewigen Provisorium umgeben zu sein. Wo sie auch hinsah – Sandberge, Erdhaufen, Mauersteine, Balken, Walzen, Winden, Gerüste, Ziegel und Bretter. Zwischen Karren und Buden ein Gewimmel von Wasserträgern, Maurern und Zimmerleuten und den ganzen Tag nichts als Hämmern, Sägen und dieses ständige An- und Abfahren der Bauwagen mit dem Geschrei und Geschimpfe der Kutscher. Ein Lärm, der kaum noch zu ertragen war. Sie sehnte den Tag herbei, an dem der östliche Seitenflügel des Schlosses endlich fertig war.
Gleichzeitig mußte sie sich um die Anlage des Gartens kümmern. Was jetzt versäumt wurde, ließ sich später nur noch mühsam nachholen. Sie wollte nicht den üblichen holländischen Schachbrettgarten, der ihr viel zu brav und langweilig erschien. Diese biederen Quadrate, vom Kanal begrenzt, mit Blumen und Statuen überfüllt, mit Buchs und bunter Erde ausgelegt – das hatte für sie Puppenstubencharakter. Sie wollte etwas Großzügiges, Weites, eine moderne französische Gartenanlage ähnlich der, die sie von Hannover her kannte und die ihrer Mutter mit dem Park von Herrenhausen gelungen war. Auf ihren Rat hin hatte Sophie Charlotte eigens Simon Godeau aus Frankreich kommen lassen, hatte mit ihm Entwurf für Entwurf besprochen, darüber mit ihrer Cousine, der Herzogin von Orleans, korrespondiert und von Le Nôtre den letztgültigen Plan begutachten lassen. Auf sein Urteil wollte sie nicht verzichten. Schließlich hatte kein anderer als er das irdische Paradies von Versailles geschaffen.
Noch keinen Tag hatte sie das Geld gereut, das sie für den Garten aufgewandt hatte, denn er schien von Woche zu Woche schöner zu werden. Die langgestreckten Rasenparterres, die Bosketts, der Karpfenteich, die vierreihige Lindenallee – alles war von Godeau aufs prächtigste gestaltet. Die 500 Taler, die sie ihm jährlich zahlte, stockte sie ihm indirekt noch durch die Zahl seiner Mitarbeiter auf, die er selber bestimmen durfte. Er sollte sich nicht unnötig mit praktischen Arbeiten aufhalten, sondern als Kunstgärtner und Gartenintendant sich ganz auf die Ausführungen seiner Ideen konzentrieren. Allmählich kam ihr die Anlage wie ein grünes Ornament vor, das ihr Schlößchen zu schmücken begann, ja es sogar heraushob, schöner und irgendwie auch größer machte. Glücklicherweise waren die Verhandlungen mit Gutsbesitzer von Wilmersdorf abgeschlossen, die angrenzende Wiese war ihm entschädigt und dem Park einverleibt worden, so daß Godeau jetzt den Küchengarten entwerfen konnte. Sie besprach mit ihm jedes Detail. Diesmal dauerte es besonders lange, denn sie erörterte mit ihm ihren Lieblingswunsch – die Pflanzung von Maulbeerbäumen. Er riet zum weißen Maulbeerbaum, dem Morus alba, der 30 Meter hoch wurde, eine schöne Krone bildete und dem Frost standhielt. Sie aber wollte noch den Baum der Klugheit, den schwarzen Maulbeerbaum, den Morus nigra, der zwar nicht zum Seidenbau taugte, dessen Beeren aber schon den alten Griechen schmeckten.
Godeau zeichnete in seinen Riß die Standorte ein, als ihr plötzlich die chère Pöllnitz meldete, daß zwei Reiter der Leibgarde des Gemahls mit dem Kissen heransprengten. Ach dieses Kissen! Schon wieder dieses Kissen! Carmoisinroter Samt mit Gold bordiert und in der Mitte sein hochherrliches Monogramm in Diamanten gefaßt – prächtig und kostbar wie alles, was von ihm kam. Zwar war sie daran gewöhnt, daß ihr Gemahl es liebte, seine Person stets mit großem Zeremoniell anzukündigen, aber daß er neuerdings sogar noch seine Wünsche per Estafette voraussenden ließ, löste dann doch ein fast mitleidiges Schmunzeln aus. Doch wie gern sich ihr kleiner verwachsener Friedrich auch inszenierte – den Wunsch, sich mit ihr im ehelichen Bett zu vergnügen, jedesmal mit einem Kissen anzukündigen hatte zumindest eine recht praktische Seite. Bevor er aus dem Stadtschloß eintraf, blieb ihr auch diesmal noch genügend Zeit, sich für den heiligen Zweck zu rüsten.
Die Dienerschaft kam in Bewegung. Ihre beiden Kammertürken, Friedrich Hassan und Friedrich Ali, sorgten dafür, daß das rotlackierte Teetischchen gedeckt wurde und im Schlafzimmer der Armlehnstuhl, der chaise à bras, für den hochfürstlichen Ehemann am rechten Platz stand und von mindestens zwei Leuchtersäulen umgeben war. Die Kammerjungfrauen besprühten den Betthimmel mit Eau de Lavande, brachten ihr das Pfirsichblütenwasser für Gesicht, Hals und Dekolleté und legten zur Auswahl leichte, seidige Kleider bereit, einige aus Kamlott, andere aus Ferrandine, damit es bei jedem Schritt aufregend rauschte und knisterte, wisperte und flüsterte. Dazu die drei verschiedenfarbigen Unterröcke, den Geheimen, den Bescheidenen und den Schäker, und natürlich die Leibchen. Unter- und Oberleibchen aus feinstem moiriertem Taft, goldbestickt mit Amormotiven, das eine von hinten, das andere von vorne zu schnüren. Darauf kam es an, denn der Gemahl wollte schnüren. Viel schnüren, aufschnüren und zuschnüren, er liebte das Schnüren, vor allem das Aufschnüren, summte beim Schnüren, flüsterte beim Schnüren, tänzelte beim Schnüren – Schnüren war seine Seligkeit.
Die Kammerjungfrauen halfen ihr rasch in das erste Leibchen und verstanden mit viel Geschick, die feinsten Seiden-, Taft- und Spitzenbänder so raffiniert über Kreuz zu schnüren, daß sie nicht ohne Anstrengung gelöst werden konnten. Dann legten sie ihr das Oberleibchen mit den Ärmelschnallen an und darüber ein durchsichtiges drittes, das mit hauchdünner Goldlitze seitlich von einer fast unsichtbaren Doppelschnürung zusammengehalten wurde. Zusätzlich überzogen sie das Kunstwerk mit breiten Schmuckbändern und setzten versteckt kleine Rosetten wie Schönheitspflästerchen auf. Als krönendes Finale drapierten sie das Ganze mit der Stimmungsschleife aus Seidenflor, die sie so banden, daß beim geringsten Versuch, sie aufzulösen, der Knoten sich immer fester zog und nur mit einem Biß zu lösen war. Beißen, das war es. Das gehörte zum vollen Pirschgang für ihren Beutefriedrich. Selbstverständlich wählte sie zu allem noch die passenden Strumpfbänder. Diesmal trug sie die Bänder nicht wie gewohnt und allgemein üblich unter dem Knie, sondern über dem Knie, und zwar ein ganz beträchtliches Stück höher, sogar ziemlich weit oben, um ihm zu zeigen, daß es ihr an Einfällen nicht mangelte und sie für gewagte Neuheiten immer einen Sinn hatte.
Sophie Charlotte ertrug das Ganze auch heute mit der Gelassenheit einer Zuschauerin und hielt es für eine gelungene Zugabe, daß sich diesmal sogar die Seidenschuhe mit den roten Absätzen schnüren ließen, schätzte doch der Herr Gemahl bei dieser Tätigkeit die kleinsten Überraschungen. Zwar harrte sie seinem Wunsch wie einer Pflicht entgegen, aber sie war Pflichten gewohnt, und auf eine mehr oder weniger kam es ihr nicht an. In dieser Hinsicht hatte sie den Pragmatismus ihrer Mutter geerbt, die ihr wiederholt gesagt hatte: Wenn man nicht hat, was man liebt, muß man lieben, was man hat.
Noch mehr Wert allerdings legte sie darauf, ihn glanzvoll zu empfangen. Was hier versäumt wurde, konnte sie mit keiner Kissenstunde wettmachen. Links und rechts der Schloßeinfahrt standen bereits die Trompeter, um ihren Landesherrn mit Fanfaren zu begrüßen. Ihnen waren noch je zwei Pauker beigesellt, deren Paukenfahnen das Wappen Brandenburgs trugen. Groß und unübersehbar der rote Adler mit Zepter und Schwert in den Fängen. Wo er ihn sah, fühlte er sich zu Hause.
Da es draußen schon dämmerte, ließ sie im Schloßhof all ihre Bediensteten mit brennenden Wachsfackeln antreten, damit er durch ein flammendes Spalier ins Schloß schreiten konnte. Sie wußte, was ihrem Frédéric guttat. Vor allem wollte sie ihm zeigen, ihr Hofstaat mochte zwar wegen mangelhafter Etikette verrufen sein – wenn der glorwürdige Gemahl kam, waren die Reihen geschlossen, und alles stand in ehrfürchtiger Erwartung. Und dann fuhr er ein, Staatslenker Friedrich, begleitet vom Hofmarschall, dem Oberkämmerer und dem Pagenhofmeister, zur Rechten und zur Linken eskortiert von den Reitern der Gardes du Corps, alle in goldgalonierten Uniformen, beeindruckend und imposant, die Schweizergarde mit ihren Federbuschhüten bildete den glanzvollen Abschluß. Die Wachen salutierten, die Fanfaren ertönten, das flackernde Licht der Fackeln ließ ihn wie Phaeton im Feuerwagen erscheinen und ganz so, als sei er vom Himmel herabgefahren – was wollte er mehr. Er drängte ins Schloß, aber sie ging mit ihm als erstes in den Garten. Vorher ein bißchen zu spazieren konnte nicht schaden. Immerhin fiel ihr das Laufen mit den enggeschnürten Leibchen leichter als das Sitzen. Außerdem hatte sie ein besonderes Anliegen.
Sie wußte nur zu gut, daß alles Wichtige vorher gesagt werden mußte, denn nach der Schnürarbeit brach er sofort wieder ins Stadtschloß auf, um seine Regierungsgeschäfte fortzusetzen. Diesmal schien er offenbar einen anstrengenden Tag hinter sich zu haben, machte wieder so ein grämliches Gesicht und sprach kaum. Allweil blieb er stehen, betrachtete die Kontur einer geschnittenen Eibe, musterte die Pomeranzenbäume, als messe er in Gedanken die Symmetrie ihrer Anpflanzungen aus, schritt neben ihr wie auf einer vorgegebenen Linie steif und korrekt durch die Laubengänge, während sie überlegte, wie sie auf ihr Anliegen, die Akademiegründung, überleiten konnte, ohne ihn in seinen höheren Betrachtungen zu stören oder damit gar seinen Unwillen zu erregen. Selbstverständlich durfte sie ihn jetzt nicht mit der Fülle organisatorischer Einzelheiten behelligen, die ein so großes Projekt mit sich brachte, sondern entschloß sich, das Ganze als eine aufregende Neuigkeit zu präsentieren, die sein ureigenstes allerpersönlichstes Interesse berührte.
»Haben Sie übrigens schon gehört, mit welcher Begeisterung sich Hofrat Leibniz für Ihre Königspläne einsetzt? Wo er auch hinkommt, spricht er hell entflammt darüber!« Der Gemahl wandte sich ihr mit einer halben Drehung zu, was für sie der Anlaß war, Näheres über das Projekt zu sagen. »Sollten Sie die Akademiegründung billigen, will Leibniz sofort ein wissenschaftliches Gutachten erstellen lassen, weshalb die Erlangung der Königswürde von historischer Bedeutung und Nutzen für das Land Brandenburg und das Haus Hohenzollern ist.«
Mehr brauchte sie nicht zu sagen. Sie spürte sofort, es hätte keinen besseren Zeitpunkt für ihr Anliegen geben können. Alles deutete darauf hin, daß ihn eine glückliche Nachricht erreicht hatte, denn er war auf einmal wie verwandelt und wurde erstaunlich gesprächig. In der Tat war ihm jede Stimme wichtig, die ihn in seinem Wunsch nach der Krone unterstützte. Doch die Stimme eines Leibniz, die ihr ganz eigenes Gewicht an den Höfen und in der Gelehrtenwelt besaß, zählte doppelt und dreifach. Die kam jetzt mehr als gelegen.
Mit stiller Genugtuung bemerkte Sophie Charlotte, daß diese Neuigkeit auch auf sie ein gutes Licht warf. Gegen die Erwartungen seiner Präsidenten und Herren Großminister, die sie am liebsten fern jeder Einflußsphäre sehen wollten, konnte sie dem Gemahl zeigen, daß sie in ihrem Lietzenburger Château nicht hinter den Ereignissen lebte, sondern die Welt sehr genau im Blick hatte. Und mehr noch: daß sie am Ruhm des Hauses Brandenburg arbeitete. Endlich mal wieder eine günstige Kombination zu günstiger Stunde. Insgeheim war sie aber auch beeindruckt von der Weitsicht des philosophischen Hofrats, der offenbar wußte, was dem Einzelnen, aber irgendwie auch dem Ganzen diente und überhaupt so ein himmlisches Gespür für die Welt hatte.
Schritt um Schritt hob sich die Stimmung des Gemahls. Er wollte noch ein paar Einzelheiten über den Akademieplan wissen, dann hörte er ihren Rock rauschen, hörte es knistern und wispern, sah auch die neuen Seidenschuhe, zählte acht Ösen, sah, was ihm guttat und drängte ins Schloß.
Über ihre Ehe nachzudenken fand sie müßig. Sie waren nun mal wie Sonne und Mond. Wenn er aufstand, ging sie schlafen. Der Rest blieb guter Wille. Aber was sollte sie machen. Eine Wahl hatte sie nie gehabt. Mit 16 geheiratet, mit 17 das erste Kind bekommen, das Wochen später starb, mit 18 eine Fehlgeburt und mit 20 dann den ersehnten Thronfolger geboren, der sie in der Achtung aller steigen ließ. Daß sie ihrem Friedrich gefallen hatte, daran zweifelte sie bis heute keinen Augenblick, denn mit 16 war man immer ein erfreulicher Anblick. Selbst der große Sonnenkönig, dem sie bei einem Besuch ihrer Cousine in Versailles vorgestellt worden war, zeigte sich von ihren Körper- und Geistesgaben, sa beauté et de l’esprit, so angetan, daß er sie gleich an seinen Sohn, den Dauphin, verheiraten wollte. Er hatte ihr sogar ein Geschenk gemacht, das mehr als seine Freigebigkeit bewies, zwölf Knöpfe und zwölf Knopflöcher aus Diamanten, wie man sie derzeit an den Ärmeln trug und damit den Wunsch verbunden, sie bald wiederzusehen. Nein, über mangelnde Vorzüge der Natur konnte sie sich wahrlich nicht beklagen.
Zwar war sie jetzt schon 32 und fand beim Blick in den Spiegel die Vergänglichkeit aller Erscheinungen in Anfängen bestätigt, aber immer noch hielt sich vieles vom Ursprünglichen fest. Das Blau der Augen und das Schwarz der Haare besaßen noch ihren Glanz und wollten ihr offenbar treu bleiben. In Bad Pyrmont, wohin sie damals mit ihrer Mutter gefahren war, hatte sie den Kurprinzen von Brandenburg zum ersten Mal gesehen. Er war mit seiner kranken Frau ins Bad gereist. Bei einem Diner saß sie, das dreizehnjährige schöne Welfenkind, neben ihm. Um gar nicht erst diese gefürchtete Langeweile aufkommen zu lassen, gab sie eine Fabel von Äsop zum besten, was ihren Tischnachbarn so köstlich amüsierte, daß er sich mit ihr bis in den Abend unterhielt. Gewiß, sie haben viel gelacht miteinander, aber sie hätte nie im Traum daran gedacht, daß dieser Mann einmal um ihre Hand anhalten könnte. Doch gleich nach dem Tod seiner Frau stand er in Hannover. Ein Witwer von 27 Jahren. Ein Hohenzoller. Ihre Eltern waren zufrieden. Zwar stammte er aus keinem altehrwürdigen Hause, wie sie fanden, und seine Vorfahren waren nur kleine Markgrafen, nur Grenzwächter, aber er galt als klug und war zumindest nicht katholisch. Zwei große Vorzüge. Eine bessere Partie gab es nicht. Natürlich verband sich mit dieser Heirat ein höherer, still dynastischer Zweck, die Rivalitäten zwischen Hannover und Brandenburg zu beenden, die beiden Häuser untereinander zu versöhnen und später vielleicht sogar gemeinsam die Gebiete zurückzuerobern, die sich die Schweden so dreist genommen hatten. Doch das war der Blick der Eltern. Ihre Mutter hatte ihr bloß ganz beiläufig gesagt: Nur wenn du eine abgrundtiefe Aversion verspürst, dann mußt du nicht. Aber Sophie Charlotte spürte keine Aversion. Sie spürte gar nichts. Nichts Abstoßendes und nichts Anziehendes. Sie spürte bloß, daß sie nicht enttäuschen wollte. Für sein Aussehen konnte er nichts. Die Amme hatte ihn einmal vom Tisch fallen lassen, seitdem war er verwachsen, ducknackig und mit hochgezogenen Schultern. Aber unterhalten konnte sie sich gut mit ihm. Sein Sinn für Humor hatte was, und die Hochzeit wurde immerhin fast ein ganzes Jahr hindurch gefeiert. Das gefiel ihr. Anschließend brach sie mit ihm ins Feldlager auf, war dabei, als er in den Krieg zog, denn ohne sie wollte er nicht sein, und sie fand dieses Leben recht aufregend und spannend. Zumindest jeden Tag etwas Neues.