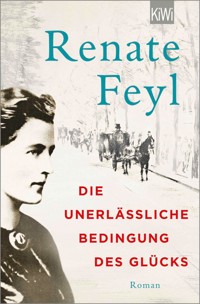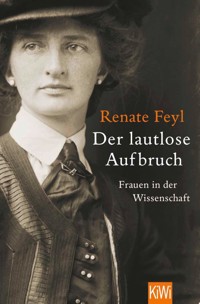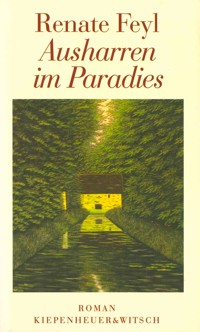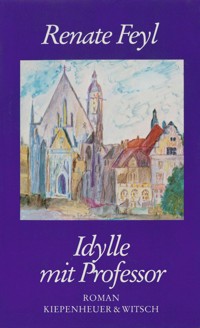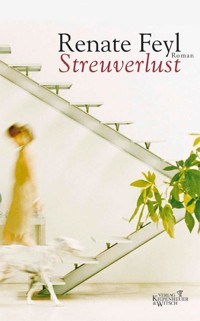9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem großen Erfolg der Profanen Stunden des Glücks - ein neuer Roman von Renate Feyl über eine bedeutende Schriftstellerin des 18. Jahrhunderts In ihrem neuen Buch schildert Renate Feyl das Leben der Caroline von Wolzogen (1 763-1847) als Schriftstellerin und Schwägerin Schillers. Was die Wolzogen in ihrer Schiller-Biographie aus Rücksicht auf Zeitgenossen verschweigen mußte, wird in diesem Roman erzählt. Zwei Dinge prägten das Leben der Caroline von Wolzogen (1763-1847): ihre schriftstellerische Arbeit und die Nähe zu ihrem Schwager Friedrich Schiller. Er liebte die Schwestern von Lengefeld, heiratete, weil Caroline ablehnte, Charlotte und wollte dennoch beide immer um sich haben – Charlotte für das alltäglich Praktische und Caroline für das geistig Höhere. Caroline, die in zweiter Ehe mit dem Geheimrat von Wolzogen verheiratet war, mußte erfahren, was es heißt, mit einem Genie in der Familie zu leben und an seiner Seite ihren eigenen Weg als Schriftstellerin zu finden. Ihr Roman Agnes von Lilien, der in den Horen vorabgedruckt wurde, erregte großes Aufsehen. Sie wurde von Goethe geschätzt und von Wilhelm von Humboldt bewundert und schuf mit der Biographie über den Schwager die Grundlage für Schillers Nachruhm. Was sie in dieser Biographie mit Rücksicht auf Zeitgenossen verschweigen mußte, wird in diesem Buch erzählt. Nach den Romanen über die Gottschedin (Idylle mit Professor) und Sophie von La Roche (Die profanen Stunden des Glücks) legt Renate Feyl mit Das sanfte Joch der Vortrefflichkeit ein weiteres Buch über eine bedeutende Schriftstellerin des ausgehenden 18. Jahrhunderts vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Renate Feyl
Das sanfte Joch der Vortrefflichkeit
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Renate Feyl
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Renate Feyl
Renate Feyl wurde 1944 in Prag geboren. Nach dem Studium der Philosophie schrieb sie Essays und Romane über bedeutende Persönlichkeiten. Sie veröffentlichte 1977 den Essayband »Bilder ohne Rahmen«, Gespräche mit den Nachfahren berühmter deutscher Wissenschaftler. 1992 erschien »Ausharren im Paradies«, ein Lehrstück von der Deformation, aber auch von der Würde des Menschen unter dem Druck einer Diktatur. »Der lautlose Aufbruch«, elf Porträts über Frauen, deren Leistungen aus der Geschichte der Wissenschaft nicht mehr wegzudenken sind, erschien 1994. »Lichter setzen über grellem Grund«, ein Roman über die berühmteste Porträtmalerin des 18. Jahrhunderts, Elisabeth Vigée-Lebrun, erschien 2011. Renate Feyl lebt als freie Schriftstellerin in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Renate Feyl schildert das Leben der Caroline von Wolzogen (1763-1847) als Schriftstellerin und Schwägerin Schillers. Zwei Dinge prägten das Leben der Caroline von Wolzogen: ihre schriftstellerische Arbeit und die Nähe zu ihrem Schwager Friedrich Schiller. Er liebte die Schwestern von Lengefeld, heiratete Lotte, die Jüngere, wollte dennoch beide immer um sich haben und eine Ehe zu dritt führen – Charlotte für das alltäglich Praktische und Caroline für das geistig Höhere. Caroline musste erfahren, was es heißt, mit einem Genie in der Familie zu leben und an seiner Seite ihren eigenen Weg als Schriftstellerin zu finden. Ihr Roman Agnes von Lilien, der in den Horen vorabgedruckt wurde, erregte großes Aufsehen. Sie wurde von Goethe geschätzt und von Wilhelm von Humboldt bewundert und schuf mit der Biographie über den Schwager die Grundlage für Schillers Nachruhm. Was die Wolzogen in ihrer Schiller-Biografie aus Rücksicht auf Zeitgenossen verschweigen musste, wird in diesem Roman endlich erzählt.
»So leichthändig erzählt, macht Literaturgeschichte endlich wieder Spaß.« NZZ
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1999, Verlag Neues Leben, Berlin
eBook © 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Silke Niehaus, Düsseldorf
Covermotive:
Motiv oben: Gemälde, Auguste Strobl, Zweite Fassung, Residenzmuseum München, Inv. Nr. ResMü. G 372 ©Bayerische Verwaltung der Schlösser, Gärten und Seen.
Motiv unten: © Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut Frankfurt
ISBN978-3-462-31780-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Endlich war ich die Last des Besitzes los. Ich atmete auf. Das Landgut hatte ich verkauft, das Haus aufgegeben und eine kleine Wohnung bezogen, die ich mir bescheiden eingerichtet hatte. Ich brauchte keine Architektenmöbel und keine terrassenförmigen Schaugestelle, die die Bücher so schön zur Geltung brachten. Auch ohne bemalte Stuckdecken und Kassettenplafonds ließ es sich ganz gut leben. Nur bei der Wahl des Ofens hatte ich weder Mühen noch Kosten gescheut und mich für einen buntglasierten Majolikaofen mit breiter Sitzbank entschieden, der nun wie eine Prachtausgabe deutscher Hauspoesie im Raum stand. Auf dem Gesimse hatte ich mein Wappen, das Wappen der Familie von Wolzogen, anbringen lassen, auch um zu zeigen, wie sehr ich diesen Wärmespender schätzte. Gewiß, es konnten sich nur wenige einen Majolikaofen leisten, aber ich war jetzt zweiundsiebzig Jahre alt und wollte für den Rest des Lebens keinen Tag lang mehr frieren müssen.
Ich hätte auch im Weimarer Schloß wohnen können. Die Großherzogin Maria Paulowna hatte mir eine elegante geräumige Wohnung mit Blick auf den Park angeboten, aber ich wollte mich von all dem Hofschnack fernhalten. Einen großen Teil meiner Zeit hatte ich auf Empfängen, Soireen, Diners, Assembléen und Redouten zubringen müssen und bei alldem nichts gewonnen als die Gewißheit, dabeigewesen zu sein. Mit meinem Umzug nach Jena hatte ich mich ein für allemal dieser lästigen Pflichten entledigt. Jetzt besaß ich alles, was ich brauchte: Freiheit und Bequemlichkeit. Es war das Teuerste, was es gab. Mehr Luxus konnte man nicht haben. Es waren die idealen Bedingungen, um in Ruhe an meinem neuen Roman, meiner Cordelia zu arbeiten. Brockhaus, mein Verleger, wartete schon darauf. Die Handlung stand fest, das Ende sah ich bereits klar vor mir, und ich wäre mit dem Schreiben auch gut vorangekommen, wenn mich nicht immer wieder lästige Briefe und Besucher gestört hätten. Und das nur, weil ich eine Biographie über meinen Schwager geschrieben hatte. Vor fünf Jahren war sie bei Cotta erschienen, und nie hätte ich mir träumen lassen, daß Schillers Leben einmal ein so großer Erfolg werden könnte. Es schien, als wollte das Echo auf dieses Buch kein Ende nehmen. Noch immer gab es lobende Rezensionen, die Verkaufszahlen stiegen beständig, die Leserpost türmte sich auf meinem Schreibtisch, und allweil besuchten mich irgendwelche gelehrten Amtsträger: Männer mit wohlklingenden Titeln und transzendentalgrauem Haar, Professoren verschiedener Fakultäten, saßen auf meiner schönen Ofenbank, wollten noch mehr über den Dichter erfahren und stahlen mir die Zeit mit ihren langweiligen Fragen.
Manche kamen auch nur, um mir zu sagen, daß noch keiner so anschaulich über das Leben Schillers geschrieben hatte und daß mit meiner Biographie nun die längst fällige Schillerforschung ihren Anfang nehmen konnte. Vieles klang recht schmeichelhaft, und ich freute mich natürlich, mit meinem Buch die gelehrten Herren Theoretiker aus ihrem wohldotierten akademischen Schlummer geweckt zu haben. Doch wirklich wichtig war mir, daß meine Schillerbiographie die Zustimmung all derer gefunden hatte, die ihn noch persönlich gekannt hatten. Mein guter Freund Goethe, von dem ich wußte, daß er mit allem Vergangenen nur ungern Berührung nahm, hatte sich noch kurz vor seinem Tode von Meyer aus meiner Biographie vorlesen lassen. Auch Wilhelm von Humboldt, der Mann meiner Freundin Li, war begeistert, daß ich Schiller ein so würdiges Denkmal gesetzt hatte. Solche Bestätigungen taten mir gut, hatte ich doch jahrelang an Schillers Leben gearbeitet; mit größter innerer Anspannung und langen Pausen, aber mit dem festen Vorsatz, die Arbeit zu Ende zu bringen, denn ich meinte, dies meinem Schwager schuldig zu sein. Schließlich kannte ich ihn wie niemand sonst, und wer, wenn nicht ich, hätte aus unserer Familie über sein Leben berichten sollen?
Jüngst erst hatte ich in einer Zeitung gelesen, daß Schillers Leben nicht nur zu einer Art Hausbuch geworden war, sondern daß durch die Biographie seiner Schwägerin ein Anlaß gegeben wurde, sich dreißig Jahre nach seinem Tod erneut mit seinen Werken zu beschäftigen.
Einerseits war es traurig, daß erst ein Buch erscheinen mußte, um wieder an ihn zu erinnern. Andererseits konnte es um den Geist der Zeit nicht ganz so kläglich bestellt sein, wenn eine Biographie so anhaltend im Gespräch blieb und alle Welt nun wieder Gedichte von Schiller las. Für gute Poesie war es nie zu spät. So gesehen konnte ich mit der Wirkung zufrieden sein. Denn meist geschah mit den Büchern doch das Umgekehrte: Sie erschienen, funkelten mehr oder weniger hell am literarischen Himmel und waren dann so gründlich vergessen, als seien sie nie geschrieben worden. Auf diese Weise etwas für Schillers Nachruhm getan zu haben, war mir eine besondere Genugtuung, kam dies doch letztlich seinen Kindern, meinen Neffen und Nichten, zugute.
Nur eines ärgerte mich im stillen immer mehr: Daß man meine literarische Kompetenz auf die Tatsache gründete, daß ich Schillers Schwägerin war. Man tat so, als sei darum mein Urteil doppelt glaubwürdig, und jedes meiner Worte verdiene allein deswegen doppelt ernstgenommen zu werden. Schon den Gedanken, daß ich alles, was ich war, allein durch ihn geworden sein sollte, fand ich so kränkend, daß er mir keine Ruhe mehr ließ. Humboldt hatte mir zwar bei seinem letzten Besuch gesagt, ich sollte diesen Stimmen keine Beachtung schenken, denn wer so etwas behauptete, hatte weder einen Roman noch eine Erzählung der Caroline von Wolzogen gelesen. Er wußte nicht, daß sie die Verfasserin der Agnes von Lilien war, sonst hätte er erkennen müssen, daß Schillers Leben nur darum ein so großer Erfolg werden konnte, weil hier eine Dichterin sich einem Dichter näherte – eine Frau, die seinen Geist nur darum so lebendig darstellen konnte, weil sie ihn selber so tief erfaßte. So etwas aus Humboldts Munde zu vernehmen, war zwar tröstlich, zumal er von Jugend an zu meinem Kreis gehört hatte und es besser als jeder andere wußte, aber es milderte meinen Unmut nicht. Nirgendwo ein Hinweis auf die Komposition meines Werkes, auf die ganz eigene Art der Darstellung, auf meine Sprache, meine Sichtweise, auf meine Form der Annäherung – nichts, gar nichts. Als ob sich so ein umfangreiches Lebensbild von selber schrieb, und das nur, weil Schillers Schwägerin es verfaßt hatte. Ich war die letzte, die sich diesen angeblich so ehrenvollen Verwandtschaftsstatus als persönliches Verdienst, ja womöglich gar als ein Privileg angerechnet hätte. Im Gegenteil, die Nähe eines solchen Mannes hätte aus mir nie eine Schriftstellerin machen können. Schließlich konnte sich nur das entfalten, was in einem selber angelegt war. Und wo nichts war, kam nichts zum Vorschein.
Mich regten die Philister und all diese omnigescheiten Piesepampels auf, die herumposaunten, daß die höchste Bestimmung meines Lebens darin bestand, Schwägerin eines Genies zu sein. Dem Abgott so nahe. Von seiner Sonne beschienen. Derlei Zuordnungen konnten nur denen einfallen, die stets nach dem passenden Schlagwort suchten, um sich auf diese Weise in den Ruf eines profunden Kenners der Literatur zu bringen. Aber diese Rezensenten und Zeitungsschreiber wußten nichts, und was sie der Öffentlichkeit darboten, blieb doch immer nur ein Hanswurstgefecht. Ihre Ahnungslosigkeit hätte mich amüsieren können, doch ich wollte nicht zusehen, wie der Name Caroline von Wolzogen nach und nach durch den Titel Schillers Schwägerin ersetzt wurde und meine Leser ein völlig falsches Bild von mir bekamen.
Andererseits fragte ich mich aber auch, ob ich nicht selber meinen Teil dazu beigetragen hatte. Ganz bewußt hatte ich mich in Schillers Leben zurückgenommen, so als hätte ich nie eine eigene Rolle in seinem Leben gespielt. Als wäre ich nie meinen eigenen Weg an seiner Seite gegangen, als hätte ich nie einen eigenen Willen gehabt. Jetzt begriff ich, daß diese falsche Bescheidenheit sich gegen mich kehrte. Schließlich hatte ich keinen geringen Einfluß auf sein Leben gehabt und hätte schon darum in der Biographie ganz anders in Erscheinung treten müssen. Aber ich wollte Rücksicht nehmen. Nein, ich mußte Rücksicht nehmen. Rücksicht auf seine Familie und seine Freunde, die auch meine Familie und meine Freunde waren.
Jetzt, da keiner mehr lebte – meine Schwester, meine Mutter, mein Mann, mein Sohn, meine Freundin – sie alle waren schon gestorben – jetzt war es an der Zeit, dieses falsche Bild von mir zu korrigieren. Schob ich es noch länger hinaus, fand ich nicht die innere Ruhe, die ich für die Arbeit an meiner Cordelia so dringend brauchte. Ich mußte einfach einmal sagen, was verschwiegen worden war und was es hieß, mit einem Genie in der Familie leben zu müssen.
Es war immer dasselbe: das trübe Wetter und die kleine Residenzstadt schlugen gehörig aufs Gemüt. Es gab Tage, da lohnte nicht mal der Blick aus dem Fenster. Alles war so grau verhangen, daß bereits am frühen Morgen der letzte Rest eines freundlichen Gedankens schwand und die Lust zu nichts zum bestimmenden Gefühl wurde. Da kam auch das Leben in den Gassen wie von selbst zum Erliegen, und die Langeweile gähnte aus allen Mauerritzen. An solchen Tagen wurde mir bewußt, was es hieß, in einer Kleinstadt zu leben: von immer den gleichen Gesichtern und immer den gleichen Gesprächen umgeben zu sein, deren einziger Sinn darin bestand, daß alles schon gesagt war, noch bevor man zu sprechen begann. Sich diesen Gesichtern zu entziehen, mißglückte regelmäßig, denn obwohl man ihnen ausweichen wollte, sah man sich an der nächsten Straßenecke wieder. Jeder begegnete jedem, jeder sah alles, und jeder wußte vom anderen. Gerüchte verbreiteten sich schneller als das Fleckfieber, und üble Nachreden hafteten zäh im Gedächtnis der Mitbürger. Geschichten und Vorgeschichte wurden über Generationen mitgeschleppt und meistens demjenigen aufgebürdet, der gar nicht mehr wußte, was er damit zu tun hatte. Die Vorstellung, bis zum Lebensende von Menschen umgeben zu sein, die einen von klein auf kannten und ständig mit den Augen von Onkeln und Tanten betrachteten, hatte etwas Bedrückendes. Schien es doch so, als sei man eingekreist vom Unabänderlichen, was nicht nur das Gefühl der Enge verdoppelte, sondern den Eindruck erweckte, permanent auf der Stelle zu treten und zu keiner Veränderung fähig zu sein. Meine größte Sorge bestand allerdings darin, daß die Kleinstadt allmählich zu einem geistigen Zustand wurde und ehe man sich versah das eigene Denken etwas Provinzielles und Beschränktes bekam. Bei trübem Wetter, so wie heute, war nicht einmal ein Kirchgänger unterwegs. Es hielt auch kein Wagen, und selbst der Postbote verschwand ungesehen im Nebelgrau. An solchen Tagen kam es mir vor, als würde ich hinter der Welt leben, irgendwo im letzten Winkel des Universums, so daß auch mein großes, elegant eingerichtetes Haus, mein eheliches Kastell, wie ein leerer Käfig erschien. Obwohl Rudolstadt eine Landeshauptstadt war mit Fürstenresidenz und Regierungssitz, mit Kammer, Steuerkollegium, Konsistorium und Superintendur, mit Schloß, Burg und Vogelschießen – es änderte nichts an der biederen Langeweile, die hier herrschte. Auch die Festlichkeiten am Hofe, an denen ich regelmäßig teilnahm, boten wenig Abwechslung. Ob Hoheit, Hochwohlgeboren, Hochedelgeboren, oder nur Wohlgeboren und nur Hochgeboren – die meisten kamen mir wie verdorrte Ofensitzer vor, von denen alles, außer Neues, zu erwarten war.
So nahm ich denn wieder einmal meinen Hund Grigri an die Leine und ging zu meiner Schwester. Lotte wohnte im Haus der Mutter gleich nebenan, und es verging fast kein Tag, an dem wir uns nicht sahen. Seit dem Tod unseres Vaters verbrachte die werte Frau Mama die meiste Zeit des Tages am Hofe, so daß Lotte viel allein war und ich die Pflicht fühlte, mich um meine kleine Schwester zu kümmern. Lotte war einundzwanzig Jahre alt, brav und recht hübsch und galt als das Musterbild einer wohlerzogenen Baronesse. Man hätte auch sagen können, daß sie lieb und ein wenig verhuscht war – still, zurückhaltend und immer froh, wenn ein anderer für sie das Wort ergriff. Vor Autoritäten schien sie einen angeborenen Respekt zu haben, denn sie bewunderte jeden, der ein höheres Amt bekleidete oder den ein klingender Titel schmückte. Darum maß sie auch allen Ereignissen am Hofe eine große Bedeutung bei und war der erklärte Liebling der Mama. Besonders gern nahm Lotte den Rat von Älteren an, weshalb auch Frau von Stein, ihre Patentante, nichts auf ihr geliebtes Lottchen kommen ließ und beide sich häufig besuchten.
Obwohl meine kleine Schwester bisher kaum einen Ball oder sonst ein Hoffest versäumt hatte, war ein Verehrer, geschweige denn Bewerber, noch immer nicht in Sicht, was eine gewisse Unruhe bei ihr auslöste und sie fast noch scheuer machte. Sie meinte, den Männern nicht zu gefallen, und fürchtete sich mittlerweile, darauf angesprochen zu werden. Natürlich tat sie, als würde sie diese Frage nichts angehen, da sie sich ausschließlich mit schönen und erhabenen Dingen beschäftigte. Mit mir jedoch sprach sie viel darüber, und wir machten uns gemeinsam Gedanken, wen sie heiraten könnte. Für sie war ich besonders glaubwürdig. Schließlich war ich drei Jahre älter, immerhin schon verheiratet, wenn auch nicht rauschend glücklich, so doch wenigstens wohlhabend und noch dazu mit einem Legationsrat, was Eindruck auf sie machte. Ich führte ein eigenes Haus, gab Gesellschaften und hatte Zeit genug, meinen Tag mit schöngeistigen Dingen zu verbringen. Außerdem hatte ich schon in der Pomona etliche Geschichten veröffentlicht, die Anklang fanden und mich in den Augen der Schwester zu einer hoffnungsvollen Autorin machten. Ich bezog drei Literaturzeitschriften im Abonnement, war in derlei Gefilden stets auf dem laufenden, kannte mich aus in Kunst und Philosophie, und darum ließ Lotte sich in diesen Dingen ganz von meinem Urteil leiten. Immer hörte sie mir gelehrig zu, und ich war froh, jemanden zu haben, mit dem ich darüber sprechen konnte. Für Lotte war ich nun mal die große und erfolgreiche Schwester, und das ließ ich mir gerne gefallen.
Diesmal brachte ich ihr die neuste Ausgabe des Teutschen Merkur mit. Zu wissen, was in der musischen Welt vor sich ging, gehörte für Frauen unseres Standes nicht nur zum guten gebildeten Ton, sondern das waren wir unserer Herkunft einfach schuldig. Ihre Katze Toutou, eine aschgraue weichhaarige Kartäuserkatze, wartete schon sehnsüchtig auf Grigri, meinen Dachshund, und nach einer fauchenden und bellenden Begrüßung tobten sie wie immer gemeinsam durch Haus und Garten. Lotte hatte schon die Staffelei aufgestellt, denn wir wollten uns im Porträtzeichnen üben, was bei diesem trüben Dezemberwetter ein guter Zeitvertreib war. Für heute hatten wir uns die Schraffiertechnik vorgenommen. Wischkreide und Wischer lagen schon bereit. Gerade als ich auf dem schönen neuen Mahagoniholzstuhl Platz nahm und mich als Modell in Positur setzte, meldete der Diener die Ankunft des Herrn von Wolzogen.
Die Freude hätte nicht größer sein können. Kaum daß wir unserem Cousin entgegeneilen wollten, stand er schon vor uns, und es schien, als wäre mit ihm ein Hauch von großer Welt in die Stube gekommen. Strahlend und gewandt, elegant in der Kleidung, elegant im Ausdruck, witzig und beweglich – typisch unser Wilhelm. Er hatte zwar das Baufach studiert, interessierte sich aber für so ziemlich alles, und da er in der Gunst des Herzogs von Württemberg stand, war mir um seine Zukunft nicht bange. Er machte sich einen Jux daraus, uns englisch zu begrüßen, dachte, er könnte seine Cousinen aus der Provinz damit in Verlegenheit bringen, aber da ich Shakespeare im Original las, nahm ich den Faden auf, und wir führten Lord William fröhlich in den Salon.
Wilhelm war nicht allein gekommen. Draußen wartete ein Freund, und er fragte, ob wir ihn empfangen würden. Jede Abwechslung und jedes neue Gesicht war willkommen. Wilhelm hielt es für nötig, uns darauf vorzubereiten, daß es sich um einen Dichter handle. Er war zwar nicht von Stand, bloß der Sohn eines einfachen Leutnants, kam also aus ganz kleinen, niederen Verhältnissen, aber er war grundgescheit und zudem amüsant und unterhaltsam. Er hatte bereits vier Theaterstücke geschrieben, war aus Württemberg geflohen und befand sich auf der Durchreise nach Weimar. Derzeit nannte er sich Dr. Ritter, doch in Wirklichkeit hieß er Friedrich Schiller. Wir sollten aber nicht darüber reden.
Das war eine tolle Überraschung. Natürlich wußte ich, wer er war, und dachte gleich an die Räuber, die ich gelesen hatte. Was waren da für Sätze gesagt! »Mich ekelt vor diesem tintenklecksenden Säculum.« »Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit.« »Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus.« Das hatte bislang noch keiner auf der Bühne zu sagen gewagt. Das klang nach Aufruhr und Ungehorsam. Da brach mal einer die Enge auf; ein Poet, dem alles Bestehende zu dumpf, zu klein, zu jämmerlich war. Ein Mann mit Empörergeist – wie sollte man den nicht kennen! Und jetzt stand er auch noch an der Tür. Es war aufregend, einmal einen echten Rebellen im Salon empfangen zu können. Noch dazu im Hause meiner Mutter. Im unbescholtenen, tugendhaften und angesehenen Hause von Lengefeld. Das war hier noch nicht vorgekommen.
Innerlich stellte ich mich auf einen wilden, ungebärdigen Mann ein, der in Kurierstiefeln und mit Hetzpeitsche erschien. Einen kraftstrotzenden Aufwiegler mit Heldenstatur. Auch machte ich mich auf ein rohes, respektloses Betragen gefaßt, vor allem auf Spitzen gegen die satte, privilegierte Adelsbrut, und sah mich schon in Auseinandersetzungen geraten und genötigt, ihm ordentlich Paroli zu bieten. Doch dann, als er Augenblicke später den Salon betrat, war ich fast ein bißchen enttäuscht. Blaß und hohlwangig stand der Räuberdichter vor mir. Er machte einen bescheidenen, ja fast schüchternen Eindruck. Das Haar kurz, der Kragen offen, die Kleidung schlicht. Die ärmlichen Stahlknöpfe an seinem mausgrauen Rock verrieten, wer er war: ein stolzer Habenichts. Wolzogen stellte ihn uns in seiner gewandten Art vor: »Meine Cousinen«, sagte er. »Frau Vizekanzler von Beulwitz und ihre Schwester, Lotte von Lengefeld.« Wir lächelten ihm zu, und da ich bemerkte, daß der Dichter fröstelte, sagte ich: »Ihre Reise war sicherlich anstrengend. Jetzt trinken wir erst mal einen heißen Rum-Kaffee.« Ich läutete dem Diener und bat den Tisch zu decken. Nicht mit irgendeinem alltäglichen Geschirr, sondern mit dem silbernen Kaffeeservice der Frau Mama. Schließlich sollte er sehen, für uns war auch ein verfolgter Mann ein ehrenwerter Gast. Mir fiel auf, daß er sich nicht neugierig umschaute und keine Inspektoraugen bekam, wie so mancher, der in diesem Raum gestanden hatte. Vielmehr erweckte es den Anschein, als sei es ganz selbstverständlich für ihn, in adligen Häusern empfangen zu werden. Er sagte nichts, fragte nichts und lächelte nur. Daß ein Mann, der dem Publikum aufrührerische Sätze entgegenschmetterte, ein so artiges Betragen haben konnte, hätte ich mir nie träumen lassen.
Als die Kaffeetafel gedeckt war und für eine behagliche, fast festliche Atmosphäre sorgte, schien Schiller sichtlich beeindruckt. Teller mit Hirschhornkuchen und Fettkrapfen, Rosinenwecken und vierteilig geflochtenen Nikolauszöpfen – alles sah üppig und stimmungsvoll aus. Wir nahmen den Rebellen in die Mitte, forderten ihn auf, zuzulangen, und da er sich nicht recht traute, sagte Wilhelm, daß nirgendwo so guter Kuchen gebacken werde wie in Thüringen, und belud ihm fröhlich den Teller. Jetzt bedauerte ich es, daß ich damals mein Exemplar der Räuber an den Kronprinzen verschenkt hatte, weil ihm die Titelvignette so gut gefiel – der Löwe mit erhobener Pranke und darunter der Schlachtruf »In tirannos«. Jetzt wäre es eine schöne Geste gewesen, das Buch aus dem Schrank holen zu können und den Autor um eine Widmung zu bitten. Das eigene Buch zu signieren, tat schließlich jedem Dichter gut. Um ihm etwas die Scheu zu nehmen, aber auch um zu zeigen, daß wir in Sachen Literatur und schöner Kunst auf dem laufenden waren, sprach ich ihn auf die Rezension des Don Carlos an, die ich gerade im Merkur gelesen hatte, und sagte: »Sie können sich etwas einbilden auf das Urteil Wielands, denn nicht mit jedem meint es der alte Kritikus so gut.«
Er gab mir recht, und ich spürte, daß ein gleichgestimmter Ton getroffen war, der die Unterhaltung in Bewegung brachte. Sein Frösteln ließ nach. Der Rum-Kaffee tat seine Wirkung. Natürlich wollte ich nicht neugierig sein, aber warum ein so bekannter Bühnendichter aus dem schönen Schwabenlande fliehen mußte, interessierte mich nun doch. Es war erstaunlich, wie gelassen er darüber sprach. In den Räubern hatte er Graubünden als das Athen der Gauner bezeichnet. Einige Lokalpatrioten hatten daran Anstoß genommen, sich bei Herzog Karl-Eugen beschwert, und der hatte ihm daraufhin bei Strafe der Festungshaft jede weitere schriftstellerische Arbeit verboten. Fast amüsiert fügte Schiller hinzu: »Der muß erst noch geboren werden, der mir das Schreiben verbieten kann.«
Mochte er auch aus ganz kleinen Verhältnissen kommen – ein Mangel an Selbstbewußtsein ließ sich jedenfalls nicht feststellen. Ich sah, wie Lotte hingerissen jede Geste von ihm verfolgte, und auch mir gefiel der hagere Rebell mit jedem Satz, den er sprach, immer mehr. Als Wilhelm dann noch erzählte, daß seine Mutter auf dem Gut in Bauerbach Schiller für längere Zeit versteckt hatte, wurde es geradezu aufregend. Plötzlich wurden alle an unserer Tafel zu seinen Komplizen, der Salon zum Verschwörernest, und über allem schwebte der prickelnde Hauch des Verbotenen. Unser Gespräch wurde immer spannender. Heute wußte er noch nicht, was morgen auf ihn zukommen würde. Alles war möglich. Ob für Zeitschriften, für einen Verleger oder für die Bühne – Hauptsache, er konnte schreiben, konnte dem Pegasus die Sporen geben und dem Unverstand heimleuchten.
Wir hörten ihm fasziniert zu. Wilhelm hatte recht: Sein Freund war kein Langweiler. Er unterhielt uns prächtig. Die Zeit schien mir schon lange nicht mehr so schnell vergangen zu sein. Als es zu dämmern begann, drängte Wilhelm zum Aufbruch, denn sie wollten nicht zu spät in Weimar eintreffen. Schillers Verehrerin, Frau von Kalb, hatte ihn für den kommenden Tag zum Essen gebeten. Danach war er bei Wieland zu Gast. Hofrat Bode und Konsistorialrat Herder erwarteten ebenfalls seinen Besuch. Alle wollten die Bekanntschaft des aufsteigenden Dichters machen. Doch wirklich zu beneiden war Wilhelm. Er fuhr anschließend weiter nach Paris und kündigte mir an, daß ich demnächst Post aus der Hauptstadt des Universums bekommen werde. Das klang verheißungsvoll. Lotte gab jedem ein Päckchen Kuchen mit.
Gleich, wo sie abstiegen – ein kleiner Reiseproviant konnte nicht schaden. Schiller bedankte sich für diese aufmerksame Geste und bedauerte, daß er uns so schnell verlassen mußte.
Seit dieser Begegnung dachte ich viel über meine Ehe nach, um die mich so manche Frau in der Residenz beneidete. Herr von Beulwitz stammte aus einem sehr wohlhabenden Hause, hatte mit dreiunddreißig Jahren schon das Amt des Vizekanzlers inne und stand am Hofe in hohem Ansehen. Er war eine durch und durch gutmütige Natur und großzügig in allen Geldangelegenheiten. In seiner Umgebung sollte keiner das Gefühl haben, sich Einschränkungen unterwerfen zu müssen. Beulwitz wollte von zufriedenen Menschen umgeben sein, die ihm seinen Blick auf die beste aller Welten nicht trübten. So sorgte er geradezu aufopfernd für Verwandte, Freunde und deren Freunde und half ganz selbstverständlich aus, wenn einer von ihnen in Zahlungsschwierigkeiten geriet. Doch nicht nur ihm und seiner Familie sollte es gutgehen. Er wollte das ganze Land in Wohlstand sehen, und daher sah er es als seine vornehmste Aufgabe an, einen geordneten Finanzhaushalt zu schaffen, gemäß seiner Lieblingsmaxime: Wo die Finanzen stimmen, stimmt alles.
Sehr früh am Morgen verließ er das Haus, und von da an war jede seiner Stunden bis ins letzte eingeteilt. Vormittags gab es die Besprechungen mit den Ministern, Präsidenten und Direktoren, den Kriegs-, Domänen-, Kammer-, Kabinetts- und Amtsräten. Danach diktierte er die Berichte für den Kanzler, der sie Fürst Friedrich Karl übergab. Zwischendurch konferierte er noch mit seinen Sekretären und den Fiskal-Advokaten. Währenddessen warteten in seinen drei Vorzimmern bereits die Repräsentanten der Zünfte. Mit ihnen beriet er die neusten Entwicklungen im Kommerz-, Fabrik- und Manufakturwesen. Kurz vor Dienstschluß empfing er meist noch die Deputationen aus der Bürgerschaft, die ihre Anliegen und Beschwerden dem Vizekanzler persönlich vortragen wollten. Den ganzen Tag über schien er von einem nicht enden wollenden Gerede umgeben zu sein. Kam er abends nach Hause, wollte er nur noch eins: in Ruhe in seinem Fauteuil sitzen und nicht mehr reden müssen. Den ganzen Tag lang freute er sich auf diese Stunden, denn zu Hause war er erst, wenn er schweigend und ungestört das Wochenblatt lesen konnte. Dann war er ein zufriedener Mensch.
Genau hier aber lag das Problem. Mag sein, daß ich seine Verdienste für unser liebes kleines Bergland nicht hoch genug schätzte. aber sein ewiges Schweigen war mir unerträglich. Es fing schon morgens beim Frühstück an. Immer mußten die Fenster geschlossen und die Vorhänge zugezogen sein, denn der Tag sollte nicht mit jäher Helligkeit über ihn hereinbrechen, sondern im dämmrigen Licht beginnen. Das erleichterte ihm den Übergang ins Wachsein. Mich machte es wahnsinnig, morgens im Halbdunkel sitzen zu müssen, denn ich kam mir jedesmal wie hinter der Welt begraben vor. Nie betrat er einmal fröhlich den Raum. Immer schlurfte er schwerfällig und lustlos an den Frühstückstisch, aß schweigend sein Rührei, trank dazu eine Tasse Hammelbrühe und las die Zeitung. Immer sah er griesgrämig und verschlossen drein. Daß da noch die Frau am Tisch saß, die mit ihm aufgestanden war, schien er gar nicht zu bemerken.
Hatte er gegessen, erhob er sich schwerfällig, drückte mir einen steifen Kuß auf die Stirn und begab sich ins Amt. Allerdings legte er mir jedesmal reichlich Bares auf den Tisch und sagte im Gehen: »Mach dir einen schönen Tag.« Diese sparsam abgepreßten Laute erinnerten mich daran, daß ihn die Natur mit einer Stimme ausgestattet hatte, was unter diesen Umständen fast schon einer erfreulichen Entdeckung gleichkam. Freilich meinte er mit »schönem Tag« nichts anderes, als daß ich zum Schneider gehen und mir Kleider machen lassen sollte. Dabei drängten sich in meinen Schränken die eleganten Roben, und ich fragte mich, ob ich je die Gelegenheit bekommen würde, sie alle auszuführen. Außerdem war es keine Freude, die Zeit beim Tailleur, einem vornehm tuenden Fettsack zu verbringen, der mich mit Maßband und lüsternen Blicken umschlich. Da wußte ich meine Zeit besser zu nutzen. Ich las und schrieb an einer größeren Geschichte, die ein Roman werden sollte.
Kam Beulwitz abends nach Hause, wiederholte sich die morgendliche Zeremonie. Ich bekam wieder meinen steifen Kuß auf die Stirn, dann setzte er sich sichtlich ermüdet an den Tisch, trank eine Tasse Hammelbrühe, und dies mit der gleichen griesgrämig verschlossenen Miene, mit der er den Tag begonnen hatte. Obwohl ich wußte, daß er nichts weiter als seine Ruhe und sein Wochenblatt wollte, fragte ich dennoch, wie es im Amt gewesen war, und er entgegnete unwirsch: »Wie soll es schon gewesen sein?« Ich konnte mir nicht vorstellen, daß sich bei diesem vielbeschäftigten Mann im Laufe des Tages nichts Erwähnenswertes ereignet hatte, und sagte: »Hat es denn nichts Neues gegeben?« Und er antwortete, als müßte er einem unliebsamen Ritual folgen: »Immer dasselbe. Hier gibt es nichts Neues.« Da ich keine Lust hatte, mich seiner Einsilbigkeit zu fügen, begann ich zu erzählen, was ich tagsüber gelesen hatte. Wie immer unterbrach er mich nach den ersten Sätzen und meinte ohne aufzuschauen: »Hauptsache, es hat dich amüsiert.« Als fürchte er, noch eine weitere Silbe hinzufügen zu müssen, begab er sich in sein Kabinett. Ich aber saß Abend für Abend am Kamin, streichelte Grigri, meinen allerliebsten Dachshund, der neben mir im Fauteuil lag, und monologisierte still vor mich hin. In so einer Ehe konnte man schon recht einsam sein.
Sicherlich war auch er nicht glücklich, eine Frau zu haben, für die gerade das Wort – ob in gesprochener oder geschriebener Form – einen so großen Stellenwert besaß. Ich wußte, daß ich keine schöne Frau war und nichts an mir hatte, was die Blicke auf sich zog. Erst im Gespräch rückte ich meine Natur zurecht und entwarf mich so, wie ich sein wollte. Diese Chance nahm er mir. Aber vielleicht war ich auch nur undankbar. Er war tüchtig und angesehen. Was wollte ich mehr?
Natürlich konnte ich mit keinem offen darüber reden. Lotte kannte zwar die allgemeine Situation, aber ich wollte sie nicht mit den Details vor der Zeit ängstigen. Meine beste Freundin, Li Dacheröden, hatte im Augenblick genug mit sich selbst zu tun. Sie mußte eine schwierige Wahl zwischen zwei Männern treffen. Mit meiner Mutter darüber zu reden, war sinnlos, denn sie hätte mich nicht verstanden. Schließlich hatte sie den tapsigen Bären, den Ursus Beulwitz, als gute Partie für mich ausgesucht. Und jedesmal, wenn er ihr aus Finanznöten half, war sie aufs neue von ihm entzückt und dankte dem Himmel, daß er uns den Herrn von Beulwitz geschickt hatte. Um des lieben Friedens willen widersprach ich ihr nicht. Nachts ringelte ich mich in meinem Bett zusammen und träumte, mein wohlhabender Ehemann sei eine Gipsbüste und stünde auf dem Vertiko. Ich hätte ihm gern einen Lorbeerkranz aufgesetzt, wenn mir so seine Gesellschaft erspart geblieben wäre.
Allerdings hatte seine Teilnahmslosigkeit auch gewisse Vorzüge. Ich dachte nicht daran, den ganzen lieben langen Tag auf den Eheherrn zu warten, nur um dann von ihm mit ein paar kümmerlichen Wortkrumen abgespeist zu werden. Vielmehr richtete ich mich in meiner Selbständigkeit ein. Manchmal besuchte ich auch Hofrat Wieland oder Knebel in Weimar, oder ich fuhr mit Lotte zu Frau von Stein zum Gut Kochberg hinauf, wo wir des öfteren mit Goethe zusammentrafen. Ich nutzte jede Gelegenheit, um eine Gesellschaft zu geben und veranstaltete freitags regelmäßig Assembléen. Es kümmerte mich nicht, ob es dem Ursus recht war. Ich verschickte die Einladungen, und – das mußte ich ihm zugute halten – es freute ihn, daß ich sein Haus mit Gästen füllte.
Alles wäre wohl zu ertragen gewesen, wenn ich nicht gespürt hätte, wie mir in dieser Situation die Lust zum Schreiben mehr und mehr abhanden kam. Ich dachte zwar viel über mein Romanvorhaben, die Geschichte der Agnes von Lilien nach, aber ich brachte nichts zu Papier. Oft träumte ich, die Worte flögen mir zu, und aller Sinn fiele von selber aufs Papier. Doch ich kam über diese schöne Vorstellung nicht hinaus. Sobald ich mich an den Schreibtisch setzte, waren meine Gedanken immer dort, wo sie nicht sein sollten. Sie führten von meiner Romanfigur fort, irrten umher, und am Ende dachte ich wieder nur über meine Ehe nach. Daß ich dieses wortlose Nebeneinander noch in zwanzig Jahren ertragen mußte, erschreckte mich so sehr, daß mir der Sinn fürs Erzählen gründlich abhanden kam. Mich zur Konzentration zu zwingen, wäre vergebliche Mühe gewesen. Schreiben hatte etwas mit Stimmung zu tun, und war die schlecht, brauchte ich gar nicht erst die Feder in die Hand zu nehmen. Schreiben durfte nichts krampfhaft Gesuchtes, nichts Gewolltes an sich haben. Die Gedanken mußten wie von selber kommen, sich andrängen und so stark sein, daß alles andere unwichtig wurde. Letztlich war doch jeder gelungene Roman ein Notizbuch der Seele. Doch meine Seele war, wenn ich an die Zukunft mit Ursus dachte, wie mit Brettern vernagelt, so daß mir kein Stückchen Prosa gelingen wollte.
Aus dieser Stimmung riß mich ein Brief. Er kam mit Estafette, was auf Gewichtiges und Dringliches schließen ließ und stets die Nachbarn ans Fenster trieb. Ich brauchte nicht auf den Absender zu schauen, um zu wissen, daß der Rebell geschrieben hatte. Er bat mich und das verehrte Fräulein Schwester, ein Quartier für ihn zu besorgen, denn er wollte in dieser schönen Gegend einen Arbeitssommer verbringen. Ich beriet mit Lotte, was wohl für ihn in Frage kam. Es war gar nicht so einfach, etwas Geeignetes zu finden. Das Quartier durfte nur wenig kosten, mußte an einem ruhigen Ort liegen, und wenn man wie er den ganzen Tag am Schreibtisch saß, sollte es auch möglichst eine schöne Aussicht haben. Lotte meinte allerdings, noch wichtiger als all das sei der Mittagstisch. Schließlich brauchte ein Dichter, der so anstrengende Kopfarbeit leistete, seine regelmäßigen Mahlzeiten. Täglich im Gasthof zu essen, war viel zu teuer und zudem auch zeitaufwendig. Mir fiel Kantor Unbehaun in Volkstedt ein, der Gästezimmer nebst Mittagstisch anbot.
Noch am selben Tag machten wir uns auf den Weg, um mit ihm über das Quartier zu verhandeln. Stube und Kammer waren eng, aber sauber, hatten Morgen- und Abendsonne, die Aussicht auf die Saale war ganz passabel, die Miete günstig und der Mittagstisch preiswert. Zudem war es vom Beulwitzschen Hause in einer halben Stunde Fußweg zu erreichen. Aus Dankbarkeit, daß so hohe Herrschaften bei ihm einquartieren ließen und so zur Verbreitung seines guten Rufes als Quartiergeber beitrugen, bot Kantor Unbehaun zusätzlich zu den üblichen Mahlzeiten noch etwas Besonderes an. Da er den Schankwirt des Ortes gut kannte, konnte er, dem Wunsch des Gastes entsprechend, für guten Gerstensaft sorgen: ein halbes Stübchen Stadtbier für elf Pfennige, böhmisch Hopfenbier für 13 Pfennige oder ein Doppelbier für 15 Pfennige. Der Gast der Frau Vizekanzler von Beulwitz sollte bei ihm über nichts zu klagen haben.
Ich schrieb Herrn Schiller, daß wir ein Quartier für ihn gefunden hatten, das seinen Wünschen entsprechen dürfte, und bereits mit der ersten warmen Aprilsonne traf er in unserem famosen Herzogtum Schwarzburg-Rudolstadt ein. Bevor er sein sommerliches Refugium bezog, bat er um die Gnade, ihm einen Tag zu bestimmen, wo er mich und das Fräulein Schwester besuchen durfte. Der bescheidene Ton gefiel mir, obgleich ich ihn mir ganz gerne etwas renitenter gewünscht hätte. Da wir uns um seine Unterkunft bemüht hatten, gab es keinen Grund, ihm die »Gnade eines Besuches« zu verweigern. Lotte konnte meine Frage, ob sie irgendwelche Einwände hätte, überhaupt nicht verstehen. So bestimmte ich ihm einen Tag, an dem ich ihn zu einem kurzen Antrittsbesuch in mein Haus bat.
Natürlich waren wir brennend neugierig zu sehen, wie er sich beim Kantor eingerichtet hatte. Um nicht aufdringlich zu erscheinen, ließen wir zwei Tage vergehen, aber gleich danach statteten wir Herrn Schiller einen Gegenbesuch ab. Als wir seine Stube betraten, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen, denn er hatte so gut wie nichts verändert. Auf dem Tisch lag lediglich ein Stapel von Rezensionsexemplaren, die der Bote gerade gebracht hatte. Keine Kiste, kein Koffer, kein Mantelsack. Nur ein kleiner Dachsranzen stand herum, in dem er wohl etwas Proviant, Papier und sein Schreibzeug verwahrte. Vielleicht war es ja Rebellenart, sich ohne alles in die Welt zu begeben. Möglicherweise reiste so ein Mann, der immer auf der Flucht war. Ich hatte so etwas jedenfalls noch nicht erlebt. Lotte fand es aufregend, daß er auf all das verzichten konnte, was anderen unentbehrlich schien. Nur gut, daß wir unsere Mama nicht überredet hatten, uns zu begleiten. Sie hätte bei diesem Anblick sicherlich nur einen einzigen Satz gesagt: »Wer nichts hat, kann auch nichts mitnehmen.« Lotte schielte in den Dachsranzen, als hoffte sie darin eine Pistole zu entdecken, spähte im Zimmer umher, als suche sie nach Verbotenem, nach irgend etwas, das Verdacht erregte, aber außer dem Bücherstapel auf dem Tisch konnte sie nichts entdecken. Mehr als mit Schiller unterhielt ich mich mit dem Kantor. Da Damenbesuch bei einem Logiergast nicht gestattet war, tat ich so, als seien wir vom Hofe geschickt, um uns nach dem Gast zu erkundigen. Das schien ihm so glaubwürdig, daß er uns beide noch zu sich einlud und mit Kaffee bewirtete.
Seit dieser Kurzvisite wechselten Briefe hin und her, und wir verabredeten uns zu Ausflügen in die Umgebung. Natürlich wäre es unschicklich gewesen, mich als verheiratete Frau allein mit einem jungen Mann zu zeigen. Die unkenden Klatschmäuler hätten es in Windeseile in alle Himmelsrichtungen verbreitet, denn die Frau des Vizekanzlers hatten sie alle im Blick. So nahm ich zu unseren Treffen Lotte mit. Sie war nicht nur mein Alibi, sondern konnte auch meisterhaft zuhören, was sich für anschließende Auswertungen stets als wichtig erwies. Sie merkte sich alles, was gesprochen wurde, und vermochte oft noch nach Wochen Passagen aus einer Unterhaltung fast wörtlich wiederzugeben. Damit stand die Arbeitsteilung bei der Betreuung unseres Sommergastes fest: Lotte lauschte, und ich nutzte die Gelegenheit, um all die Gedanken, Urteile und Ansichten, die sich in meiner dialoglosen Ehe aufgestaut hatten, auszusprechen. Jedesmal ließ ich einen Picknickkorb packen, erleichterte dabei Herrn von Beulwitz um eine Flasche Burgunder – einen der besten Tropfen, die in seinem Weinkeller lagerten – und brach dann mit Lotte auf. Schiller kam uns meist schon auf halbem Wege entgegen. Wir hatten einen geheimen Ort vereinbart, wo wir ungestört sein konnten. Grigri erspähte den einsamen Wanderer schon von weitem und lief ihm bellend entgegen. Am Saaleufer breiteten wir dann eine Decke aus, ließen uns zum Picknick nieder und redeten ganz allgemein von Gott, der Welt und dem Schnupftabak. Doch schon nach dem ersten Treffen wollte ich es genauer wissen, wollte erkunden, wie er dachte und ob er auch wirklich so belesen und gebildet war, wie ich gerne glauben wollte. Ich schwang mich hoch hinauf, schwärmte vom dreiundzwanzigsten Gesang der Ilias, schilderte den Genuß bei Platons Gastmahl, schwenkte zu den neueren Philosophen hinüber, streifte mit einer Seitenbemerkung Voltaire, den ich nicht besonders schätzte, weil er mit seinem Witz über alles hinwegglitschte, und kam endlich zu Kant, meinem verehrten Apollo Immanuel, auf den ich nichts, aber auch gar nichts kommen ließ.
Genau das war es, was ich so nötig brauchte: Satz für Satz ein Tanz der Worte, von dem ich wußte, daß ich ihn beherrschte und damit die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken vermochte. Es war nun mal meine ganz eigene Art, mit dem Taftkleid zu rauschen, und ich spürte voller Genugtuung, mit welcher Bewunderung er mir zuhörte. Vor allem genoß ich es, einmal zeigen zu können, daß es zwei weibliche Wesen gab, die zwar hinter den Bergen wohnten, aber doch in der Welt zu Hause waren. Der heilige Homer, Plato und Kant – nichts Geringeres interessierte uns, und wann bot sich schon einmal eine solche Gelegenheit, mit seinem Wissen zu paradieren? Mehr aus Koketterie denn aus ernsthaftem Interesse fragte ich Schiller, ob er im Gegensatz zu meiner Schwester und mir zum Kern aller Erkenntnis vorgedrungen sei und uns sagen könne, wie die Urteile a priori und die Urteile a posteriori zustande kämen. Als ich hörte, daß er die neuste Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft noch nicht besaß und daher auch noch nicht gelesen hatte, versprach ich ihm, diesem Mangel abzuhelfen. Schließlich hatte ich freien Zugang zur Hofbibliothek und konnte mir jederzeit Bücher ausleihen.
Vor allem aber war ich froh, daß der Bibliothekar inzwischen die Ausgaben des Fiesco und des Don Carlos besorgt hatte, denn wenn man die Arbeiten eines Dichters kannte, konnte man sich gleich viel besser mit ihm unterhalten. Außerdem war ich neugierig auf die dramatischen Arbeiten, die er seit den Räubern zu Papier gebracht hatte. Gelang es doch nur selten, mit einer zweiten Arbeit an den Erfolg der ersten anzuknüpfen. Was ich dann jedoch las, beeindruckte mich. Der Rebell hatte sich ins Philosophische gesteigert. Ich brauchte ihn nicht mehr für die Kantschen Gedanken zu begeistern, er hatte sie bereits in seinen Figuren umgesetzt.
Es sprach mir aus der Seele, wie er die Bestimmung des Menschen sah. Wir waren nicht geboren, um als ewig wimmernde Klopse unsere Umstände zu beklagen, sondern konnten uns über sie erheben und sie selber gestalten. Wir waren nicht die ohnmächtigen, passiven, allem ausgelieferten Wesen, sondern Akteure, die geistige Fähigkeiten besaßen und mit ihrem Denken sich selber bestimmten. Wir konnten uns hinaufarbeiten zu unseren Möglichkeiten, auch unsere kleinsten Talente entwickeln und mit dem Gebrauch der eigenen Vernunft uns die Freiheit schaffen, zu der wir geboren waren. Das war ein großer, idealer Daseinsentwurf, der mich begeisterte. Denken statt lamentieren. Sich selbst bestimmen und sich die Freiheit schaffen, zu der man geboren war. Das klang stolz und hochgestimmt. Was ich da las, war ganz in meinem Sinne, nur daß ich es nicht so ausdrücken und gestalten konnte. Ich sah die trüben Funzeln vor mir, die um Beulwitz herumscharwenzelten, die keinen eigenen Gedanken an ihre Bestimmung verschwendeten und nur ein höheres Amt, einen wohlklingenderen Titel und eine bessere Dotation anstrebten. Ich hörte die immer gleichen Gespräche über rüpelige Kutscher, impertinente Nachbarn, faule Diener, unglückliche Ehen, mißratene Söhne und unverschämte Advokaten. Und nun war jemand aufgetaucht, der einmal Töne anstimmte, die sich von dem ewig kleinen Lebensgeklimper wohltuend abhoben. Das übertraf alle Erwartungen.
Vor unserem nächsten Treffen packte ich einen Württemberger Trollinger und als Delikatesse eine Göttinger Wurst in den Picknickkorb und eilte ihm mit Lotte entgegen. Ich konnte es kaum erwarten, meine Begeisterung loszuwerden. Was mir bei Kant gefiel, hatte ich in Schillers jüngsten Arbeiten gefunden: aufsteigen zu sich selbst und begreifen, daß das Sein des Menschen sein eigenes Produkt ist. »Helden wie Marquis von Posa zu zeigen, die nicht immer alle Schuld beim anderen suchen, sondern den Mut haben, für sich selbst zu stehen«, sagte ich, »das tut not. Die meisten, die ich kenne, führen doch nur den Willen eines anderen aus, selige Fahnenträger, die nichts lieber tun, als sich zur Stimme ihres Herrn zu machen, und nur von der einen Angst geplagt sind, irgendwann ihren eigenen Verstand gebrauchen zu müssen.«
»Sie sprechen vom Pöbel«, entgegnete er. »Der Pöbel verbreitet sich überall und gibt zum Unglück den Ton an. Zu kurzsichtig, um das Ganze zu ermessen, zu kleingeistig, um Großes zu begreifen, zu boshaft, um Gutes zu wollen.« Ich stutzte einen Moment, weil er das Wort »Pöbel« so unbekümmert gebrauchte. Doch dann bemerkte ich, daß er damit eine geistige Haltung beschrieb, die quer durch alle Stände ging, und stimmte ihm zu. »Ein selbstbestimmter Mensch ist ein tüchtiger Mensch. Auf den muß man setzen«, sagte ich. »Wer Verstand hat und ihn nicht zu benutzen weiß, der mag meinetwegen zum Pöbel gehören. Auf jeden Fall muß man dagegen angehen.«
»Das ist Illusion«, meinte er. »Da mögen noch so viele Freunde der Wahrheit zusammenstehen. Da könnten Himmel und Erde verschleißen wie ein Kleid. Der Pöbel hört nie auf, Pöbel zu sein.« Ich sah das nicht ganz so pessimistisch. »Es ist Sache der Kunst, immer wieder daran zu erinnern, daß keine Notwendigkeit besteht, sich zum Wurm zu machen«, sagte ich. »Aber wer es tut, der soll sich nicht wundern, wenn er getreten wird.«
»Das versuche ich ja ständig«, entgegnete er. »Der Pöbel kann schreien, aber er kann meine Absicht nicht vereiteln. Der Mensch muß endlich dahin kommen, daß er seinen Wert fühlt. Künstler, Philosophen und Dichter können ihm dabei behilflich sein. Nur im denkenden Selbst, in der Vernunft liegen die Kräfte, die die Freiheit schaffen. Letztlich muß der Kopf das Herz bilden.« Das waren Gespräche nach meiner Art, und jüngst, als wir wieder an unserem Platz am Saaleufer saßen, sagte er ein wenig in Magistermanier, aber dennoch nebenbei und zwischen zwei Gläsern Konstanziawein: »Wenn wir nur halbwegs etwas Vernünftiges zustande bringen wollen, müssen wir uns über die plattköpfige Generation erheben und Zeitgenossen einer besseren Menschenart werden.«
Daß er geradezu gesetzmäßig von der Dummheit der Zeitgenossen ausging und statt edler Menschen überall taube Nüsse sah, imponierte mir besonders. Mir wären solche Worte in seiner Gegenwart nicht so leicht über die Lippen gegangen, denn aus dem Munde einer Baronesse hätte es zu überheblich, zu sehr nach Adelsdünkel geklungen. Doch er, ein Poet aus dem Volke, ein Mann ohne Stammbaum und Wappen, konnte es sich erlauben, so elitär zu sprechen, ohne hochmütig und verletzend zu wirken.
Titan Fridericus gefiel mir von Tag zu Tag mehr. Er hatte ja recht: Zeitgenossen einer besseren Menschenart werden. Das war doch was. Auch ich kannte dieses Gefühl, nur noch von Dummheit, Unglück, Elend und Krankheit umgeben zu sein; ein Gefühl, daß das eigene Leben nicht mehr als ein Notquartier und jede Bewegung ein Waten durch diesen Morast war. Wohin man auch blickte – alles niedrig, verkommen, schmutzig, häßlich, schlecht und schäbig. Jeder Mensch nur ein Ableger aus der Gattung Geschmeiß, Gelichter, Gesindel, Gesocks und Gezücht. Aber ich wollte mich nicht auf das Gemeine hinabdrükken lassen. Im Gegenteil, auch ich träumte davon, mich den sublimeren Dingen zuzuwenden – Dinge, die zwischen ewiger Wahrheit und vergänglicher Existenz lagen und daran erinnerten, daß die Zeit zu kostbar war, um sie mit Banalem zu verplempern. Wir hörten dieses Wort zum erstenmal und lachten, doch ich spürte, wie recht er hatte. Sich nur nicht auf das Häßliche einlassen und sich solange damit beschäftigen, bis es von einem selbst Besitz ergriff. Das war schon der erste Schritt zur Selbstzerstörung. Dazu aber war ich nicht auf der Welt. Daß er Idealen anhing, die längst verloren schienen, empfand ich nicht als altmodisch, sondern als kühn und revolutionär. Seine Sehnsucht nach Größe, die er so vehement verteidigte, schaffte noch mehr Übereinstimmung zwischen uns und ließ mich seine Nähe noch mehr genießen.
Nachts lag ich oft wach und dachte über unsere Gespräche nach. Mein Gipsbüstengemahl rückte in die Ferne. Es interessierte mich nicht mehr, daß ich abends allein am Kamin sitzen mußte und er kein Wort mit mir wechselte. Meine Gedanken waren bei Schiller. Seine Art, die Welt zu sehen, trug eine spannungsvolle Unruhe in mich und glich einem Sog, dem ich mich nicht entziehen konnte. Für nichts war ich so empfänglich wie für das Wort. Nichts sprach mich so an, nichts haftete so fest. Aus dem Wort kam eine Magie, die mich ganz in ihren Bann zog, mich in Atem hielt, mich aufwühlte, mich gelöst und frei machte, beweglich und biegsam, denn im Wort verströmte ich meine Sinnlichkeit. Er fing sie auf und forderte sie ein. Seine Freude, mir zuzuhören, weckte meinen rhetorischen Ehrgeiz, mich so zu zeigen, wie ich sein wollte, und machte aus jedem unserer Gespräche ein süßes intellektuelles Spiel. Mal war ich obenauf, mal ihm unterlegen, mal ihm ganz fern, mal heißherzig nah und immer dabei, ein metaphysisches Knäuel zu entwirren. Ich war wie aufgebrochen und spürte, wie er meine Kopflust von Tag zu Tag steigerte.
Allmählich jedoch merkte ich, er hörte mir nicht nur zu, sondern horchte in mich hinein, als würde er hier etwas finden, was auch sein Empfinden steigerte. Vielleicht war es mein Sinn für Poesie, der die nüchterne Umgebung verwandelte. Die Poesie war wie eine schöne Stimmung, die mich anwehte, auf ihre Flügel nahm und forttrug – hin zu den gedachten Bildern, die zwischen allem hervorschienen, die glänzten und schimmerten, ihre eigenen Farben, ihre eigenen Töne hatten, die Vorgefühl und Ahnung waren und eine Wirklichkeit schufen, in der es einen anderen Himmel und andere Sterne gab. Wie angelockt folgte er dieser Spur, und irgendwo im fernen Schönen berührten wir uns. Es war wunderbar, einen Mann getroffen zu haben, dem mein poetischer Sinn so viel bedeutete. Ungehindert konnte ich meine Gedanken ausbreiten und bekam auf alles, was ich sagte, ein Echo. Auch wenn er im dürftigen Überrock und mit verschrammten Kniebundschnallen neben uns im Gras saß, so imponierte er mir wie kein anderer, und ich genoß es, von ihm bewundert zu werden.
Neulich, als er zu spät kam und sich mit schnellen Schritten ungestüm unserem Picknickplatz näherte, schien er mir wie ein wildes aufgebrachtes Einhorn, das auf uns zustürzte und uns zu verschlingen drohte. Doch dann, als es mich wie die Jungfrau Maria am Ufer sitzen sah, legte es sanft seinen Kopf in meinen Schoß und folgte wie ein zahmes Haustier. Mir ging dieses Bild vom Einhorn nicht aus dem Kopf, aber ich behielt es für mich, denn er brauchte nicht zu wissen, daß er auch noch nachts in meinen Gedanken war. Schließlich war ich verheiratet und wandelte streng auf dem Pfad der Tugend. Es genügte, daß ich nach jedem unserer Treffen noch einige Gedanken in mein livre de pensées eintrug und dabei spürte, wie der Poet mich poetischer machte.
Ursprünglich hatte ich ja geglaubt, daß er es mit seinem Arbeitssommer nicht so ernst meinen würde und alles nur ein Vorwand war, um die beiden Saaleprinzessinnen wiederzusehen. Doch der Rebell arbeitete wirklich. Und nicht nur an einer, sondern an mehreren Geschichten gleichzeitig. Er sprach aber nicht über seine Vorhaben. Kam er einmal zu einer Verabredung zu spät, entschuldigte er sich lediglich, zu sehr in seine Geschäfte vertieft gewesen zu sein. Meist las er uns vor, was er die Tage vorher geschrieben hatte und was dann bald darauf im Druck erschien. Ob Der Geisterseher oder Der Menschenfeind oder die Briefe über Don Carlos