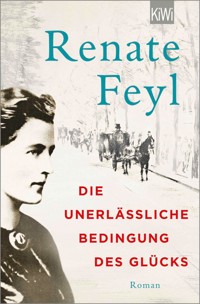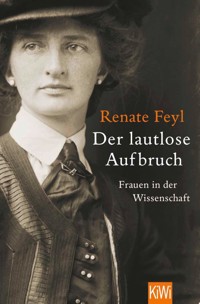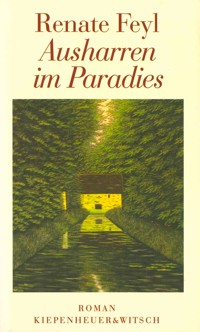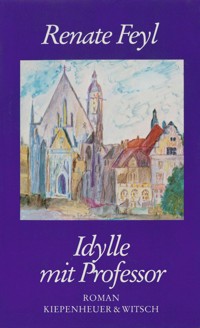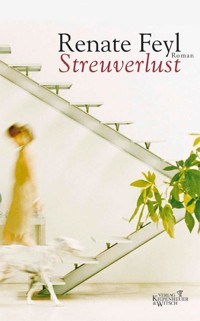9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als 1771 der erste deutsche Frauenroman Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim zur Leipziger Messe erschien, machte er seine Verfasserin mit einem Schlag berühmt: Sophie von La Roche (1731-1807). Ihre Jugendliebe Wieland und Herder, Goethe, Lenz und Schiller bewunderten sie ebenso wie vor allem die Damen der Gesellschaft, später abonnierte Katharina die Große 500 Exemplare von Sophie von La Roches Zeitschrift Pomona.Dennoch war der glanzvolle Start der La Roche als Romanautorin vor allem der Beginn einer mühseligen, von Neid, Klatsch, Schicksalsschlägen und, nach dem Sturz ihres Mannes, ständigen Geldsorgen begleiteten Autorinnenkarriere. In ihrem wunderschön geschriebenen Roman erzählt Renate Feyl die Geschichte der La Roche und ihrer literarischen Laufbahn, ihrer Lebensmaximen und Kämpfe, wobei der Detailreichtum über den Alltag der »Großmutter Brentanos«, über die Erziehung ihrer Kinder und ihrer Ehe, vor allem aber über die Besonderheiten des damaligen »Literaturbetriebs« fasziniert. Voll brillianter Seitenhiebe und lebenskluger Einsicht: die Geschichte einer bedeutenden Frau und das Gegenstück zu Idylle mit Professor, dem Roman über Victoria Gottsched.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Renate Feyl
Die profanen Stunden des Glücks
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Renate Feyl
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Renate Feyl
Renate Feyl, geboren in Prag, studierte Philosophie und lebt als freie Schriftstellerin in Berlin.
Weitere Werke von Renate Feyl:http://bit.ly/1GiZWmG
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als 1771 der erste deutsche Frauenroman Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim zur Leipziger Messe erschien, machte er seine Verfasserin mit einem Schlag berühmt: Sophie von La Roche (1731-1807). Ihre Jugendliebe Wieland und Herder, Goethe, Lenz und Schiller bewunderten sie ebenso wie vor allem die Damen der Gesellschaft, später abonnierte Katharina die Große 500 Exemplare von Sophie von La Roches Zeitschrift Pomona.
Dennoch war der glanzvolle Start der La Roche als Romanautorin vor allem der Beginn einer mühseligen, von Neid, Klatsch, Schicksalsschlägen und, nach dem Sturz ihres Mannes, ständigen Geldsorgen begleiteten Autorinnenkarriere.
In ihrem wunderschön geschriebenen Roman erzählt Renate Feyl die Geschichte der La Roche und ihrer literarischen Laufbahn, ihrer Lebensmaximen und Kämpfe, wobei der Detailreichtum über den Alltag der »Großmutter Brentanos«, über die Erziehung ihrer Kinder und ihrer Ehe, vor allem aber über die Besonderheiten des damaligen »Literaturbetriebs« fasziniert. Voll brillianter Seitenhiebe und lebenskluger Einsicht: die Geschichte einer bedeutenden Frau und das Gegenstück zu Idylle mit Professor, dem Roman über Victoria Gottsched.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1996, 2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Silke Niehaus, Düsseldorf
Covermotiv: © akg images, Berlin; bpk, Berlin
ISBN978-3-462-30946-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
1
Eigentlich hätte alles so bleiben können. Sie lebte in den angenehmsten Verhältnissen und war eine zufriedene Frau. Ihr Mann hatte ein einflußreiches Amt. Die Kinder waren gesund und standesgemäß erzogen. Auch der Haushalt konnte sich sehen lassen. Das Meublement war geschmackvoll, das Tafelsilber erlesen, die Gemälde kostbar, die Bibliothek ausgesucht und das Personal in Sold und Livree gut gehalten.
Sophie war zwar wohlhabend, doch von Hause aus weder reich noch adelig geboren und konnte sich auch nicht zu den Begüterten dieser Erde zählen. Aber sie hatte stets nach den Prinzipien der Vernunft gehandelt, das Nützliche mit dem Praktischen verbunden und immer genau abgewogen, was sie tun und was sie lassen mußte, um sich ihr Leben so vorteilhaft wie möglich einzurichten.
Diesen nüchtern-kalkulierenden Sinn hatte sie jedoch geschickt zu verbergen gewußt, indem sie ihr Augenmerk nicht nur auf das Notwendige, sondern zugleich auch auf das Schöne richtete, so daß sie für ein Musterbild des Empfindsamen und Weiblichen gehalten wurde.
Sophie war vierzig Jahre alt und in ihrem Äußeren so beeindruckend, daß jeder, der sie kannte, überzeugt davon war: Bei ihrer Geburt hatten die Grazien Pate gestanden. Sie wußte dieses Äußere natürlich auch zu schätzen und legte einen besonderen Wert darauf. Nicht daß sie sich wie eine Nürnberger Puppe bemalt hätte, glaubten doch höchstens primitiv denkende Geschöpfe, mit Puder und Schminke die fliehende Jugend aufhalten zu können. Ihr kam es auf das Gesamtbild an, auf die Eleganz ihrer Erscheinung, mit der sie einen Lebensstil bekundete, wie ihn nur der gebildete Teil der Menschheit besaß. Ihm fühlte sie sich zugehörig. Außerdem war sie sich ganz sicher, daß in der Eleganz der äußeren Erscheinung auch die innere Noblesse zum Ausdruck kam. Mit dieser Haltung hatte sie bis jetzt nur Zustimmung erfahren. Leute von Geburt, Rang und Vermögen schätzten sie und suchten ihre Gesellschaft, was gleichfalls zu ihrer Zufriedenheit beitrug. Nein, es hätte keiner Veränderung bedurft.
Selbst daß sie schon achtzehn Jahre verheiratet war und bislang keinen Tag davon missen wollte, zählte sie zu den angenehmen Lebensumständen. La Roche besaß zwar gleichfalls keinen Landbesitz, keine Reichtümer und gehörte nicht zum Adel. Aber mit Zielstrebigkeit und Fleiß hatte er sich Ansehen und Wohlstand erarbeitet. Außerdem war er ein geistvoller Mann und heiterer Spötter, der auch in Gott noch Fehler entdeckte und dessen Vergnügen es war, allem die Krone des Witzes aufzusetzen, so daß an seiner Seite noch keine Langeweile aufgekommen war.
Mehrere Jahre hatte sie mit ihm am Mainzer Hof gelebt, später auf Schloß Warthausen, wo er die Geschäfte des Grafen von Stadion führte, und vor kurzem war La Roche als Geheimer Staatsrat an den Hof zu Trier berufen worden. Sein neuer Dienstherr, Kurfürst Clemens Wenzeslaus, brauchte nicht einmal zu befürchten, daß später ihre Kinder der Landeskasse zur Last fallen und den Kurtrierern einträgliche Ämter und Pensionen wegnehmen könnten. La Roche hatte vorgesorgt: Ihren beiden Töchtern standen bereits gute Partien in Aussicht, dem ältesten Sohn hatte er für 1800 Gulden eine Leutnantsstelle im Augsburgischen gekauft, und die zwei Nachzügler waren gerade erst drei und fünf Jahre alt.
Daß La Roche die Position eines Geheimen Staatsrates erreicht hatte, war für Sophie ein besonderes Glück und gab ihr das Gefühl, ganz oben zu sein. Jetzt besaß die Familie eine noch größere Reputation, und das gesamte finanzielle Budget erfuhr eine beträchtliche Erweiterung. Als Frau Staatsrätin konnte sie nun ein noch größeres Haus führen und so repräsentieren, wie sie es sich immer gewünscht hatte.
Hier in Koblenz-Ehrenbreitstein, wo der Kurfürst residierte, boten sich dafür die allerbesten Möglichkeiten. Ihr Haus lag direkt am Fuße des Schlosses. Es war groß und geräumig, hatte einen prächtigen Garten und bot einen herrlichen Blick auf den Rhein. Dicht neben ihm führte eine Zugbrücke über einen Kanal, der den Fluß mit einem künstlich ausgebauten Hafen verband, wo die kurfürstlichen Leibhofjachten, Staatsschaluppen und Küchenschiffe ankerten. Eine noblere Wohnlage hätte sie sich nicht denken können.
Sophie hatte schon eine Reihe von Empfängen gegeben und war zufrieden, als ihr deutlich wurde: Die ersten Familien drängten sich danach, im Hause des Staatsrats La Roche verkehren zu dürfen. Hier am Rhein, unter diesen regsamen, fröhlichen und offenherzigen Menschen konnte ihr Leben wie der Strom gleichmäßig und erhaben dahinfließen. Zu ihrer Freude waren auch ihre beiden Töchter aus dem Internat zurückgekehrt, und Sophie hatte endlich wieder Lulu und Maxe um sich, was ihr die neue Umgebung noch liebenswerter machte. O ja, es hätte alles so bleiben können, wie es war. Doch da trat etwas ganz Unerwartetes in ihr Leben. Sie konnte es selber kaum begreifen und wußte nicht, wie ihr geschah: Eines Morgens wachte sie auf und war berühmt.
Mit vielem hatte sie in ihrem Leben gerechnet – damit nicht. Vieles hatte sie sich schon vorgestellt, doch dies lag so fern, daß sie nie den geringsten Gedanken, nie die leiseste Hoffnung daran verschwendet hätte, geschweige denn, daß es ihr je einer Überlegung wert gewesen wäre. Nichts lag ihr ferner, nichts war ihr fremder als der Gedanke an Ruhm. Doch nun stand sie im Licht der Öffentlichkeit und nahm alles, was geschah, mit einem Gemisch von Irritation und Befremden auf. Jedesmal wenn sie ihren Namen in der Zeitung fand, schien sie aufs neue überrascht und begriff nicht, wieso ausgerechnet sie eine derartige Begeisterung auslösen konnte, denn schließlich hatte sie doch nichts weiter getan, als ein kleines »Romängen« geschrieben. Es war ja nicht einmal zur Veröffentlichung bestimmt gewesen. Sie wollte sich nur einen Kummer von der Seele schreiben; den Kummer, daß sie ihre beiden Töchter nicht selber unterrichten durfte, sondern der Etikette halber in ein französisches Kloster geben mußte. Darum, nur darum hatte sie sich an den einsamen Nachmittagen ein papiernes Mädchen erzogen. Was hätte sie auch anderes tun sollen? La Roche war im Amt, die Töchter außer Haus, der älteste Sohn in Erfurt zur Ausbildung, und um die beiden Jüngsten kümmerte sich die Kinderfrau. Da blieb ihr doch gar nichts anderes übrig, als sich eine sinnvolle Beschäftigung zu suchen und sich mit dem Schreiben ein bißchen die Zeit zu vertreiben. Mehr war doch nicht! Und plötzlich dieses Aufsehen.
Selbst daß sie ihre Autorschaft auf dem Titelblatt verschwiegen hatte, nützte nichts – die Begeisterung für die Geschichte des Fräuleins von Sternheim war so groß, daß sich die Anonymität nicht halten ließ. Mehrmals am Tage kam der reitende Postillion, um die besonders eiligen Briefe zu bringen. Die Einladungen in die vornehmen Häuser der näheren und ferneren Umgebung türmten sich auf ihrem Schreibtisch. Schon morgens wurden ihr Billette von Fremden überreicht, die auf der Durchreise waren und der berühmten Verfasserin der Sternheim einen Besuch abstatten wollten.
Sophie glaubte, die Welt um sie herum hätte auf einmal die Gestalt eines Karussells angenommen. Sie wußte nicht, wer sich um wen drehte oder wer gar von wem gedreht wurde, sondern hatte nur noch den Eindruck, aus der Bahn geschleudert zu sein. Ihre Irritation war auch darum so groß, weil sie meinte, dieses plötzliche Herausgehobensein könnte sie in einen unliebsamen Gegensatz zur Mitwelt bringen und ihr die Harmonie zerstören, in der sie bisher so angenehm gelebt hatte. Sie befürchtete, die anderen könnten vielleicht annehmen, daß ihr Ruhm einer inneren Unausgefülltheit entsprang, ein Ersatz für die schöneren Dinge des Lebens war, deren sie nie teilhaftig werden durfte und daß sie sich gerade darum manch scheelen Blicken aussetzen mußte. Zum Glück aber war sie keine einsame, verwachsene, unglückliche, geschiedene, kinderlose, verwitwete oder gar exaltierte Frau, sondern die ganz normale, gesunde, heitere und zufriedene Gattin eines ganz normalen, gesunden, heiteren und zufriedenen Ehegatten; nahm, wie es sich gehörte, freudig Anteil an seinem beruflichen Aufstieg, sorgte mit mütterlichem Opfersinn für ihre fünf munteren Kinder, las eifrig die neusten Produkte der Literatur, um sich an den geistreichen Unterhaltungen der Männer zu beteiligen, so daß genaugenommen ihrem Ruhm nichts Ungehöriges oder Tadelnswertes anhaften konnte. Denn in einen solchen Ruf zu kommen, war ihre größte Sorge.
La Roche versuchte in seiner heiter-weltmännischen Art ihr den nötigen Abstand zu geben und ermunterte sie, die Dinge so zu sehen, daß sie keine tiefere Wirkung auf sie hatten. Das Aufsehen, das sie erregte, fand er überaus schmeichelhaft. Er genoß es, von so vielen Seiten auf seine Frau angesprochen zu werden. Es hob ihn von den anderen Regierungsbeamten ab. Fast alle Staatsräte, die er kannte, hatten schöne und begüterte Frauen, als gehörte dies zu ihrem Standard und ihrem Rang. Doch er war die Ausnahme. Er besaß das Besondere, die Steigerung, das absolut Ungewöhnliche – er hatte eine berühmte Frau. Sogar der Kurfürst hatte sich schon nach ihr erkundigt und sie beide zum Souper geladen.
La Roche spürte täglich: Der Ruhm seiner Sophie verlieh ihm eine Vorzugsstellung am Hofe, die er selbstverständlich auszubauen gedachte. Er war zwar schon weit oben, aber die letzte Stufe zur Regierungsspitze fehlte noch. Vor ein paar Tagen erfuhr er ganz im Vertrauen vom Konferenzminister, daß sein Name im Zusammenhang mit der Besetzung des Kanzlerpostens gefallen war. Geübt in diplomatischen Andeutungen und feinen Tonlagen, wußte La Roche die Zeichen zu deuten und kam jeden Abend fröhlicher nach Hause. Neuerdings speiste er mit Sophie länger als gewöhnlich, denn immer gab es andere Überraschungen, immer irgend etwas Unverhofftes, das sich tagsüber bei ihr ereignet hatte und das sie nun miteinander besprachen. Aus dem Kabinett brachte er die neuesten Zeitungen und Journale mit, in denen er ihren Namen gefunden hatte. Genüßlich entfaltete er Blatt um Blatt, lehnte sich voller Behagen in den Stuhl zurück und las nicht ohne Genugtuung, was die Herren Rezensenten über seine geliebte Sophia geschrieben hatten. In der Braunschweigischen Zeitung versprach man den Lesern, daß sie in Frau La Roches Roman die strengste Tugend in der sittsamsten Kleidung antreffen würden. Albrecht von Haller in den Göttingischen Anzeigen pries den sittlichen und empfindsamen Roman, dessen Heldin Religion habe, und Johann Georg Sulzer in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek lobte das Prinzip der moralischen Nützlichkeit und das Wunderbare des Charakters der Hauptperson.
La Roche zitierte die Sätze mit einer so wohligen Miene, als nehme er ein Dessert zu sich. Um den Abend zu verlängern, probierte er stets noch einen der guten Rheinweine und sah überhaupt seine Frau in einem ganz neuen Licht. Daß sie schön war, hielt er immer für einen ihrer großen, wenngleich unverdienten Vorzüge. Daran hatte er sich längst gewöhnt. Aber daß sie nun plötzlich auch noch berühmt war, gab ihr einen zusätzlichen Reiz, eine ganz andere Art von Sinnlichkeit, die sie in seinen Augen jünger und begehrenswerter machte. Außerdem sah er plötzlich in allem die feineren Nuancen, die geistigen Züge zum Vorschein kommen, die den Genuß weiblicher Gegenwart noch steigerten.
Delikat empfand er lediglich die Tatsache, daß sie plötzlich wie ein Stern ausgerechnet in den Reihen derer leuchtete, von denen er seit jeher eine höchst ungünstige Meinung hatte. Denn die Romanschriftsteller hielt er für eine ganz besondere Species, die nichts anderes verdiente, als abwechselnd mit Spott und Mitleid betrachtet zu werden. Da er ein höflicher Mensch war, schwieg er sich natürlich angesichts der neuen Situation darüber aus, ja vermied die kleinste Andeutung. Doch er besaß nun mal eine natürliche Abneigung gegen all diese verblasenen Produkte verwirrter Phantasten und vermochte nicht zu begreifen, wie ein vernünftiger Mensch überhaupt einen Roman lesen konnte. War doch ein Roman für ihn ein frommes Märchen, das sich einer ausdachte, um sich zur Freude anderer aus der Wirklichkeit hinauszulügen. Und der Urheber eines solchen Werkes saß dafür von morgens bis abends in seinem Schreibkabinett vor dem entstöpselten Tintenfaß, schaute tief vor sich hinsinnend – so er Glück hatte – auf einen schönen Apfelbaum, währenddessen er seinem geplagten Gehirn Kapitel um Kapitel abdestillierte. Hatte diese beklagenswerte Natur endlich genügend Worte aus dem Nichts komponiert, schickte er die Bogen einem Verleger, der sie zwischen zwei Buchdeckel preßte und das Epos den neugierigen Lesern in der Hoffnung übergab, bei ihnen all die Gefühle herauszukitzeln, die sie selber noch nicht kannten. Gelang dem Schriftsteller die Unterhaltung des großen Publikums, das ohnehin ständig auf der Suche nach einem Zeitvertreib war, dann durfte sich auch der größte Plattkopf einer Aura popularis erfreuen, die ihn ermutigte, überall dort, wo er in Erscheinung trat, das Pfauenrad der Eigenliebe prächtig und weithin sichtbar zu schlagen. Meist führten sich diese Prosascribenten unter den Heerscharen ihrer Leser so auf, als seien sie vom Himmel herabgefahren und hätten ein Anrecht auf Unsterblichkeit. Ihm brauchte man nichts zu erzählen. Er konnte nur lachen über die Herren Romanschriftsteller, die sich doch allesamt als Konjunkturritter des Geschmacks erwiesen, als umherziehende Hilfsprediger und schwadronierende Barbiergesellen des Wortes, deren ganze Unternehmung darin bestand, andere mit ihrem Geist anzunässen, um dafür auch noch Lob und Ehre einzuheimsen. Vor allem hatte sich La Roche stets darüber amüsiert, mit welchem Ernst und welchem Eifer allerorten über Romane gesprochen wurde. Doch noch mehr amüsierten ihn diejenigen, die solche erdichteten Geschichten auch noch lasen, sogar Spaß daran fanden und in jeder Zeile die Offenbarung selber zu entdecken meinten.
Daß jetzt jedoch ausgerechnet seine geliebte Maria Sophie dieser beklagenswerten Gilde der Wortschöpfer angehören sollte, hatte für ihn mehr eine humorvolle Seite, die er einer Laune, einer Grille und vor allem dem Zufall zuschrieb, und darum ging er amüsiert darüber hinweg. Aber er hielt es für seine Pflicht, sie zu ermuntern, ihren Ruhm gelassen hinzunehmen und vor allem zu genießen. Denn Ruhm kam und Ruhm ging, und solange sie ihn hatte, wollten sie sich gemeinsam daran erfreuen.
Inmitten der Turbulenzen strahlte seine Nähe etwas Beruhigendes aus und gab ihr ein Gefühl des Schutzes, nach dem es sie noch nie so sehr verlangt hatte wie im Augenblick.
Voller Behagen sortierte er die Einladungen nach der gesellschaftlichen Gewichtigkeit der Absender, nach wohlgeborenen, wohlhabenden und wohldenkenden Familien, freute sich, wenn alles zusammenkam, und stellte eine Liste auf, welchen der Besuche sie zuerst wahrnehmen mußten, und welchen sie auf später verschieben konnten. Sophie spürte deutlich, wohin es ihn zog: Spötter wie er brauchten die Geselligkeit, um ihr Talent auszuleben. Sie wußte nur zu gut, wie wohl er sich auf diesem Schauplatz fühlte.
Doch diesmal nannte er einen anderen Grund: Früher hat man mich um dich beneidet, weil du so jung warst, sagte er, heute weil du berühmt bist. Das auszukosten ist mir ein ganz besonderer Genuß. Natürlich wollte sie ihm dieses Vergnügen nicht versagen, nicht nach achtzehn Jahren Ehe, wo jedes Vergnügen, das man am anderen noch fand, ohnehin schon fast etwas Heiliges war.
Dennoch löste seine Freude über die Einladungen bei ihr eher ein zwiespältiges Gefühl aus, denn Sophie hatte eigentlich gehofft, nicht mehr ganz so häufig an Empfängen, Assembléen und all diesen Geselligkeiten teilnehmen zu müssen. Sie kannte das alles zur Genüge: Mit einem Champagnerglas und ein paar hochedelgeborenen Damen herumzustehen, um zu den langweiligen Gesprächen über Kinder, Wunderheiler, Brunnenkuren und Brüsseler Spitzen ein interessiertes Gesicht zu machen; im Fischbeinharnisch und mit gestickten Tanzschuhen die Kulisse zu bilden und zuzusehen, wie sich die Herren der Schöpfung immer tiefer in die Geistlosigkeit hinabtranken, wie ihre Ratsbäuche anschwollen und sie zu guter Letzt laut polternd über gut zugerittene Dragonerpferde, Jagdfalken und die Erhöhung ihrer Revenuen sprachen – es war doch immer dasselbe.
Andererseits gab sie ihm recht, wenn er meinte, daß Ruhm nicht irgend etwas Beliebiges war, sondern eine Frage der gesellschaftlichen Reputation, die selbstverständlich gewisse Verpflichtungen mit sich brachte. Dies leuchtete ihr auch darum ein, weil sie nie etwas unterlassen hätte, was ihrer Familie Vorteile bringen konnte.
Aber Sophie war nicht im Überschwang, sondern behielt alles kühl im Blick. Sie begriff, daß sie sich diesmal in einer ganz besonderen Situation befand. Immerhin war sie als Frau Staatsrätin schon eine herausgehobene Erscheinung und genoß weithin Achtung und Respekt. Daß jetzt ihr Ruhm noch dazukam, mußte geschickt ausgeglichen werden, war sie sich doch ganz sicher: Die lieben Mitmenschen vertrugen bei anderen immer nur ein bestimmtes Maß an Erfolg. Sie wollte aber keinen reizen, keinen verärgern oder gar neidisch stimmen. Sophie wollte gefallen und wußte, wenn einflußreiche Leute einen guten Eindruck von ihr hatten, konnte das der Stellung ihres Mannes nur dienen. Diese Steigerung, nicht nur Frau Staatsrätin zu sein, sondern noch dazu eine berühmte Schriftstellerin, wollte sie darum durch ein betont bescheidenes Auftreten ausgleichen.
Deshalb achtete sie diesmal besonders auf ihre Garderobe, erschien nirgendwo in kleiner oder gar großer Gesellschaftstoilette und kleidete sich in einer schlichten, fast durchschnittlichen Eleganz. Sie legte auch keinen Schmuck an und vermied jeglichen Aufputz, um den Gastgeberinnen das Gefühl der Überlegenheit zu lassen. Nichts wäre ihr unangenehmer gewesen, als durch eine besondere äußere Attraktivität sich noch zusätzlich von den anderen abzuheben und damit nur unnötige Barrieren aufzubauen. Sie nahm sich auch vor, nicht über die großen Gegenstände der Poesie oder gar der Philosophie zu reden, sondern über einfache, naheliegende Dinge: über die Erziehung ihrer Töchter, über die Befähigung der Tanz- und Musikmeister, über englische Wochenschriften und empfindsame Erzählungen. Diejenigen, die sie mit ihren Einladungen beehrten, sollten sehen: Die Frau Staatsrätin La Roche war eine von ihnen. Sie war nichts Besonderes und nichts Besseres. Sie war so wie sie, auch wenn der Ruhm sie plötzlich über die anderen gestellt hatte. Ihr Konzept ging auf. Die Frauen, vor deren scheelsüchtigen Blicken ihr etwas bange gewesen war, kamen mit offenen Armen auf sie zu, nahmen sie in ihre Mitte und bestürmten sie mit Fragen. Vor allem war es ihnen ein Bedürfnis, ihr zu sagen, daß das, was sie in der Sternheim beschrieben hatte, auch ihre eigenen Erfahrungen waren und völlig mit dem Leben übereinstimmte. Wort für Wort konnten sie das Empfinden der Heldin nachvollziehen, denn sie wußten, wie das war: hoffnungslos in einen Mann verliebt zu sein, schließlich einen anderen zu heiraten und in der Ehe nur Enttäuschung zu finden. Das Großartige der Sternheim bestand für sie darin, daß sie trotz allem nicht unterlag, sondern ihren Lebenselan und ihr Selbstvertrauen behielt. An dieser Romanheldin konnte man sich aufrichten. Mit ihr hatte sie für alle Frauen ein Vorbild geschaffen.
Die Schwester des Kurfürsten, Prinzessin Maria Kunigunde, die einen Kreis erlauchter Personen der Autorin zu Ehren geladen hatte, sagte ihr, worin die Ursache der allgemeinen Begeisterung lag: Noch nie war ein Roman geschrieben worden, der vom Leben einer Frau erzählte, die tätig ihr Unglück überwand. Noch nie war so deutlich gezeigt worden, daß das höchste Verdienst nicht darin bestand, dem Mann zu gefallen, sondern sich für andere nützlich zu machen. Weder Gellert noch Hagedorn war dies gelungen, nein, Sophie La Roche hatte ihnen allen aus der Seele gesprochen und sich Wort für Wort in ihre Herzen geschrieben.
An der Tafel des Kurtrierischen Staatsministers Baron von Hohenfeld las man sich gegenseitig laut die Briefe vor, die man von anderen Höfen, von hohen und gebildeten Personen bekommen hatte und in denen von der Wirkung der Sternheim die Rede war. Die jungen Männer wollten so empfindsam lieben können wie Lord Seymour, die jungen Frauen so selbständig handeln wie Fräulein von Sternheim, und von allen Seiten schallte Sophie nichts als Begeisterung und Lob entgegen.
La Roche hörte dem allen mit stillem Vergnügen zu und konnte sich eines inneren Schmunzelns nicht erwehren. Mochten die Anwesenden auch der Empfindsamkeit seiner Gemahlin huldigen – er kannte nur die andere, die praktische, zupackende Sophie, die stets nach der Vernunft handelte, die genau wußte, was sie wollte, die alles im Blick und alles im Griff hatte, den Haushalt rationell führte und sein Geld trefflich verwaltete. Doch hier wurde sie betrachtet wie eine poetische Mimose, wie die zarte, gefühlvolle Dichterin, die Frau, die für das Seelische zuständig war. Immer bewegt, entrückt, ergriffen, gerührt. Immer im höheren Taumel. Er konnte sich nur amüsieren, wenn er sah, daß sie sich wie eine verschwebte Muse gebärdete, von der man glauben mußte, sie würde Tag für Tag nichts anderes tun, als schöne Gedanken schön zu formulieren. Sollten sie meinen, was sie wollten – für ihn war das Geschehen ein neuerlicher Beweis, daß seine Sophia eine glückliche und seltene Anlage besaß: Alles, was sie unternahm, gelang ihr mit Bravour.
Das Überraschende war für ihn auch diesmal wieder, wie spielerisch und leicht sie auch hier die Perfektion erreichte. Hätte er sie nicht besser als all die Anwesenden gekannt, hätte er wohl gleichfalls geglaubt, die geborene Poetin vor sich zu haben: zurückhaltend, fast scheu, leicht unbeholfen antwortend und doch mit jedem Wort so schwärmerisch; so gefühlvoll in jeder Silbe; so nachdenklich, so beschaulich und so bescheiden beredt, wenn sie nach ihren Romanfiguren gefragt wurde. Ach, seine geliebte Maria Sophie! Wie gerne hätte er sie auf der Stelle in die Arme nehmen, wie gerne jetzt mit ihr zum Vergnügen aller ein bißchen küssen und ein bißchen weinen mögen. Sie war prächtig, einfach prächtig.
Obwohl es Sophie anstrengte, fast jeden Tag einer anderen Einladung zu folgen, hatte sie doch nicht das geringste Gefühl einer Erschöpfung. Manchmal ließ der Gastgeber sie in seiner Chaise nach Hause bringen oder gebot einem Diener, mit der Handlaterne vorauszugehen, um die Autorin und ihren Ehegemahl sicher zu geleiten. Immer freute sich Sophie schon auf den nächsten Abend. Diese unmittelbare Bestätigung, die sie von Mal zu Mal erfuhr, gab ihr einen ungewohnten Auftrieb. Seit langem hatte ihr Wohlbefinden nicht mehr eine derartige Steigerung erfahren, und einige Tage lebte sie sogar anhaltend im Glück: Christoph Martin Wieland hatte seinen Besuch angekündigt.
Sie geriet in eine geradezu fieberhafte Aufregung, denn Wieland war für sie in jeder Hinsicht ein besonderer Gast. Er hatte nicht nur ihren Roman herausgegeben und mit einem Vorwort versehen, er war auch ihr Cousin und mehr noch: Er war einst ihr Verlobter gewesen. Daß sie ihn damals nicht geheiratet hatte, betrachtete sie längst als eine höhere Fügung, denn an seiner Seite wäre sie wohl nie die Frau Staatsrätin geworden. Aber ihre Liebe zu ihm besaß diesen stillen Nachklang, der immer wieder durch ihren Alltag hallte und ihr oft wie aus dem Nichts die Situation von damals gegenwärtig machte.
Eigentlich sollte sie die Frau eines italienischen Arztes werden, aber ihre Mutter starb, und der Vater löste sofort die Verlobung auf, denn er wünschte nicht, daß seine Enkelkinder katholisch getauft würden. Mit ihren zwölf jüngeren Geschwistern kam sie zu den Großeltern nach Biberach. Im Hause des Pastor Wieland traf sie Christoph Martin. Er war siebzehn, doch sie hatte mit der Welt abgeschlossen, erwartete nichts mehr, wollte nichts mehr, sondern interessierte sich nur noch für das Höhere, für griechische Tragödien und englische Romane. Christoph Martin hörte ihr überwältigt zu, ging stundenlang mit ihr spazieren und versenkte sich berauscht in die Welt des Erhabenen und Schönen. Er war hingerissen von seiner Cousine und gestand ihr, daß er keinen Augenblick mehr ohne sie leben konnte. Er wollte sie glücklich machen auf Zeit und Ewigkeit.
Bei Wieland fand sie den gleichgestimmten Ton ihrer Seelen, der über alle Enttäuschungen hinweghalf. Er verstand sie, er fühlte mit ihr, und sie lebte auf. Glücklich teilten sie den Eltern ihre Verlobung mit. Ein paar Monate blieben ihnen noch, dann ging er zu Bodmer in die Schweiz. Er schickte seiner englischen Sophie Briefe über Briefe, verfaßte herrliche Gedichte auf seine »göttliche Doris« und besang sie in schönen Dithyramben. Jeden Abend lag ein anderer Gruß von ihm auf ihrem Bett. Verzückt las sie Zeile für Zeile, hoffte auf seine baldige Heimkehr, doch plötzlich wurden seine Briefe kürzer, der Ton kühler, die Abstände länger. Durch Zufall erfuhr sie, daß er sich in eine junge Witwe verliebt hatte. Sie wollte es nicht glauben, fragte nach, wartete auf eine Erklärung, doch als Antwort kam nur ein schwärmerischer Bericht über die Schönheit der Berner Frauen. Sie wußte nicht, was sie davon halten sollte, fühlte sich getäuscht und im Stich gelassen und sah keinen Sinn mehr, länger an sein Versprechen zu glauben. Nach zwei gescheiterten Verlobungen mußte sie nüchtern der Zukunft ins Auge sehen. Ihr Vater hatte wieder geheiratet, und seine Frau zeigte ihr jeden Tag deutlicher, daß sie sie aus dem Haus haben wollte. Sophie blieben nur noch zwei Möglichkeiten: entweder ins Kloster oder in eine Ehe zu flüchten. Im stillen, tief im stillen hoffte sie noch immer auf einen Brief von Christoph Martin, wartete sehnsuchtsvoll auf ein Gedicht, ein Zeichen, ein Signal seiner Liebe, Tag um Tag, Nacht um Nacht, doch es kam nichts. Nichts was an sein Versprechen erinnerte. Da stand für sie fest: ihr cherissime ami hatte sie vergessen.
Um sich abzulenken von ihrem Unglück, ging sie zu einer befreundeten Familie zum Teenachmittag. Überraschend erschienen noch zwei Gäste, die in Begleitung des Grafen von Stadion auf einer Durchreise in Augsburg weilten. Der eine von ihnen kam fast zielstrebig und mit einem weltmännischen Lächeln auf sie zu, stellte sich ihr formvollendet vor und begann ein Gespräch. Die anfänglich leicht dahinperlende Konversation ging in eine angeregte Unterhaltung über. Es machte ihr Spaß, endlich einmal wieder in französisch zu parlieren, zu zeigen, was sie konnte, was sie wußte, und sich über Kunst, Wissenschaft und die neuesten Journale austauschen zu können. La Roche war entzückt. Er begleitete sie nach Hause, besuchte sie am nächsten und am darauffolgenden Tag, und da er wieder abreisen mußte, fragte er sie ganz unvermittelt, ob sie ihn heiraten wollte. Einen Moment lang war sie schockiert, aber dann sah sie ihre Chance, ja geradezu ihre Rettung. Sie kannte diesen Georg Michael La Roche zwar nicht näher, aber er war Kurmainzischer Hofrat, noch dazu Junggeselle, hatte ein weltmännisches Betragen, war amüsant in seinen Betrachtungen – genaugenommen sprach nichts gegen ihn. Doch sie sagte ihm ganz ehrlich: Lieben kann ich Sie nicht, denn mein Herz gehört Wieland, einem Dichter. Aber wenn Sie mich heiraten wollen, werde ich Sie verehren und dankbar dafür sein, daß Sie mich aus dem ungeliebten Vaterhaus befreit haben.
La Roche eilte zu Herrn Gutermann und bat um die Hand seiner Tochter. Daß sie keine Mitgift zu erwarten hatte, störte ihn so wenig wie ihre schwärmerische Liebe zu diesem Dichter. Er fand das Herzensbekenntnis seiner künftigen Gemahlin sogar rührend und anmutig, denn es zeugte von ihrem aufrichtigen Charakter. Aber zugleich amüsierte es ihn auch, weil er wußte, daß so ein armer Plinius einer so schönen Frau wie Sophie kein Leben in einem gesicherten Wohlstand bieten konnte. Nicht einen Augenblick war La Roche eifersüchtig auf ihren geliebten Versifex oder wäre gar auf den Gedanken gekommen, in ihm einen Konkurrenten zu sehen. Er sagte nur lächelnd: Wann immer du es wünschst, werde ich selbstverständlich deinen kleinen Poeten in unserem Hause empfangen. Zum Aufwärmen und Sattessen findet er stets eine offene Tür.
Inzwischen waren achtzehn Jahre vergangen, und sie hatte sich längst an den Sarkasmus des geschätzten Gatten gewöhnt. Auch damals hatte sie sich nicht darüber aufgeregt, sondern sah vielmehr mit stillem Vergnügen, wie sich La Roche in seinem Urteil zurücknehmen und von seinem hohen Roß herabsteigen mußte. Denn Wieland kam. Nicht um sich aufzuwärmen und sattzuessen, sondern um sie zu sehen und ihr zu sagen, wie enttäuscht er war, daß sie nicht auf ihn gewartet hatte. Sophie schämte sich zwar ein wenig, weil er in der ärmlichen Tracht eines Abbés vor ihr stand – schwarz mit kurzem Mäntelchen und Kragen – und so gar nichts von sich hermachte. Doch er unterhielt sich wenigstens sehr angeregt mit La Roche, und je länger sie miteinander sprachen, desto mehr entdeckte er in ihrem kleinen Poeten einen aufgeklärten, gebildeten Mann, mit dem es ein Vergnügen war, Gedanken auszutauschen.
La Roche besorgte ihm sogleich eine Stadtschreiberstelle in Biberach mit auskömmlichem Gehalt und freier Wohnung. Weil er sah, mit welchem Fleiß er nebenher noch seine Bücher schrieb, nutzte er seine Beziehungen zum Statthalter von Erfurt und verschaffte Wieland eine Professur an der Universität. Hier mußte er zwar viermal in der Woche pro deo et patria Vorlesungen halten, aber bekam dafür sechshundert Taler – eine Summe, von der La Roche meinte, daß es sich damit gleich doppelt so gut dichten ließ.
Um Wielands Einkünfte noch zusätzlich aufzubessern, gab er ihm ihren Sohn Fritz zur Erziehung, entlohnte es ihm großzügig und freute sich, daß jetzt die Ausbildung beendet war und Wieland ihren Sohn nun persönlich zurückbrachte. Auch Sophie sah dem Tag ihrer Ankunft freudig entgegen. Das letzte Mal hatte Wieland sie vor vier Jahren in ihrem Salon auf Schloß Warthausen besucht, und sie konnte es kaum erwarten, ihn endlich wiederzusehen.
Sie ließ das ganze Haus gründlich herrichten und vor allem den jüngst erworbenen prächtigen Kronleuchter anbringen – eine Neuheit, die inzwischen in keinem der wohlhabenden Häuser fehlen durfte. Sie schmückte die Räume mit spanischem Flieder und Pyramiden aus Wachskerzen, stattete das Gästezimmer für Wieland aufs komfortabelste aus, ließ den Weinwagen kommen, um die Vorräte aufzufüllen, und überwachte persönlich das Eindecken der Tafel. Sophie wählte ihre kostbarsten Tafelaufsätze und Dessertplatten, streute zwischen die Gedecke porzellanene Rosen als Sinnbild der Freude und legte eine englische Speisenfolge fest mit Roastbeaf und Plumpudding, Whisky und Tee. Dazu passend trug sie ein englisches Kleid. Auch ihren englischen Hund, den braunbeigen Mops Charles, präsentierte sie auf einem eigens für ihn bestimmten Kissen aus feinstem türkischen Saffianleder. Wieland sollte sehen: sie war noch immer seine englische Sophie.
Sie lud auch noch ein paar gute Freunde ein, Staatsminister Baron von Hohenfeld, einen einflußreichen Mann, auch die beiden Jacobis, Georg, den Dichter, und Fritz, den Philosophen, denn Wieland sollte in ihrem Hause Gelegenheit haben, führenden Männern des Geistes zu begegnen. Außerdem war es ihr auch ein stiller Genuß, ihm zeigen zu können, wie sie als Frau Staatsrätin lebte und mit wem sie verkehrte. Doch dann, als sie draußen den Reisewagen halten hörte, begann ihr Herz zu klopfen, und sie mußte Wieland betont langsam entgegengehen, um ihre Aufregung zu verbergen. In einiger Entfernung blieb sie stehen, zwang sich wie zur Selbstberuhigung innezuhalten, damit Vernunft und kühle Einsicht in sie zurückkehren konnten. Aber als sie sah, daß auch er sich zur Zurückhaltung zwang, vergaß sie alle Etikette und rannte auf ihn zu. Wieland schien ebenfalls alles zu vergessen, warf seinen Hut hinter sich auf die Erde und ergriff ihre Hände, um sein Gesicht darin zu verbergen.
In diesem Augenblick war sie wie so oft schon froh, daß sich ihre Liebe nicht erfüllt hatte, denn gerade darum schien sich das kostbarste, das bleibende – die Idee von ihr – bewahrt zu haben.
Als sie sich dann gegenübersaßen, sah Sophie, daß sein Gesicht blatternarbig und mager geworden war. Aber die Tatsache, daß dieses Gefühl von damals nie wirklich ein Ende genommen hatte, daß sie beide vielmehr mit diesem kleinen ewig lodernden Rest lebten, gab auch dieser Begegnung ihren ganz eigenen sinnlichen Reiz, der sie spontan verwandelte. Die Gedanken formten sich wie von selbst, die Worte flogen ihr zu, sie fühlte sich ungeheuer schön und begehrenswert, fing jeden Blick berauscht auf und gab ihn über Worte zurück; jeder Satz traf, jede Begründung saß, und ihre Antworten gefielen ihm offensichtlich so sehr, daß er sie mit noch besseren übertreffen wollte. Es war ein bewegtes Hin und Her, ein Herauslocken und Zurücknehmen, ein Spiel, eine verbale Berührung, ein Sichdarstellen mit Worten, Sichzeigen und -verhüllen – nie hätte sie gedacht, daß ein Gespräch eine so herrliche Umarmung sein konnte.
La Roche war beeindruckt von Wieland. Er trug nicht mehr dieses ärmliche schwarze Mäntelchen, sondern war elegant gekleidet, und der Erfolg stand ihm außerordentlich gut. Nach seinen beiden letzten Romanen genoß er die ungeteilte Liebe des Vaterlands, war zum Regierungsrat ernannt worden, und selbstverständlich konnte bei einem solchen Mann von Aufwärmen und Sattessen nicht mehr die Rede sein. Im Gegenteil: Es war eine Ehre, den Dichter des Agathon und Musarion zu Gast zu haben. La Roche kannte viele, die ihn um diese Stunden beneideten.
Wieland sprach ihn zu seiner größten Überraschung auf die Briefe Über das Mönchswesen an. La Roche hatte seine Streitschrift vor wenigen Wochen anonym erscheinen lassen und war nicht wenig erstaunt, daß seine Autorschaft bereits bis zu Wieland durchgedrungen war. Die Kreise der hohen und niederen Geistlichkeit reagierten empört darauf, doch Wieland gratulierte ihm zu diesem Buch. Er hatte bislang noch nicht so etwas Scharfsinniges und Vergnügliches über die Scheinheiligkeit der Pfaffen und den Hochmut der Theologen gelesen. Er konnte La Roches Appell nur Wort für Wort unterstützen: Wir müssen uns überwinden, alle Menschen als unsere Brüder und Miterben des Himmelreiches anzusehen. Auf das Tun kommt es mehr an als auf den Glauben.
Eine wirklich mutige Schrift, sagte er. Ich hoffe nur, daß sich die Anonymität des Verfassers hält und Ihnen daraus keine Nachteile erwachsen werden.
Ein solches Lob aus Wielands Munde zu hören, war für La Roche mehr als eine Anerkennung. Es war ihm ein Beweis, daß sie als aufgeklärte Männer für die gleichen Ziele kämpften. La Roche hatte ja nie daran gezweifelt, daß Wieland mehr Licht im Kopfe hatte als eine ganze deutsche Universität, aber jetzt wußte er: Wieland war das Beste, was Sophie mit in die Ehe gebracht hatte.
Dann, an der großen Tafel sprachen sie natürlich alle über die Sternheim. Über den Erfolg des Romans war Wieland keineswegs erstaunt, im Gegenteil: er hatte ihn vorausgesehen. Es brauchte für seine Begriffe auch keinen merkantilischen Sinn, um zu erkennen, daß Sophie sich damit den besonderen Beifall des schönen Geschlechts verdienen würde. Ohne Zweifel hatte sie sich eine ganz neue Leserschicht, die Frauen, erobert. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die Frauen der Mittelklasse. Ihnen, sagte er, stand der Sinn längst nach mehr als nur dem Gebetbuch und dem Hauskalender. Auch seine Frau hatte den Roman mit dem größten Vergnügen gelesen. Dies zeigte ihm, daß selbst in den treuesten und besten Ehefrauen ein rebellischer Sinn, ein Drang nach Unabhängigkeit wohnte, den Sophie wie keine andere vor ihr ausgesprochen hatte. Darum, nur darum brach ihr Roman einem neuen Weiblichkeitsideal die Bahn. Und nicht nur das, er ging weit darüber hinaus. Genaugenommen war er eine Satire auf das Hofleben und die große Welt, denn er zeigte die Lügen und den Schein, die Finessen und Schikanen der vermeintlich feinen Gesellschaft. Auch darin sah er eine Ursache, weshalb ihr Roman verdientermaßen Epoche machte. Daß man allerdings ihn, der das Ganze an die Öffentlichkeit befördert hatte, wegen seiner gutgemeinten Empfehlungen und Fußnoten in den Rezensionen derart rupfte, stimmte ihn ärgerlich. Andererseits schien es ihm auch bezeichnend. Er sah darin einen erneuten Beweis für die unverschämte und anmaßende Art, in der die Zeitungsschreiber kritisierten. Aber mit diesen Pedanten und Halbgelehrten, die ihre Urteile ohne Überlegung trafen und sich in den Zeitungen ausbreiteten wie die Stinkmorcheln, mußte ein Schriftsteller leben. Je berühmter er war, desto lieber nahmen sie seine Bücher in ihre Ätzlauge, um es sich im Schlepptau seines Ruhmes wohlsein zu lassen. Wieland kannte das zur Genüge und hatte sich damit abgefunden: Rezensenten beschnüffelten die Bücher nur, und je nach der Witterung, die ihnen entgegenkam, wurde geurteilt. Doch darüber noch mehr Worte zu verlieren, lohnte der Mühe nicht.
Es wurde gut gegessen und gut getrunken, und dann, als der Tee kam, nahm Wieland Sophie zur Seite, um ihr etwas sehr Erfreuliches mitzuteilen. Er hatte für sie das bestmögliche Honorar herausgehandelt: fünfzig Dukaten. Fast hundertfünfzig Reichstaler. Ein beachtliches Sümmchen für eine bis dahin unbekannte Autorin. Respektabel durch und durch. Der jüngst verstorbene verehrte Gellert hatte für seine Fabeln gerade mal zwanzig Reichstaler und sechzehn Groschen und für seine Lehrgedichte fünfundvierzig Reichstaler erhalten. Wieland war stolz, ihr ein solches Honorar präsentieren zu können.
Sophie wußte natürlich seine Bemühungen zu schätzen, aber sie lehnte selbstverständlich das Geld ab. Sie war schließlich kein »armer Dichter« und hatte es als Frau Staatsrätin nicht nötig, von einem Verleger ein Honorar entgegenzunehmen. Sie war in der glücklichen Lage, auf die Dukaten, die er ihr zubilligte, nicht angewiesen zu sein. Gemessen an dem, was der Herr Verleger an ihrem Buch verdiente, war das Honorar in ihren Augen ohnehin nur ein Handgeld. Und gemessen an dem Vergnügen, das sie beim Schreiben empfunden hatte, war es in Geld gar nicht aufzuwiegen. Wenn der Herr Verleger ihr aber unbedingt ein Honorar zahlen wollte, so sollte Wieland es entgegennehmen, und sie würde es dann dem Armenhaus stiften.
Wieland war sichtlich beeindruckt von dieser Geste und meinte, sie könne wahrlich dem Himmel danken, so gutsituiert zu sein, daß sie auf ein Honorar nicht angewiesen war, geschweige denn, daß sie seinetwegen die Feder in die Tinte tunken mußte. Gerade für eine Schriftstellerin war ein gediegener Finanzstand der eigentliche Luxus, der ihr die geistige Unabhängigkeit garantierte. Sie war zu beneiden. Sophie genoß seine Bewunderung und vor allem, daß sie ihm vorführen konnte, den richtigen Mann geheiratet zu haben.
Fast etwas verschüchtert saß Wieland vor ihr, war fasziniert, mit welcher Souveränität sie alles zu meistern verstand, wie ihr alles glückte und alles zufiel, und gerade darum fand er, daß es seine Pflicht war, ihr einmal deutlich zu machen, daß sie die Ausnahme war. Denn nicht allen ging es so gut wie ihr. Jetzt, da sie zum Poetenstande gehörte, sollte sie wissen, wie es auf diesem Felde bestellt war, wie traurig, wie schaurig trostlos es unter den Poeten aussah. Vor allem konnte sie von Glück sagen, als Frau für den Unterhalt einer Familie nicht sorgen zu müssen, denn die Poesie trug zwar schöne Blumen ein, aber leider nicht die Früchte, die einen nährten. Er hatte ja inzwischen drei Kinder und wußte, wovon er sprach.
In Deutschland muß man Bücher über das Pillendrehen und das Klistiersetzen schreiben, um als Autor etwas zu verdienen, sagte er. Als Poet steht man allemal traurig da.
Er verhehlte ihr nicht, wie sehr ihn das Geschäft des Autors ekelte. Die Notwendigkeit, alle Jahre etwas Neues in den Druck geben zu müssen, quälte ihn oft so sehr, daß ihm das Leben manchmal unerträglich schien. Und dann diese Flut von Neuerscheinungen! Die Meßkataloge wurden immer dicker, und inzwischen wetteiferten fast dreitausend Dichter im weitläufigen Vaterland um die Gunst des Publikums. Darunter kannte er nicht wenige, die ein kümmerliches Winkeldasein fristeten. Es gab auch genügend, die als Gelegenheitsdichter für Geburts-, Hochzeits- und Leichencarmen ihr Brot verdienten oder als Soldknechte der Feder im Dienste der Bücherfabriken standen: literarische Proletarier, die sich oft redlich mühten, aber doch nie eine Aussicht hatten, Ruhm zu ernten, wie es ihr über Nacht gelungen war.
Jedes Wort von ihm schien ihr eine doppelte Bestätigung all dessen, was sie bisher getan hatte, und sie spürte auf einmal, daß auch Zufriedenheit lustvolle Formen annehmen konnte. Alles um sie herum steigerte sich zum Vollkommenen: Die Tafel mutete sie außerordentlich schön an, die Gäste fühlten sich sichtlich wohl und unterhielten sich angeregt, der Tee und das Konfekt schmeckten vorzüglich, nur ihre Kinder benahmen sich nicht so, wie sie es sich gewünscht hätte. Sie standen zu dritt in der Ecke und musterten verstohlen die Gäste. Fritz hatte sich aus der Tabaksdose seines Vaters eine Pfeife gestopft und fand offensichtlich Vergnügen daran, seine Schwestern so zu unterhalten, daß sie unablässig kicherten. Auf einmal hörte Sophie, wie Fritz sich über seinen Lehrer Wieland lustig machte und auch noch dessen hohe heisere Stimme nachahmte. Die Töchter feixten so unverhohlen, daß es peinlich war. Innerlich aufgebracht, aber beherrscht ging sie auf die drei zu, forderte sie auf, sich gefälligst an der allgemeinen Unterhaltung zu beteiligen und zu zeigen, daß sie nicht irgendwelche dummen Geschöpfe waren mit nichts als Unsinn und Albernheiten im Kopf, sondern die Kinder des Staatsrats La Roche.
Aber Maximiliane hatte keine Lust, sich unter die Gäste zu mischen. Sie waren ihr alle zu alt und außerdem zu langweilig. Sophie hätte ihr auf der Stelle den Kopf zurechtsetzen mögen. Sie begriff ihre Tochter nicht. Maxe war mit ihren sechzehn Jahren eine Schönheit und von der Natur mit allen Vollkommenheiten ausgestattet, daß nicht nur Wieland sie enthusiasmiert mit einer Miltonschen Eva verglich. Zudem las sie ständig Romane, interessierte sich für Kunst und Landschaftsmalerei und hatte doch keinen Mangel an Gesprächsstoff.
Sophie wäre so gerne stolz auf sie gewesen, hätte so gerne gesehen, wie ihre Maximiliane in den Augen der Gäste zur Zierde des Hauses avancierte, aber sie tat so, als ginge sie das alles nichts an, separierte sich mit ihren Geschwistern und fand auch noch Spaß daran, sich über alle lustig zu machen. Dabei war Maximiliane doch stets die Vernünftigste von allen.
Sophie öffnete entschlossen den Flügel und gab ihrer jüngsten Tochter ein Zeichen, denn Lulu hatte mit ihrer herrlichen Kontra-Alt-Stimme schon manches Mal eine Gesellschaft entzückt. Fritz begleitete sogleich maniriert einherschreitend seine Schwester zum Instrument, küßte in der Art eines ergebenen Bewunderers das allerliebste Primadonnenhändchen und sagte zum allgemeinen Gelächter: Soloauftritt der ersten dramatischen Sängerin des Hauses, Mademoiselle Luise La Roche. Dann fiel er mit theatralischer Geste ihr zu Füßen. Maximiliane konnte vor Lachen nicht mehr an sich halten, und Lulu bekam einen roten Kopf. Sie stand zu Sophies Ärger wie eine störrische Geiß vor dem Flügel und weigerte sich, auch nur einen einzigen Ton zum besten zu geben. Als die Gäste ihr zuredeten, ja geradezu bettelten, wenigstens ein kleines Liedchen zu singen, wurde sie nur noch unwilliger und rannte schließlich an ihrer Mutter vorbei aus dem Salon.
Um den schlechten Eindruck zu mindern, forderte Sophie ihren Sohn auf, sich an den Flügel zu setzen, zumal er einen erstklassigen Unterricht auf diesem Instrument genossen hatte und Händels Klaviersuiten so eindrucksvoll zu intonieren verstand. Doch Fritz tat baß erstaunt und meinte, er könne gar nicht Klavier spielen, er beherrsche bloß die Gambe.
Sophie war wütend, daß ihre Kinder sie so blamierten. Aber sie ließ sich nichts anmerken. Glücklicherweise bestanden die Gäste nicht weiter auf den musikalischen Darbietungen. Dennoch wollte Sophie ihre Kinder in die Unterhaltung einbeziehen und zeigen, daß sie gut erzogen und gut ausgebildet waren. Als sich Jacobi zu ihr gesellte und Fritz noch immer demonstrativ unbeteiligt und schweigend neben ihr stand, sagte sie stolz, daß Wieland ihrem Sohn gerade meisterlich die Poesie beigebracht habe, woraufhin Fritz bemerkte, ihn hätten nur Bücher über die Infanterie interessiert.
Dann erzähle doch Herrn Jacobi wenigstens einmal von deinem exzellenten Tanzlehrer, sagte Sophie, um seine Unart etwas abzuschwächen, doch Fritz meinte nur: Wieso exzellent? Mehr als Deutschwalzen hat mir der Tolpatsch nicht beigebracht.
Sophie mußte an sich halten, um nicht die Fassung zu verlieren. Augenblicke später bot sich ihr wieder das gleiche Bild: Die beiden Töchter standen mit ihrem Bruder wie ein Häuflein Verschwörer in der Ecke, musterten die Anwesenden, flüsterten und tuschelten, lachten allweil auf und blickten dabei schadenfroh auf ihre Mutter, als hätten sie es darauf angelegt, sie endlich einmal vor allen Gästen aus der Haut fahren zu sehen.
Sophie sah: Sie wollten die Provokation. Sie gefielen sich im Widerspruch. Aber das war nichts Neues für sie. Es zeigte ihr bloß wieder einmal: Mit jedem einzelnen Kind konnte man auskommen, doch zusammen waren sie unerträglich. Statt sich zu freuen, daß bei ihnen im Hause die ersten Geister verkehrten, statt die Chance zu nutzen, mit ihnen zu reden, etwas von ihnen zu lernen und einen angenehmen Eindruck auf sie zu machen, gefielen sie sich ganz offensichtlich darin, das Gegenteil von dem zu tun, was von ihnen erwartet wurde. Wie blamabel, eine Wand vor sich zu haben, gegen die es kein Ankommen gab! Aber Sophie mochte sich nicht ärgern. Sie mochte sich ihre schöne Stimmung nicht verderben lassen.
Wenige Monate später, als der Sohn der Frau Rath Goethe zu Besuch kam, sah sie: Die lieben Blagen konnten auch ganz anders, wenn sie nur wollten und ihnen der Sinn danach stand. Eigentlich wollte Sophie einmal Ruhe haben vor immer neuen und immer anderen Gästen, aber sie hatte jüngst Frau Goethe in Frankfurt kennengelernt, hatte einen vergnüglichen Nachmittag bei ihr verbracht, Maxe und Cornelia waren Freundinnen geworden, und es wäre gegenüber Frau Goethe mehr als unhöflich gewesen, ihren Sohn jetzt nicht zu empfangen. Nein, diesen Gefallen mußte sie ihr schon tun. Außerdem hatte sie von ihr erfahren, daß ihr Wolf ein begeisterter Leser der Sternheim war, und es stimmte Sophie letztlich immer milde, wenn wieder ein neuer Enthusiast die Absicht hatte, sie persönlich kennenzulernen. Dafür wollte sie sich dann doch die Zeit nehmen, zumal sie gerade gegenüber jungen Menschen auch darauf bedacht war, jeden Eindruck von Überheblichkeit zu vermeiden.