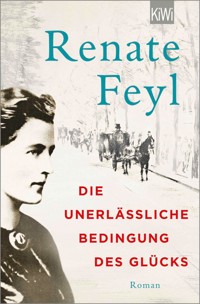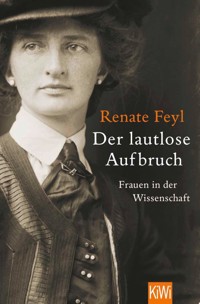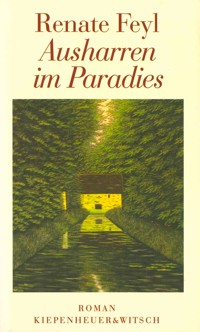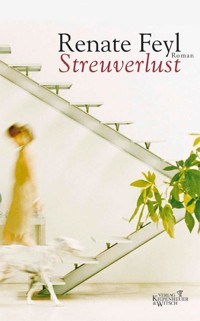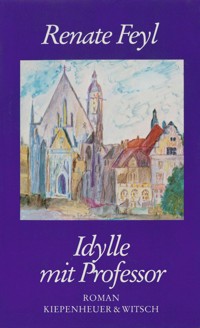
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leipzig, 1735. Victoria geht voller Bewunderung die Ehe mit dem gefeierten Professor Gottsched ein. An seiner Seite blüht sie auf und taucht ein in die Welt der Sprache und Literatur. Ihrem Mann wird sie zur unentbehrlichen Gehilfin. Doch Victoria will noch mehr. Sie beginnt, ihre Arbeiten unter ihrem eigenen Namen zu veröffentlichen. Bald ist sie berühmter als Gottsched – ein Erfolg, der ihr zum Verhängnis wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Renate Feyl
Idylle mit Professor
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Renate Feyl
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Renate Feyl
Renate Feyl, geboren in Prag, studierte Philosophie und lebt als freie Schriftstellerin in Berlin. Von ihr erschienen bei Kiepenheuer & Witsch »Idylle mit Professor« (1988), »Ausharren im Paradies« (1992), »Die profanen Stunden des Glücks« (1996), »Das sanfte Joch der Vortrefflichkeit« (1999), »Streuverlust« (2004), »Aussicht auf bleibende Helle« (2006) und »Lichter setzen über grellem Grund« (2011).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Zweiundzwanzigjährig wird Victoria Kulmus 1735 die Frau des Professors Gottsched, damals berühmt als einflußreichster Kritiker der deutschen Sprache und Literatur. Voller Bewunderung folgt sie seinem Ideal, »für den Mann das Paradies seiner Augen, die Göttin seiner Lust und der Quell seiner Gedanken zu sein«. Als er sie wegen ihrer Intelligenz zu seiner »Gehilfin« ernennt, ihr Lateinunterricht gibt und sie im Übersetzen unterweist, ist sie seine gelehrigste Schülerin. Aber schon bald beginnt die »Gottschedin«, sich geistig zu emanzipieren. Sie fertigt Übersetzungen nicht mehr nur anonym für ihren Mann an, sondern sucht sich eigene Projekte, die unter ihrem Namen erscheinen. Mehr noch: Sie schreibt eigene Lustspiele – derb, witzig, die Philister aufstörend. Bald ist sie berühmt, berühmter als ihr Mann, dessen Ruhm verblaßt. An diesem Punkt beginnt die Entwicklung für sie verhängnisvoll zu werden. Ohnmächtig muß sie erkennen, daß sie weiterhin von dem Einfluß und den kleinen Intrigen ihres Mannes abhängig bleibt, daß sie, auch wenn sie »die erste Schriftstellerin Deutschlands« ist, nie aus dem Schatten Gottscheds heraustreten wird. Resigniert stirbt sie mit 49 Jahren.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1989, 1992, 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Kalle Giese, Overath
ISBN978-3-462-30947-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Die ideale Frau muß für den Mann …
Friederike Karoline Neuber kommt früher als erwartet …
Immer häufiger sucht Gottsched Anlässe …
Die ideale Frau muß für den Mann das Paradies seiner Augen, die Göttin seiner Lust und der Quell seiner Gedanken sein. Ist sie geschickt, führt sie ihn auf Höhen, von denen er selber nichts ahnt. Ist sie klug, geht sie in den geistigen Dingen auf und tritt dennoch immer wieder hinter sie zurück. Im Haus, ihrem ureigensten Reich, soll sie Fleiß und Ordnung walten lassen, soll erhalten und mehren, was der Mann erwirbt und besitzt. Kehrt er abgekämpft heim, will er das andere von ihr – Ruhe, Freude, Anmut, Harmonie. Dies stellt sich nicht in Chaos und Wirrwarr, sondern allein in der Ordnung her.
Weiblich sein bedeutet, den Mann zu faszinieren, ihn mit immer neuen Seiten zu überraschen. Dazu gehören Verstand und wacher Geist. Bildung und Wissen sind für eine Frau unerläßlich. Das heißt nicht, daß sie zu den Tiefen der Erkenntnis vordringen soll. Diese Mühen obliegen ihr nicht, zumal die Natur ihr einen anderen Verstand als dem Manne gegeben hat. Weiblicher Verstand ist anschaulich, sinnlich, aufs Detail gerichtet, geht auf im Einzelnen und erschöpft sich in ihm. Männlicher Verstand zielt auf das Übergeordnete, Allgemeine und Wesentliche, ist für das Abstrakte und Theoretische bestimmt. Im weiblichen Denken muß daher nicht Tiefe, sondern Muße liegen. Ist sie allerdings vom Schicksal ausersehen, an der Seite eines gelehrten Mannes zu gehen, und gelingt es ihr, seine geschickte Gehilfin zu werden, dann wird dieser Mann ein solches Geschöpf als wahrhaftes Glück empfinden. Arbeitet sie darüber hinaus an ihrer eigenen Vervollkommnung, ein innerlich reicher, erfüllter Mensch und damit ihm ebenbürtig zu werden, so hat er die ideale Frau gefunden.
Victoria erhält diese lehrreiche Unterweisung gleich nach der Hochzeit, als Gottsched mit ihr im Jahre 1735 in der Extrapost von Danzig nach Leipzig fährt. Für sie sind es nicht nur Worte. Es sind Maßstäbe. Frau eines berühmten Mannes zu sein, ist ein besonderes Amt. Es bedarf besonderer Verpflichtungen. Würden ihre Eltern noch leben, sie wären zufrieden mit ihr. Nichts hat Dr. Kulmus sehnlicher gewünscht, als daß die Tochter eines Akademikers auch die Frau eines Akademikers wird, damit die geistige Tradition der Familie gewahrt bleibt. Er hat ihr immer wieder gesagt: Heirat ist nicht gleich Heirat, und Ehe ist für einen Mann etwas anderes als für eine Frau. Für ihn ist es eine Form, für sie ein Inhalt. Wo er sein Vergnügen sieht, hat sie ihre Existenz.
Ihre Geschwister, ihre Freundinnen beneiden sie. An der Seite dieses berühmten Mannes wird ihr Leben Bedeutung bekommen. Es wird etwas von jenem Licht erhalten, das er in Fülle verbreitet. Was kann sie einem solchen Mann anderes geben als das Versprechen, sich dem Ideal der Vollkommenheit anzunähern?
Der Empfang in Leipzig ist überwältigend.
Victoria und Gottsched stehen am geöffneten Fenster und schauen auf die Straße hinab. Studenten haben sich zu einem Halbrund formiert und bringen ihnen eine solenne Abendmusik dar. Im Widerschein der Fackeln glänzen die Zeichen der Landsmannschaften. An der langen Stoßklinge und dem gelben Gefäß mit dem großen, runden Stichblatt erkennt Gottsched die Hallenser, an der breiten Klinge die Wittenberger, an dem schwarzen, eisernen Gefäß die Jenenser und an dem kleinen Galanteriedegen die Leipziger. Auch die Fahnen erklärt er. Ein Hausdiener stellt Lichter in das Fenster, damit das Hochzeitspaar von den Jubelnden gesehen wird.
Erregung zeichnet Victorias Gesicht. Nach Singen und Jauchzen ist ihr zumute. Sie möchte laut und übermütig, grob und zärtlich sein, etwas Ungehöriges tun, mit ihm tanzen, ihn jagen und fangen, möchte den Lauf der Welt unterbrechen, aus Zeit und Raum schweben, sich fallen lassen oder hinunter auf die Straße springen und tot sein. Es würde ihm zeigen, daß sich ihr Leben in diesem Augenblick erfüllt hat.
Immer mehr Nachbarn schauen aus den Fenstern und erscheinen vor den Haustüren. Neugierige eilen herbei. Berittene verweilen am Straßenrand. Eine Menschenansammlung entsteht. Jubelrufe werden laut. Leipzigs Musenpaar soll leben, dreimal hochleben. Verwirrt nimmt Victoria die öffentliche Beachtung wahr, die mit einemmal auch ihrer Person gilt.
Jüngst erst mit widrigen Lebensumständen in Danzig gerungen, den Tod des Vaters, dann den Tod der Mutter erlebt, der Belagerung und Beschießung der Stadt während des Kampfes um den polnischen Königsthron gerade noch heil entkommen und jetzt die Frau eines gefeierten Mannes – sie kann es noch gar nicht fassen. Sie hat zwar seit dem vierzehnten Lebensjahr mit dem Magister korrespondiert, hat ihm ihre Gedichte geschickt und im Beisein ihrer Eltern auch zweimal seinen Besuch empfangen, aber hat doch nie gedacht, daß ausgerechnet sie es sein wird, die er für würdig hält, mit ihm den Bund der Ehe zu schließen.
Wäre sie eine schöne Frau, sähe alles ganz anders aus. Aber wer ist sie denn schon? Genau besehen hat sie nichts, worauf sie besonders stolz sein könnte. Sie ist zwar aus gutem, aber nicht aus begütertem Hause. Sie hat kein Vermögen und keine reichen Verwandten. Auf eine Erbschaft darf sie nicht hoffen. Sie ist auch nicht berühmt wie eine Dacier oder eine Châtelet, geschweige denn, daß sie es verstünde, sich mit einem gewissen Nimbus zu umgeben. Sie hat nichts, was sie vor anderen besonders auszeichnen könnte: nicht das Liebliche einer Venus, nicht die Weisheit einer Minerva, nicht das Ansehen einer Vesta, nichts hat sie, gar nichts außer vielleicht einer Zukunft. Sie kann ihrem Gottsched im Augenblick nichts anderes geben als die Hoffnung, einmal so zu werden, wie er sich seine Frau wünscht.
Victoria schmiegt sich an ihn. Er flüstert ihr zu, daß sie an seiner Seite eines Tages die größte Muse an der Pleiße sein wird, und sie ist dankbar, etwas von ihm zu vernehmen, das in diesem Moment ihr allein gilt. Seine Stimme, diese tiefe, in sich ruhende Stimme, die ihr der Inbegriff alles Männlichen ist, schafft Intimität, wo immer er sich aufhält. In dem vollen Klang liegt etwas unvergleichlich Überlegenes, Großes und Kraftvolles, etwas so Bestimmendes und Zwingendes, dem sie sich fraglos fügt. Sie fühlt es bis in die Fingerspitzen: Die erotische Faszination dieses Mannes geht von seiner Stimme aus.
Sie findet es wunderbar, daß er keine Spur von Aufregung zeigt. Wissend um seine Würde, steht er gelassen am Fenster, blickt auf die Straße hinab und nimmt die Jubelrufe so selbstverständlich entgegen, wie es nur demjenigen gelingt, dem eine solche Begrüßung gebührt. Seine Haltung beeindruckt sie: die Hände auf dem Fenstersims, die Schultern zurückgenommen, das Kinn vorgestreckt, damit Entschlossenheit und Tatkraft deutlich zum Ausdruck kommen. Den Kopf leicht in den Nacken gewinkelt, schweift sein Blick an allem Irdischen, Gegenständlichen vorbei direkt in die Ferne, als zöge in diesem Augenblick das Morgenrot der Erleuchtung herauf, für die anderen unsichtbar, aber für ihn schon so nahe. Sein Lächeln schwebt über die Köpfe dahin, erheischt Respekt und kommt zu ihm zurück. Nur ein Mann, der sich seines Wertes sicher ist, vermag sich selbst so zuzulächeln. Victoria ist stolz auf ihn und insgeheim natürlich stolz auf sich. Ein Gemahl wie Gottsched wird mehr als jeder andere Verständnis für ihre eigenen Absichten aufbringen: Sie will schreiben. Was sie bereits als Unverheiratete in Danzig getan hat, möchte sie in ihrer Ehe fortsetzen und über die bisher im Druck erschienenen Gedichte hinausgehen. Sie will sich in Übersetzungen versuchen. Vielleicht werden ihr sogar eigene Lustspiele gelingen. Nie ist ihr die Zukunft in einem schöneren Lichte erschienen. Luftsprünge möchte sie machen, wenn es die Würde des Augenblicks zuließe.
Gottsched stellt sich hin und wieder auf die Fußspitzen, als wolle er eine Rede beginnen. Bürger von Rom! Victoria ist überzeugt, daß er selbst einen Cicero an Eloquenz noch übertreffen würde. Aufgeregt erwidert sie seinen Händedruck. So, wie er neben ihr steht, machtbewußt und voll erhabenen Ernstes, bestätigt es sich ihr aufs neue: Er ist nicht irgendein Professor, so ein emsiger, aufs Sammeln, Sichten und Ordnen erpichter Buchgelehrter. Er gehört zu jenen, deren Titel nur die erste akademische Weihe auf dem Weg zu einem großen Ziel ist – Erzieher der Nation zu werden.
Bange überkommt sie auf einmal, ob sie ihm überhaupt eine ebenbürtige Gefährtin sein kann. Geistig ist sie doch – gemessen an ihm – ein unbeschriebenes Blatt. Daß sie die Höhe seiner Gedanken jemals erreichen wird, erscheint ihr jetzt fraglicher denn je. Sie weiß nicht einmal, ob sie seinem Forschergeist, diesem unerbittlichen Arbeitseifer zu folgen vermag. Sie weiß nur: Außergewöhnliche Menschen bedürfen außergewöhnlichen Verständnisses. Die Liebe wird den Rest tun. Sie ist der Zauberspiegel, der alles in doppelter Größe wiedergibt.
Victoria meint, er müsse fühlen, was sie im Augenblick empfindet – nicht schlechthin einem Glück, einer Seligkeit geht sie entgegen. Sie lehnt sich an seine Schulter und träumt sich über die Klänge hinaus in den Abend. Eine milde Mailuft trägt den Duft nahe gelegener Gärten heran. Sie atmet tief ein. Alles in ihr schlägt höher – das Herz, die Gefühle, ja selbst die Erwartungen scheinen sich zu vervielfachen.
Der Zeitpunkt der Heirat hätte für Gottsched nicht günstiger sein können. Victoria ist zweiundzwanzig Jahre, gesund und tatfroh, er zählt gerade fünfunddreißig und hat seit kurzem eine ansehnliche Bestallung als Professor ordinarius der Logik und Metaphysik mit allen ihm in dieser Eigenschaft zustehenden Prärogativen, Emolumenten und Freiheiten: privaten Kollegiengeldern, Freitisch, fünf Klaftern Brennholz, Universitätsimmunität und Neujahrssalär. Überdies hat ihm sein Verleger Breitkopf eine schöne Wohnung in seinem Hause im »Goldenen Bären« am Alten Neumarkt überlassen, wo sich die Buchhandlung, die Buchdruckerei und die Schriftgießerei befinden. Für die Korrektordienste, die er dem Verleger leistet, wird Gottsched ein Leben lang ohne Mietzins die erste Etage bewohnen dürfen. Von hier aus sind es nur ein paar Schritte zur Universität, zur Paulinerkirche und zur Bibliothek, so daß er die Stätten seines Wirkens jederzeit rasch zu erreichen vermag. Auch über mangelnden Vorlesungsbesuch kann er nicht klagen. Studenten aller Fakultäten drängen in seine Kollegien, sind angetan von der Reform der Sprache, Literatur und Bühne, die er über Sachsens Grenzen hinaus verfolgt, und verehren ihn als den Caesar der Poesie. Selbst unter den Kollegen steht Gottscheds Ansehen in vollstem Flor. In den ersten Häusern der Stadt ist er ein gern gesehener Gast. Kommen vornehme Fremde, wird er mit zur Tafel gebeten, denn wo er erscheint, erhält der Abend Glanz.
Als er vor elf Jahren aus seiner Vaterstadt Königsberg floh, hatte er keine Ahnung, daß sich sein Leben einmal derart fügen würde. Damals waren ihm die Soldatenwerber des preußischen Königs auf den Fersen, die noch immer in allen Landen nach Männern Ausschau halten, die von außergewöhnlicher Körpergröße sind. Er war rechtzeitig gewarnt worden vor diesen Auflaurern und Menschenfischern, die er bis heute tief verabscheut. Durch List und Gewalt, mit Branntwein und Versprechungen reißen sie ruhige Landessöhne aus dem Schoße ihrer Familien und schleppen sie nach Potsdam, um die sonderbare Leidenschaft eines Königs zu stillen, der behauptet, Gott habe ihm alle Menschen von ungewöhnlicher Größe vermacht. Gewiß, als Leibgrenadier hätte Gottsched kein schlechtes Leben geführt, denn es ist kein Geheimnis, daß der König seine Riesen mit Grundstücken beschenkt, ihnen Kanonikate und Pfründe erteilt, Häuser und Wirtschaften baut, ihnen den Wein- und Bierausschank erlaubt oder Geld vorschießt, damit sie sich Kaufläden anlegen können, mitunter auch wohlhabende, gutgewachsene Mädchen zwingt, ihnen die Hand zu reichen. Aber um keinen noch so verlockenden Preis der Welt wollte Gottsched die preußische Muskete tragen. Ob er nun der Leibgarde oder einem anderen Regiment des Königs zugeteilt worden wäre – Armee blieb Armee, und der Militärdienst war für ihn, den Studenten der Theologie mit Neigung für Philosophie und Poetik, eine Form des Gehorsams, der nur für jene taugt, denen Gott einen schläfrigen Geist gegeben hat. So floh der Pastorensohn mit seinem Bruder im tiefsten Winter über Polen, Schlesien und die Lausitz zu Fuß, zu Pferd, auf Hühnerwagen, mit einfacher und schneller Post und erreichte nahezu mittellos, doch mit mehreren Empfehlungsschreiben, die Tore von Leipzig.
Auch wenn ihm nicht die Soldatenwerber auf den Fersen gewesen wären, hätte er über kurz oder lang in seinem preußischen Vaterland für sich keine Zukunft gesehen. Denn längst war es auch bis nach Königsberg an das Collegium Albertinum gedrungen, daß Friedrich Wilhelm einen Ekel hatte vor allem, was gelehrte Kenntnis hieß, und daß er wünschte, niemand in seinen königlichen Landen solle mehr lernen, als was dazu nötig sei, um ein abgehärteter Soldat, ein arbeitsamer Bürger, ein sparsamer Wirt und ein ehrlicher Christ zu sein. Wo der oberste Landesherr höchst eigenhändig Gelehrte mit Namen wie Tintenkleckser, Narren, Grübler und Schmierer versah, fürchtete Gottsched um eine gedeihliche Atmosphäre für die Wissenschaft. Seine Zweifel wurden bestärkt, als ihn die Nachricht traf, daß Christian Wolff, den er wie keinen anderen Philosophen schätzte, die Stadt Halle und die preußischen Lande bei Strafe des Stranges binnen achtundvierzig Stunden zu verlassen hatte. Über Nacht mit ein paar Bücherkisten und einer hochschwangeren Frau fliehen zu müssen, nur weil es einen aufrecht gesinnten Mann danach verlangt, Ordnung, Licht und Gründlichkeit in das philosophische Denken zu bringen – das gab Gottsched den letzten Anstoß zum Aufbruch. In einem Land, wo die Suche nach Wahrheit mit Ausweisung bestraft wird, sah er für sich kein Zuhause. Und nicht ohne Absicht hatte er sich Leipzig als Ziel gewählt.
Diese Stadt, Sachsens Zierde und fremder Länder Bewunderung, gilt ihm noch immer als ein Mittelpunkt Deutschlands, der – umgeben von lauter Stutzerwinkeln – Größe und Weitläufigkeit offenbart. Neujahr, Ostern und Michaelis werden hier die Messen eingeläutet und sorgen mehrmals im Jahr für ein buntes Treiben, wie es den Griechen bei ihren Olympiaden nur alle vier Jahre vergönnt war. Vor allem aber kommen zu den Ostermessen Hunderte von ausländischen Buchhändlern, weil in Leipzig wie in keiner anderen Stadt Verlage, Kupferdruckereien und Zeitschriftenredaktionen eine Hochburg der Musen bilden, die Schriftstellern, Buchgelehrten, Verlegern, Antiquaren, Bibliothekaren, Forschern und Federfertigen aller Art eine gastliche Herberge bietet. Beweglicher Geist und merkantiler sächsischer Sinn haben die Stadt zu einem Umschlagplatz für Ideen gemacht und eine Atmosphäre geschaffen, die Lust weckt, dabeizusein und mitzuhalten. Hier lebt man mit den literarischen Ereignissen in vertrauter Gesellschaft, von hier gehen Impulse und Tendenzen aus, hier schlägt alles zu Buche, hier laufen die Fäden zusammen, werden die Kontakte geknüpft und die Sensationen angebahnt. Leipzig ist eine Garküche des Ruhmes. Außerdem besitzt die sächsische Metropole eine so ehrwürdige wie aufstrebende Universität, an der Fleming, Günther und Leibniz studiert und Thomasius gelehrt haben. Eine idealere Stadt kann es für Gottscheds Pläne nicht geben. Ob es eine höhere Fügung, ein gütiges Schicksal oder bloß ein guter Instinkt war – er dankt dem Himmel, den preußischen Landen entsagt zu haben.
Nach dem erhebenden Empfang weiht Gottsched Victoria ohne Säumen in die Mysterien des Alltags ein. Er stellt ihr das Personal vor – die Köchin, die gute Seele; die Dienstmagd, das brave Ding – und führt sie durch die Wohnung. Obgleich die Zimmer eher sparsam eingerichtet sind und die Möbel sich nicht gerade kostbar ausnehmen, mutet sie dennoch hier alles groß und repräsentativ an. Auf den ersten Blick erkennt sie, daß noch vieles für sie zu tun ist und ihr genügend Möglichkeiten bleiben, ihren Geschmack in Vorhängen, Bildern und anderen Neuerungen sichtbar zu machen.
Doch dann, als sie sein Arbeitszimmer betreten, verschlägt es ihr schier die Sprache. Wo sie hinschaut – hohe Bücherschränke, üppig gefüllt mit Geist. In der Mitte ein Schreibtisch, groß und unverrückbar, als müsse er das ganze Universum tragen. Auf der Schreibtischplatte Stapel von Manuskripten, Konspekten, Entwürfen, Druckbögen und Büchern, dazwischen ein Chronometer, dessen dumpfer, gleichmäßiger Schlag unbarmherzig zur Arbeit mahnt. Hinter dem Schreibtisch ein hochlehniger Sessel, würdig eines Olympiers; zur Rechten der Erdglobus, zur Linken der Himmelsglobus und in Reichweite ein Schrank mit Münzen und Mineralien. Besonders beeindruckt ist sie von dem astronomischen Fernrohr. Es steht wie ein Wegweiser zum Himmel vor dem Fenster und gibt dem Raum eine erkenntnisschwere Atmosphäre. Noch nie hat Victoria ein solches Kabinett der Weltweisheit gesehen. Nicht bei ihrem Vater, der Leibarzt des polnischen Königs war und selbst gelehrte Abhandlungen schrieb, und nicht bei ihrem Onkel, diesem Meister der Prosodie, der sie in der Behandlung und Messung der Sprache im Vers unterwies. Noch nie hat das Reich der anmutigen Gelehrsamkeit für sie derart Gestalt angenommen.
Mit Bestimmtheit betont Gottsched, daß in diesem Zimmer nichts verändert werden darf. In den anderen Räumen der Wohnung mögen beliebige Neuerungen getroffen werden. Nicht das geringste hat er dagegen einzuwenden, im Gegenteil. Nur in seinem Zimmer muß alles so bleiben, wie es ist. Hier soll nicht Staub gewischt oder vermeintlich Ordnung geschaffen werden. Hier wünscht er keine Störung, und unaufgefordert hat niemand in diesem Raum etwas zu suchen. Die geringste Ablenkung würde ihn verstimmen, so wie ihn bereits eine Lücke in seinen Bücherschränken, die er sich nicht zu erklären vermag, überaus nervös macht.
Victoria kann ihn verstehen. Mit allem hier, mit jedem Gegenstand, ist er auf besondere Weise verbunden. Hier haben die Dinge einen Sinn, den ein anderer nicht sieht. Ihr braucht er wahrlich nicht zu sagen, daß jeder fremde Handgriff in diesem Zimmer wie ein Eingriff, wenn nicht wie eine Bevormundung anmuten muß, die einem selbständigen Geist zutiefst zuwider ist. Sie weiß ja von ihren eigenen bescheidenen Arbeiten, wie schnell bei der geringsten Ablenkung der Gang der Gedanken gestört wird und wie mühsam die Zwiesprache mit den Ideen und Vorstellungen wieder aufgenommen ist. Selbstverständlich wird sie dieses Zimmer nur betreten, wenn er sie dazu auffordert. Als Gottsched die Tür des geheiligten Tempels hinter sich schließt, ist ihr, als habe sie einen Blick in sein Wesen getan.
Mit der Geste eines hochherzigen Gönners übergibt er ihr den nächsten Raum. Ihr ureigenstes Reich wird das Toilettenzimmer sein. Es ist nicht groß, aber für ihre Zwecke wie geschaffen. Hier, wo die Frau des Hauses sich aufhält, liegt für ihn das eigentliche Zentrum einer Wohnung. Hierher zieht es die vertrauteren Freunde der Familie, für die nicht immer gleich der Salon hergerichtet werden muß, und hier wird auch er seine Stunden mit ihr verbringen: Tee oder manchmal auch ein Täßchen Kaffee trinken, ihr vorlesen, ihr zuhören oder zusehen bei der Arbeit und das geistige Tête-à-tête pflegen.
Besonders beeindruckt ist sie von einem Lesepult, das verloren in einem Erker steht und den Anschein erweckt, als warte es auf einen Benutzer. Victoria öffnet das Fenster, schaut in eine üppig ausladende Kastanie, auf deren Zweigen weiße Blütenkerzen wie lustige kleine Zuckerhüte stehen und sanft vom Wind bewegt werden. Einen Augenblick lauscht sie in das Rauschen der Blätter hinaus, dann fällt sie ihm um den Hals. Die Wohnung ist nach ihrem Geschmack. Gottsched freut sich. Er zweifelt keinen Augenblick daran, daß sie alles noch behaglicher herrichten wird, und will ihrem Geschick und ihrer Umsicht völlig freie Hand lassen.
Zur Bestätigung seiner Worte entnimmt er der Schublade des Lesepults ein Buch und überreicht es ihr mit einer so feierlichen Miene, als wolle er damit sein Schicksal in ihre Hände legen. Er hat es eigens für sie binden lassen, dieses Poesiealbum des Alltags. Neugierig blättert sie, schaut auf leere Seiten, die durch einen Mittelstrich in zwei Rubriken eingeteilt sind. Gottsched vertraut ihr das Herzstück aller familiären Ordnung, das Haushaltungsbuch, an. Hier soll sie die Einnahmen und Ausgaben genauestens eintragen, damit am Monatsende die Summe der Einkünfte mit der des Verzehrs verglichen und etwaige Schlußfolgerungen für den jeweils kommenden Monat gezogen werden können. Sie wird selbst bald merken, daß das Leben in einer Welt- und Messestadt zu unbedachten Ausgaben verleitet und die Kosten, die der Haushalt und vor allem die Repräsentation erfordern, hoch sind.
Einen Augenblick meint Victoria, das Buch liege wie ein Prüfstein in ihren Händen. Sie verspricht ihm, sich Mühe zu geben und es sorgfältig zu führen. Er vernimmt dies mit Genugtuung, denn er mißt der Beschäftigung mit dem Haushaltungsbuch große Bedeutung bei. Schließlich handelt es sich dabei um keine dieser gewöhnlichen Arbeiten wie Staubwischen, Fensterputzen oder Möhrenschaben – dafür hat er ihr Personal gegeben –, nein, Höheres, Übergeordnetes liegt in dieser Tätigkeit. Hier zeigt sich schwarz auf weiß, ob eine Frau Geschick und Talent zur Vorausschau hat, ob sie lenkend die Dinge in die Hand zu nehmen vermag und imstande ist, im Kleinen zu mehren, was der Mann im Großen erwirbt.
Überdies offenbart sich für ihn gerade in diesem Buche eine Grundtugend des Lebens, die Sparsamkeit. Sie ist ein Zeichen von beweglichem Intellekt, verlangt Umsicht und geschickten Ausgleich zwischen einem Bedürfnis und seiner Befriedigung. Sparsamkeit ist die Kunst, das Geld so einzuteilen, daß man dennoch auf nichts verzichten muß. Nur die Dummen und Einfältigen verwechseln sie mit Geiz. Gottsched krönt seine Ausführungen mit der Klage des Marcus Tullius Cicero: Oh, ihr unsterblichen Götter! Sie sehen es nicht ein, die Menschen, welch eine große Einnahme die Sparsamkeit ist!
Victoria wartet auf weitere Worte, doch Gottsched küßt seine junge Frau und führt sie noch einmal durch alle Räume der Wohnung. Er ist voller Überschwang, voller Begehrlichkeit und flüstert ihr Zärtlichkeiten ins Ohr. Seine Stimme bekommt wieder diesen tiefen, vollen Klang. Victoria ist glücklich. Sie kann es kaum erwarten, in seinem Sinne tätig zu werden und ihm seine Welt zu verschönern.
Doch vorerst hat sie einer gesellschaftlichen Pflicht zu genügen und sich auf die Antrittsbesuche vorzubereiten. Müßte sie allein diese Visiten bestehen, wäre ihr bang ums Herz. Gottscheds Begleitung jedoch gibt ihr Sicherheit. Wo er erscheint, richtet sich das Interesse auf ihn, und keiner wagt es, in seiner Gegenwart sie mit neugierigen Fragen zu bedrängen.
Schon während des ersten Besuches bei Professor Ernesti bestätigt es sich: Mehr als die junge Frau Gottscheds beschäftigt den Rektor der Thomasschule die Angelegenheit seines Kantors Bach, der vor längerem schon beim Dresdner Hofe um das Prädikat eines Hofkompositeurs eingekommen war, diesem Gesuch die Stimmen des Kyrie und Gloria der h-Moll-Messe beigefügt hatte und noch immer auf die Antwort des Kurfürsten wartet.
Bei Friedrich Otto Menke wird mit Gottsched über einen neuen Beitrag für die Acta eruditorum verhandelt, und im Hause Winkler hält der Professor höchstpersönlich ihr zwar ein humoriges Privatissimum über den Satz, daß in der Vernunft allein alle Regeln unseres Handelns liegen, wendet sich aber dann Gottsched zu und spricht mit ihm über die bewegenderen Fragen der Zeit. Er liest einen Brief vor, den er aus Frankfurt an der Oder erhalten hat und worin beklagt wird, daß noch immer Dozenten, die Vorlesungen über die moralischen und metaphysischen Schriften Wolffs halten, in Preußen mit Kassation und einer fiskalischen Zahlung von hundert Speciesdukaten bedroht werden. Nur der Kurfürstlich Sächsische Hofrat Mascow interessiert sich für Victorias Herkunft und will von ihr, der Danzigerin, wissen, wie das Grab Opitzens in der Oberpfarrkirche zu St. Marien ausschaut.
Sobald die Frauen des Hauses hinzukommen und Victoria in ihren Kreis ziehen, nehmen die Gespräche eine Wende. Da wird geklagt über die Unzuverlässigkeit der Dienstboten, über die Verteuerung der Brüsseler Spitzen, über die Untauglichkeit der Wundärzte und den ungenügend aufgestockten Fiskus für Professorenwitwen. Hier erfährt sie die Adressen von eleganten Tailleurs und guten Porträtstechern, von Häusern, in denen den ganzen Tag Lombart, Piquet, Billard oder Basette gespielt, und von dieser oder jener Gattin, der ein galantes Verhältnis nachgesagt wird. Auch Professorenhaushalte, wo Tod und Krankheit schicksalhaft in das Leben eingegriffen haben, sind ihr bald ein Begriff. In kurzer Zeit kennt sie sich in den höheren akademischen Kreisen Leipzigs aus.
Die Herzlichkeit, mit der Victoria allerorts aufgenommen wird, schreibt Gottsched voller Genugtuung insgeheim sich und seinem Ansehen zu und ist hocherfreut, daß sie an diesem neuen Leben ganz offensichtlich Gefallen findet. Er rät ihr, auch künftighin den Umgang mit den Frauen zu pflegen, denn etliche seien unter ihnen, von denen sie manch nützlichen Ratschlag für die alltäglichen Dinge bekommen könne.
Mit brennender Neugier jedoch sieht Victoria dem Besuch bei Christiane Mariane von Ziegler entgegen. Sie kann es kaum erwarten, die Frau kennenzulernen, von der Gottsched in höchsten Tönen schwärmt. Vor noch nicht allzulanger Zeit hat er sie als Mitglied in die Deutsche Gesellschaft aufgenommen und zur Kaiserlichen Poetin krönen lassen. Die Musiker und Literaten, die in ihrem Salon ein und ausgehen, huldigen ihr wie keiner anderen und künden in Gedichten und Liedern von ihrem Ruhm. Bach komponiert gerade auf die Zieglerschen Texte die Kirchenkantaten von Misericordias Domini bis Trinitatis und dirigiert hin und wieder ihr zuliebe die Gartenmusiken, die sie zum Ergötzen der Leipziger veranstaltet. Wo Victoria hinkommt, mit wem sie auch spricht – Frau von Ziegler ist jedem ein Begriff. Selbst über ihr Schicksal weiß man sich im Bilde: Mit zwölf Jahren wird ihr Vater, der Leipziger Bürgermeister Romanus, arretiert und als Staatsgefangener auf die Festung Königstein verbracht; mit sechzehn heiratet sie, verwitwet früh, heiratet erneut, den Hauptmann von Ziegler, zieht mit ihm in den Schwedenkrieg, aus Liebe heißt es, aus großer Liebe, doch auch Ziegler stirbt, und bald darauf verliert sie ihre beiden Kinder, sechs und zehn Jahre alt. Victoria kann verstehen, daß eine solche Frau nur noch in der Musik und in der Poesie zu leben vermag.
Sie liest noch einmal in Frau von Zieglers Gedichtband, dem Versuch in gebundener Schreibart, liest auch ihre Briefe in Prosa, denn nichts wäre ihr peinlicher, als eine Dichterin zu treffen und deren Werke nicht zu kennen. In Gedanken legt sie sich zurecht, was sie darüber sagen wird, denn daß man einer Poetin, die so ernste, erhabene Verse schreibt, nicht mit banalem Gerede die Zeit stehlen darf, gebietet sich für Victoria von selbst. Wünscht die Dichterin allerdings nicht angesprochen zu werden, kann Victoria auch das nur zu gut verstehen.
Als sie dann klopfenden Herzens an der Seite Gottscheds den Salon der Frau von Ziegler betritt und diese in einem leicht wehenden Seidenkleid auf sie zueilt und umarmt, als sei sie ihre vertraute Freundin, verschlägt es Victoria die Sprache. Die schöne, extravagante Erscheinung dieser vierzigjährigen Frau verblüfft sie so sehr wie die unkomplizierte, hinreißende Herzlichkeit, mit der sie empfangen wird. Ehe sie recht begreift, wie ihr geschieht, hält sie schon ein Weinglas in der Hand und befindet sich inmitten einer Schar illustrer Gäste. Der hohe Raum mit seiner Deckenornamentik, dem Zierporzellan, den Silberleuchtern, der verschwenderischen, aber leicht vernachlässigten Eleganz der Einrichtung strahlt eine Atmosphäre von Luxus und Exklusivität aus, wie sie Victoria bisher nur aus den Beschreibungen französischer Salons kennengelernt hat.
Ein Gespräch unterbrechend, gesellt sich Frau von Ziegler zu einem jungen Mann am Klavier und improvisiert mit ihm über ein Thema von Händel. Selbst in der Wahl der Musikinstrumente scheint die Dichterin das Ausgefallene zu bevorzugen, denn Victoria hat noch nie ein weibliches Wesen auf einer Querflöte spielen sehen. Wie anmutig und heiter die Zieglerin ihrer musikalischen Eingebung folgt. Keine Anstrengung in ihrem Gesicht, nichts Verkrampftes in ihrer Haltung, sanft wie eine Muse steht sie da und weiß mit jeder neuen Kadenz zu überraschen. Die Darbietung beeindruckt. Es wird viel Beifall gespendet, viel getrunken und viel gelacht.
Victoria hat Mühe, sich in diesem fröhlichen Durcheinander von Stimmen und Farben vorzustellen, daß an diesem Ort, in diesem Raum vor zwei Jahren der Dekan der philosophischen Fakultät der Wittenberger Universität im Beisein vieler angesehener und gelehrter Männer der Frau von Ziegler das Diplom einer Poeta laureata überreicht und ihr eigenhändig den Efeukranz aufgesetzt hat. Victoria ist so durcheinander, ist von allem so irritiert und so fasziniert, daß sie die Eindrücke erst nach und nach ordnen muß.
Mit einem gewinnenden Lächeln kommt Frau von Ziegler auf sie zu, stopft sich eine Pfeife mit Nürnberger Tabak, raucht sie mit lässiger Eleganz, nimmt Gottscheds Arm und beginnt mit ihm über ihren gemeinsamen Liebling Fontenelle zu schwärmen. O nein, er ist nicht nur Metaphysiker wie Malebranche, nicht nur Geometer wie Newton, Gesetzgeber wie Peter der Große, Staatsmann wie d‘Argenson. Er ist alles in allem. Er ist alles überall. Gott schuf Fontenelle und ruhte aus.
Voller Bewunderung hört Victoria der Dichterin zu und sieht, daß auch Gottsched und die Umstehenden von ihr entzückt sind. Wie souverän sie urteilt. Wie brillant sie formuliert. Und dieses selbstsichere, gewandte Auftreten! Trotz ihrer Faszination ist Victoria auf einmal tief unglücklich. Sie fühlt sich neben dieser Frau unbeholfen und ausdruckslos. So wie die Zieglerin möchte sie sein können und weiß, daß sie das nie erreichen wird. Nie könnte sie so zwanglos den Gästen begegnen, nie das Interesse anderer so leichthin auf sich lenken. Vielleicht muß sie sich damit abfinden, daß sie nichts von dem hat, was eine große Dichterin ausmacht: keinen Glanz der Gedanken, keinen Schliff der Rede, kein gewandtes Auftreten. Sie ist zu brav, zu korrekt, zu bieder. Nur eine Tugendwächterin im Tempel der Vernunft. Die Zieglerin aber hat mehr, hat etwas von diesem aufregend anderen, das den Nimbus einer großen Künstlerin ausmacht.
Victorias Unsicherheit ist auf einmal so groß, daß sie sich am liebsten in den äußersten Winkel des Salons verkriechen würde. Angesichts dieser Frau spürt sie gleich einem physischen Schmerz, wieviel ihr dazu fehlt, eine Dichterin zu werden. Wenn sie sich als Person schon nicht darstellen kann, wie soll es ihr dann mit Worten in den Büchern gelingen? Ihr Verdruß wird immer stärker. Sie müßte geistreich sein, parlieren wie Frau von Ziegler, Bonmots zu Perlschnüren aneinanderreihen, doch das Gefühl, in diesem Salon der Musiker und Literaten die Enge und Einfalt der Provinz zu verkörpern, nimmt ihr allen Mut. Dieses krämerselige Danzig mit seinen Händlern und Mammonsknechten ist wahrlich nicht zu vergleichen mit dem kunstsinnigen Leipzig. Provinz, das wird Victoria in diesem Augenblick deutlich, ist ein Zustand, der sich nicht verleugnen läßt.
Während sie den Ausführungen der Zieglerin lauscht, jedes Wort von ihr verinnerlicht, jede Geste studiert, glaubt sie plötzlich zu wissen, weshalb Gottsched dieser Frau ein Madrigal gewidmet hat: Ich schreibe die bei dir verbrachte Zeit zur glücklichsten in meinem Leben. Sie kann ihn verstehen. Und doch – nie war sie so unzufrieden mit sich. Alles in ihr drängt zum Aufbruch. Allerdings befürchtet Victoria, daß Gottsched nicht mitkommen würde, wenn sie ginge. Und ihn fragen möchte sie nicht. Schließlich liebt er die angeregte Unterhaltung über alles. Unerträglich fände sie die Blamage, würde er den Hausdiener zu ihrer Begleitung mitschicken und selbst noch ein Weilchen bleiben wollen. Ein dumpfer Kopfschmerz macht sich bemerkbar und gibt ihrem Gesicht etwas Unruhiges, Zerknirschtes.
Inmitten ihrer Unschlüssigkeit kommt Gottsched auf sie zu und fragt, ob ihr etwas fehlt. Überrascht von seiner Teilnahme, vermag sie nichts hervorzubringen. Die Worte sitzen ihr wie Knoten im Halse. Besorgt um ihr Befinden, bricht Gottsched den Besuch ab und begleitet sie nach Hause. Er fragt nichts, und sie sagt nichts. Victoria fühlt nur, je weiter sie sich vom Hause der Frau von Ziegler entfernt, desto wohler wird ihr. Die milde Abendluft beruhigt ihr aufgebrachtes Gemüt.
Gottsched schlägt ihr einen kleinen Spaziergang vor. Sie willigt dankbar ein. Ihre Arme schlingen sich ineinander, und er sagt beiläufig, daß er froh ist, gegangen zu sein. Die Zieglerin war ihm wieder einmal viel zu geschwätzig. Victoria glaubt sich verhört zu haben, doch Gottsched fährt mit der kritischen Würdigung des Abends fort. Seine Stimme empfindet sie zärtlich gurrend wie nie. Sie umschmeichelt ihre Sinne und durchdringt sie mit einer körperlichen Erregung. Ihr Kopfschmerz weicht. Die Wortknoten lösen sich auf. Sie findet wieder zu sich zurück. Ab und zu bleibt Gottsched stehen, küßt und herzt sie und lenkt dann seine Schritte auf dem direktesten Weg nach Hause.
Victoria hält das Leben wieder in ihren Händen, findet es flügelleicht und voller Zauberberge. Gierig atmet sie die sommerschwere Nachtluft ein, lacht und freut sich und weiß, daß es noch ein famoses Beilager geben wird.
Wie für andere das tägliche Brot ist für Gottsched die Ordnung etwas Lebensnotwendiges. Denn wo Ordnung herrscht, ist Klarheit, und wo Klarheit ist, sind tiefe Einsichten möglich. Wird ihm schon ein unaufgeräumter Bücherschrank oder eine unaufgeräumte Wohnung zum Ärgernis, so gerät er geradezu in Harnisch, wenn er auf unaufgeräumte Gedanken und eine vernachlässigte Sprache trifft. So wie Christian Wolff sich vorgenommen hat, Ordnung und Klarheit in das philosophische Denken zu bringen, so drängt es Gottsched dazu, für Ordnung und Klarheit in der Sprache und Literatur zu sorgen.
Wo er auch hinhört, was er auch liest – die deutsche Sprache bietet sich ihm als ein einziges Durcheinander, ein wüstes Wortgemengsel dar, das weder Reinheit noch Natürlichkeit, geschweige denn Schönheit besitzt. Der Adel und die Höfe sprechen Französisch, die Gelehrten Latein und das Volk im Landesdialekt. Zwischen ihnen stehen die erwerbstüchtigen Bürger mit einer Sprache, die von allem etwas hat, die vornehm und gebildet klingen soll und bei genauerem Hinhören sich doch bloß als ein aufgeblasenes Kauderwelsch erweist. Selbst der schlichteste Neujahrsglückwunsch gerät zum unverständlichen Schwulst. Da wird nicht mehr von Glück und Gesundheit gesprochen, da »werden Eure Excellence pardonniren, daß ich mir die Permission ausgebeten, zu dem mit aller Prospérité angetretenen neuen Jahre, mit gehorsamsten Respecte und tiefster Submission zu gratuliren, und sincèrement zu wünschen, daß der Höchste Eure Excellence in allem contentement dieses und viele andere Jahre conserviren wolle, damit ich ehestens occasion habe, meine témoignage zu bezeigen«.
Wenn Gottsched sich so etwas anhören muß, meint er jedesmal, einen Krampf in den Ohren zu bekommen. Denn die Sprache erweist sich für ihn nicht schlechthin als eine Summe von Worten und Satzgebilden, sondern als ein Maßstab für die Geisteskultur eines Volkes. Doch den vermag Gottsched bei den Deutschen nicht zu erkennen. Es gibt die Pfälzer, die Thüringer, die Sachsen, die Preußen, die Pommern, die Schlesier, aber es gibt kein einiges, starkes Vaterland, das allen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit gäbe und auf diesem Boden große Talente erstehen ließe, die Eigenes hervorbrächten. Alles kommt ihm fremd und von anderen Nationen geborgt vor. Er will aber nicht gelten lassen, daß nur die französische Sprache Feinheit und Eleganz besitzt und nur in ihr höhere Empfindungen ausgedrückt werden können. Wie oft hat er schon seinen Studenten gesagt: Wenn nur jeder alles, was er denkt, will und fühlt, in deutscher Sprache zu sagen bemüht ist, dann wird sich diese Sprache wie von selber ausbilden und die Fähigkeit erlangen, auch die feinsten Inhalte auszudrücken. Er müht sich ja nicht erst seit kurzem darum, die deutsche Sprache von ausländischem Sauerteig zu befreien, für Natürlichkeit, Durchbildung des Stils, Deutlichkeit des Ausdrucks und für verbindliche grammatikalische Regeln zu sorgen. Seit Jahren verfolgt er das Ziel, eine einheitliche Sprache zu schaffen, die jedermann, hoch wie niedrig, gleichermaßen miteinander verbindet und wieder ein Gefühl des Stolzes auf seine Muttersprache geben kann.
Wie trostlos sieht es erst in der Literatur aus. Opitz, Fleming und Dach läßt er als Dichter gerade noch gelten, doch Hofmannswaldau und Lohenstein bringen in Gottscheds Augen nur mehr Abenteuerliches und Phantastisches hervor, gewürzt mit niederer Sinnlichkeit und Lüsternheit. Christian Weise, der Zittauer Rektor, schreibt Komödien, die zwar als Erziehungsmittel in den Schulen dienen, aber Zeile um Zeile dem Hanswurstgeschmack des Pöbels das Wort reden. Canitz, der vornehme Hofmann, hat sich zwar vom Lohensteinschen Schwulste abgewandt, ahmt aber auch nur die Franzosen nach. Und gar erst die Lyrik! Für Gottsched ist sie bloß ein unaufhörliches Geleier inhaltsleerer Gelegenheitsdichtungen. Die Poeten, sofern sie überhaupt diesen Namen verdienen, gleichen wilden Vögeln, die singen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist – natürlich in heimischer Mundart.
Gottsched braucht sich keine Vorwürfe zu machen, dem tatenlos zugesehen zu haben. Was in seiner Macht stand, diesen trostlosen geistigen Zustand aufzuheben, hat er getan. Um das Denken seiner Landsleute auf Höheres, auf Kunst und Literatur zu lenken, hat er den Versuch einer kritischen Dichtkunst für die Deutschen geschrieben, ein Lehrbuch der Poetik, das aufräumt mit verworrenen Vorstellungen, ästhetische Begriffe klar bestimmt und den höchsten Zweck der Poesie ein für allemal festlegt: Poesie soll erziehen und bilden. Nacheinander hat er zwei Zeitschriften ins Leben gerufen, Die vernünftigen Tadlerinnen und den Biedermann, in denen er immer wieder gegen die Fremdwörtersucht an den deutschen Höfen, gegen sprachliche Mißgeburten und schlechte Schreibart zu Felde gezogen ist. Und nicht nur das! Er ist über die theoretischen Gefilde hinausgestiegen, hat sich der Deutschübenden poetischen Gesellschaft in Leipzig angeschlossen und in kurzer Zeit alles nach seinen Plänen umgestülpt: die Gesellschaft in Deutsche Gesellschaft umbenannt, ihr eine neue Satzung gegeben, sich zum Vorsitzenden wählen lassen und bis zur Stunde das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verloren: Er will diese Gesellschaft in eine große deutsche Dichterakademie verwandeln, so wie einst Kardinal Richelieu aus einem Privatverein für die Pflege der französischen Sprache die Académie française begründet hat.
Mit Genugtuung stellt Gottsched fest, daß das Ansehen seiner Deutschen Gesellschaft ständig steigt und daß die Zeitschrift, die er für sie ins Leben gerufen hat, viel gekauft und gern gelesen wird. Er ist stolz, mit den Beiträgen zur kritischen Historie der deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit das erste Literaturjournal in Deutschland gegründet zu haben. Wer hier schreibt, tut dies nicht in seiner heimischen Mundart, sondern bedient sich als Mustersprache der Sprache der mitteldeutschen Landschaften, wozu Gottsched außer Meißen auch das Vogtland, Thüringen, Mansfeld, Anhalt, die Lausitz und Niedersachsen zählt.
Er kann nur lächeln über die Engstirnigkeit und Kurzsichtigkeit jener eifernden Winkelgötzen, die sich gegen die Einführung dieser einheitlichen Schriftsprache auflehnen und behaupten, die Sprache der mitteldeutschen Landschaften gründe sich auf Luther und sei Ketzersprache. Sollen sie ihre Befürchtungen in die Welt hinausposaunen und mit frommer Galle über ihn herfallen – bei dem edleren Teil seiner Landsleute werden sie kein Gehör finden. Die haben längst begriffen, daß derjenige, der auf eine einheitliche, alle Provinzen verbindende Sprache drängt, an der Wohlfahrt des Vaterlandes arbeitet. An Sympathiebekundungen und Zuspruch hat er darum keinen Mangel. Unter der wachsenden Schar seiner Anhänger befinden sich inzwischen einflußreiche Freunde. Johann Ulrich König, der Hofpoet in Dresden, begönnert ihn. Graf Ernst Christoph von Manteuffel, Königlich Polnischer und Sächsischer Staatsminister, unterstützt gleichfalls Gottscheds Bemühungen, und Bodmer und Breitinger, die führenden literarischen Köpfe der Schweiz, sind auf seiner Seite. Überdies sitzen allerorts seine Schüler und sorgen für die Verbreitung seiner Reformen. Deutsche Gesellschaften schießen nach dem Leipziger Vorbild wie Pilze aus dem Boden, allen voran die in Jena, Göttingen, Helmstedt und Königsberg. Gottscheds Korrespondenz weitet sich täglich aus. Inzwischen erreichen ihn Briefe aus allen Hauptstädten Europas. Selbst Kardinal Quirini in Rom wartet auf Antwort.
Manchmal weiß Gottsched nicht mehr, was er zuerst machen soll. Die Vorlesungen müssen ausgearbeitet werden. Breitkopf drängt auf die Fertigstellung der Ausführlichen Redekunst. Die Korrekturbögen für die Zeitschriftenbeiträge stapeln sich auf Gottscheds Schreibtisch. Die Bitten zu Fest- und Gedächtnisreden werden immer zahlreicher. Ein Gedichtband ist in Vorbereitung, wartet auf die ordnende Hand des Meisters, und er, der um sich herum alles klar und übersichtlich haben will, glaubt, das Chaos über sich hereinbrechen zu sehen und in einer Flut von Aufgaben ertrinken zu müssen. Glücklicherweise aber hat er eine junge, tatkräftige Frau.
Aus heiterem Himmel erklärt ihr Gottsched eines Morgens, daß sie sich zur Genüge mit dem Haushalt und der eleganten Welt vertraut gemacht hat, nun aber das Eigentliche, Höhere bevorsteht und er sie zu seiner gelehrten Gehilfin ausbilden will. Victoria ist zunächst überrascht, aber dann begeistert. Wie anders, wenn nicht über den Weg der Bildung sollte sie sich dem Ideal der Vollkommenheit annähern können?
So darf sie das einmalige Privileg nutzen, das sie als Frau eines gelehrten Mannes besitzt, und seine Vorlesungen mit anhören. Wegen Raummangels in der Universität finden sie in Gottscheds Wohnung statt. Gemäß der akademischen Ordnung, die auch hier gilt, wünscht er nicht, daß sie sich unter die Studenten mischt. Die Gegenwart eines weiblichen Wesens würde die Gemüter verwirren und die Sittlichkeit im Hörsaal gefährden. Darum sitzt Victoria auf einem Schemel hinter einem winzig geöffneten Türspalt und lauscht in Gottscheds Arbeitszimmer hinein, wo sich die Studenten zum Collegium rhetoricum versammelt haben. Natürlich befolgt sie getreu, was er ihr aufgetragen hat: weder durch Husten, Räuspern, Niesen, Stuhlrücken, Schurren oder andere Geräusche ihre Anwesenheit kundzutun. Nur zu gut versteht sie, daß Gottsched keinerlei Störungen bei seiner Vorlesung gebrauchen kann, weiß sie doch, daß es ihm um mehr als die Theorie der Rhetorik, der Poetik und Stilistik geht – er will das Empfinden für die Schönheiten der deutschen Sprache wiedererwecken.
Auch wenn es ihr schwerfällt, sich in aller Herrgottsfrühe auf einen so ungewohnten Gegenstand zu konzentrieren, so bemüht sie sich doch, aufmerksam seinem Vortrag zu folgen. Geschmückt mit der langlockigen Perücke, ist Gottsched nicht mehr der Verfasser sauber gereimter Jubel- und Traueroden, nicht mehr der Privatmann und Poet. Er ist der akademische Vertreter von Reim und Prosa, der Professor ordinarius, der Amtswalter des Geistes. Seine Worte bekommen ein besonderes Gewicht. Selbst seine Schritte klingen würdiger, wenn er über die Dielen schreitet, und es fällt ihr nicht schwer, sich auszumalen, wie erhaben er im Augenblick dreinschauen mag.