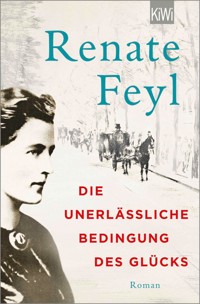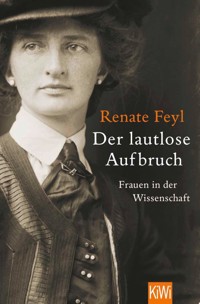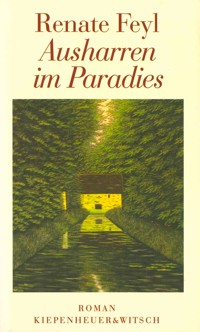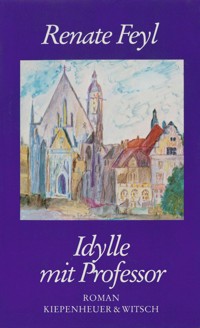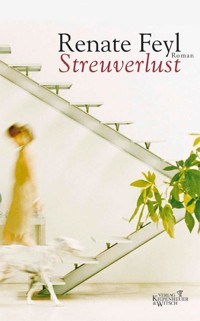9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Renate Feyls Erfolgsroman über die bedeutendste Porträtmalerin des 18. Jahrhunderts Elisabeth Vigée, Tochter eines Pastellmalers und einer Friseuse, ist 1767 gerade zwölf Jahre alt, als der berühmte Seemaler Claude Joseph Vernet ihr Talent entdeckt. Binnen kürzester Zeit wird aus der kleinen Liz eine gefeierte Porträtmalerin, die für ihren frischen, natürlichen Stil verehrt wird. Bald gehört auch Königin Marie Antoinette zu ihren Bewunderern und lässt sich gleich mehrfach malen. Als die Revolution ausbricht und Versailles gestürmt wird, flieht Vigée mit ihrer Tochter nach Italien. Was als Kunstreise getarnt ist, wird zum langjährigen Exil. Während sie im Rest Europas und in Russland Triumphe feiert, bleibt in ihrer Heimat nichts, wie es war. Raffiniert und geistreich erzählt Renate Feyl die Geschichte einer faszinierenden Frau, die in ihren Bildern einen neuen, freien Gesellschaftston anschlägt. Meisterhaft beleuchtet sie den europäischen Kunstmarkt und die geschichtlichen Umbrüche und liefert zugleich ein flirrend lebendiges, atmosphärisch beeindruckendes Zeitporträt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Renate Feyl
Lichter setzen über grellem Grund
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Renate Feyl
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Renate Feyl
Renate Feyl, geboren in Prag, studierte Philosophie und lebt als freie Schriftstellerin in Berlin.
Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch
»Idylle mit Professor«, 1988; »Ausharren im Paradies«, 1992; »Die profanen Stunden des Glücks«, 1996; »Das sanfte Joch der Vortrefflichkeit«, 1999; »Streuverlust«, 2004; »Aussicht auf bleibende Helle«, 2006.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Elisabeth Vigée, Tochter eines Pastellmalers und einer Friseuse, ist 1767 gerade zwölf Jahre alt, als der berühmte Seemaler Claude Joseph Vernet ihr Talent entdeckt und sie fortan fördert. Binnen kürzester Zeit wird aus der kleinen Liz eine gefeierte Porträtmalerin, die sowohl in den intellektuellen Pariser Salons verkehrt als auch von der aufgeklärten Aristokratie für ihren frischen, natürlichen Stil verehrt wird – und sich von niemandem vereinnahmen lässt. 1776 heiratet sie den Kunsthändler J.B. Pierre Lebrun. Bald gehört auch Königin Marie Antoinette zu ihren Bewunderern und lässt sich gleich mehrfach malen. Als die Revolution ausbricht und Versailles gestürmt wird, flieht Vigée mit ihrer Tochter nach Italien. Was als Kunstreise getarnt ist, wird zum 12-jährigen Exil. Während sie im Rest Europas und in Russland Triumphe feiert, berühmte Persönlichkeiten porträtiert und beauftragt wird, den Papst zu malen, bleibt in ihrer Heimat nichts, wie es war; Licht und Schatten vermischen sich unaufhaltsam …
Raffiniert, geistreich und mit großem sprachlichen Feingefühl erzählt Renate Feyl die Geschichte einer faszinierenden Frau, die in ihren Bildern einen neuen, freien Gesellschaftston anschlägt. Meisterhaft beleuchtet sie den europäischen Kunstmarkt und die geschichtlichen Umbrüche und liefert zugleich ein flirrend lebendiges, atmosphärisch beeindruckendes Zeitporträt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2011, 2013, 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © ullstein bild – Alinari
ISBN978-3-462-30948-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Es war schon eine Zumutung, morgens aufzuwachen …
So schön der Erfolg auch war …
Daß ein Theaterstück einmal so viel Aufsehen …
Für Lebrun war vieles mit der Revolution …
Es war schon eine Zumutung, morgens aufzuwachen und auf leere weiß gekalkte Wände blicken zu müssen. Keinen Tag länger wollte sie das ertragen. Nicht daß sie sich schimmernde Seidentapeten gewünscht hätte, aber gemessen an dieser trostlosen Schlafkammer schien ihr Bethlehems Stall geradezu als ein Luxusquartier. Allein das eiserne Bettgestell reichte aus, um auch den letzten freudigen Gedanken in die Wüste zu schicken, doch diese kahlen weißen Wände gaben ihr das Gefühl, die Welt würde nichts als ein öder Kreidegrund sein.
Kurz entschlossen zog sie sich einen Kittel über, legte ein verschlissenes Laken auf die Dielen und rieb ein paar Farben an. Dann holte sie eine Doppelleiter und begann einen Regenbogen an die Decke zu malen. Sie plazierte den Bogen so, daß die wenigen Sonnenstrahlen, die morgens durch die Fensterluke kamen, direkt auf die Farben trafen und ihnen Spiel und Bewegung gaben. In einem Halbrund trug sie in breit hingestrichener Linie ein kräftiges Violett auf, ließ es am Rande in ein schimmerndes Blau auslaufen, führte das Blau in ein helles Grün, das Grün in ein Gelb, dunkelte es zum Orange und schloß mit einem warmtonigen Rot. Ihm fügte sie mit einem Hauch von Azur noch ein Stückchen Himmel an, damit die Schweiflinien deutlicher hervortraten und der Eindruck einer Überwölbung entstand.
Zwar ging die Arbeit langsamer als erwartet voran, doch als sie die Verschönerung beendet hatte, legte sie sich auf das Bett, betrachtete ihr Deckenwerk und fand, daß das kleine Alla-prima-Fresko gelungen war. Morgens aufwachen und auf Farben sehen zog gleich ganz anders in den Tag. Es gab so ein schönes Gefühl, allem voraus zu sein. Noch bevor sie aus dem Bett sprang, war sie schon unterwegs. Nicht irgendwo, sondern inmitten der Farben, mitten im Spiel des Lichts. Vor allem ließ der Regenbogen die winklige Kammer höher und breiter erscheinen. Der Blick zur Decke rückte die Welt wieder zurecht.
Der Bruder war begeistert, doch die Mutter regte sich auf. In einem eigenen Haus mochte so etwas noch angehen, aber sie wohnten zur Miete, und da konnte eine solche Kapriole sie teuer zu stehen kommen. Ihre Tochter wußte doch, daß am Monatsende kein einziger Sou übrigblieb! »Du solltest dich endlich von dem Gedanken verabschieden, Malerin zu werden. In Paris gibt es zu viele davon. Das hat keine Zukunft. Denk doch an deinen Vater! Was nützen die schönsten Bilder, wenn sie keiner haben will.« Und schon war die Mutter dabei, erneut die ganze Armut, in die sie geraten waren, vor ihr auszubreiten. Liz kannte die Litanei. Nichts hatte ihnen der Vater hinterlassen. Kein Haus, keine Barschaft, kein Grundstück, keine Pension, von der sie leben konnten. Nichts, gar nichts. Hätte er die Professur bei der Akademie bekommen, wären sie natürlich sofort in ein besseres Quartier gezogen, aber Maître Vigée konnte es ja nicht lassen, hastig zu essen und wie ein Tischbarbar alles hinunterzuschlingen. An einer Fischgräte zu sterben! Ihr so etwas anzutun! Nun saß sie da. Eine unversorgte Witwe mit zwei Kindern, einem Herrn Sohn, der demnächst studieren wollte, und einem Fräulein Tochter, das sich irgendwelche Kunstflausen in den Kopf gesetzt hatte. Und keiner fragte danach, wovon sie das finanzieren sollte!
Die Mutter ließ sich in den Sessel fallen, griff nach einem Kaffee wie nach einer Arznei fürs Gemüt und fand alles um sich herum nur noch abgrundtief ungerecht. Andere wußten nicht, wohin mit dem Geld, und sie hatte Mühe, den Wasserträger und die paar Klafter Brennholz zu bezahlen! Doch für Liz war auch das kein unbekannter Seufzer, und sie dachte nur, solange es für den Kaffee reichte, konnte es so schlimm mit der Armut nicht sein. Am liebsten hätte sie jetzt ihr Skizzenbuch geholt und die Mutter so gezeichnet, wie sie da saß, so verdrossen rebellisch, fast grantig schön. Doch sie hielt sich zurück, denn das hätte Frau Jeanne nur noch mehr verärgert. Der Regenbogen reichte schon. Allerdings ließ sie kein Auge von ihr, prägte sich jede Regung ihres Gesichtes, jeden Lidschlag ganz genau ein, denn sie sah: Wenn die Mutter vom fehlenden Geld sprach, dann sprach alles aus ihr. In einem größeren Moment konnte sie keiner malen. Aber leider war jetzt das andere verlangt: in braver Andacht zuzuhören, bis sich Frau Jeanne ihren Ärger von der Seele geredet hatte. Erfahrungsgemäß dauerte das ein Weilchen, denn in solchen Situationen kam bei ihr stets eins zum andern und endete auch heute wieder bei dem Unglück, als Friseuse ihr Brot verdienen zu müssen. Liz gab sich Mühe, nicht zu gähnen, und sandte dem kleinen Bruder einen Blick, als wollte sie ihm sagen, daß auch er gefälligst mit betroffener Miene dem Klagelied zu folgen hatte.
Ja, es war ein Elend, bei Wind und Wetter jeden Morgen wie ein Packesel das Haus verlassen zu müssen, um ein paar gutsituierten Damen das Haar zu toupieren. Den Koffer voller Kämme, Bürsten, Kräuselscheren, Lockenwickler, Kopfkratzer, Seegras-Poufs und den vielen Büchsen mit dem parfümierten Puder – all das zu schleppen war keine Kleinigkeit. Dazu bei Regen von den vorbeifahrenden Kutschen mit Straßenkot bespritzt zu werden und jedesmal mit beschmierten Röcken und Strümpfen bei den Kundinnen anzukommen – da konnte sie noch so oft die Flecken auf den Strümpfen mit weißer Kreide übermalen – sie stand doch immer wie ein Fliegenpilz vor ihnen. Freilich hätte sie eine Sänfte nehmen können oder einen Fiaker, um sich diese Strapazen zu ersparen, doch das wenige, was sie verdiente, konnte nicht gleich wieder für den Mietkutscher ausgegeben werden. Schließlich brauchten sie das Geld zum Leben. Die großen Damen waren leider nicht spendabel, sei denn, sie hatten Läuse. Dann gab es ein paar Sous extra. Immerhin war es eine günstige Gelegenheit, die Kopfkratzer diskret zum Kauf anzubieten, weshalb sie die Grattoirs stets in allen Farben und Formen bei sich hatte. Läuse belebten das Geschäft. Auf diese zusätzliche Einnahme konnte sie sich verlassen. Doch das Schlimmste war das Pudern. Mehr als einmal hatte sie den Erfinder dafür an den Galgen gewünscht. Mit Cape und Maske in irgendeinem ausgeräumten Schuppen direkt über dem Platz der Kundin bestes lufttrockenes Weizenmehl an die Decke zu werfen, Pfund um Pfund, damit es als feiner Riesel auf ihren Kopf niederstäubte, und die ganze Prozedur so lange zu wiederholen, bis das Haar so weiß war, daß sich die Dame jung und schön fühlte – diese Mode mochte begreifen, wer wollte. Sie hatte jedenfalls hinterher Stunden damit zu tun, den Mehlstaub auszuhusten, gar nicht zu reden von der Verschwendung! Statt das teure Weizenmehl allerorts an irgendwelche Stubendecken zu klatschen, wäre es vernünftiger gewesen, daraus Brot zu backen. Dann hätten alle etwas davon gehabt.
Bei diesen Worten verlor sich der Jammer, die Sorge verschwand und das Gesicht der Mutter wurde zu einem leibhaftigen Sinnbild der Gerechtigkeit, was Liz so faszinierte, daß sie am nächsten Morgen, kaum daß sie allein in der Wohnung war, in die Malstube des Vaters ging, um diesen Moment auf der Leinwand festzuhalten. Sie überlegte nicht lange, wie sie das Porträt anlegen sollte, alles war im Gedächtnis bereits vorgezeichnet, Form und Linienführung standen fest, und glücklicherweise waren im Farbenkasten noch genügend Pigmente vorrätig. Sie mußte sich beeilen, denn die Mutter durfte sie nicht in der Malstube erwischen. Hier hatte Liz Tag für Tag dem Vater bei der Arbeit zugesehen. Er hatte ihr gezeigt, wie man eine Leinwand schneiden und die Farben anreiben mußte, hatte sie in die Geheimnisse der Materialien eingeweiht, ihr das unterschiedliche Arbeiten mit Pastell, Öl und Tempera erklärt und dann, als sie ihn mit ihrem Selbstporträt überraschte, hatte er es lange ganz versunken betrachtet und nur gesagt: »Du wirst Malerin werden, oder es wird nie eine geben. Du wirst eine Vigée!« Das klang nach. Tag und Nacht. Er wußte eben, was in ihr steckte. Er hatte den klaren Blick voraus. Da konnte ihr die Mutter noch so oft verbieten, die Malstube des Vaters zu betreten – sie wollte ihr schon zeigen: Sie wurde eine Vigée.
Rasch spannte sie eine Flachsleinwand auf, grundierte mit einem dunklen, warmen Ton, gab etwas Honig dazu, damit die Farben nicht rissen, und sah das Kolorit schon vor sich: aschblauer Hintergrund, ein zurückhaltend schimmerndes Grau und das ganze Licht auf die Stirn gelegt – Frau Jeanne sollte nicht bemitleidenswert, sondern aufbegehrend lebendig sein.
Kaum daß die Mutter zu ihren Kundinnen unterwegs war und Liz den kleinen Bruder zu beaufsichtigen hatte, zog es sie zum Schrillen, Buntbewegten, und sie ging mit Etienne zum Pont Neuf. Hier stand sie an der Farbenmündung der Stadt, hier flossen alle Farben von Paris zusammen, trafen so dicht aufeinander und bekamen eine so starke Präsenz, daß sie jedesmal den Eindruck hatte, die Farben nicht nur zu sehen, sondern sie auch zu hören, zu riechen, zu schmecken und zu fühlen. Am Pont Neuf waren alle Sinne beschäftigt. Wo sie auch hinsah – Fahnen, Wimpel, Girlanden und Buden über Buden, umlagert von parfümierten Lakritzenwassermännern, von stinkenden Tabaksrasplern, von Musikanten in glitzernden Phantasiekostümen und selbst die Trommelwirbel grellbunt. Dazwischen in granatroter Livree die Ausrufer für das Wachsfigurenkabinett und das Affentheater und die knallig bemalten Stände der Soldatenwerber mit ihren Flaggen und Feldzeichen. Von den Karren der Obsthändler leuchteten die Orangen- und Zitronenpyramiden und breiteten ihre Farbe wie eine sonnig-südliche Landschaft aus, in der die grünen Kappen der Trompeter noch grüner und die weißen Federbüsche der Kavalleristen noch weißer wurden. Selbst die Blumenmädchen und Taschenspieler bekamen einen opalisierenden Schimmer und die Melodien der Leierfrauen einen helltonigen Klang. Im Gedränge schienen die Gegensätze so deutlich zu werden, als würden ihnen die Farben dafür die Konturen leihen. Knöchrige Gestalten, die nach Gichttripper aussahen, neben geschniegelten Dragonern in lichtblauen Uniformen, abgerissene Lumpensammler und barfüßige Hökerinnen neben silberbetreßten Lakaien, blumenbestickte Reifröcke und schillernde Spitzenmantillen neben schweißtriefenden Sackträgern und verlausten Zechern, klebrige Mägde neben reinlichen Grisetten, schwarzgekleidete Abbés neben grellgeschminkten Huren und über allem der fettige, grünbraunölige Geruch von Froschschenkeln, Brathühnern und Fischsuppen. Dazwischen die Polizeireiter mit den blankgeputzten Flinten und die schwerbeladenen Kehrichtkarren, die einen vielfarbigen Gestank ausdünsteten.
Etienne ging nicht gern über die Brücke, ihn ängstigte das Gewühl, doch sie fand das bunte Ineinander berauschend: unter ihnen die Lastkähne, neben ihnen Leiterwagen, girlandengeschmückte Equipagen und Karossen und mittendrin gläserne Kutschen und weiße Pferde, Sänftenträger, Reiter und Fußgänger in einem nicht enden wollenden Hin und Her. Liz ging den Farben wie einem Lichtstrahl nach und landete diesmal am Quai de la Ferraille, wo die Buden der Kleidertrödler und Lumpenhändler standen und in den Bäumen bunte Lampions hingen. Sie kaufte dem Quälgeist ein Stück Mandelkuchen und dazu noch zwei Krokantbonbons, damit er zu Hause nicht plauderte, und dann spazierte sie an den Trödlerständen wie an einem Ufer der Sonne entlang. Wo der Platz nicht reichte, hatten die Händler ihre Waren auf der Straße ausgebreitet. Menschen pickten wie bunte Kakadus in den Kleiderhaufen. Auf speckigen Lederhosen lagen die feinsten Valencienner Spitzen, auf Tischen, Kisten und Bänken türmten sich die Stoffreste oder waren von den Ballen in breiten Bahnen nebeneinander ausgerollt. Scharlachfarbener Atlas, türkises Tuch von Romorantin, brauner Bougran, gelbe Tiretaine, samtschwarze Ratine, taubengrauer Pinchina, Calmande in schwülem Violett, grüngeäderte Indienne, Gaze und Musselin in blassem Rosa neben azurblauem Taft und überall an den Stangen die Unterröcke. Unterröcke über Unterröcke, Wolkenberge von Unterröcken in weißglänzendem Seidencroisé. Es war, als schaute sie in eine Glitzergrotte. Von der Seine kam leichter Wind auf, der die Unterröcke wie Tüllschmetterlinge um die Stangen flattern ließ und allem ringsum etwas so Filigranes, Hingehauchtes und Verwehtes gab, daß sie meinte, die Luft müßte hier die Farbe von Seidencroisé haben, ja sogar noch rauschen und knistern. Sie stand und schaute, hielt den Bruder fest an der Hand, vergaß den Lärm und das Getümmel und ließ die Farben auf sich wirken. Verglich sie, ordnete sie, kombinierte und ergänzte, merkte sich jeden Lokalton, so als würde sie Wort um Wort ein Gedicht auswendig lernen, stahl die Farben von den Stangen, den Buden und Bäumen und lagerte sie wie einen kostbaren Vorrat ein. Endlos hätte sie hier stehen können, doch das Glockenspiel der Schlaguhr ertönte, und sie drängte erschrocken fort, denn sie wollte unbedingt noch vor der Mutter zu Hause sein, um sich nicht neue Litaneien anhören zu müssen.
Überraschend stand Monsieur Vernet an der Tür. Claude Joseph Vernet, der Meister der Lichteffekte, grauhaarig, mager und im schlichten Reitrock. Seine Bilder von den Seehäfen Frankreichs hatten ihn berühmt gemacht. Keiner ließ den Nebel aus der Leinwand so aufsteigen wie er, keiner konnte eine diesige Ferne und ein stürmisches Meer beeindruckender malen. Mit dem Vater war sie ein paarmal in seinem Atelier gewesen und durfte sogar einmal zusehen, wie er mit einem breiten Fischotterpinsel die Wolkenfarbe auf eine ausgedehnte Wasserfläche setzte, so daß eine Spiegelung entstand. Es war atemberaubend. Sie hatte zu fragen gewagt, wie ihm diese schäumenden Wogen gelangen, und seine Antwort war ihr noch immer gegenwärtig: »Die Wellen des Meeres überschneiden sich wie die Schuppen eines Tannenzapfens. Es ist alles ganz einfach. Du mußt dich nur an die Grundmuster halten.«
Liz bat Vernet freudig herein und rief aufgeregt die Mutter. Doch Frau Jeanne geriet sichtlich in Verlegenheit. Zwar hatte ein unangemeldeter Besuch den Vorteil, daß der Gast keine großartige Bewirtung erwarten durfte, aber daß Vernet ausgerechnet jetzt nach dem Regen kommen mußte, war ihr unangenehm. Die Straße glich einem dampfenden Rinnsal aus Kuhfladen und Pferdeäpfeln, und die ganze Gegend stank nach Kloake. Gewiß, in solchen Stunden ließ es sich überall in der Stadt nur mit einem Riechfläschchen aushalten, aber sie fand, in ihrer Gegend waren die Ausdünstungen besonders heftig. Natürlich vermied sie es, von Gestank zu reden, weil allein der Gebrauch dieses Wortes einen üblen Geruch in die Nase trieb, und sprach darum nur von der schlechten Akustik. Nach jedem Regen hatte die Luft eine schlechte Akustik. Der Mieter im Dachgeschoß, ein kulturloser Rüpel, nutzte diese Stunden, um sein Nachtgeschirr in die Dachtraufe zu entleeren, damit alles diskret im Rinnstein landete und fortgespült wurde. Aber wie immer blieb auch heute das nächtliche Kompott neben dem Hauseingang liegen, was nicht nur den Geruchssinn aufs äußerste strapazierte, sondern dem Auge einen so ekelhaften Anblick bot, daß es Überwindung kostete, dieses Haus überhaupt zu betreten. Sie hatte sich darüber schon beim Quartierkommissar beschwert, mußte sich aber belehren lassen, daß es nur verboten war, das Nachtgeschirr direkt aus dem Fenster auf die Straße zu entleeren, weil dabei ein Passant getroffen werden konnte. Allein das konnte zur Anzeige gebracht werden.
Liz sah der Mutter an, wie sehr sie sich des Gestankes wegen schämte, und verstand sie nicht. In einer so riesigen Stadt gehörte das nun mal dazu. Schließlich war es kein Geheimnis, daß das Wasser der Seine zwischen den Schenkeln eines Engels entsprang. Wer hier ein edles Landlüftchen erwartete, war selber schuld. Doch für Frau Jeanne gab es diesmal unglücklicherweise auch noch zwei Kranke in der Straße, die sich wie die Bessergestellten mehrere Fuhren Mist vor ihren Häusern hatten abkippen lassen, um den Lärm der vorbeifahrenden Wagen zu dämpfen. Und ausgerechnet jetzt mußte ein so seltener Besuch kommen! Noch dazu ein so berühmter Mann! Hätte sie das geahnt, hätte sie wenigstens rasch noch ein bißchen Lavendelspiritus in den Zimmern versprüht, um nicht in den Verdacht zu geraten, direkt über einem Abort zu wohnen. Aber Vernet schien das wenig zu bekümmern. Er bereitete in der Königlichen Akademie eine Ausstellung über Pastellmalerei vor und ihm lag daran, daß sein Freund Louis Vigée posthum mit ein paar Arbeiten vertreten war, die er sich ausleihen wollte.
So sehr sich Frau Jeanne auch über das Ansinnen freute – sie mußte ihn enttäuschen. Vor einiger Zeit hatte sie eine günstige Gelegenheit genutzt und alle Pastelle verkauft, um ihre finanzielle Lage zu verbessern. Aber wie er sah, hatte es nicht gereicht. Sie führte Vernet in die Malstube ihres Mannes, damit er sich überzeugen konnte, daß nichts mehr da war, und ärgerte sich im stillen, so voreilig die Bilder veräußert zu haben, denn nach einer solchen Akademieausstellung hätte sie vermutlich das Doppelte dafür bekommen. Vernet sah enttäuscht auf die leeren Wände, und plötzlich wandte er sich der Staffelei zu. Liz erschrak. Vor kurzem hatte sie das Porträt der Mutter noch mit einem hellen Firnis überzogen, um den Farben eine größere Leuchtkraft zu geben, und danach vergessen, es von der Staffelei zu nehmen. Sie machte sich Vorwürfe, damit für neuen Ärger zu sorgen.
Vernet blieb vor dem Bild stehen, betrachtete es lange, trat einen Schritt zurück, sah Liz an, und sie nickte, reuig zwar, aber doch selbstbewußt. »Dein Vater hat immer von deinem Talent geschwärmt«, sagte er, »und wie ich sehe, zu Recht. Großartig, wie hier das Licht spielt. Das Bild spricht. Alle Wirkungen zusammengefaßt in einem Punkt, alles auf den Ausdruck konzentriert, das nenne ich gekonnt!«
Frau Jeanne war sichtlich überrascht. Sie hatte das Bild noch nicht gesehen, ja sie wußte gar nichts von seiner Existenz, fühlte sich nun aber doch geschmeichelt, wie gut die Tochter sie getroffen hatte und vor allem, wie beeindruckt Vernet davon war. Er wollte wissen, ob sie noch mehr gemalt hatte, und Liz holte aus dem Schrank all ihre Bilder. Sie hatte sich selbst gemalt, dann den Bruder, den Freund des Bruders, den Freund des Freundes, die Nachbarin, die Schwester der Nachbarin, hatte wild drauflosgemalt, ohne Überlegung, ohne Ziel, und immer in der Sorge, die Mutter könnte auch noch die Farben des Vaters verkaufen. Dann wäre alles vorbei gewesen, denn Geld für neue Farben hatte sie nicht. Vernet musterte Bild für Bild und war verblüfft.
»Wer so malen kann, hat eine Zukunft«, sagte er zu Frau Jeanne, »Ihre Tochter ist ein Naturtalent. Ihr liegen die Farben im Blut. Nur im rein Handwerklichen müßte noch einiges verbessert werden. Ich melde sie noch heute bei Briard an. Er hat sein Atelier im Louvre. Bei ihm lernt sie Zeichnen, Linienführung, Komposition, Perspektive. Dafür ist er genau der Richtige.«
Liz sah triumphierend, aber auch mißtrauisch zur Mutter und atmete auf, als sie nicht widersprach. Zwar hätte sie es besser gefunden, Frau Jeanne wäre von selbst darauf gekommen, daß ihre Tochter einiges Talent haben könnte, so aber hatte sie immerhin eine Berühmtheit darauf gestoßen, und einer Berühmtheit glaubte sie glücklicherweise jedes Wort. Vernet nahm das Porträt von der Staffelei und fragte Liz, ob sie es ihm verkaufen würde. »Ich schenke es Ihnen«, sagte sie, doch das lehnte er kategorisch ab und legte acht Francs auf den Tisch, was nicht als großzügige, sondern vielmehr als eine symbolische Geste gedacht war. »La Tour hat seinerzeit auch acht Francs für sein erstes Porträt bekommen und jeder weiß, heute ist er der reichste unter uns Malern.«
Frau Jeanne war entzückt. Acht Francs waren nicht wenig. Dafür konnte man sich einen ganzen Monat bei einem Speisewirt einmieten. Daß unverhofft ein so schöner Betrag ihre klägliche Haushaltskasse auffüllte, schien ihr verheißungsvoll. Sie dachte sofort an eine Feier und an ein gutes Essen. Bislang hatte sie den sonntäglichen Braten beim Pastetenbäcker für zwei Sous in den Ofen schieben lassen und sparte damit für zehn Sous Brennholz. Doch der Braten war immer halb angebrannt und trocken, weil der Gauner von Bäcker mit der Spicknadel stets den Saft abzapfte, um ihn für die feinen Pasteten zu verwenden, die er in die vornehmen Häuser trug. Endlich brauchte sie einmal nicht zu sparen und konnte den sonntäglichen Braten selber zubereiten. Nach langer Zeit sah sie einem festlichen Tag entgegen. Liz aber sah nur das andere: Ohne die Mutter noch länger bitten und drängen zu müssen, durfte sie ab sofort zum Zeichenunterricht gehen. Von Stund an wollte sie jedes freie Fleckchen Leinwand bemalen, damit die teure Mama nicht auf ihren schönen Sonntagsbraten verzichten mußte.
Zwar hatten die acht Francs eine wohltuende Wirkung, aber sie minderten nicht das instinktive Mißtrauen von Frau Jeanne gegen eine Kunst, von der man leben mußte. Wer wie sie so viele Jahre mit einem Pastellmaler verheiratet war, der wußte, wovon er sprach. Immer den Kopf voller Farben und meistens das Portemonnaie leer. Ihr brauchte keiner etwas zu erzählen. Sie sah ja, was los war. Scharen von Habenichtsen strömten von überall her täglich in die Stadt und hofften, mit ihrer Malerei Geld zu verdienen. Großes Geld. Und mehr noch: Reich und berühmt wollten sie werden und alles möglichst über Nacht. Auch wenn manche nur ein grobes, pelziges Pastell zustande brachten und Bilder malten, die aussahen, als hätten sie mit einer Krähenfeder über die Leinwand gekratzt – sie hielten sich alle für große Meister. Selbstverständlich ein neuer Tizian, selbstverständlich ein kleiner van Dyck oder ein Poussin, wenigstens ein Largillière. Frau Jeanne dachte dabei nicht mal an das Lungervölkchen, das von morgens bis abends auf den Quais herumhockte, alles malte, was ihm vor den Pinsel kam, und wohl glaubte, um genial zu sein, genügte es schon, die Luft von Paris zu atmen. Sie dachte an die vielen, die als Gehilfen bei etablierten Malern arbeiteten, sich um Ausbildung und Abschluß bemühten und irgendwann einsehen mußten, daß es die pure Illusion war, in der Kunst reich und berühmt zu werden. Von wegen große Bildidee, großes Historiengemälde, glanzvolle Ausstellung in der Académie royale, glanzvolle Ausstellung im Salon du Louvre, von wegen Preise, Titel, Ehren und Pensionen! Letztlich waren sie heilfroh, wenn sie für einen Kupferstecher Vorlagen liefern oder für einen Almanach die Bilderrätsel zeichnen durften, irgendwo als Lehrer unterkamen oder gar das Glück hatten, als Amtsmaler angestellt zu werden, um die Köpfe der Ratsherren auf das Format von Paradeporträts zu bringen, mit Schärpe, Orden und dem ganzen Staatskram. Selbst schlecht bezahlte Aufträge abzulehnen konnten sich nur die wenigsten leisten. Sie wußte, wie dankbar viele waren, wenn sie zwischendurch auch mal Fächer und Ofenschirme bemalen durften, und sei es um den Preis, ein Fächerkleckser genannt zu werden. Hatte die Kirche Bedarf an neuen Andachtsbildchen, standen die Mitglieder der Gilde parat, malten von morgens bis abends den heiligen Nikolaus oder die Jungfrau Maria, bekamen drei Livres pro Woche, dazu aus Barmherzigkeit täglich eine warme Suppe und wurden auch noch um einen so trostlosen Auftrag beneidet. Nein, ihr brauchte keiner etwas zu erzählen von diesem Pinsel- und Palettenglück. Selbst wer schon einen Namen hatte, war sich nicht zu schade, das Genie seiner Farbkraft auf den guthonorierten Firmenschildern unter Beweis zu stellen. Schöne große Schilder für Apotheker, Notare, Chirurgen oder Juweliere. Schilder, vor denen die Passanten in neugieriger Bewunderung stehenblieben und die ihnen sagten, daß es sich lohnen würde einzutreten. Frau Jeanne hatte es mehr als einmal erlebt: Die wirkliche Begabung eines Malers bestand allein darin, immer neue Erwerbsquellen ausfindig zu machen. Gerade in Paris, in diesem Schlammsitz der Musen, wo alles zu Kunst gemacht wurde und jeder in jedem seinen Konkurrenten sah. Es wunderte sie nicht, daß man sich neuerdings um die Aufträge als Knopfmaler balgte. Münzgroße Knöpfe für prächtige Überröcke mit freien künstlerischen Motiven zu versehen, sicherte immerhin ein Weilchen die täglichen Unkosten für eine mehrköpfige Familie. Handelte es sich um den Überrock eines Herzogs oder sonst einer bedeutenden Kreatur, bot ein solcher Auftrag auch noch die Chance, sich am Hof ins Gespräch zu bringen und den königlichen Schatullen näherzurücken. Allerdings waren auch das oft nicht mehr als Hoffnungen, denn aus Erfahrung wußte sie, sobald eine Mode vorüber war, gerieten auch die Namen der Maler in Vergessenheit, und sie saßen wieder im Café Gradot auf dem Quai de l’Ecole und trauerten den schönen Zeiten nach, wo sie noch ihre Miete bezahlen konnten und Kredit beim Weinhändler und der Austernverkäuferin hatten. So sah sie doch aus, die Realität der grands peintres! Als ob das eine schöne Aussicht war! Von wünschenswert ganz zu schweigen. Nein, die Kunst machte nur Freude, wenn man nicht von ihr leben mußte.
Natürlich wollte Frau Jeanne ihrer Tochter die Begeisterung nicht ausreden, denn Begeisterung war immer noch besser als jede flaue Art zu leben. Aber eines sollte sie sich durch den Kopf gehen lassen: Nach allem, was sie mit ihrem Vater erlebt hatte, wurde die Kunst in erster Linie vom Geschmack der Zeit bestimmt, und der änderte sich so rasch wie das Wetter. Solange ihre Bilder gefragt waren, mochte sie ja ein angenehmes Leben führen. Was aber, wenn die Einnahmen ausblieben? Dann konnte niemand ausschließen, daß sie eines Tages ihre Kinder auf dem Dachboden zur Welt bringen und in Betten schlafen mußte, die mit Eierschalen gefüllt waren. Oder schlimmer noch: Wenn sie krank wurde und irgend etwas eintrat, das sie unfähig machte, den Pinsel in die Hand zu nehmen? Dann stand sie als beklagenswerte Malerin da, die tragische Muse, die am Ende noch froh sein mußte, wenn sie im Städtischen Asylhaus Aufnahme fand. Wenn sie dieses Risiko eingehen wollte, bitte sehr. Sie konnte sie schließlich zu ihrem Glück nicht zwingen. Aber es gab weit bessere Möglichkeiten. Das mußte ihr deutlich gesagt werden.
Zwar wollte sich Frau Jeanne aus falschem mütterlichen Stolz nichts einbilden, aber ihre Tochter war schön. Mit ihren 15 Jahren fast beängstigend schön. Mochte Vernet ihr auch ein Naturtalent bescheinigen, mochten ihr in Gottes Christus Namen die Farben im Blut liegen – als Mutter hatte sie die Pflicht, zuallererst an ihre Versorgung zu denken. Das war das Wichtigste. Ihre kleine Aphrodite schien doch geradezu prädestiniert dafür, sich hoch hinauf zu heiraten. Es wäre ja unverantwortlich gewesen, nicht schon jetzt darauf zu achten, daß sie einen Mann fand, der finanziell fest im Sattel saß. Jetzt hieß es aufpassen, daß ihre Tochter sich nicht zu wählerisch gebärdete. Schließlich war alles besser, als von der Kunst leben zu müssen.
Liz konnte darauf warten: Kaum wehte das erste frühlingsmilde Lüftchen, drängte die Mutter auf die Promenade und spazierte mit ihr den Boulevard du Temple auf der einen Seite hinauf und den Boulevard du Temple auf der anderen Seite hinunter. Unter dem ersten maigrünen Flor der Bäume traf sich die elegante Welt. Die Kaffeehäuser und Bänke voll besetzt, auf der Mitte der Fahrbahn schnelle englische Cabriolets, gefederte Kutschen, die Räder mit silberbeschlagenen Speichen, sechsspännige Equipagen mit Beiläufern zur rechten und zur linken und auf den Trittbrettern livrierte Lakaien, Kavaliere hoch zu Roß, die Paradepferde prächtig aufgezäumt, Damen mit Bolognesern und der neusten blonden Lockenpracht, mondän gesteckt als flambeau d’amour, Frackträger, Stutzer, Bonvivants – ein buntes Gewühl und sie im Strom dieses geschäftigen Müßiggangs, der allem ein so leichtes, luftiges Air gab, daß sie meinte, mitten in einem Aquarell zu sein.
Es wäre ein schöner Farbenspaziergang gewesen, aber Liz wußte ja, daß die Mutter sie auf dieser Heiratsmeile zur Schau stellen wollte, und es dauerte nicht lange, da kamen auch schon die reizenden Empfehlungen: »Sieh mal dort drüben, Steuerpächter Blancard, steinreich und ledig, sein Vater starb kürzlich in Ausübung seiner Laster, oder noch besser: da vorne der Direktor der Königlichen Lotterie im Gespräch mit Sautelet, dem Präsidenten des Bankhauses, beide mehr als kreditsicher und zudem noch stattliche Erscheinungen. Wer denen gefällt, ist gemacht.« Zwar fand es Liz ganz amüsant, wen die Mutter alles mit Namen kannte, fast so, als sei es neben dem Frisieren ihre Hauptbeschäftigung, die Reichen und Berühmten der Stadt für sie im Blick zu haben, aber um diesen Hinweisen den Charakter diskreter Anbahnungen zu nehmen, stimmte sie natürlich sofort ihre pädagogische Leier an, und es folgten die gewohnten Ratschläge für tadellose Manieren und einen unbefleckten Ruf. Es hätte Liz nicht gewundert, wenn Frau Jeanne ihr auch noch mit der unbefleckten Empfängnis gekommen wäre. So was verleidete alles. Unter dem aufgespannten Tugendschirm präsentiert zu werden reichte ja schon, aber dann auch noch gesagt zu bekommen, auf wen sie den Blick zu richten hatte, das war zuviel. »Der Mann dort drüben, der gerade aus dem Café kommt und jetzt zu dir herüberlächelt, ist Monsieur Bachelier, der begehrteste Junggeselle der Stadt. Er erbt mal die Tuchwebereien seines Vaters. Und er hat keine Geschwister.«
Liz sah flüchtig zu ihm hin und meinte trocken: »Schwer zu malen. Sein Kopf sitzt zu tief auf den Schultern. Der eignet sich nur für ein Standporträt.« Was gingen sie denn all diese bemoosten Flaneure an? Reich, na schön. Aber was hatte sie damit zu tun?! Wer waren die denn, daß sie ihnen gefallen sollte! Wenn denen etwas an ihr lag, konnten sie ja ein Porträt bestellen. Dafür fühlte sie sich bestens gerüstet. Zeichnen beherrschte sie jetzt perfekt. Schließlich hatte Briard nicht umsonst wochenlang eine Gipsfigur vor ihr postiert, links und rechts daneben eine brennende Kerze gestellt und sie Schatten zeichnen lassen. Stundenlang Schatten. Tagelang Schatten. Kernschatten, Schlagschatten, Halbschatten, Lichtschatten, farbige Schatten, Schatten abgetönt, Schatten aufgehellt, Schatten verwischt, Schatten schraffiert, Schatten bis zur Erschöpfung. Sie verstand sich auf Skizze, Studie und Karton, war firm in Kreide-, Kohle-, Rötel-, Tusch- und Federzeichnung und wußte jetzt, daß jeder Linie, auch wenn sie noch so zufällig erschien, ein Gesetz zugrunde lag. Sie wußte Bescheid, sie kannte sich aus, sie fühlte sich der Welt überlegen. Und daß sie schön war, sah sie selbst. Das brauchte ihr niemand zu sagen. Sie hatte sich schon mehrere Male porträtiert und alle Züge, alle Proportionen ihres Gesichts genau studiert. Der Blick in den Spiegel war ihr mehr als vertraut und immer erfreulich. Sie sah gut aus und konnte gut malen – als ob das nicht genügte. Sie war bestens versorgt.
Um Frau Jeanne zu zeigen, daß sie der Boulevard als Heiratsmeile nicht interessierte, zückte sie demonstrativ ihren Skizzenblock, stellte sich abseits und begann zu zeichnen. Großzügig hingeworfene Bewegungsstudien: Absteigen vom Pferd, Einsteigen in die Equipage mit zusammengeklapptem Reifrock, dem sperrigen panier articulé, die schlurfenden Schritte des Sänftenträgers, der ausgestreckte Arm des Zeitungsverkäufers, der schräggeneigte Kopf eines Violinspielers – das waren die weit interessanteren Dinge für sie. Und wenn überhaupt ein Flanieren auf dem Boulevard Spaß machte, dann nur mit ihrer Freundin Ann-Rosalie, die gleichfalls bei Briard Unterricht nahm. Da machten sich die beiden ein Vergnügen daraus, all denen, die ihnen hungrige Blicke zuwarfen oder sie dreist wie Bordellgänger musterten, eine Grundfarbe zuzuordnen: Da kam der Flohbraune, der Scheißgelbe, der Fahlgrüne, der Indischrote, der Beinschwarze, der attische Ocker, der Bleiweiße, der Bergblaue, der Goldpurpur, die Mumie, das Drachenblut. Aber auch der Schwammbauch, die Fettwurst, das Fleischgesicht, die Gassenvenus, der Pfeffersack, die Kartoffelnase und in den Kutschen irgendeine durchlauchte Hochherrlichkeit oder ein anderer Kohlstrunk. So allerdings bekam das Flanieren auf dem Boulevard etwas Aufregendes.
Nur die Sonntage waren ein Ärgernis. Es wollte ihr partout nicht einleuchten, warum eine arbeitsreiche Woche in geballter Langeweile enden mußte. Schon morgens die ganze Trostlosigkeit: weiße Schuhe, weiße Strümpfe, das gute Seidenkleid, das gestickte Halstuch, der Sonntagsmantel, der Festtagshut, das samtrote Gebetbuch und dann in Dreierprozession zur Kirche: Mutter, Bruder, Schwester. Saß einer mit seinem Hund in der Kirchenbank oder las bei der Predigt die Zeitung, dann war das zwar abwechslungsreich und amüsant, doch die Mutter empörte sich auf dem Nachhauseweg so sehr über einen Pfarrer, der solche lottrigen Sitten einreißen ließ, anstatt diese frechen Lümmel am Kragen zu packen und vor die Tür zu setzen, daß sie jedesmal wütend ihre Schritte beschleunigte und sie abgehetzt nach Hause kamen, wo sie sich weiter empörte, bis eine Tante erschien. Wenn sich bald darauf ein Onkel dazugesellte, wurde Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und über die steigenden Preise geschimpft. Das Zweipfundbrot kostete nun schon vier Sous, und für ein Paar Schuhe sechs Livres auf den Tisch zu legen – wer sollte das noch bezahlen. Kein Wunder, wenn die Schuhe jetzt auf Kredit gekauft wurden. Gar nicht zu reden von den Wasserpreisen. Der blanke Wucher! Und ständig diese Angst vor dem Winter. Es konnte doch nicht sein, daß ein rechtschaffener Mann im Winter im Bett bleiben mußte, nur weil ihm das Geld für die Heizung fehlte, während der triefnäsigste Minister 20000 Livres im Jahr einsackte und für sein dummes Geschwafel auch noch im Warmen saß. Das mußte man sich einmal vorstellen. Für Nichtstun auch noch hoch bezahlt werden! Die Kaffeerunde war sich einig: Sie alle arbeiteten von Jahr zu Jahr immer mehr und hatten immer weniger in der Tasche. Sie konnten von morgens bis abends noch so sehr rackern und sich krumm schuften – es blieb einfach nichts übrig. Aber Hauptsache in Versailles bogen sich die Tische und die Königin konnte im scharlachroten Seidenbett schlafen und an jedem Finger einen Ring für eine halbe Million Livres tragen. Wo um Himmels willen sollte das noch enden!?
Waren die Gegenstände der Wut ausgetauscht, ging es zu den Krankheiten. Sonntag für Sonntag Kaffee und Kuchen mit Elendsgeschichten – es war nicht zum Aushalten. Bis zum Einbruch der Dämmerung der Schauerrefrain: Der Nachbar lag im Zehrfieber, und in St. Antoine grassierte schon wieder das Kotbrechen, nur weil das Beamtengesindel im Magistrat nicht für sauberes Wasser sorgte. Die Tante hatte noch immer ihren Wetterkalender in der Schulter, denn jedesmal wenn das Wetter sich änderte, begannen die Schultern zu schmerzen. Ein Bekannter von ihr war bedeutend an den Pocken erkrankt und bekam von seinen Eltern einen Sou für jede Pustel, an der er nicht kratzte. Kopfgicht kurierte man am besten mit gelben Rüben und Meerrettichsaft und bloß nicht in ein Krankenhaus kommen! Im Krankenhaus wurde man nicht geheilt, sondern auf dem kürzesten Weg zu Gott geschickt. Es war doch kein Zufall, daß neben dem Hôtel-Dieu gleich der Städtische Friedhof lag. Liz kannte das alles und dachte nur, wieviel Nützliches hätte sie jetzt in der Malstube tun können. Aber der Sonntag war Ruhetag, da durfte sie keinen Pinsel anfassen, nicht mal eine Skizze auf das Papier kritzeln und hatte alles zu meiden, was auch nur annähernd nach Arbeit aussehen konnte. Der Sonntag war zum Heulen.
Allerdings änderte sich das unverhofft, denn Briard hatte für sie die Erlaubnis erwirkt, in den Museen die Alten Meister kopieren zu dürfen. Frau Jeanne begriff diese Ausnahmeregelung sofort als eine neuerliche Anerkennung des Talents der Tochter, hegte sie doch seit Vernets Besuch die Hoffnung, damit schon bald ihre Haushaltskasse aufbessern zu können. Weil Liz nur in Begleitung einer erwachsenen Person die Gemälde kopieren durfte, wurden schlagartig die Kaffeerunden eingestellt, und Frau Jeanne begleitete sie Sonntag für Sonntag pünktlich zu den Öffnungszeiten in die Museen. Sie ging mit ihr ins Palais du Luxembourg zu Rubens oder ins Palais Royal zu den italienischen Meistern. Liz studierte die Lichtabstufungen bei Raffael, kopierte Köpfe von Rembrandt und van Dyck und manchmal auch die Mädchenköpfe vom braven Greuze. Sie saß mit ihrer Staffelei vor dem Bild, neben sich den Farbenkasten, den Malstock und die Palette in der Hand, während die Mutter einen Stuhl ans Fenster gerückt hatte und die Zeit nutzte, um für Etienne zum Geburtstag eine Brieftasche zu besticken. In den Räumen war es zugig und kalt. Allweil blieben ein paar Museumsbesucher stehen und schauten der Kopistin neugierig über die Schulter. Zwar empfand sie das als unangenehm und störend, doch noch schlimmer war der Museumswärter. Unablässig ging er mit Aufsehermiene neben ihr auf und ab, klapperte mit seinem großen Schlüsselbund wie ein Kerkermeister, doch sobald sie Hände kopierte, blieb er demonstrativ stehen. Mißtrauisch und ganz wie ein Mann vom Fach verfolgte er jeden Pinselstrich, als wollte er prüfen, ob sie überhaupt die nötige Begabung zum Malen mitbrachte, denn Hände zu kopieren war das Allerschwierigste. Wenn die Hände mißrieten, mißriet das Gesicht. Liz wußte das und spürte, wie er insgeheim darauf lauerte, daß ihr die Karnation mißglücken würde, damit er sie anschließend bedauern oder belächeln konnte. Aber sie ließ sich nicht nervös machen, denn die Chance, die großen Meister zu kopieren, kam so schnell nicht wieder. Schon gar nicht am siebten Tag der Woche, diesem vertrübten trostlosen Ruhetag, an dem man sonst zu Hause sitzen und sich langweilen mußte. Eine ganze Horde von Museumswächtern hätte sich neben ihr postieren können – es hätte sie nicht abgehalten, denn besser ließ sich kein Sonntag verbringen.
Ein livrierter Bote brachte einen Brief für Mademoiselle Elisabeth Vigée mit der Bitte, die Antwort gleich mitnehmen zu dürfen. Liz brach das Siegel auf, überflog die Zeilen und konnte es kaum fassen: Madame Geoffrin hatte bei Vernet das Porträt der Mutter gesehen und war so begeistert, daß sie nur den einen Wunsch hatte: gleichfalls von Mlle Vigée gemalt zu werden. Auf diesem Wege wollte sie anfragen, ob der Montag nach Reminiscere für eine Sitzung genehm sei.
Liz mußte erst einmal tief durchatmen, denn von einer so berühmten Frau ein solches Lob zu bekommen, brachte sie einen Moment lang ganz durcheinander. Dann holte sie entschlossen ihr Schreibzeug, setzte sich an den Tisch, bedankte sich in aller Form für die Aufmerksamkeit, die sie ihr widmete, und wählte 11 Uhr vormittags, weil zu dieser Zeit das Tageslicht besonders günstig war. Sie übergab dem Boten die Antwort und wartete voller Ungeduld darauf, daß die Mutter endlich nach Hause kam. Kaum daß sie Frau Jeanne die Straße heraufkommen sah, rannte sie ihr entgegen, nahm ihr den Koffer ab, und als sie in der Wohnung waren, platzte sie mit der Nachricht heraus, daß Madame Geoffrin von ihr gemalt werden wollte.
Der Mutter verschlug es die Sprache. Sie machte ein so verdutztes ungläubiges Gesicht, als hätte sie soeben einen Hauptgewinn in der Lotterie gezogen, ließ sich in den Sessel fallen und verlangte erst einmal nach einem Kaffee, um diese Neuigkeit mit der nötigen Ruhe aufzunehmen. Schließlich war Madame Geoffrin nicht irgendeine dieser beneidenswert reichen Witwen, sie war die Königin der Pariser Salons, bei der die geistige Elite Europas verkehrte. Und was für Männer! Keine Zitterrochen von den hohen Fakultäten, nein, bei ihr trafen sich nur ausgesucht kühne Köpfe. Männer, die sich trauten, öffentlich gegen all die schönen Posten und dicken Pfründe des Adels zu Felde zu ziehen – Voltaire, Rousseau, Diderot, Raynal, d’Alembert, Marmontel, d’Holbach, Choiseul, Condillac – sie alle saßen an ihrem Tisch und konnten sich darauf verlassen, daß jeder neue Gedanke von ihr stipendiert wurde. Vor kurzem erst hatte sie das Sternensümmchen von 100000 Livres für die Enzyklopädie gestiftet, damit das Mammutunternehmen gegen alle Verbote fortgesetzt werden konnte. Und daß in ihrem Salon, diesem bureau d’esprit, regelmäßig die neuen Mitglieder für die Akademie ausgeguckt wurden, war auch kein Geheimnis. »Die Geoffrin ist eine Institution. Sie zieht im Hintergrund die Fäden. Wer von ihr geschätzt wird, kommt groß ins Gespräch. Diese Frau nutzt dir mehr als irgendeine freundliche Notiz im Mercure. Ich sage ja immer: Die Nähe zu den Großen ist schon das halbe Geschäft. Wenn ich das Glück gehabt hätte, einer Dame dieser Qualität das Haar frisieren zu dürfen, stünde ich heute gewiß ganz anders da. Van Loo hat sie gemalt und Chardin, und nun bist du an der Reihe. Eine riesengroße Ehre. Also zeig, was du kannst und gib dir Mühe!«
Liz ärgerte sich. Wenn sie das schon hörte! Mühe geben! Immer diese Sprüche. Diese abgewrackten Belehrungen. Sie saß doch nicht mehr in der Klosterschule im Faubourg Saint-Antoine. Lächerlich! Als ob Mühe etwas nutzte. Malen war schließlich kein Lockendrehen. Da konnte sie sich noch so viel Mühe geben – entweder ein Porträt gelang oder es gelang nicht. Alles andere blieb gutgemeint. Ihre Ermahnung hätte sich die werte Frau Mama getrost ersparen können, doch leider hörte Liz den Satz noch mehrere Male in den verschiedensten Varianten, mal als Ansprache, mal als Tagesorder, bevorzugt als Tischgebet und selbst auf dem Weg zu Madame Geoffrin bekam sie etwas von der großen Ehre und der Mühe vorgemurmelt. Lieber wäre sie alleine zur Sitzung gegangen, aber die Mutter ließ es sich nicht nehmen, sie zu begleiten. Frau Jeanne hatte sogar eine Mietkutsche bestellt, damit die Tochter nicht wie ein Hungerleider mit Malkasten, Staffelei und Leinwand vom Straßenkot bespritzt an der Tür stehen mußte. Vorfahren hinterließ doch gleich einen ganz anderen Eindruck und zeigte, daß ihre Tochter es nicht nötig hatte, sich mit der Konterfei-Kunst Geld zu erbetteln, geschweige denn auf ein Honorar dringend angewiesen zu sein. Ob Anfänger oder berühmt – für Frau Jeanne gab es nicht die geringsten Zweifel, daß es immer ratsam war, dem Auftraggeber als erstes seine Unabhängigkeit zu dokumentieren. Das schaffte Respekt.
Liz saß schweigend neben der Mutter in der Kutsche, kam sich wie in Begleitung einer Anstandsdame vor, hörte nicht zu, was sie sagte, und fand es bloß peinlich, wie sie sich herausgeputzt hatte. Die Frisur hoch aufgetürmt, im Haar diese gräßlichen Bestecknadeln mit Schmetterlingen und Kornblumen, und auch das Rüschenhalsband und das Rosenhütchen wären nicht nötig gewesen. Sie hatte sich viel zu sehr aufgetakelt. Schließlich begleitete Frau Jeanne sie zur Arbeit und nicht zum Ballett. Doch es blieb keine Zeit, darüber ein Wort zu verlieren, denn plötzlich stand sie vor Madame Geoffrin und war erschrocken. Konsterniert und erschrocken. Sie hatte sich die Salonkönigin ganz anders vorgestellt, nicht so alt, nicht so runzlig, nicht so krumm in der Haltung und nicht so schlecht angezogen. Eisengrau das dürftige Kleid und das Spitzenhäubchen unter dem Kinn gebunden, obendrauf noch ein schwarzes Hütchen – schlimmer konnte es nicht kommen. Eine ausgebrannte Frau von Welt, abgemüdet und im Lächeln so einen Zug ins Jenseits – Liz begriff sofort, was auf sie zukam: Nichts war undankbarer, als das Alter zu malen.
Madame Geoffrin führte sie hinauf in den Salon, in dem sie porträtiert werden wollte. Als Liz den Raum betrat, glaubte sie, in einen verstaubten Musentempel geraten zu sein. An den Wänden ringsum kostbare Gobelins, dazwischen Bilder Alter Meister, Spiegel, Pendulen, Supraporten, Marmorbüsten und mittendrin die femme du monde, die uralte Geoffrin, die in dieser Umgebung allerdings eine ganz unerwartete Lebendigkeit zeigte. Liz spannte die Leinwand auf, ließ ein Podest kommen, damit das Modell ihr gegenüber erhöht sitzen konnte, prüfte den günstigsten Lichteinfall, und kaum daß Madame Geoffrin in ihrem Lieblingssessel Platz genommen hatte, gab es für Liz nur die eine Überlegung: Malte sie nach der Natur, mochte das Bild keiner ansehen, malte sie nach der Phantasie, machte sie sich unglaubwürdig. Sie mußte etwas finden, das dazwischenlag, ein drittes, das Jugend und Alter verband. Darum bat sie, ihr etwas von dem zu erzählen, was sie im Moment am meisten beschäftigte. Beim Sprechen, das hatte Liz schon mehrmals erprobt, trat das Wesen zutage, und das Gesicht bekam Charakter.
Madame Geoffrin berichtete schwärmerisch, wie gut allerorts über die junge Künstlerin gesprochen wurde und daß exzellente Kenner das Porträt der Mutter schon mehrfach für einen Watteau gehalten hatten. Liz tat, als würde sie die Komplimente überhören, war aber stolz auf jedwedes Wort dieser Art, das im Beisein von Frau Jeanne gesprochen wurde. Sie sah kurz zu ihrem Modell auf, dachte einen Moment über die Komposition nach, entschied, daß Frontalstellung sich besser eignete als Profilstellung, und begann mit Kreide in großzügigen Linien die Umrisse auf die Leinwand zu skizzieren. Alles ging ihr leicht von der Hand. Erst als Madame Geoffrin sich darüber aufregte, daß es noch immer keine weiblichen Vollmitglieder in der Akademie gab, da spannte sich ihr Gesicht, die Augen bekamen Glanz, und Liz spürte, daß sie jetzt mit der Farbe beginnen mußte. Hell, Dunkel, Schatten, Licht – jetzt war sie im Gespräch mit ihr, jetzt tönte sie etwas an, das über die bloße Wiedergabe der Natur hinausging. Jetzt konnte sie sich einbringen und ihren Eindruck von ihrem Gegenüber ins Bild setzen. Doch plötzlich ging die Tür auf und der Salon füllte sich mit Freunden und Gästen, die Madame Geoffrin eigens zu diesem Ereignis geladen hatte. Sie begrüßte alle, rief der jungen Malerin freudig die Namen zu, doch Liz war von all dem so irritiert, daß sie sich keinen merkte und sich mit einem Mal von einem Kranz von Zuschauern umringt sah. Einige stellten sich hinter sie, um ihr über die Schulter zuzusehen, was sie partout nicht ertrug, denn es kam ihr so vor, als wollten sie prüfen, ob sie überhaupt den Pinsel richtig in der Hand halten konnte. Die Atmosphäre war zerstört, der Strom des Malens unterbrochen. Am liebsten hätte sie ihre Sachen zusammengepackt und wäre gegangen. Sofort. Auf und davon. Doch sie war sich der einmaligen Situation bewußt, denn schließlich wurde nicht jeder hierher zum Malen gebeten. Sie ließ sich ihren Ärger nicht anmerken. Es wäre unprofessionell gewesen. Am Ende wurde es ihr gar noch als Unsicherheit, Schwäche oder Nichtkönnen ausgelegt. Sie und eine Probenonne! Soweit kam es noch! Wenn die erlauchten Geister des Fortschritts schon so erwartungsvoll um sie herumstanden und sich mit ihren großen Kunstrichteraugen wie Prüfmeister gebärdeten, dann wollte sie ihnen zumindest demonstrieren, daß sie in der Lage war, in einer Sitzung eine Ölskizze auf die Leinwand zu bringen. Bloß nicht vor diesen Zuschauern zögern oder lange überlegen. Gleich, ob der Schatten eine Nuance heller oder dunkler zu sein hatte – vor diesem Forum mußte er auf Anhieb sitzen. Darum begann sie wie Raffael zuerst mit Gesicht und Händen und alles Drumherum mußte sich wie von selber ordnen. Wenn sie schon als Nouveauté in dieses Haus gebeten war, dann wollte sie niemanden enttäuschen. Denn hier, da hatte die Mutter ausnahmsweise einmal nicht übertrieben, hier wurde der Ruf gemacht. Salon hin, Salon her, Tempel der Kunst oder Büro des Geistes – sie war in der Brutstube der öffentlichen Meinung. Soviel wußte sie schon selber. Dazu brauchte es keine Unterweisung. Sollten sie in Gottes Namen hinter ihr stehen und zusehen. Farbton um Farbton ließ sie das Bild einer grande dame der Gesellschaft entstehen, zwang sich, wenigstens innerlich den Gesprächsfaden zu ihr wieder aufzunehmen, und hielt die Atmosphäre des Salons als einen Ausdruck ihres Gesichtes fest, der die Züge formte: Frau mit Hintergrund. Liz vermied, auch nur einen einzigen der Umstehenden anzuschauen, tat, als existierten sie gar nicht, konzentrierte sich ganz auf ihre Ölskizze und war froh, daß Madame Geoffrin ihr Kleid hochgeschlossen trug und der Kragen direkt unter dem Kinn endete, so daß sie keinen Hals zu malen brauchte und sich diesen Aufwand ersparen konnte. Denn länger als drei Stunden durfte die Sitzung nicht dauern. Danach wurde alles Strapaze.
Ein Livreebedienter reichte den Gästen Kaffee und Konfekt. Frau Jeanne war bereits mit einigen von ihnen munter im Gespräch und fand es wunderbar, daß ihre Tochter vor einem so erlesenen Publikum ihr Talent unter Beweis stellen durfte. Im stillen hatte sie natürlich die Hoffnung, daß sich aus diesem Kreis schon bald ein Heiratskandidat melden würde. Schließlich war keiner, der im Salon der Madame Geoffrin verkehrte, eine schlechte Partie. Liz brauchte nicht zur Mutter zu schauen – sie konnte ihre Gedanken erraten. Sie spürte sie geradezu. Es hätte sie auch gewundert, wenn beim Anblick so vieler Männer Frau Jeanne nicht als erstes die gute Versorgung in den Sinn gekommen wäre.
Irgendwie war es seltsam: Plötzlich flatterte fast jeden Tag ein Brief ins Haus, oder es stand ein Bediensteter an der Tür und überbrachte Mademoiselle Elisabeth ein Billett. Sie brauchte eigentlich gar nichts mehr von all dem zu lesen, sie kannte den Inhalt: Die Absender hatten den Wunsch, von ihr porträtiert zu werden, und baten um einen Sitzungstermin. Zwar freute sie diese Nachfrage, denn sie sah, daß sich mit den Honoraren die Haushaltskasse der Mutter aufbessern ließ, aber trotzdem konnte sie sich den plötzlichen Andrang nicht so recht erklären. In keiner Ausstellung waren ihre Bilder bislang gezeigt worden, in keiner Zeitung hatte ihr Name gestanden und plötzlich diese Nachfrage. Das machte sie stutzig. Die Vorstellung, mit jedem neuen Tag würden neue Porträtwünsche auf sie zukommen, versetzte sie in eine innere Unruhe, denn alle wollten die Bilder am liebsten sofort und sie fragte sich, wie sie das schaffen sollte. Nachts schlief sie schlecht, suchte nach einer Erklärung, und als es vormittags wieder an der Tür klopfte, überlegte sie, ob sie überhaupt noch öffnen sollte. Sie war nicht da, sie war auf Reisen. Am besten in Italien. Das klang nicht nach peinlicher Ausrede, das war glaubhaft und zudem respektabel, denn jeder Maler, der auf seine Reputation hielt, mußte wenigstens einmal im Leben in Italien gewesen sein. Bei ihr stand die höhere Weihe eben gleich am Anfang. Wenn es so weiterging, sollte die Mutter das demnächst verbreiten.
Liz zögerte einen Moment, doch als es ein zweites Mal klopfte, hörte sie schon an dem raschen Aufschlag, daß es nur die Freundin sein konnte, und ließ sie erleichtert ein. Ann-Rosalie kam mit einer großen Zeichenmappe. Inzwischen hatte sie sich auf die Pastellmalerei verlegt, hatte schon mehrere Porträts für einen betuchten Anwalt geliefert und war sich ganz sicher, bald gut im Geschäft zu sein. Sie fehlte bei keiner Ausstellungseröffnung, wußte über alle Arbeiten der Gilde Bescheid und kannte sich in der Malerszene bis ins letzte Geflüster aus. Mit einem Siegerlächeln öffnete sie die Zeichenmappe und breitete die neusten Raritäten aus – Aktstudien von Ménageot, die er ihr zu Übungszwecken überlassen hatte. »Du weißt ja, wie er ist«, sagte sie, »erst leiht er etwas großzügig aus, und dann hat er Angst, daß er es nicht wiederbekommt, und holt es sich am nächsten Tag zurück.«
Liz ließ alles stehen und liegen, legte die Blätter auf die Staffelei, holte zwei Stühle und schloß vorsichtshalber die Zimmertür ab, damit der Bruder sie beim Aktzeichnen nicht überraschen konnte. Eigentlich hätte sie auch noch die Vorhänge zuziehen und sich zusätzlich die Augen verbinden müssen, denn genaugenommen durften sie das, was sie da kopierten, gar nicht sehen. Nichts davon ahnen, nichts davon wissen, nichts davon kennen. Doch sie war sich mit ihrer Freundin einig: Wenn ihnen der Blick auf das Nackte offiziell verboten war, dann mußten sie eben zur Selbsthilfe greifen und sich diesen Blick hinterrücks verschaffen. Trotzdem: Als sie zu zeichnen begann, ärgerte sich Liz, daß sie wie zwei verdorbene Sünderinnen hier hocken mußten, zwei Lotterdamen, zwei Schwestern der Unzucht, um hastig in aller Heimlichkeit nachzuholen, was den männlichen Kollegen erlaubt war. Auch wenn die Männer in den Aktklassen mindestens 20 Jahre alt oder wenigstens verheiratet sein mußten – aber sie hatten immerhin die Chance. Doch daß für Frauen ganz prinzipiell das Aktstudium verboten war, das sah sie nicht ein. Wenn das ihr Schamgefühl verletzen sollte, dann hatte sie keins. Und daß dies eine Malerin aus der Bahn werfen könnte, war wohl ein Laternenwitz. Sie durfte ja noch nicht einmal vor Antiken und Gipsabgüssen sitzen, um das Muskelspiel eines Helden abzukupfern. Da nützte auch der größte Lendenschurz nichts. Hätte sie im Louvre oder den anderen heiligen Hallen der Kunst gewagt, auch nur den Fuß einer nackten Statue nachzuzeichnen, hätte sie auf der Stelle für immer Hausverbot bekommen, und das zu riskieren wäre erst recht eine Dummheit gewesen.
Sie schaute auf Ménageots Aktstudien – Nackter gestreckt, Nackter gehockt, Nackter gebeugt – und fragte sich, warum dieser Anblick für sie so verderblich sein sollte. Ihr wurde davon nicht fiebrig, sie begann nicht zu zittern, ins Wanken geriet auch nichts, ihr Kopf blieb kühl, sie stürzte in keinen Abgrund und daß der Blick auf das Kleine Nackte ein weibliches Wesen angeblich in Taumel und Ekstase versetzte – das hatte doch nur einer erfunden, der davon träumte, ihm könnte das einmal passieren. Was immer darüber behauptet wurde – sie betraf es nicht. Vielmehr zeigte ihr diese kümmerliche Gestalt des Aktmodells, daß der Anblick des Nackten eher deprimierend war, jedenfalls so, daß man ihm schnell ein Mäntelchen umhängen wollte. Es hatte für sie irgendwie etwas Bemitleidenswertes, und das Verführerische daran konnte wohl nur ein Blinder entdecken. Ob sie nun das Adamsgewächs sah oder nicht, blank oder mit Feigenblatt, darauf kam es doch gar nicht an. Jetzt beim Kopieren sah sie erneut: Der Blick auf das Ganze, auf den Bau des Körpers, seine Proportionen, seine Haltung, seine Veränderung in der Bewegung – dieser Blick wurde ihr vorenthalten. Für eine Malerin blieb eben nur der sichtbare kleine Rest. Kein Wunder, wenn sie alle Bewegung, die es gab, ins Gesicht verlegen mußte.
Trotzdem kopierte sie jetzt mit Eifer die kostbaren Leihgaben, um wenigstens ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man mit feiner Kreuzschraffur die Muskelpartien als Licht- und Schattenvolumen herausarbeiten mußte. Ganz nebenbei erwähnte Liz die momentane Auftragsflut, und als sie ihre Arbeit beendet hatten, warf Ann-Rosalie einen Blick auf die Billetts, die in der Schale lagen, sah auf die Absender und mußte unwillkürlich schmunzeln, denn einige der Namen waren ihr bekannt. »Goldsöhne und Großtuer«, sagte sie, »zu viel Zeit, zu viel Geld, zu viel Langeweile. Offenbar hat sich jetzt herumgesprochen, wer da hinter der Staffelei steht. Es mögen ja ein paar ehrliche Anfragen darunter sein, aber der Rest ist Vorwand. Nachsteiger, verstehst du, alles Nachsteiger. Von wegen gemalt werden! Die wollen doch nur sehen, ob du für eine Liaison zu haben bist. Wenn sie wirklich ein Porträt wollten, hätten sie längst zu Vien oder La Tour gehen können. Aber was gibt es bei den zauseligen Brabbelköpfen schon zu sehen? Du dagegen bist die echte Attraktion. 17 Jahre, aufregend gebaut und endlich mal was anderes. Diese Geldmänner sind immer auf eine Abwechslung aus, die wollen Spaß und Vergnügen. Laß dir bloß ein Drittel des Honorars vorabzahlen, sonst siehst du am Ende keinen Sou!«
Ann-Rosalie erzählte, was ihr gerade mit einer Auftragsarbeit für einen reichen Eisenhändler passiert war, der sich von ihr in Pastell hatte malen lassen, und daran mußte Liz denken, als sie zu ihrer ersten Sitzung ging. Angeblich ein Prinz. Vielleicht auch wirklich nur so ein Großtuer. Von genauer Bezahlung war jedenfalls nicht die Rede, außer der allgemeinen Bemerkung, daß er sie gut honorieren wollte. Aber das konnte auch eine Floskel sein. Doch eine Vorauszahlung einzufordern, fand sie unpassend, sah es doch so aus, als ob sie Geld nötig hätte. Die Wohnung war angemietet, und mitten im Empfangsraum hatte er eine Stele mit dem Kopf des Achilles aufstellen lassen, vor der er porträtiert werden wollte. Pose Kleiner Sonnenfürst. Lässig lümmelte er an der Stele, spielte an seinem Galanteriedegen, spitzte unentwegt den Mund, warf ihr Luftküsse zu, ließ kein Auge von ihr und sagte so ganz nebenher: »Wissen Sie, daß Sie einer Venus gleichen? Man zählt Sie zu den schönsten Frauen von Paris, was sage ich, ganz Frankreichs! Wußten Sie das?« Sie spürte, daß er es darauf angelegt hatte, sie aus dem Konzept zu bringen. Diese gierigen Blicke zu malen, hatte sie keine Lust. Dazu noch dieses schlüpfrige Lächeln, das er hartnäckig auf sie richtete, denn er schien es zu genießen, daß sie nicht ausweichen konnte. Was sollte sie machen? Es stand nun mal kein gerupftes Huhn vor ihm. Sie war, wie sie war, und er mußte sie aushalten. Doch beim Malen ständig auf ihre Erscheinung angesprochen zu werden, lenkte vom Gegenstand ab. Und der Gegenstand war nun mal diese turtelnde Hoheit und nicht sie, die Malerin. Es schien ihr, als würden sich die Verhältnisse verkehren, als wäre sie das Modell. Allein daß ein solches Gefühl aufkam, störte die Arbeit und nahm ihr den intuitiven Schwung. Sie wußte schon jetzt, daß dieses Porträt höchstens ein gutes Übungsstück wurde, mehr nicht. Handwerklich korrekt, das Hell-Dunkel gerade noch in der Proportion, doch sonst langweilig und fad. Ihr fiel einfach nichts dazu ein. Dieses Anackern brachte sie so sehr in eine Abwehrstellung, daß sie nicht offen ihr Gegenüber aufnehmen konnte, sondern sich vor ihm wie eine Auster verschloß. Wenn aber das Porträt gut werden sollte, mußte sie sich ganz auf den anderen einlassen. Doch sie konnte es nicht. Sie fand keinen Zugang. Schon ihm in die Augen sehen zu müssen kostete Überwindung. Am liebsten hätte sie an ihm vorbeigeschaut, aber vom Wegsehen entstand kein Porträt. Als jedoch die Blicke des Prinzen immer zudringlicher wurden, geradezu dreist und abtastend, als er auch noch sein Bein in den engen Pantalons so empfehlungsreich nach vorne schob und seine Stimme so ein balzendes Tremolo bekam, änderte sie spontan ihr gesamtes Konzept, verwarf die Skizze, wischte mit dem Ärmel die Kreide von der Leinwand, begann noch einmal von neuem und sagte nur: »Drehen Sie bitte den Kopf zur Seite. Ihr Gesicht wirkt am besten im Halbprofil.« Damit blieb ihm nichts anderes übrig, als die Augen von ihr abzuwenden, und schon kehrte Ruhe ein.
Ihre Freundin hatte recht: Die Porträtwünsche waren nur ein Vorwand, sie kennenzulernen und mit ihr ins Gespräch zu kommen. Eine günstige Gelegenheit in bewährter Abfolge: Man bestellte sich die kleine Malerin ganz offiziell ins Haus, ließ sie ein bißchen was auf die Leinwand pinseln, anschließend darüber der schöne Plausch auf dem Sofa, Fortführung der Arbeit im Landhaus eines Verwandten und Übergabe im Bett. Aber so wie es jüngst bei Ann-Rosalie gelaufen war, ging es bei ihr nicht. Sie paßte auf. Nicht daß sie etwas gegen Verehrer gehabt hätte, im Gegenteil: Warum sollte sie auf diese Accessoires verzichten? Schließlich gehörten sie so sehr zum guten Ton, daß es fast schon unehrenhaft gewesen wäre, keinen Verehrer zu haben, aber in der Arbeit hörte der Spaß auf. Wenn sie damit ernstgenommen werden wollte, mußte das eine vom anderen strikt getrennt bleiben. Sie malte ja nicht, um sich vor einem Mann zu präsentieren und sich ihm zu empfehlen, um dann irgendwo als Hausschatz mit Kunstbegabung zu enden; sie malte, weil dies die Sprache war, in der sie sich am besten ausdrücken konnte. Über ihre Bilder konnten alle reden, gut und schlecht und was sie wollten, doch Betthoffnungen bediente sie nicht. Aber Aufträge deshalb abzusagen kam nicht in Frage. Goldknabe oder nicht – Kunde war Kunde, und der mußte zunächst mal beim Wort genommen werden. Sie traute sich schon zu, allem gewünschten Darüberhinaus gewachsen zu sein und den Ablauf in der Hand zu behalten. Sollte sie sich schaden, nur weil irgendwelche bedürftigen Herren sich etwas versprachen, was sie nicht erfüllen konnte? Da mußten sie sich schon anderswo umsehen. Es mangelte ja nicht an Angeboten. Allerdings nahm sie für Aufträge außer Haus ab sofort jedesmal ihre Mutter mit. Ohne Frau Jeanne betrat sie kein fremdes Haus. Sie half beim Bereitstellen der Malutensilien, auch beim Einrichten des Porträtplatzes und saß den Rest der Zeit wie eine leibhaftige Mahnwache im Raum, strickte Socken für den Sohn, damit der Liebling in den Hörsälen der Universität keine kalten Füße bekam und die gute Ausbildung ihm später einmal einen guten Posten brachte. Doch schon nach der dritten Sitzung blieb Liz bei dem bewährten Ausweg: Für diese tänzelnden Fechtmeister, die meinten, ihr imponieren zu müssen, wählte sie konsequent das Halbprofil – die Augen von ihr abgewandt. Maltechnisch nicht die schlechteste Lösung.