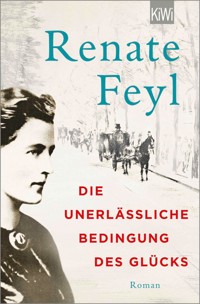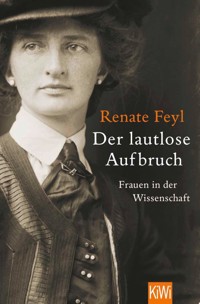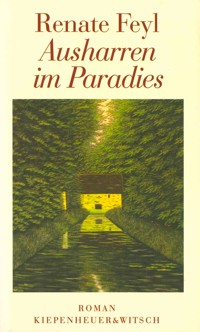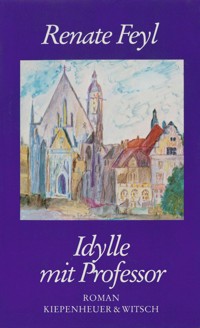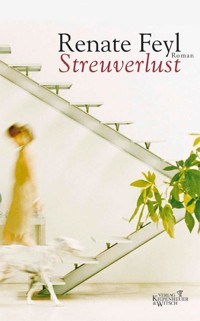
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Reichweiten des Erfolgs – Renate Feyl erzählt eine fesselnde Geschichte aus der Radiowelt Die Geschichte von Roland Zarth ist die Geschichte einer großen Passion: zu hören und gehört zu werden. Aus dem Hörmenschen wird ein Radiomacher, der alles daransetzt, seinen Sender zur Nummer eins zu machen. Was man braucht, um sich im Frequenzgewirr der Metropole durchzusetzen, gibt gleichzeitig Aufschluss über die Beschaffenheit unserer Zeit. Roland Zarth steht am Anfang einer viel versprechenden Karriere: Mit seinem Spartensender_ Taff_ hat er sich in kürzester Zeit etabliert. Der Aufstieg vom Geschäftsführer der Taunuswelle zum Akteur auf der Hauptstadtbühne prädestiniert ihn in den Augen seiner Geldgeber für Größeres. Er soll das defizitäre Metropolenradio zum Erfolgssender machen. Das heißt zum ersten Mal Vollprogramm, und dieser Aufgabe widmet sich Zarth mit ganzer Kraft. Was dies für seine Lebensgefährtin Vera bedeutet, die hin- und hergerissen ist zwischen ihrer eigenen Karriere als Innenarchitektin und dem tiefen Wunsch nach Familie und Kindern, zeigt Renate Feyls mitreißender und humorvoller Roman auf höchst anschauliche Weise. Renate Feyl wirft einen ironischen Blick hinter die Kulissen einer Welt, in der Erfolg alles gilt, schwarze Zahlen am hellsten leuchten und der Hit-Mix sanft die Werbeinseln umspült. Dieser Roman über den Leerlauf der Rotation zeigt die Verhältnisse, in denen wir leben. Eine staunenswerte Geschichte von einem Aufsteiger, der auch im Niedergang umstandslos zum Neubeginn ansetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Renate Feyl
Streuverlust
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Renate Feyl
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Renate Feyl
Renate Feyl, geboren in Prag, studierte Philosophie und lebt als freie Schriftstellerin in Berlin.
Weitere Werke der Autorin:http://bit.ly/1GiZWmG
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Geschichte von Roland Zarth ist die Geschichte einer großen Passion: zu hören und gehört zu werden. Aus dem Hörmenschen wird ein Radiomacher, der alles daransetzt, seinen Sender zur Nummer eins zu machen. Was man braucht, um sich im Frequenzgewirr der Metropole durchzusetzen, gibt gleichzeitig Aufschluss über die Beschaffenheit unserer Zeit. Roland Zarth steht am Anfang einer vielversprechenden Karriere: Mit seinem Spartensender Taff hat er sich in kürzester Zeit etabliert. Der Aufstieg vom Geschäftsführer der Taunuswelle zum Akteur auf der Hauptstadtbühne prädestiniert ihn in den Augen seiner Geldgeber für Größeres. Er soll das defizitäre Metropolenradio zum Erfolgssender machen. Das heißt zum ersten Mal Vollprogramm, und dieser Aufgabe widmet sich Zarth mit ganzer Kraft. Was dies für seine Lebensgefährtin Vera bedeutet, die hin- und hergerissen ist zwischen ihrer eigenen Karriere als Innenarchitektin und dem tiefen Wunsch nach Familie und Kindern, zeigt Renate Feyls mitreißender und humorvoller Roman auf höchst anschauliche Weise.
Renate Feyl wirft einen ironischen Blick hinter die Kulissen einer Welt, in der Erfolg alles gilt, schwarze Zahlen am hellsten leuchten und der Hit-Mix sanft die Werbeinseln umspült. Dieser Roman über den Leerlauf der Rotation zeigt die Verhältnisse, in denen wir leben. Eine staunenswerte Geschichte von einem Aufsteiger, der auch im Niedergang umstandslos zum Neubeginn ansetzt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2004, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © photonica/Neo Vision
ISBN978-3-462-30949-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Morningshow
Lifestyle
Werbeinsel
Wellness
Werbeinsel
Megamix
Werbeinsel
Late Night
Morningshow
Morningshow
Die ersten Gäste waren erschienen, und alles deutete darauf hin, daß der Brunch ein Erfolg werden würde. Die Türen zur Dachterrasse waren weit geöffnet. Eine Jazzkapelle sorgte für Stimmung, zwei Kellner kümmerten sich um die Bewirtung, ein dritter nahm den Ankommenden die Mäntel ab. Vera ging noch einmal durch die Räume und fand das Arrangement rundum gelungen. Die Event-Agentur hatte gute Arbeit geleistet und sich in jedem Detail an die Absprachen gehalten. Vera war zufrieden, denn darin stimmte sie mit Zarth überein – das große Ereignis sollte auch groß gefeiert werden: Taff, das Radio mit Charisma, schrieb seine erste schwarze Null. Der Sprung in die Gewinnzone war geglückt und der Weg zur Marktführerschaft geebnet. Lange hatte Zarth auf diesen Tag hingearbeitet, und nun war die kopernikanische Wende gekommen. Alle Mühe hatte sich gelohnt. Jetzt begann eine neue Zeitrechnung.
Der Raum füllte sich mit Freunden, Mitarbeitern und Förderern von Taff, die ihm alle gratulierten. Zarth war in Hochstimmung. Er genoß es, einmal nichts als Zustimmung und Lob zu vernehmen und in all seinen Entscheidungen bestätigt zu werden. Wenn auch im nachhinein, doch er hatte sich immer gesagt: egal wann, Hauptsache, irgendwann. Und jetzt war der Tag gekommen. Andere Radiostationen, die fast gleichzeitig mit ihm gestartet waren, dümpelten noch immer in den roten Zahlen dahin, er aber hatte vor der erwarteten Zeit seinen Sender nach oben geführt, ganz ohne Hörerkauf und Gewinnspiele. Das machte ihm in der Branche so schnell keiner nach. Jetzt brauchte er sich nicht mehr sagen zu lassen, wie gut seine Konkurrenten waren und was für großartige Reichweiten sie hatten. Jetzt hatte er bewiesen, daß er das richtige Gespür für die Wünsche der Hörer besaß. Ein Sender, der Gewinn brachte, sprach für sich selbst. Da mochte noch soviel hin und her, hoch und schön geredet werden, es zählte nur eins: War man im Minus, oder war man im Plus? Und er war im Plus, endlich im Plus. Nun mußte er sich nicht mehr um mangelnde Werbebuchungen sorgen. Taff war das Lieblingsradio der Szene und griffiges Kapital.
Doch auch sein Wechsel von der Provinz in die Hauptstadt erschien ihm in diesem Moment wie der Sprung ins Glück. Begonnen hatte Zarth in Dietzendorf bei einem kleinen Privatsender, aus dem unter seiner Leitung in kurzer Zeit die beliebte Taunuswelle wurde, die den Gesellschaftern einen schönen Gewinn abwarf. Vom Erfolg verwöhnt, investierten sie in der Hauptstadt das Geld in ein zweites Radio und beriefen Zarth zum Gründungsgeschäftsführer. Er hatte dem Radio den Namen »Taff« gegeben und bereits wenige Monate nach dem Sendestart vor dem Aus gestanden. Er beschwor die Herren der Taunuswelle, durchzuhalten, überzeugte sie, daß sein Konzept tragfähig war, und heute bekam er die Bestätigung.
Beschwingt begrüßte er die Gäste, von denen einige zu seinem engeren Kreis gehörten: Axel, der beliebte Frontmann von Shiva TV, der für Taff die Nachtschiene moderierte, und Leuschner, der Experte für Zeitgeist, der Trendkolumnen für mehrere Zeitungen schrieb, immer die Flöhe husten hörte und schon darum ein wichtiger Mann war. Besonders freute ihn, daß Möhl gekommen war, Staatssekretär Möhl, ein Mann, der ihn all seine Vorurteile gegen das Beamtentum vergessen ließ. Möhl sprach seit kurzem den Wochenkommentar für Taff und war auch auf anderen Sendern gefragt, denn er besaß einen feinen Humor, von dem Zarth meinte, daß er in Deutschland so selten gedieh wie in Schweden die Teestaude. Doch noch mehr schätzte er an Möhl die Nähe zur Politik. Auf die konnte ein Radiomacher nicht verzichten. Selbst sein Kollege Blumberg von Antenne 1 war heute erschienen, obwohl er genau wußte, daß er hier einen Konkurrenten treffen würde, gegen den er gerade prozessierte, weil der den Sender öffentlich als »Latrine 1« verunglimpft hatte. Überhaupt hatte niemand abgesagt, was Zarth zeigte, daß er derzeit hoch im Kurs stand.
Vera hatte auch nicht gerade einen Verliererberuf, aber nie hätte sie so leichthin 80 Leute auf die Beine gebracht. Jetzt wurde ihr wieder einmal bewußt, diese Medienmenschen hatten ihre ganz eigene Anziehungskraft. Sie waren zwar nicht klüger als andere, aber sie hatten es in der Hand, aus einem Niemand einen Jemand zu machen, und die Aura des Populären gab nun mal einen zusätzlichen Glanz. Es gefiel ihr, daß man sich um Zarth drängte, ja sie genoß es geradezu, denn in solchen Momenten bekam sie eine sinnlich-sichtbare Anschauung, wie wichtig und gefragt er war. Es schmeichelte ihrem Selbstbewußtsein und gab ihr dieses Gefühl von Steigerung, das sie so sphärisch machte, wie sie es nannte, so empfänglich für jeden Blick und jede körperliche Regung von ihm. Sie hatte immer einen Mann gewollt, der auch ihrer Reputation diente, einen Mann, den sie vorzeigen konnte und um den sie beneidet wurde.
Fast aufgeregt gab ihm Vera ein Zeichen, daß Schuchard gekommen war. Großunternehmer Schuchard besaß mehrere Autohäuser, zwei Baumärkte und eine Weinversandhandlung und war mit einer halben Million Jahresetat sein potentester Werbekunde. Zarth hatte nicht geglaubt, daß er kommen würde, und fühlte sich nun doppelt geehrt. Er eilte auf ihn zu, begrüßte ihn und seine Frau und geleitete ihn ins Zimmer. Die beiden Gesellschafter, die Herren der Taunuswelle, brauchte er ihm nicht vorzustellen. Schuchard kannte sie gut, denn er kam selbst aus der Region und hatte seinerzeit auf der Taunuswelle für das heutige Mutterunternehmen seine erste Werbung schalten lassen. Daß es ihn gleichfalls aus der Provinz in die Hauptstadt geführt hatte, darin sah Zarth eine Parallelität des Weges, die ihm über das Geschäftliche hinaus noch eine menschliche Verbundenheit mit ihm gab. Er freute sich, ihn mit Staatssekretär Möhl bekanntmachen zu können und Schuchard das Gefühl zu geben, nicht umsonst gekommen zu sein. Vera kümmerte sich sofort um seine Frau, denn auch sie sollte sich von der ersten bis zur letzten Minute wohl und als Vorzugsgast fühlen. Vera wußte aus eigener Erfahrung, daß ein guter Eindruck immer indirekt auf den Mann zurückwirkte. Allerdings vermied sie ganz bewußt ein Gespräch über das taffe Szeneradio, schon um zu zeigen, daß es noch andere Dinge auf dem Globus gab und sie neben Zarth ihre eigene berufliche Welt besaß und hier nicht weniger erfolgreich war. So etwas mußte gerade die Frau eines Unternehmers besonders gut verstehen, und so wandten sie sich den Graphiken zu, für deren Motive sich Frau Schuchard interessierte.
Vera hatte auch einige ihrer Architekturkollegen eingeladen. Allen voran Kuno, der gerne mit seinem höheren Alter, seinen 40 Jahren, kokettierte und sich als karriereresistent bezeichnete. Mit ihm arbeitete sie am liebsten zusammen. Er war zwar kein Mann großer Ideen, aber präzise und verläßlich in der Ausführung. Er kannte die Wohnung bereits, doch die übrigen Kollegen hatte sie eingeladen, um ihnen einmal vorzuführen, in welchem Umfeld sie sich bewegte. Erzeugte doch allein schon die Nähe zu Medien bei ihnen Respekt. Außerdem wollte sie vermeiden, daß man bei ihr und Zarth immer nur dieselben Leute traf.
Diesmal hatte sie sich noch etwas Besonderes einfallen und eine Aqua-Bar aufbauen lassen. Wasser war Trend, und wer im Trend lebte, gehörte zu den Gewinnern. Diskreter konnte auf Zarths Status nicht hingewiesen werden. Selbstverständlich ließ sie nur die feinsten und teuersten Wässer präsentieren. Wasser aus isländischen Gletschern, reinstes Regenwasser aus der australischen Wüste und natürlich in der eleganten blauen Flasche Tynant aus Wales, im türkisen Flacon Ten Degrees und für den kultischen Genuß das rare Wattwiler aus den Vogesen. Über dreißig verschiedene Wässer von bitter und süßlich bis felsig und salzig waren aufgebaut. Zufällig hatte sie in einer Illustrierten etwas über die höhere Bedeutung des Wassers gelesen und war froh, die kleine Gebrauchsphilosophie gleich zum besten geben zu können. Wasser – das alles durchströmende, verbindende Urelement. Eines zu allem, alles zu einem. Nippen am Universum. Aufnahme von Substanz. Und dann die Verwandlungen, die nur der Hochsensible wirklich zu genießen verstand: ein Schluck Tau, ein Schluck Reif, ein Schluck Schnee, ein Schluck Hagel. Und nicht zu vergessen, der symbolische Wert: Wasser, das allzeit Reinigende, Quell der Gesundheit und der Schönheit. Aqua Katharsis. Schließlich in der unscheinbaren 0,6-Liter-Flasche das Feinste vom Feinen, 7800 Tropfen Cloud Juice aus Tasmanien, Wolkensaft pur, der alles verwandeln konnte. Spätestens von da an, so hoffte sie, konnten die Gespräche in die Tiefe gehen.
Es ertönte ein Gong, und Zarth hielt eine kleine Ansprache. So etwas lag ihm. Die Stimmung erfassen und aus dem Augenblick handeln. Außerdem hatte er beim jüngsten Managerseminar gehört, daß dort, wo sich Menschen versammelten, auch immer ein paar Worte an sie gerichtet werden sollten. Das verband und schuf Gemeinsamkeit. Er hatte sich nichts zurechtgelegt. Die Worte mußten spontan kommen, ganz ungezwungen, und durften an keine der üblichen Sonntagsreden erinnern, deren Glaubwürdigkeit im allgemeinen gegen null tendierte. Er sparte weder mit Witz noch mit Anspielungen auf Gesetzgeber und Medienwächter, streifte, weil es die Branche beschäftigte, auch den Übergang vom Analogen zum Digitalen, den er in einer Eigenformulierung, auf die er ein wenig stolz war, als die Brücke vom Einfachen zum Vielfachen bezeichnete, und lüftete dann wie ein Magier die Zauberformel, das Geheimnis seines Erfolges, die drei großen C, von denen alles abhing: Content, Community, Commerce. Leichthin entwickelte er, wie das eine das andere bedingte und das andere aus dem einen folgte, als handle es sich um Gesetze der Natur, die es zu beachten galt, wenn man Hörer gewinnen wollte. »Content – das will ich hier doch einmal sehr deutlich unterstreichen – Content ist der Schlüssel. Ist Voraussetzung und Grundsubstanz, Ursprung und Ausgangspunkt: Content ist Inhalt. Nicht mehr und nicht weniger. Ohne Inhalt läuft gar nichts. Nur wer einen interessanten Inhalt besitzt, kann eine Community aufbauen, und wo eine Community ist, gibt es Commerce oder im Umkehrschluß: Es läßt sich kein Umsatz machen, wenn der Inhalt nicht stimmt und nichts rüberkommt. Die Technik ist zwar wichtig, doch der Inhalt ist mehr. Der Content birgt den Schatz. Ein moderner Hort der Nibelungen, um es poetisch auszudrücken. Wer ihn findet, dem gehört die Zukunft. Darum muß jeder überzeugte Radiomacher ein Schatzsucher sein, denn im Content liegt der Erfolg und mit dem Erfolg kommt das Geld und wo das Geld ausbleibt, mangelt es an Content.«
Im Raum herrschte plötzlich ungewohnte Stille. Kein Gläserklirren, kein Husten, kein Schurren, nur gespannte Aufmerksamkeit. Allen war anzusehen, sie wollten mehr von ihm hören, denn aus ihm sprachen Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Und nicht nur das: Aus ihm sprach durch Erfolg bestätigte Kompetenz.
Vera hatte nie daran gezweifelt, daß er zu den Menschen gehörte, denen im richtigen Augenblick auch das Richtige einfiel. Im stillen genoß sie ein bißchen, daß ihre Freundin Dorothee, die neben ihr stand, sich wieder einmal davon überzeugen konnte: Zarth war keine dieser glitzernden Mediengrößen, er war ein Mann mit Substanz. Dorothee, mit der sie zusammen studiert hatte, die inzwischen eine Galerie für Junge Kunst betrieb und wacker die Bürde einer alleinerziehenden Mutter trug, hatte ihr damals abgeraten, mit Zarth zusammenzuziehen. Hatte sie beschworen, ihre Wohnung nicht aufzugeben und ihre so glänzend gestartete Karriere nicht zu gefährden. Doch Vera lebte nun schon ein halbes Jahr mit ihm, ohne ihren Entschluß bereut zu haben. Sie kannte genug Frauen aus dem Kollegenkreis, die vergeblich einen Mann suchten, der ihrem Niveau entsprach. Sie hatte Glück gehabt und sah das nüchtern: Bedrohte Arten mußten gehegt werden.
Der Applaus war für sie das Signal, den Kellnern zu bedeuten, den Champagner zu reichen. Dem Koch, der mit seiner hohen weißen Mütze hinter dem Büfett wartete, gab sie ein Zeichen, sich noch einen Augenblick zu gedulden. Erst mußte auf Zarths Erfolg angestoßen werden. Die kleinen Rituale der Bewunderung sollte er an einem Tag wie heute schon voll genießen.
Plötzlich stand seine Tochter im Raum. Vor kurzem hatte Anja ihren 15. Geburtstag gefeiert und war mit Geschenken von Großeltern, Mutter und Vater überhäuft worden. Sie führte ihren Hund an der Leine, eine englische Bulldogge, ein prächtiges Exemplar mit faltenreichem Fell, massivem Kopf und Karpfenrücken; beeindruckend in seiner Erscheinung, aber ständig leidend. Vera hatte ihn eigens ins Zimmer gesperrt, weil dieses behäbige Tier immer dann zur Hochform auflief, sobald es von Menschen umringt war, und jeden freudig ansprang, was nicht unbedingt bei allen nur Begeisterung auslöste. Einige wollten das allerliebste Hundchen gleich streicheln, bückten sich und verschwappten den Champagner, andere hielten sich etwas verunsichert fern, Frau Schuchard wich aus, denn sie fürchtete zu Recht um ihre Strümpfe. Die Kellner balancierten nervös die Tabletts mit den Gläsern an den Gästen vorbei, Leuschner hielt als Zeitgeistheld tapfer still und ließ sich beschnuppern, und Blumberg wechselte mit den Herrn der Taunuswelle diskret ins Nebenzimmer, denn sie wollten keine Kratzer auf den Lederschuhen riskieren. Vera streifte Anja mit einem vorwurfsvollen Blick und hielt nach Zarth Ausschau, um ihn zu bitten, seine Tochter zu ermahnen, den Hund sofort wieder wegzusperren. Denn ob sie es Anja sagte oder nicht – sie hörte sowieso nicht auf sie, sondern nur auf ihre Mutter. Doch Exgattin Zarth war derzeit in Kanada. Anja genoß sichtlich ihren Auftritt, faßte die Leine kurz, ging an das noch nicht eröffnete Büfett und suchte quälend wählerisch nach einem Salatblatt. Der Koch reichte ihr verständnisvoll lächelnd ein Artischockenherz. Sie nahm es, lächelte ihm zu, warf wirkungsvoll ihr Haar in den Nacken, wohl wissend, daß die Augen der Gäste auf sie gerichtet waren.
Sichtlich beeindruckt von der Tochter des Hauses, schwebte der beliebte Frontmann von Shiva TV auf sie zu, küßte ihr die Hand und empfahl sich als Kavalier: »Ich bin der Axel von Shiva. Dem Sender für Esoterik und Kosmischen Tanz und stets auf der Suche nach einem schönen Gesicht.«
Anja ging zu Vera und forderte sie auf, ihr das schleimige Monster vom Hals zu schaffen. »Hast du Ron gesehen?« Nie hätte sie ihren Vater »Roland« genannt. Diesen Vornamen fand sie vermufft und provinziell und war stolz, daß ihre Namensgebung inzwischen allgemein akzeptiert wurde. Vera sagte nur: »Schaff den Hund aus dem Zimmer. Du siehst doch, er stört hier.« Doch Anja streichelte ihren Liebling, als sollte ihm Furchtbares zugemutet werden.
Obwohl Zarth dicht umringt war, fand Vera einen Moment, ihn an seine Vaterpflichten zu erinnern. Er beruhigte sie und meinte, sie sollte das nicht so streng sehen, junge Menschen hätten nun mal ein starkes soziales Empfinden, und dieser Hund mit seinem geselligen Wesen machte doch allen Freude. Dennoch nahm er Anja zur Seite und bat sie, darauf zu achten, daß der Hund keinen belästigte und niemandem zu nahe kam. Sie gab ihrem Vater einen Kuß, warf Vera einen triumphierenden Blick zu und mischte sich wieder unter die Gäste.
Zarth eröffnete das Büfett, an dem sich sofort eine Schlange bildete. Vera freute sich über die perfekte kulinarische Präsentation, für die zwar ein stattlicher Betrag gezahlt werden mußte, was sie aber gerne tat, wenn das Ergebnis stimmte. Sie achtete darauf, daß niemand allein herumstand und mit diesem trostlos leeren Partyblick in sein Weinglas starrte, sich edel abgehoben gab oder als geselliger Eremit gefiel, der bloß gekommen war, um zu demonstrieren, daß er mit all dem nichts zu tun haben wollte. Ihr ging es um die Atmosphäre, um das, was einen anwehen und tragen mußte und allem erst die richtige Dimension verlieh. In ihrem Hause sollten alle mit allen reden und jeder das Gefühl haben, vom anderen wahrgenommen und geschätzt zu werden. Gourmetpräsentationen wurden schließlich anderswo auch geboten. Daran waren ihre Gäste gewöhnt. Bei ihr gab es mehr, gab es Trüffel für das Ego, wie sie es nannte. Darum ließ sie jeden im Gespräch fühlen, wie wichtig und herausgehoben er war, gab ihm zu verstehen, daß er zwar gekommen war, um den Erfolg von Zarth zu feiern, aber doch selber im Mittelpunkt stand. Die strahlenden Blicke taten ihr gut. Mehr Komplimente für die Gastgeberin konnte es nicht geben. Niemand sollte sich langweilen oder mit dem Gefühl einer sinnlos vertanen Zeit den Brunch verlassen. Vor allem nicht seine Mitarbeiter, von denen er die drei wichtigsten eingeladen hatte. Vera handelte in bewährter Arbeitsteilung stellvertretend für Zarth und widmete ihnen ganz besondere Aufmerksamkeit, denn sie fand, ein Chef war gut beraten, wenn er sich seine Mitarbeiter als stille Sympathisanten erhielt. Brendel, sein Programmdirektor, der aus Schwerin stammte und seine Entwicklung als den wissenschaftlichen Weg vom Klassenkämpfer zum Spaßpartisan bezeichnete, war mit Dorothee so intensiv ins Gespräch vertieft, daß Vera sich zu Hassler und Raabe gesellte und mit seinem Marketing- und seinem Werbechef auf den gebrechlichen Zustand der Stadt zu sprechen kam. »Unsere Stadt hat kein Zentrum und kein Geld«, sagte Hassler. »Daraus läßt sich alles erklären.«
»Es war nie anders«, entgegnete Vera. »Schon meine Mutter hat immer gesagt: keine Strümpfe, aber Gamaschen.« Sie stimmten ihr zu: In dieser Stadt klafften Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Gespräche dieser Art weckten Interesse und schlossen keinen aus. Die Stimmung hätte nicht besser sein können. Die kleine Jazzkapelle kam gut an. Im Repertoire nichts Schrilles, genau das richtige zum Brunch.
Gut gelaunt ging Zarth auf Runke, den Chefredakteur der Programmzeitschrift Hörzeit zu, um ihn an das Versprechen zu erinnern, das Programm von Taff in seiner Zeitschrift abzudrucken. Sprach doch gerade nach einer solchen Bilanz alles dafür. War das Programm dort abgedruckt, bekam es am Markt einen ganz anderen Stellenwert, und die Leute aus der Werbewirtschaft konnten sehen, daß Taff, das Radio mit Charisma, zu den wichtigen Sendern gehörte, zu denen, die eine hohe Akzeptanz bei den Hörern besaßen und dafür im Ranking ganz vorne lagen. Er hatte sich eine Reihe von Argumenten zurechtgelegt, doch überraschenderweise sagte Runke: »Im kommenden Heft ist Ihr Programm im Blatt.«
Für Zarth ein Grund mehr zu jubeln, denn so etwas machte auch auf die Konkurrenten Eindruck. Leuschner, der kleine Zeitgeistwisperer, gesellte sich dazu, verfolgte eine Weile das Gespräch, wandte sich dann an Zarth und meinte leicht euphorisch: »Ich hab ja immer gewußt, Leute wie wir – geborene Hessen und Himmelsstürmer – sorgen hier demnächst für den richtigen Medienwind.«
Zarth reagierte mit einer lächelnd abwinkenden Handbewegung, denn er war an derlei Übertreibungen gewöhnt. Doch Leuschner erwiderte fast im Ton des Protestes: »Ja hast du denn noch nichts von deinem Glück gehört?«
Zarth sah ihn etwas irritiert an. Er wußte nicht, welches Glück es für ihn noch geben könnte, da sagte Leuschner mit wichtigtuerischer Miene: »Die Amerikaner suchen für ihr Metropolenradio einen neuen Geschäftsführer, und du bist im Gespräch. Dein Name wird hoch gehandelt.«
Das allerdings war eine Überraschung. Eine Nachricht, die Zarth traf, die auf ihn einhieb und alles, was im Moment so geordnet und überschaubar erschien, jäh durcheinanderwarf. Er gab sich Mühe, weder verwirrt noch verdutzt zu erscheinen, schon um zu zeigen, daß es nichts geben konnte, was er nicht bereits wußte. Darum versuchte er, Leuschners Mitteilung fast gleichgültig als das branchenübliche Geschwätz abzutun. Doch gleichzeitig fühlte er eine innere Unruhe aufkommen, die sich nur schwer unterdrücken ließ. Vieles ging ihm plötzlich durch den Kopf. Selbst wenn es sich um ein Gerücht handeln sollte, so wußte er doch aus Erfahrung, daß solche Gerüchte nie grundlos in die Welt gesetzt wurden. Natürlich hatte auch er davon gehört, daß das Metropolenradio mit seinem wortlastigen Programm aus der Verlustzone funkte. Aber daß die amerikanische Investorgruppe ausgerechnet ein Auge auf ihn werfen könnte, daran hätte er nie gedacht, zumal er ja nur einen Spartensender zum Erfolg geführt hatte. Metropolenradio dagegen hieß Vollprogramm. Wie oft hatten ihm Werbekunden die große Buchung mit dem Hinweis verweigert, daß Taff kein Vollprogramm, sondern nur ein Spartenradio sei. Ein Vollprogramm hatte ohne Frage ein anderes Gewicht, vom höheren Budget ganz zu schweigen. Er wagte nicht, diesen Gedanken weiterzuverfolgen, sondern zwang sich zur Ernüchterung. In der Radioszene wurde viel gemunkelt, und ständig kursierten neue Namen: heute hoch im Kurs und morgen schon vergessen. Die Halbwertszeiten der Geschäftsführer verkürzten sich rapide.
Irgendwie genoß Zarth diese innere Unruhe aber auch, und es schien, als würde allein die Kenntnis dieser Information ihm einen zusätzlichen Auftrieb geben. Nicht irgendeiner – sein Name war im Gespräch. Ihm, keinem anderen traute man offenbar die Leitung eines Metropolenradios zu. Das war mehr als ehrenvoll. Auch wenn sich diese Nachricht als Blindgänger erweisen sollte – eine bessere Werbung für ihn gab es nicht. In seiner Branche kam es darauf an, ständig im Gespräch zu sein. Wer im Gespräch war, empfahl sich als Leistungsträger. Wenn das die Herren der Taunuswelle erfuhren, gaben sie sich vielleicht sogar einen Ruck und legten endlich mal bei seinem Jahreseinkommen zu. Was immer hinter den Kulissen geraunt wurde – es konnte nur zu seinem Vorteil sein. Selten hatte er sich so gut gefühlt, denn es bestätigte sich ihm erneut: Die wirklichen Akteure hatten ihre eigenen Gesetze, und eines davon hieß: Erfolg bringt Erfolg.
Vergnügt beobachtete er Vera, die das kleine Damenprogramm absolvierte, Frau Schuchard nicht von der Seite wich und all die Aqua-Nixen wie einen Zirkel der Emanzipierten um sich scharte. Er fand, mit ihrem beachtlichen diplomatischen Talent hätte Vera mindestens Botschaftergattin oder Generalkonsulin werden sollen. Überhaupt bewunderte er die Leichtigkeit, mit der sie die gesellschaftlichen Dinge bewältigte, und fragte sich, wie ihr das neben dem Beruf noch gelang, der sie ja auch nicht gerade wenig in Anspruch nahm. Es war jetzt nicht der Augenblick, darüber nachzudenken, aber er schien sich sicher, daß sie im Gegensatz zu ihm ein spielerisches Verhältnis zur Welt besaß. Ohne sie, das machte ihm ein solcher Anlaß wieder einmal spontan klar, wäre er verloren gewesen.
Er paßte einen geeigneten Moment ab, nahm sie kurz zur Seite und sagte nur: »Sollte das Gespräch auf das Metropolenradio kommen, dann hör genau hin und merk dir die Namen, die in diesem Zusammenhang fallen. Da ist was am Kochen.«
Vera hätte gern mehr darüber erfahren, doch da kam Anne auf sie zu, Dr. Anne Gerhard, ihre Rechtsanwältin, mit der sie stets die Honorarverträge durchsah und die vor kurzem ihr Rigorosum magna cum laude bestanden hatte. Die kleine tüchtige Anne war immer auf der Suche nach einem kapitalen Mandanten und immer in der Hoffnung, daß sich einer in sie verlieben würde. Vera konnte das gut verstehen, denn Anne war mit ihren dreißig Jahren auch nicht mehr die Jüngste und hatte wenig Lust, den Rest ihres Lebens mit schönen Betrachtungen über die Liebe zu verbringen. Leider trug sie auch heute wieder ein Kostüm von Jil Sander, das sie nicht gerade vorteilhaft ins Bild setzte. Dieses Schmalschultrige, Fipsige, Fadgraue und Triste ließ sie ältlich erscheinen, und die Jacke mit dem spärlich ausgefransten Krägelchen machte sie zu einer letzten Versprengten der 50er Jahre. Anne schwor zwar auf die Nobelmarke, aber Vera begriff nicht, wie man soviel Geld ausgeben konnte, um nach nichts auszusehen. Doch das Äußere war vergessen, sobald Anne zu sprechen begann. Ihre Art, alles in juristische Begriffe zu zerlegen, um dann dem verblüfften Gegenüber die ganze Welt als gültiges Urteil zu präsentieren, faszinierte. Anne erkundigte sich leicht amüsiert nach dem Typ, der das Büfett wie den Himmel durchmusterte.
»Staatssekretär Möhl«, entgegnete Vera. »Spricht seit kurzem den Kulturkommentar für Taff. Kennt Gott und die Welt. Dem solltest du unbedingt deine Visitenkarte geben.« Vera paßte einen geeigneten Moment ab und machte Frau Dr. Anne Gerhard mit Thomas Möhl bekannt. Um sich juristisch kompetent einzuführen, sprach Anne ihn gleich auf den neuen Rundfunkbegriff an, doch der Herr Staatssekretär sah aufs Büfett, schilderte die Vorzüge der Olivenpastete, belud seinen Teller, riet ihr, gleichfalls zuzulangen, und wich während des Brunches nicht mehr von ihrer Seite.
Besonders bemerkenswert fand Vera, daß Zarth sie den Gästen, die sie heute zum ersten Mal sah, als »meine Frau« vorstellte. Dieses »Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen?« hörte sich ungewohnt an und so, als läge darin ein doppelter Stolz auf sie. Offenbar zeigte sich in dieser Art von Besitzanzeige das Barometer seiner Zufriedenheit. »Meine Frau.« Sein kleines Dankeschön. Es sollte wie eine Auszeichnung klingen. Sie sagte nichts, widersprach dem aber auch nicht, tat, als hätte sie es nicht gehört, lächelte ihrem Gegenüber zu und schien ob dieser Bezeichnung eher etwas verlegen. Verheiratet waren sie nicht, und irgendwie hatte dieses verbale Bekenntnis in diesem Augenblick auch etwas Karitatives für sie, so als wollte er seine ganze Fürsorge geltend machen, ihr etwas Gutes tun und einen höheren Status geben. Sie wußte schon selber, wer sie war. Innenarchitektin Vera Pflüger. Das war das Basisformat. Die verläßliche Form. Alles andere kam dazu oder nicht dazu. Allerdings verriet ihr diese Art der Vorstellung insgeheim den Wert, den er dem eheamtlichen Status zuordnete. Erst in dieser Fassung, so schien es ihr, war sie ihm näher als nah, war identisch nah, und das ließ tief in sein Innerstes blicken.
Zarth gesellte sich von einem zum andern, freute sich über die zufriedenen Gesichter und hoffte im stillen, vielleicht zufällig doch noch diese oder jene Information über das Metropolenradio zu erhaschen, aber mit wem er auch sprach – es war von Taff und nichts als den großartigen Umsatzerwartungen die Rede. Er winkte Anja zu sich und war selbst ein wenig erstaunt, wie souverän sie den Hund zu führen verstand. Gerade das bestätigte ihn in der Meinung, den Kindern nicht zuviel hineinzureden, sondern sie gewähren zu lassen. Es war ihm anzusehen: Er zeigte sich gern mit seiner Tochter. Nicht etwa, um die familiäre Harmonie zu demonstrieren oder weil eine schöne junge Frau an der Seite eines Medienmannes fast schon zum Berufsdress gehörte, sondern um seine Nähe zur Jugend zu demonstrieren, die schließlich zur Kernzielgruppe seines Senders gehörte. 14–24, Trendkäufer. Nähe zur Jugend bewies Kompetenz, und die Insider sollten sehen: Gründungsgeschäftsführer Zarth kannte sich aus in seiner Zielgruppe. Nicht umsonst hatten die 14- bis 24jährigen in seinem Sender eine Radioheimat gefunden, und die letzten Quick Votes hatten es bestätigt: Hörverweildauer steigend. Das sollte ihm die Konkurrenz erst mal nachmachen! Doch die Gegenwart seiner Tochter tat ihm auch darum gut, weil sie jetzt einmal sah, wie er gefeiert wurde und welche Anerkennung er für sein Radio bekam. Er zweifelte nicht daran, daß sie jedes Detail postwendend ihrer Mutter am Handy mitteilen würde. Ihm war es recht, denn Inge hatte ihm ja nie etwas zugetraut.
Voller Genugtuung kündigte er Schuchard an, daß Taff seinen Platz in der großen Programmzeitschrift erhalten werde. Schuchard sollte sehen, daß er seine Investition ins Programm nicht umsonst getätigt hatte. Nun konnten sie mit weiteren Hörerzugewinnen rechnen. Schuchard trank ihm zu. »Wenn es soweit ist, denke ich mal darüber nach, meine Buchungsraten zu erhöhen«, sagte er. Solche Sätze waren Musik in den Ohren eines Senderchefs, die köstlich nachhallten, denn sie bestätigten den Aufwärtstrend.
Während Zarth mit Anja zur Aqua-Bar ging, flüsterte ihm Vera zu, von Axel hatte sie eben gehört, daß im Sender schon von den Plänen der Amerikaner gesprochen wird. Zarth fragte sich zwar, warum an seinem Ohr der Flurfunk stets vorüberging und andere die Gerüchte offenbar immer um Wellenlängen früher erfuhren, wollte aber nicht weiter darüber nachdenken, sondern nahm nun auch Vera in den Arm. Die beiden Frauen waren Glückstreffer, zwei absolute Glückstreffer. Er hatte ja schon oft zum Brunch geladen, aber keiner war so gelungen wie dieser. Ein Sunshine-Morning mit Sunshine-Feeling. Einen Augenblick gesellte er sich zu den Jazzern, schaute ihnen zu, summte mit und schaltete unbemerkt sein Handy wieder ein. Eigentlich wollte er es ausgeschaltet lassen, weil es an einem Tag wie heute nichts Wichtiges mehr geben konnte. Doch nun war Zarth auf Steigerung gestimmt und hatte das Gefühl, es könnte noch Großes kommen.
Bei einer Ausstellung über Stadtentwicklung hatte Vera ihn kennengelernt. Er hatte neben ihr gestanden, zufällig waren sie ins Gespräch gekommen und hinterher noch auf einen Drink gegangen. Anschließend fuhr er sie nach Hause, blieb die ganze Nacht, und am nächsten Tag zog er mit seiner Dolby-Digital-Musikanlage bei ihr ein. Seine Entschlossenheit war beeindruckend. Vom ersten Tag an hatte sie gespürt: Zarth liebte das Risiko. Das gefiel ihr. Von den anderen, den Tränen, wie sie es nannte, hatte sie genug: Unselbständige Männer, die ihre Nähe gesucht hatten, um an ihrem Unternehmungsgeist zu partizipieren, und sie dabei in allem bloß reduzierten – nein, das war nichts für sie. An Zarths Seite dagegen ließen sich positive Energien aufbauen. Allein schon die Gewißheit, nicht eingeengt zu werden, verdoppelte den Elan und gab all ihren Vorhaben wie von selber Struktur. Anders hätte sie das Berufliche mit dem Privaten wohl auch nicht so mühelos verbinden können.
Allerdings war sie durch ihn auch ganz unerwartet in komfortable Verhältnisse geraten. Zweimal in der Woche kam die Putzfrau; Einkaufen und Kochen erübrigte sich. An den Wochenenden gingen sie essen, und sonst bestellten sie rasch bei Giovanni, dem Italiener an der Ecke, eine Lasagne oder einen Salat. Meist genügte ein Anruf, und Augenblicke später wurde geliefert. Ohne Frage, der finanzielle Komfort erleichterte vieles und machte sie doppelt beweglich. Nicht daß sie etwa einen Hang zu Verschwendung und Luxus gehabt hätte, aber die neue Situation gab ihr auf einmal beruflich ein Gefühl der Unabhängigkeit. Fiel ein Auftrag aus, stürzte sie nicht gleich in ein finanzielles Desaster, sondern konnte das Ganze gelassen angehen und sich als Freiberufliche sogar auch mal leisten, einen Auftrag abzulehnen und den großen Chefs im Architektenbüro zu demonstrieren, daß sie es nicht nötig hatte, im letzten Hühnerstall das Konzept vom ganzheitlichen Wohnen zu verwirklichen. Zarth gab ihr zusätzlich einen finanziellen Rückhalt, was sie als einen großen Gewinn empfand. Nein, er war mit den anderen nicht zu vergleichen. Dachte sie an ihren letzten Freund, kam er ihr geradezu wie eine Lichtgestalt vor. Seine ganze Energie hatte der Typ darauf verwandt, sich ihr gegenüber wie eine Hausfrau aufzuspielen und sie zu belehren, mit dem Geld stets so umzugehen, daß jede Ausgabe das Doppelte einbrachte. Immer war er auf ein Schnäppchen aus, jagte nach Rabatten, zog aus Sonderangeboten seinen Lebensgewinn und wäre am liebsten noch mit der S-Bahn bis zur Endstation gefahren, damit das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte.
Zarth war glücklicherweise ein ganz anderes Kaliber, stand haushoch über allen, besaß drei Kreditkarten und war ausgesprochen spendabel. Inzwischen trug sie von ihm einen Memoirering, sieben Brillanten, Top Wesselton, lupenrein – eine nette Geste der Zugehörigkeit. Ihre Honorare gingen so, wie sie kamen, auf ihr Konto respektive in festverzinsliche Wertpapiere. Von seinem Geld lebten sie und bestritten alle Unkosten. Eine Aufteilung, die sie sich besser nicht denken konnte. Der Gleichberechtigung wegen schlug sie ihm allerdings vor, sich zur Hälfte an der Miete zu beteiligen, und war fast ein wenig enttäuscht, daß er das Angebot annahm. Doch günstig blieb es für sie allemal. Ob es sich um tägliche Ausgaben oder größere Anschaffungen handelte – nie rechnete er mit, nie rechnete er nach. Er fragte auch nicht: War das nötig, sondern freute sich immer nur über den Effekt. Sie fand es hinreißend, daß er ein so pragmatisches Verhältnis zum Geld besaß. Geld war kein Wert an sich für ihn. Geld kam, Geld ging, floß zu, floß ab, eine bewegte Materie, die der Zirkulation der Kräfte diente. Nicht mehr und nicht weniger. Doch über allem stand sein Ansehen. Er war wer und bedeutete vielen was. Das machte sie sinnlich, mitunter auch stolz. Mit ihm hatte sich das Blatt für sie gewendet, denn mit einem Mal führte sie ein Leben auf Guthabenbasis. Alles, was kam, kam dazu, und das genoß sie.
Längst hatte sie das Gefühl, in den Dingen jenseits des Radios die Führung übernommen zu haben. Mehr noch: Ganz unbemerkt glich sie bei ihm gewisse Defizite aus. Er besaß nun mal keinen Geschmack, und es ließ sich auch nicht leugnen, daß ihm jeglicher Gestaltungssinn fehlte. Sie empfand dieses Manko als äußerst vorteilhaft, denn hier konnte sie ihre Talente voll zur Geltung bringen: Ohne Zweifel, sie brachte Stil in sein Leben. Durch sie hatte er überhaupt erst eine Vorstellung von dem bekommen, was schön war; eine Ahnung von den angenehmeren Seiten des Seins. Wäre er ihr nicht begegnet, hätte er wohl noch heute in seinem dürftigen Appartement gesessen und sich mit dem Schlichtesten vom Schlichten begnügt: Tisch, Stuhl, Schrank, Bett. Karge Landschaft. Null Ambiente.
Auf ihren Rat hin hatten sie ihre Wohnung aufgegeben, und er hatte die Dachterrassenwohnung in bester Citylage und ganz in der Nähe des Senders gemietet. Lieber wäre er in einen Loft gezogen, weil, wie er scherzhaft meinte, sich in der Größe der Räume die eigene Größe besser ausschreiten ließ, doch so sehr sie sich auch darum bemüht hatte, die Lofts waren belegt. Allerdings war ihnen ein Haus recht preiswert angeboten worden, aber mit Eigentum wollte er sich nicht belasten. In seiner Branche mußte man beweglich bleiben und jederzeit in der Lage sein, die Zelte wieder abzubrechen. In der neuen Wohnung war sie endlich zu dem ersehnten großen Arbeitszimmer gekommen und hatte keinen Aufwand gescheut, um alles so einzurichten, daß es seinem Status entsprach. Ob er wollte oder nicht, aber als ein Mann der Öffentlichkeit zählte er zu den Geschmacksträgern, die im Blickfeld standen, und ab einer bestimmten Gehaltsklasse – das wußte sie von ihren Auftraggebern – war Wohnen nicht schlechthin wohnen, sondern die Präsentation des beruflichen Erfolgs. Darum mußte die Wohnung seinem Lebensentwurf entsprechen, mußte Großzügigkeit und Weite haben, alles mußte bis in den letzten Winkel durchschaubar, alles geräumig, hell und gläsern demokratisch sein. Sie hatte ihm auch ein kleines Online-Séparée eingerichtet, einen Raum, in dem er in seinen freien Stunden sich in die Welt hinausklickte, ins Netz ging, wie er es nannte, und die Internetradios wie Feindsender abhörte.
Zarth war begeistert. Er übernahm nicht nur Veras Geschmack und Stil, sondern gab ihn als seinen eigenen aus und gestand ihr, sich nirgendwo so wohl zu fühlen wie zu Hause, bei seiner Nestbauerin. Ohne Frage, er war glücklich, sie getroffen zu haben. Er brauchte eine Frau, die die Dinge in die Hand nahm und der er vor allem nicht erklären mußte, was der Beruf für ihn bedeutete: von Montagmorgen bis Sonntagnacht seine Bestimmung, seine Leidenschaft, sein Fieber. Nicht daß er sich zu frühkindlichen Analysen versteigen wollte, aber seine Sinne waren von Anfang an aufs Hören gerichtet. Schon in der Schule hatte er alles Wichtige beim Zuhören gelernt. Was er nicht hörte, behielt er nicht im Gedächtnis. Zuhören machte für ihn alles lebendig. In der Uni arbeitete er gleich im Campusradio mit, war voller Enthusiasmus mit dem Mikro unterwegs und entdeckte dabei noch etwas anderes, das seinen Sinn für das Hören weit überstieg: Das Radio gab ihm Öffentlichkeit, und mit der Öffentlichkeit konnte er eingreifen in den Gang der Dinge. Es blieb nicht beim Interpretieren, er konnte verändern. Raus aus den Büchern und rein in die Welt. Dabeisein, mitgestalten und die Gesetze der Trägheit überwinden – das entsprach seiner Natur so sehr, daß er fest davon ausging, mit einem Sendungsbewußtsein geboren zu sein. Die Message war in ihm. Glücklicherweise mußte er kein einziges Wort darüber verlieren, denn Vera begriff vom ersten Tag an: Ohne Radio konnte er nicht Zarth sein.
So angenehm das Leben mit ihm auch war, seit Anja bei ihnen wohnte und auch noch ihren Hund mitgebracht hatte, war es für Vera schwieriger geworden. Zwar wußte sie, daß man sich bei geschiedenen Männern auf so manches einstellen mußte, und hatte auch bei Zarth mit etlichem gerechnet, aber doch nicht damit. Schließlich hatte Inge bei der Scheidung alles darangesetzt, daß er kein Sorgerecht bekam. Doch als sich ihr dann überraschend eine Karriere in Kanada bot, erinnerte sie sich plötzlich wieder an ihn. Anja sollte die Schulausbildung in Deutschland erst beenden, bevor sie zu ihr kam. Vera hatte sich geärgert, daß Zarth nicht den berechnenden Zug erkennen wollte, sondern ganz euphorisch war und es als ein Geschenk des Himmels betrachtete, seine Tochter bis zum Abitur bei sich behalten zu dürfen. Doch was hieß bei sich! Vera war schließlich diejenige, an der alles hängenblieb. Zwar brauchte sie seinem kleinen Engel nicht jede Stunde ihrer freien Zeit zu opfern, aber Anja war verwöhnt und mäkelte an allem herum. »Drei Leute und ein Badezimmer! So was kenn’ ich gar nicht. Ein echter Tiefstand. Voll kraß.« Mehrmals in der Woche bekam Vera diesen Vorwurf zu hören und wußte natürlich, worauf er zielte. Anja ließ keine Möglichkeit aus, um darauf hinzuweisen, aus welch gutem Hause sie kam. Sie begriff einfach nicht, wie sich ihr Vater mit diesem dürftigen Domizil abfinden konnte, und fand es eine Zumutung, ein Gemeinschaftsklo benutzen zu müssen.
Statt ihr gehörig die Meinung zu sagen, tröstete er sie voller Verständnis und meinte fast entschuldigend, wichtiger als zwei Bäder in der Wohnung sei im Zeitalter der Information die Kommunikationskultur. Stolz verwies er auf Computer, Laptops, Notebooks, ISDN-Anschluß mit Mobiltelefonen, den ganzen Hightech-Kram, der sie Tag und Nacht mit der Welt kommunizieren ließ – wo gab es das schon? Außerdem besaß jeder von ihnen sein Handy nebst dem ganz eigenen Klingelton, mit dem er sich auf dem Handy des anderen zu erkennen gab und vom Rest der Welt abhob. Zarth hatte sich für die Reveille entschieden, eine spielerisch forsche Marschmelodie, Vera für die Fuga, einen klassisch unaufgeregten Ruftontyp, und Anja für den Mosquito, ein so schrilles Läuten, daß es fast einer Körperverletzung gleichkam. Untereinander voll vernetzt sein – was wollte sie mehr!
Nicht daß Vera etwas gegen das verwöhnte Kind gehabt hätte und mit Anja schlecht ausgekommen wäre, im Gegenteil: Sie gehörte zu den vernünftigen Vertreterinnen ihrer Generation, färbte sich die Haare nicht grün, ließ sich keine Tattoos setzen und lehnte das Piercing ab. Daß sie gern zur Schule ging, war auch keine Selbstverständlichkeit, und es machte Vera Spaß, mehrmals in der Woche gemeinsam mit Anja zu zeichnen. Ärgerlich war etwas ganz anderes: Was immer gesagt wurde – jedes Wort trug sie ihrer Mutter hin. Alles wurde brühwarm berichtet. Stundenlange Gespräche am Handy, und die Rechnung bezahlte der Papa. Inge hinterm Ozean war immer dabei. Inge war über alles im Bilde und wußte über jeden Schritt Bescheid. Nichts, was in dieser Wohnung vor sich ging, blieb ihr verborgen. Es störte Vera, daß Zarth ihr das überhaupt zumutete, ja mehr noch: daß er es gar nicht als Störung empfand. Vielmehr sprach er, seit Anja im Haus war, von ›seiner Familie‹. Vera fand zwar, daß er auch hier wieder einmal leicht zur Übertreibung neigte, denn sie hatte gewisse andere Vorstellungen davon, aber sie ließ derlei Zuordnungen unwidersprochen, schon um das Gefühl des Zusammenhalts nicht zu mindern.
Seit Stunden hielt sich Vera in der Büroetage auf, um den Fortgang der Arbeiten zu kontrollieren. Sie erwartete das Prunkstück der Ausstattung, den Chefsessel. Das Architektenteam, mit dem sie seit einiger Zeit eng zusammenarbeitete, hatte dieses Hochhaus entworfen und gebaut, und von ihm hatten sie und vier Kollegen den Auftrag erhalten, die Etage im 15. Stockwerk auszustatten. Jeder hatte einen Raum zu gestalten und dafür ein eigenes Konzept entwickelt, das den Wünschen des Auftraggebers Rechnung trug: Nicht das übliche genormte Dienstgrau sollte es sein, sondern ein Büro, das sich von anderen Büros deutlich unterschied. Vera sollte sich für die Raumgestaltung von der Philosophie des Feng Shui leiten lassen. Zuerst wußte sie damit nichts anzufangen, denn um Moden kümmerte sie sich nicht, aber andererseits hatte sie keine Auswahl in den Aufträgen und mußte nehmen, was kam. Doch je länger sie sich mit der Materie befaßte, desto vertrauter wurde sie ihr, und inzwischen hatte sie von allem eine so klare Vorstellung, daß sie sich selber getragen fühlte von den unsichtbaren Strömen der Energie, die nie verlorenging.
So wie sich ein Fluß durch die Landschaft schlängelte, sollte die Energie frei durch die Räume schwingen und dem Chi, der Lebenskraft, Eintritt gewähren. Keine sperrigen Gegenstände, keine Tischkanten, keine dunklen Ablageecken durften ihr den Weg versperren. Vera achtete darauf, daß selbst der Teppichboden mit seinem Flor so lag, daß man nicht gegen den Strich in den Raum hineinlief. Die Energie mußte zum Arbeitsplatz, dem Kraftort, gelenkt werden, und leuchtende Farben, Farben des Yang, sollten sie aktivieren. Vera hatte sich für Rot entschieden. Im Rot floß alles zusammen: Licht und Sonne, Feuer und Wärme, und sie war sich ganz sicher: Das Leuchten des Rots hellte die Gemütskräfte auf und stärkte die Leistungslust. Keine andere Farbe war für das Büro so geschaffen. Statt der üblichen Graphiken hatte sie gegenüber dem Schreibtisch eine Videowand installieren lassen, auf der nichts anderes zu sehen war als ein vom Wind bewegtes Mohnfeld. Vera setzte sich an den Schreibtisch, sah auf das Bewegtbild und war zufrieden. Der dunkle Glanz des Scharlach illuminierte den Raum, und es war zu spüren, wie aus dem flammenden Rot eine Energie kam, die sich bis in den letzten Winkel verströmte. Ganz versteckt hatte sie eine Ruhezone eingerichtet und, um Mißverständnissen vorzubeugen, in der Konzeption nicht von Ruhezone, sondern bürogerecht vom Lazy-Working-Bereich gesprochen. In seinem Zentrum, abgewandt von den Aktenschränken, hatte sie einen Liegesessel aufstellen lassen und ihm einen schwenkbaren Computertisch mit ausziehbarer Tastatur zugeordnet, die sich in jeder Lage bequem bedienen ließ. Alles war so angeordnet, daß auch von hier der Blick direkt auf das windbewegte Mohnfeld fiel und die Farbe des Yang ihre volle Wirkung entfalten konnte.
Vera sah der Abnahme zuversichtlich entgegen. Sie war sicher, daß ihr Feng-Shui-Büro den Wünschen des Auftraggebers entsprach. Sie fand, der Raum hatte Atmosphäre, und wo es Atmosphäre gab, gab es Energie, und wo die Energie floß, ließen sich aktive Kräfte bündeln. Dafür hatte sie ohnehin einen Sinn, und sie spürte von Mal zu Mal, daß das Ganze ihr nicht nur Spaß machte, sondern ihrem Wesen entsprach, denn sie war ein osmotischer Typ und empfänglich für das Verborgene.
Der Chefsessel wurde geliefert, und sie atmete auf, denn er war das dominierende Objekt. Wochenlang war sie unterwegs gewesen, bis sie dieses Modell gefunden hatte. Die Männer packten ihn aus, und plötzlich sah sie, daß die Farbe nicht stimmte. Sie hatte die Katalogposition 540, Rubinrot, bestellt, geliefert wurde in der Position 549, Ziegelrot. Eine unglaubliche Schlamperei. Sie geriet außer sich. Die Handwerker feixten und verstanden ihre Aufregung nicht. Sie hielten sie sichtlich für überspannt und fragten, wo das Problem lag. Doch Rot war eben nicht gleich Rot. Zwischen Rubin und Ziegel lagen Welten. Gerade in ihrer Konzeption ging es um die Farbe. Erst die richtige Farbe gab die richtige Wirkung. Wenn die Farbe nicht stimmte, schimmerte und funkelte das Ganze nicht. Nie hätte sie dieses fahle, blasse, verblichene Ziegelrot gewählt, das an nichts als ausgespülten Waschbeton erinnerte, ohne Wirkung und ohne Effekt war. Aus dem Rubinrot dagegen kam ein heißer, sinnlicher Ton und so viel Licht, daß es die Schwingung des windbewegten Mohnfeldes aufnahm und die Freude der Wahrnehmung steigerte. Aber das verstanden diese Teppichbodenleger nicht.
Sofort rief sie bei der Firma an, wurde mit dem Auslieferungslager verbunden, ließ sich den Chef geben, regte sich kolossal auf, daß nicht einmal mehr die einfachsten Dinge klappten, dreifarbige Begleitscheine und dahinter nichts als Schlamperei, unfähig, die richtige Zahl zu schreiben, zu bequem, das Kreuz an die vorgegebene Stelle zu setzen, die Gedanken immer woanders und immer im Sonnenschein – und nun diese Misere! Sie bestand darauf, daß in spätestens zwei Tagen der Sessel in der bestellten Farbe geliefert wurde. »Wie Sie das organisieren, ist nicht meine Sache«, sagte sie, »bei diesem Auftragsvolumen kann ich doch wohl Zuverlässigkeit erwarten!« Die andere Stimme gab kleinlaut bei. Vera legte wütend den Hörer auf und forderte barsch, ihr dieses Ziegelrot aus den Augen zu schaffen. Plötzlich klingelte ihr Handy. Ausgerechnet die Reveille! Sie sagte Zarth, daß er später anrufen sollte, weil im Moment alles schieflief, weil man sich auf niemanden mehr verlassen konnte, alles nur noch Husch und Pfusch war und weil dahinter ein Prinzip lag, und was hieß Prinzip, nein, viel mehr, es war dieses elende Gesetz von der ständig steigenden Wurstigkeit, doch er fiel ihr ins Wort und sagte: »Ich bin Chef vom Metropolenradio! In drei Stunden fliege ich nach New York. Sei so gut, pack ein paar Sachen zusammen, und bring mir den Koffer zum Flughafen. Ich warte in der Lounge am Gate acht.«
Es war wieder einmal typisch. Immer kam bei ihnen alles Wichtige gleichzeitig. Nichts verlief in einem überschaubaren Nacheinander. Es wäre ja ein Wunder gewesen, wenn sie einmal ganz ungestört hätte arbeiten können. Sie sah zur Uhr. Ein paar Minuten blieben ihr noch. Sie sagte den Handwerkern, daß sie kurz einen Außentermin wahrnehmen müsse, und gab noch ein paar Anweisungen. »Meine Handynummer haben Sie, also rufen Sie an, wenn es Fragen gibt.« Dann eilte sie zum Auto und raste los.
Zu Hause setzte sie sich einen Augenblick still in den Sessel und überlegte, in welche Situationen Zarth wohl kommen könnte. Kurz darauf sprang sie auf und packte all das ein, was für hochrangige Besprechungen nötig war: Anzug, Hemd mit Haifischkragen und Doppelmanschetten, Ledergürtel, dunkle Schuhe, zum Wechseln zwei seiner Boss-T-Shirts und Cool Water von Davidoff, das Dressing fürs Gemüt. Jetzt bewährte sich, daß sie vor einiger Zeit im Internet ein Sockenabonnement für ihn gebucht hatte und seitdem regelmäßig mit einem Packen beliefert wurde, so daß ihr die nervende Suche nach ein paar passenden Socken erspart blieb. Sie lagen im Sechserpack im Schrank. Da sie der Ausstattung der Hotels mißtraute und auch nicht wußte, in welcher Kategorie ihn seine neuen Chefs unterbringen würden, packte sie ihm vorsichtshalber noch Handtücher, Seife und Badepantoffeln ein und natürlich sein Rasierset, das immer griffbereit war. Nur die Armbanduhr lag nicht am Platz. Fieberhaft suchte sie seine funkgesteuerte Solaruhr, lautverträglich, mit ewigem Kalender, Zeitzoneneinstellung und wasserdicht bis 30 Meter – ohne sein Chronometer fühlte er sich auf Reisen unbehaust. Sie riß alle Schränke und Schubfächer auf, fand die Armbanduhr schließlich auf seiner Musikanlage, atmete auf, eilte in ihr Arbeitszimmer zum Bücherregal und steckte in die Seitentasche des Koffers noch rasch Die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Das Bändchen nahm wenig Platz weg und war als Notlektüre gedacht, falls es unterwegs zu längeren Wartezeiten kommen sollte. Wegen des Titels schlug sie es vorsorglich noch schnell in eine Hülle ein, damit er bei den Mitreisenden nicht in den Verdacht geriet, Schweinskram zu lesen, oder ihm fälschlicherweise erotische Bedürftigkeit unterstellt wurde. Sie überlegte kurz, ob sie nichts vergessen hatte, prüfte noch einmal den Inhalt, dann schmiß sie den Koffer ins Auto und jagte über den Stadtring zum Flughafen. Sie fand sogar noch eine Parklücke, löste den Parkschein und rannte zum Gate acht. Zarth kam schon auf sie zu, unübersehbar in seiner Körpergröße, strahlend und wie von aller Schwerkraft losgelöst, umarmte sie, hob sie spontan in die Höhe und sagte: »Jetzt steigen wir ganz groß ein.«
Obwohl sie wußte, daß er für den Erfolg geschaffen war, konnte sie dennoch kaum fassen, daß er schon wieder auf dem Siegertreppchen stand. Kürzlich erst die schwarze Null für Taff und jetzt noch eins höher und Chef vom Metropolenradio. Es war großartig. Sie hielt ganz still in seiner Umarmung. Ihr Herz schlug höher, ihr Blut floß schneller, der Ärger mit der Büroetage war vergessen, der Streß fiel ab, die Welt entrückte. Ewig hätte Vera so stehen können.
Es blieb noch etwas Zeit bis zum Abflug, und er ging mit ihr noch rasch auf einen Cappuccino in die Snackbar Flyer’s. »Fast das doppelte Jahresgehalt«, sagte er. »Das zahlen die nicht umsonst. Da kannst du dir ja vorstellen, was auf mich zukommt.« Er entschuldigte sich, daß er sie aus ihrer Arbeit gerissen hatte und mit seinem überstürzten Abflug belästigte, aber der Büroleiter des Hauptgesellschafters, der gerade aus Budapest gekommen war, wartete am Airport in Frankfurt, um gemeinsam mit ihm nach Stamford zu fliegen, zur US