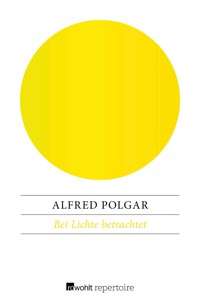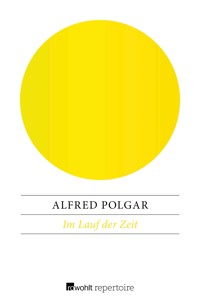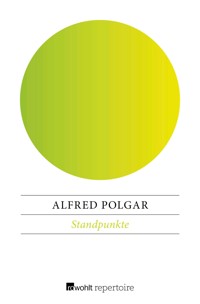9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band vereinigt eine repräsentative Auswahl der Meister-Feuilletons von Alfred Polgar. Zu höchster Finesse entwickelte er Reize und Valeurs der kleinen Form, die in aphoristischer Knappheit eine Welt auf die Probe stellt. Was dieser Autor für die Spalten unter dem Strich der ersten oder zweiten Seite großer urbaner Tageszeitungen schrieb, das bleibt bestehen als eine Kette von Streiflichtern, die das Menschliche und das Unmenschliche seiner Zeit bis auf den Grund erhellen. Diese Texte manifestieren ein zwiefältiges Understatement: sie geben sich anspruchslos in Gegenstand und Formung. Gerade dadurch aber reichen sie – Paradox der Kunst – über sich hinaus; gerade dadurch fassen, erschließen, erfüllen sie mehr, als sie vorgeben; gerade dadurch formulieren sie gültigeren Ausdruck als manches Monumentalwerk, das die Weite der Welt zu umspannen sucht. Was Polgar hinterließ, zeichnet nicht nur die Statur einer Gesellschaft im Zwiespalt zwischen Gefordertem und Geleistetem – es zeichnet die Statur eines Mannes, der seine Befunde dieser Welt, ihres Scheins und ihres Seins, in dezenten Miniaturen sacht und beiläufig zu radikalisieren verstand, bis aus den Gebilden seines wissenden Worts ungetrübte Wahrheit hervorging.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Alfred Polgar
Auswahl
Prosa aus vier Jahrzehnten
Herausgegeben von Bernt Richter
Ihr Verlagsname
Über Alfred Polgar
Über dieses Buch
Dieser Band vereinigt eine repräsentative Auswahl der Meister-Feuilletons von Alfred Polgar. Zu höchster Finesse entwickelte er Reize und Valeurs der kleinen Form, die in aphoristischer Knappheit eine Welt auf die Probe stellt.
Was dieser Autor für die Spalten unter dem Strich der ersten oder zweiten Seite großer urbaner Tageszeitungen schrieb, das bleibt bestehen als eine Kette von Streiflichtern, die das Menschliche und das Unmenschliche seiner Zeit bis auf den Grund erhellen. Diese Texte manifestieren ein zwiefältiges Understatement: sie geben sich anspruchslos in Gegenstand und Formung. Gerade dadurch aber reichen sie – Paradox der Kunst – über sich hinaus; gerade dadurch fassen, erschließen, erfüllen sie mehr, als sie vorgeben; gerade dadurch formulieren sie gültigeren Ausdruck als manches Monumentalwerk, das die Weite der Welt zu umspannen sucht.
Inhaltsübersicht
Vorwort von Siegfried Melchinger
Als Alfred Polgar 1926 das erste Buch seiner Geschichten unter dem Titel ‹An den Rand geschrieben› bei Rowohlt erscheinen ließ, schrieben Kritiker: ja, da gehörten sie auch hin. Es ist nicht zu leugnen, daß unseren Autor, den wir lieber unseren Dichter nennen würden, wäre diese Vokabel nicht seit einiger Zeit in Mißkredit geraten, das kränkte. Noch im Exil, 1943, schickte er einem neuen Band, der unter dem Titel ‹Geschichten ohne Moral› Neues und Altes vereinigte, eine «Rechtfertigung» voraus, die er unterteilte «a) überhaupt, b) der Kürze, c) des bißchens Narrheit».
‹An den Rand geschrieben› war übrigens gar nicht sein erstes Buch, auch wenn er es so nannte und so wollte: in den Bibliotheken finden sich zwei Bücher aus dem Jahre 1908: ‹Die Quelle des Übels› und ‹Parodien›, darunter der in Kabaretts vielgespielte Sketch ‹Goethe im Examen›: eine Satire auf die Schulmeisterei. Und 1912 waren Novellen unter dem Titel ‹Hiob› erschienen. Immerhin, auch 1908 war er schon 35 Jahre alt, und was dann in den zwanziger Jahren in Buchform herausgegeben wurde, war die Auslese aus einer journalistischen Produktion, von deren Umfang sich nur der ein Bild machen kann, der einmal versucht hat, von Zeilenhonoraren zu leben.
Was Polgar als «erstes Buch» angesehen wissen wollte, war der Beginn eines neuen Lebensabschnitts; denn von nun an geriet ihm, was er für die Journale schrieb, immer mehr so, daß es den Tag, an dem es gedruckt wurde, überleben mußte. Die Zeit der Reife war gekommen, nach ungezählten Versuchen die Früchte der Meisterschaft. Um die «Kürze» zu rechtfertigen, schrieb er: «Ich bin mir wohl bewußt, daß auch in einer Geschichte von geringem Umfang gar nichts stehen und daß die Knappheit ganz gut der Not-Effekt eines kurzen Atems sein kann. Dennoch glaube ich, daß eben die konziseste literarische Form der Spannung und dem Bedürfnis der Zeit gemäß ist … Das Leben ist zu flüchtig für behaglich verweilendes Schildern, zu romanhaft für Romane.»
Nun, als Polgar seine Geschichten zu sammeln begann, erschien einer der längsten Romane, die es gibt – der ‹Ulysses› von James Joyce, und er wird heute noch gelesen. Das Tempo der Zeit hat offenbar das Tempo des Lesens nicht zu überholen vermocht, ja, wir neigen dazu, anzunehmen, daß einer, der liest, auszusteigen wünscht aus dem Zug der Zeit, zumal – besonders wenn er sich die Zeit nimmt, Polgar zu lesen. Zwischen der Kürze und der Zeit besteht offenbar keine ästhetische Relation. Und um der Rechtfertigung willen haben wir Polgars «Rechtfertigung» gewiß nicht zum Ausgangspunkt unserer Betrachtung gemacht, denn einer solchen bedarf unser Klassiker nicht mehr. Polgar war gekränkt, weil der Rang seiner Arbeit an der Vergangenheit gemessen wurde, aus der er sie entwickelt hatte. Nicht ohne Würde schrieb er hin: «Meine Literatur». Für uns ist diese «Rechtfertigung» interessant, weil wir an ihr erkennen, welche Bedeutung er selbst seinen Geschichten zumaß. In seiner degagierten Art sprach er von der knappen Form als dem «Ergebnis konsequenten, mit mancher Qual verknüpften Bemühens, aus hundert Zeilen zehn zu machen». Was leicht scheint, ist nicht immer leicht gewesen. Und Polgars Leichtfertigkeit hat, wie er selbst am besten wußte, ein spezifisches Gewicht von hohem Karat.
Die Gattung, aus der Polgars «kleine Form» hervorgewachsen ist, war eine, wenn der Ausdruck gestattet wird, «vorliterarische»: das Feuilleton. Eine Gattung des Journalismus also. Auf die Frage, was eigentlich ein Feuilleton sei, konnte man kaum eine andere Antwort finden als: es steht unterm Strich. Heute gibt es nur noch in wenigen Zeitungen diesen Strich, der die großen Themen des Tages, der Politik vor allem, von den übrigen trennt; und noch seltener sind die Blätter geworden, in denen schon die erste Seite das aufweist, was unter dem Strich steht: das Feuilleton. Als Polgar begann, waren die Themen, die dort behandelt wurden, keineswegs auf das beschränkt, was man in den Zeitungen von heute «Kultur» nennt. Theater und Kunst gehörten zwar dazu, und die meisten «Feuilletonisten» waren zugleich Kritiker, alle Kritiker aber auch Feuilletonisten: ebenso wichtig genommen wurden die «Gesellschaft», die Jahreszeit, die Feste, wie sie fielen, die Mode, die Prozesse, kurz, «das Leben», das nicht deshalb ausgeschlossen bleiben sollte, weil es sich nicht für die großen Schlagzeilen eignete. Freilich wurde das alles auch im «Lokalen» und im «Vermischten» behandelt, doch kam es ins Feuilleton, wenn es eine Voraussetzung erfüllte: es mußte gut geschrieben sein. So wurde die Definition gefunden: Feuilleton sei, was gut geschrieben ist. Und da man über alles unterm Strich schreiben durfte, über Gott und die Welt und das Leben und die Großen und die Kleinen, vorausgesetzt eben, daß man gut darüber schrieb, sahen tiefere Geister im «Feuilletonismus» ein Zeichen der Zeit, die sich mit witzelnder Oberflächlichkeit über den Ernst der Dinge hinwegtäuschte, stets bereit, Moral und Gewissen für eine Pointe zu verkaufen. Heute kennt der Journalismus das Feuilleton kaum mehr (und es läßt sich nicht leugnen, daß es deswegen mit Moral und Gewissen nicht eben besser steht). Bei der allmählichen Verkümmerung des Genres spielte der Zwang zur Kürze, den Polgar fälschlich auf die Literatur bezog, eine unbestreitbare Rolle in der Zeitung: die Leute hatten immer weniger Zeit, jene gut geschriebenen Sachen zu lesen, die sich einst unter dem Strich über viele Seiten hingezogen hatten, um dann zunächst nur noch ebenso viele Spalten und schließlich nicht einmal diese mehr zu füllen (die Papierschwierigkeiten im Ersten Weltkrieg taten ein übriges dazu). Aber die besten unter den Feuilletonisten verstanden es, aus der Not nicht nur eine Tugend, sondern ein Prinzip zu machen. So kam es in den zwanziger Jahren zu einer Blütezeit der kleinen Form, in der das Feuilleton noch einmal, bevor es unter dem Druck der größeren Themen fast völlig zum Erliegen kam, höchsten Glanz ausstrahlte. Und hier geschah, was so oft in der Geschichte der Künste zu beobachten ist: daß gleichsam aus dem Humus einer vorkünstlerischen Produktivität Gebilde hervorwuchsen, denen der Rang Kunst nicht abgesprochen werden kann. Um in der Sprache unseres Klassikers zu reden: Polgar machte dem Feuilleton (wie die Massary der Operette) den Sublimierungsprozeß. (Polgar und andere, von Peter Altenberg bis Kurt Tucholsky, aber ich denke doch: keiner wie Polgar.)
Worin unterscheidet sich ein journalistisches von einem Literatur gewordenen Feuilleton? Wo finden wir in ihm das Merkmal des Kunstwerks? «Dort, wo Wirkung ist ohne erkennbare Ursache», antwortet uns Polgar. Die nicht erkennbare, nicht rationalisierbare Ursache, von der die Wirkung eines Kunstwerks der Sprache ausgeht, läßt sich bei Polgar als Musik umschreiben. Doch ist es eine geheimnisvolle Art von Musik, denn aus dieser Sprache dringt nicht Schönklang ins Ohr, und sie sucht auch nicht eine bestimmte Melodie oder einen persönlichen Rhythmus. Würde man sagen, sie sei etwas wie Debussy, würde man ihr einen Impressionismus zuschreiben, den sie nicht besitzt. Und doch ist da ein legatissimo, ein dolce, ein tempéré und modéré, ein Gran nichtsubstantieller Samt, das in einigen der schönsten Stücke der zwanziger Jahre an die préludes oder die images erinnert. Es ist das, was zwischen den Worten ist, die ungeschriebenen Noten der Zwischenräume, die sich zuweilen in Interpunktionen pointieren, der Bogen der syntaktischen Komposition, den keine Grammatik erklärt. Schon eher nachprüfbar ist die Wortwahl, die mit unfehlbarem Instinkt vieles draußen läßt – im 18. Jahrhundert nannte man diese Sicherheit des Geschmacks «Delikatesse». Hier meldet sich Österreichisches, aber so, als wäre es durch die Schule Lessings und Lichtenbergs gegangen. Nachprüfbar ist auch die Kunst der Struktur, vor allem, wenn sie, was zuweilen vorkommt, ein wenig zu kunstvoll geraten ist (so in dem fast preziösen ‹Ludwig XIV.›).
Oft wird von der Pointe her aufgebaut, deren Überraschungsmoment darin liegen mag, daß es das alles, was zuvor verführerisch ausgemalt wurde, gar nicht gibt. Oder ein Idyll wird systematisch zersetzt, indem ihm kleine Dosen Realität injiziert werden. Doch ist dies alles so wenig aus Konstruktionsprinzipien zu erklären wie der Witz der Paradoxe, deren Herstellung ein Virtuose wie Polgar selbst genau zu analysieren wußte (bei Oscar Wilde): «der den Vordersatz aufhebende Nachsatz; das verkehrte Sprichwort; der Tausch von Schluß und Prämisse; die Pyramide mit der Spitze unten und der Basis oben; die Behandlung einer moralischen Frage als einer ästhetischen; das Einmaleins als Geschmackssache; die Umdrehung platten Sinns zu apartem Unsinn.» Aber was nützt das Rezept ohne das einzige Ingrediens, auf das es ankommt: den Einfall? Polgars Metaphern dienen niemals nur der Verdeutlichung; sie haben stets das unerklärbar Stimmende des «Überraschungsmoments» (wie er es selbst ausgeführt hat in ‹Von Bildern und Vergleichen›: so das Schönste, was je über einen Schauspieler geschrieben worden ist: «Wo er hintritt, wächst Gras» (über Oscar Sauer). Oder: «Weißes Weizenbrot, das wie gebackener Friede schmeckt.» Oder (vom «Hingang» des Freundes auf das Standesamt): «er war zerrissen, jetzt ist er genäht». Oder (von Ringelnatz): «Er hat den Stein der Narren entdeckt, welcher dem der Weisen zum Verwechseln ähnlich sieht.» So funkeln auch seine Pointen nicht nur von Witz, sondern von der Einfallskraft der Sprache: «Wenn eine Frau schweigt, hört man es.» – «Ach, jeder ist sich selbst der Fernste.» – «Man konnte sogar die Schritte hören, mit denen er in sich ging.» – «Ach, was wäre die Anna für eine Anna, wenn sie wie die Gnädige eine Anna hätte.» Oder die unerfindliche Definition der Zeit: «daß Heute morgen Gestern ist».
Solche Einfallskraft setzt Philosophie voraus. Freilich nicht die der professionellen Philosophen, sondern die derer, die nachzudenken lieben. Und darin zeigt sich, daß wir bei unserem Versuch, Formales zu analysieren, von Anfang an Sinn mit angesprochen haben. Selbst das, was wir als Musik zu deuten vorschlugen, konnte nur entstehen, wenn der Standpunkt die Perspektive und die Dimension bestimmte, worin das zu Sagende so oder so zu Wort kam. Polgar hat diese Interferenz von Wort und Sinn oder von Objekt zu Subjekt in ein Paradoxon gefaßt: «Auge des Kindes: da blickt eine Welt hinein. Auge des erwachsenen Menschen: eine Welt blickt da heraus.» Von daher verstehen wir am besten seine besondere Art der Kritik, die er nicht ohne Ironie gegen die Kollegen folgendermaßen umrissen hat: «Kritik spiegelt weniger die Eindrücke, die der Betrachter vom Werk als vielmehr jene, die das Werk vom Betrachter empfing.»
Polgar war kein Vorkämpfer. Er entschied sich nicht für Richtungen und Parteien, weder für literarische noch für politische. Der Platz, den er einnahm, um der Dinge zu harren, die da kommen würden, läßt sich in keine Fronten einreihen. Er saß, im Theater, gleich weit entfernt von Kerr und Jhering und verfolgte deren Streit mit ironischer Verwunderung. Sein scharfes kritisches Auge war unterdessen damit beschäftigt, Verlogenheit, Mache, Bluff, Prahlerei und Schwulst zu durchschauen; er verfügte über ein fast untrügliches Gespür für das Talent, und es war ihm gleichgültig, auf welcher Seite der Richtungen er es fand. Von dem Platz aus, wo er saß, konnte man genauer erkennen, was einer wollte, und das herauszufinden, war seinem kritischen Hang zur Objektivität zunächst das Wichtigste. Er kritisierte nicht die Vordergründe, mit denen die starken und meist oberflächlichen Effekte erzielt werden, sondern was dahintersteckte, Tiefe oder Leere. Obwohl er fast ausschließlich Theaterkritiken schrieb, mochte er das Theater nicht, wie etwa sein Freund Siegfried Jacobsohn, als das spezifische Ressort seines Metiers ansehen. Von seinen Kritiken sagte er, sie «wollen das Theater nicht nur als Kunstphänomen würdigen. Sie untersuchen den Fang, der ihm aus dem Strom des Lebens ins Netz ging, nehmen ihn – egal ob Schätze oder alte Stiefel – als Objekt der Betrachtung und Erzählung, wobei manchmal die alten Stiefel den ergiebigeren Stoff liefern als die Schätze.» Hier spricht der sublimierende Feuilletonist. Seine Kritiken unterscheiden sich weder im Stil noch in der Struktur von den Erzählungen. «Meine kritischen Erzählungen und erzählenden Kritiken» – so formulierte er diese Übereinstimmung. Beide sind «Geschichten aus dem Leben». Es zeigt sich, daß der Platz, den er im Theater einnahm, der gleiche war wie der, von dem aus er das Leben betrachtete; was er sah, war für ihn das gleiche. Die Welt – theatrum mundi, Theater – Stücke der Welt. «Die Erzählungen sind Kritiken über Schauspiele, Possen und Tragödien, wie das Leben sich beehrt, sie darzubieten.» Zwischen den Stoff, den ihm Welt, Leben, Menschen, Zeiten lieferten, legte er die Distanz einer genau abgewogenen Nichtbeteiligung, die freilich niemals zur Nichtbetroffenheit ausartete. So saß er am Fensterplatz des dahinfahrenden Eisenbahnzuges, an einem Ecktisch im Kaffeehaus («Seit zehn Jahren sitzen die zwei, jeden Tag stundenlang, ganz allein im Kaffeehaus. Das ist eine gute Ehe! Nein, das ist ein gutes Kaffeehaus.»), auf einer Bank im Park, auf dem Stuhl des Gerichtsberichterstatters (wo er die «Jagdlust der Justizfunktionäre» interessierter verfolgte als den jeweiligen Fall), in der Hotelbar, am Rand der «alten Straßen» und der «großen Boulevards». («… es regnet heftig, zweifach hell im Nässespiegel leuchtet der Boulevard, ein winziges Ritzerchen nur auf dem Stern Erde, der mit Milliarden anderen um die Sonne kreist, die mit Milliarden anderen Sonnen im Weltraum kreist, der wahrscheinlich auch um etwas kreist, ein winziges Ritzerchen nur auf dem Stern Erde, eine haarfeine Linie, aber das Antlitz des Planeten wäre noch medusenhafter ohne sie.»)
Nichts ist charakteristischer für den Polgarschen Sublimierungsprozeß als der Radius des Gesichtskreises, in dem ihm, von seinem Standpunkt aus, das alles erscheinen konnte, was er sah. So konnte er in den vergangenen Sommer blicken und was damals geschah mit den Augen dessen betrachten, der weiß, was inzwischen geschehen ist (lang bevor die ‹Zeitmaschine› auf dem Theater in Gang gesetzt wurde); oder er konnte sich vorstellen, es sei fünfzig Jahre später: «Träume dein Leben!» Ja, er liebte es, die Anstrengungen der Menschen mit den Augen der Götter zu betrachten, und er konnte denen nachfühlen, daß sie dabei in «das bekannte homerische Gelächter» ausbrachen («von ihm den Hauch eines Echos einzufangen, ist, unter anderm, dieses Buch bemüht»). Er sah die Wichtigkeiten der Gegenwart in der Optik des umgekehrten Opernglases; dabei fand er: «Was ist unwahrscheinlicher: Postkutschen oder ‹Flammenwerfer in Tätigkeit›? Landschaften in Lichtrosa und Himmelblau oder ein ‹Granattrichterfeld›?» Der Vergleich mit dem Opernglas trifft nicht ganz das Richtige: die Optik, die er einzustellen pflegte, zeigte ihm, ähnlich wie im Theater, den Vordergrund so verschwimmend, daß der Hintergrund doppelt scharf erschien. Im Hintergrund war zum Beispiel der Tod – eines seiner Lieblingsthemen, immer neu anvisiert, immer tiefer bedacht, mit unermüdlichem Ernst nacherlebt. Eines der Grundmotive seiner Geschichten: das Leben vom Tode her zu betrachten, «Gespenster am Tage» zu sehen, «verurteilt zu lebenslänglichem Leben» (vom neugeborenen Kind: «Die Erwachsenen, ausgepichte, eingewöhnte Sträflinge des Lebens, besänftigen den Neuankömmling mit verlegenen Humor. Oh, sie wissen genau, mit wieviel Recht es sich beklagt, da zu sein!»).
Dieser Skeptiker, der an keine Weltveränderung glaubte, weil er die Menschen kannte, war frei von Verachtung, meilenfern von Hochmut, gefeit gegen Kälte. Er hatte, wovon man heute nicht fern redet, Herz. Er fühlte mit den Unglücklichen. Der Schmerzensschrei der Kreatur ging ihm durch Mark und Bein. Er fand sich mit keinem Unrecht ab. Er war sozial nicht aus Prinzip, sondern von Natur. Er war kein Marxist, aber er gab Marx recht, wenn dieser sich über die herrschende Gesellschaftsordnung empörte. Der Österreicher in ihm fand die preußische Verherrlichung der Arbeit lächerlich. Er glaubte nicht an künftige Paradiese; er hielt gar nichts davon, daß man die Lebenden für die Nachwelt opferte, und ebensowenig vom Ruhm, für eine große Sache zu sterben.
Was trieb ihn an, nicht nur zu schreiben, sondern dieses Leben zu beschreiben, das er so skeptisch betrachtete? Lassen wir es ihn selbst sagen: «Nein, ich glaube nicht, daß meine Arbeit notwendig ist; dennoch muß ich sie tun. Sie ist meine Reflexbewegung des Widerstandes gegen das Grausige, Lächerliche, Unentwirrbar-Dunkle innerer und äußerer Welt, sie ist der natürliche Ausdruck meiner Freude am Geschenk des Daseins und meines Zweifels am Wert dieses Geschenks, sie ist ein so wesentlicher Teil von mir, daß ich mich selbst verneinen müßte, wollte ich sie verneinen. Dazu fehlte mir ja auch eventuell nicht die Lust, aber die Kraft.»
Als Alfred Polgar vierzig geworden war (und ein Dichter), hatte er gelernt, das Treiben dieser Welt mit dem skeptischen Lächeln dessen zu betrachten, der gewohnt ist, seinen «Bedarf ernster Lebensweisheit bei den großen Humoristen zu decken». Das war er selbst: ein großer Humorist. Dann sorgte die Zeit dafür, daß diesem Zeitgenossen allmählich das Lächeln verging. Der erste Schock war der erste Krieg.
‹Hinterland›, die Geschichten aus den Jahren 1916 bis 1923, nannte er sein «Kriegsbuch». Aus der «Ohnmachtsperspektive» behandelt es das «kleine Elend des Krieges» und dessen, was danach kam, des Hungerns und Frierens. Aber im Vorwort heißt es (1925 geschrieben): «Das Dämonische und das Gewaltige verführen; und auch der Schrecken, ins Großartige gesteigert, hat seine Anziehungskraft. Vielleicht ist es zum Zweck des ‹Nie wieder Krieg› besser, von der Erbärmlichkeit, der erstickenden Dummheit und Dumpfheit, der grenzenlosen, infernalischen Lächerlichkeit jener räudigen Zeit (die ‹die große› genannt wurde) zu sprechen, als von ihren Greueln.» Es war zwecklos. Schon die Möglichkeit, daß sich das wiederholen konnte, macht dieses Buch zu einem Dokument, an dem kein Historiker dieser Zeit und aller Kriegs- und Nachkriegszeiten vorübergehen sollte. Die Hoffnung des «Nie wieder Krieg» ließ in den zwanziger Jahren das Lächeln noch einmal wiederkehren, wenn es auch skeptischer, schon ein wenig bitter geworden war. Noch einmal belebte sich der österreichische Sinn für «das Komödische des Lebens». Dem danken wir die schönsten Geschichten. Dann veränderte sich die Optik. Die Distanz verringerte sich. Die Dinge rückten dem Betrachter immer näher auf den Leib. Noch in der Erbitterung des Exils glaubt man zuweilen den Mut zu spüren, der die Niederwerfung des Bösen für möglich hielt. Aber es zeigte sich, daß Irreparables geblieben war. Die Verbitterung überlebte das Ende. Die Klage über die Fremde ist Anklage geworden. Wer einmal die Muttersprache, deren «Atmosphäre für den Geist ist, was Luft für die Lunge ist», als «Gefängnis» erlebt hat («je länger man in der Fremde lebt, desto fremder wird sie») – für den kann es wohl keine Rückkehr mehr geben. Einst hatte es geheißen: «O Fremde, wie bist du schön – für den, der noch eine Heimat hat.» Jetzt, am Ende dieses Lebens, steht ein Satz von schneidender Endgültigkeit: «Die Fremde ist nicht Heimat geworden, aber die Heimat ist Fremde.»
Auch Stoffe und Stil der Geschichten änderten sich im Exil. Sie näherten sich der short story, wie sie in Amerika verlangt wurde. Doch war da mehr im Spiel als nur der Zwang, sich dem Markt der Fremde anzupassen (wie ihn die Satire ‹Sein letzter Irrtum› mit grimmiger Selbstironie verspottet). In einem der kostbarsten Stücke dieses Bandes, der Betrachtung über den Neudruck der ‹Kulturgeschichte der Neuzeit› von Friedell, findet sich am Ende das Wort von der «schärferen Präzision der Maßstäbe, mit denen wir heute geistiges Produkt messen». Das also hat sich verändert. Das alte Lächeln kann nicht mehr wiederkehren. Jene Musik ist hart geworden (nicht daß es keine Musik mehr wäre). Die Worte werden nüchterner gewählt. Die Lust an der Struktur tritt weit zurück hinter der Dringlichkeit der Sache. Noch immer ist aus dem Betrachter kein Kämpfer geworden. Aber da die Sprache die natürliche Ausdrucksart ist, kann es gar nicht anders sein, als daß die diesem «vielleicht überempfindlichen Organismus» zugefügten Erfahrungen die Sprache verändert haben.
Alfred Polgar – ein kluger Kopf und ein tiefer Geist, ein Musikant der Worte und ein Künstler der Sprache, ein Souverän der Einfälle und ein Schöpfer aus Einbildungskraft, ein Meister der kleinen Form, die Großes verdichtet, deren Klassiker, ein Dichter.
Alfred Polgars kritische Erzählungen und erzählende Kritiken: Kostbarkeiten aus dem Kupferstichkabinett der Weltliteratur.
1 Mensch unter Menschen
Das Kind
Nun das Kind zur Welt gekommen ist, haben alle, mit Ausnahme des Neugeborenen, große Freude. Verwandte und Bekannte blicken lächelnd auf das feuerrote, verrunzelte Stückchen Mensch, obschon es doch eigentlich mehr Gefühl des Mitleids wecken sollte, denn da es ins Leben trat, trat es ja in den Tod, und mit jeder Sekunde, die es sich vom Augenblick seines Anfangs entfernt, nähert es sich dem Augenblick seines Endes. Vor neun Monaten noch unsterblich wie eine ewige Idee, ein göttliches Prinzip, ist es nun schon mitten drin im Sterben, hat von dem Zeitkapitel, mit dem es sein Auslangen finden muß, vierundzwanzig Stunden schon verbraucht. «Me genesthai!» sagt der Weise, nicht geboren werden ist das Beste. Aber wem widerfährt das schon? Unter Millionen kaum einem.
Das Kind quiekt. Not und Unbehagen sind die ersten, die an die noch verschlossene Tür des Bewußtseins klopfen und das Kind durch ihr Klopfen im Schlafe stören. Schreiend erhebt es Klage, Anklage, daß es da ist. Die Erwachsenen, ausgepichte, eingewöhnte Sträflinge des Lebens, empfangen den Zuwachs mit verlegenem Humor. Heuchlerisch fragen sie: «Na, was iserlt denn?» als ob sie nicht ganz genau wüßten, was es iserlt.
Der Vater fordert das Kind mit singenden Schmeicheltönen auf, zu lächeln. Er späht gierig nach diesem Lächeln aus, als nach einem Zeichen, daß das arme Wesen sich mit dem Schicksal, dazusein, abgefunden habe. «Na, so lach doch ein bißchen» heißt soviel wie: Zeige doch, daß du mir verzeihst, dich in die Gemeinschaft der Lebenden gestoßen zu haben. Vaterliebe ist zum Teil Schuldgefühl gegen das Geborene. Aber natürlich ist dieses Gefühl in den Vätern bis zur Unmerklichkeit verkapselt, zurückgedrängt vom Schöpferstolz, obgleich ja, an der mütterlichen Leistung gemessen, des Vaters kurze Arbeit zum Werden der Kreatur nicht gar so imponierend ist.
Haust schon eine Seele in dem planvoll organisierten Zellenhäufchen? Waren die guten Feen schon da, die die Gaben, und die bösen Magier, die die ersten Komplexe bringen? Die kleine Maschine ist in vollem Betrieb; das Herz schlägt, das Blut wandert, die Drüsen sezernieren, die Lungen schaffen Kohlendioxyd ins Freie, und die winzigen Fingerchen, Zinken einer Puppenküchengabel, schließen sich um den Finger des gerührten Vaters. Das Kind greift nach dem, was es erreichen kann. Siehe, ein Mensch!
Wenn es zum ersten Male die Augen aufschlägt, da vollzieht sich Neugeburt des Alls durch das Neugeborene. Es öffnet der Welt Pforten, durch die sie einzieht, um zu sein. Der Ansturm ist heftig, immer wieder müssen die zarten Tore geschlossen werden. Nicht drängen, alles kommt dran.
Auge des Kindes: da blickt eine Welt hinein. Auge des erwachsenen Menschen: eine Welt blickt da heraus. Darum ist es so trübe wie ein Glas, an dem viele Spuren von Getrunkenem haften.
Das Kind schreit. Doch wenn es zu trinken bekommt, tut es einen ganz zarten Seufzer der Erleichterung, seine Züge entspannen sich, und mit jedem Schlückchen Milch saugt es ein Schlückchen Frieden in sein Antlitz. So wird der Mensch vom Beginn an durch Nahrung bestochen, seine wahre Meinung zu unterdrücken und Ruhe zu geben und lieb zu sein. Ach wie lieb ist das Kind! Auch das Böse en miniature ist lieb. Auch die Hölle in Taschenformat und der Teufel, wenn er daumengroß erschiene, mit einem Mauseschwänzchen, wären es.
Die Mutter ruht blaß und erschöpft. Es ist ihr wunderlich zumute, so angenehm leer und so schmerzhaft verlassen, so reich beschenkt und so gröblich ausgenutzt. Und ihre Seele, die Gott dankt, ist heimlich gewärtig, daß er ihr danke. Darauf hat sie auch Anspruch. Denn der Schöpfer lebt in seinen Geschöpfen, und jedes Stück neues Leben, das wird, ist seinem eigenen zugelegt.
Leise geht die Tür auf. Die Mutter wäre gar nicht erstaunt, wenn drei Könige aus Morgenland auf Zehenspitzen hereinkämen.
Es ist aber nur der Onkel Poldi.
Jugend
Zufall führte durch die alten Straßen, seit den Tagen der Kindheit nicht mehr begangen. Sie sind arm und häßlich wie vor Jahrzehnten und erfüllt von der gleichen quälenden Geschäftigkeit. Kleinheit, Unmusik, Stumpfsinn der Daseinsmüh spiegelt sich in ihnen. Vielleicht beobachtet eben ein braves Gottkind das Geracker – wie wir den Insekten zusehen im Gräserwald – und sein Präzeptor sagt ihm: Gehe hin zu den Menschen und lerne! All dieser Straßen und Schauplätze frühesten Erlebens hatte ich längst nicht mehr gedacht. Nun steigen mit den alten Kulissen aus Versenkungen des Hirns Szenen und Figuren wieder auf, Klang und Geruch, Stimmen, Gesichter. Tote Welt, blaß hineinschattiert in die lebendige Straße, wird offenbar.
Da ist der alte Kaufmannsladen, und noch steht der Name des Besitzers, der Besitzer war zu meiner Zeit, auf dem Schilde, nur mit einem beigepinselten «vormals». Mir fällt ein, daß mein Bruder in diesem Laden aus Wut über elterliche Verweigerung irgendwelchen Wunsches tückisch den Hahn des Petroleumfasses aufgedreht hatte. Es brach Feindschaft aus zwischen dem Kaufmann und meinem Vater, der Schadenersatz leisten mußte. Beide sind längst tot und wohl schon wieder versöhnt. Der Kommis hatte das Gesicht voll Blatternarben und hieß Heinrich. Ich sehe ihn die Brotlaibe von dem Wagen abladen, auf dessen Trittbrett hinten ein Stück mitzufahren meine große Passion war. Die Brotlaibe hatten in der Mitte eine Einbuchtung wie ein Nabel und glänzten roßkastanienbraun. Der Kaufmann kaufte alte Zeitungen, vier Heller gab er für das Kilo oder den Gegenwert in Äpfeln.
Äpfel … Gibt es noch den Kaufmannsladen in der Straße?
Nein, den Laden gibt es nicht mehr, aber die Straße zieht, obgleich es ein winterlicher Tag ist, sogleich Sommergefühl aus der Erinnerung: Verfaultes Obst, Hitze und säuerlicher Geruch der Gärung und Fliegen und Melonenschalen in der Straßenrinne. Viele Tröge mit zerquetschten Kirschen, Riesenkörbe voll Aprikosen, die alle eine kranke Wange hatten, Stachelbeeren, denen Teile der Eingeweide außen an der Hülle klebten. Alles so ekelhaft billig, lästig, unter jedem Wert, voll verschämten Bewußtseins, daß es eigentlich weggeschüttet gehöre, mißmutig verlegen in die Rolle einer Ware sich schickend. Ich stehe in der winterstarren Straße und bekomme Sommerbauchweh.
An der Ecke ist noch das Haus, wo mein Vater die Klavierschule hatte. Ich sehe zu den Fenstern hinauf, und leises Mißbehagen beunruhigt das Rückenmark. Irgendwas Widriges, Unkompensiertes, Offenes meldet sich. Plötzlich ist es da: Schulschlußfeier, bei der mein Bruder und ich vierhändig die ‹Don Juan›-Ouvertüre spielten. Ich wollte heute noch, ich könnte es ungeschehen machen. Warum mußte ich damals so kläglich patzen, warum? Mein Herz fragt wieder die vergangene Frage und schmeckt die alte Bitterkeit. Armer Vater! Wenn wir, er im Nebenzimmer, übten, hörte er die falschen Fingersätze und rief die Korrekturen hinein. Ich führte unterm Klavier mit meinem Bruder erbitterte Fußkämpfe ums Pedal. O wie ich ihn haßte! Ich hätte ihm nicht nachgeben, sondern ihn schlagen sollen. Aber so fing es an … und so blieb sie, die Beziehung zum Bruder und zum Bruder Mensch. Meine Arme sind lahm von nicht versetzten Schlägen. Ungegebene Prügel klagen geisterhaft im Blute. Die Mutter pflegte, war Zank zwischen den Kindern, jedem heimlich zu sagen: Der Gescheitere gibt nach. Mein Bruder, der der Gescheitere war, verzichtete darauf, es zu sein, und behielt recht.
Auch das Durchhaus mit den drei viereckigen Höfen steht noch. Es war dort eine Fabrik oder Niederlage von Spirituosen und immer ein mildscharfer, wohliger, essenzieller Geruch von gebrannten Wässern, ein Geist, der mit ausgespannten, durchsichtigen Flügeln sich schwebend hielt über den drei viereckigen Höfen. Dieser Geruch war eine der stärksten Erlebnistatsachen meiner Kindheit, stärker als Haß und Liebe. Aber warum es so war, kann ich nicht sagen. Jetzt riecht das Vorstadthaus ganz gemein nach Vorstadthaus. In Wehmut denke ich des verstorbenen Duftes. Bis auf die feinste Nuance kann ich ihn in der Nase erinnern.
Und da ist das Gymnasium. Ich gehe durch das höllische Tor. Mit größter Heftigkeit, mit beiden Füßen sozusagen, springt der Name des Schuldieners ins Gedächtnis: Kunschner! Nicht wenn es das Leben gegolten hätte, wär er mir alle drei Jahre hindurch eingefallen. Gesichter, Bärte, Augengläser und, sonderbarerweise, Unterschriften von Professoren erscheinen halb und durcheinander, wie auf einem futuristischen Bild. Da ist die kleine Freitreppe, drei Stockwerke hoch, und ich entsinne mich der Sensation, die es bei uns Schülern machte, als wir einmal den Katecheten mit dem jüdischen Religionslehrer in trautem, ernstem Gespräch, haltmachend nach jedem zweiten Schritt, die Stufen hinaufsteigen sahen. Im ersten Stock haftet der Blick parsifalisch gebannt lange an der Türaufschrift: Lehrmittelkabinett. Freundlich-schlimme Magie wirkt aus dem Wort. Auch aus der Aufschrift «Sprechzimmer» weht ein erregendes Fluid. Ich möchte hineingehen und mich nach den Lernerfolgen eines Schülers erkundigen. Ob ich die Antwort bekäme: «Der Junge könnte ja, wenn er nur wollte!»? Eigentlich nimmt meine Seele das Wiedersehen mit der Schule in Wurschtigkeit hin. Auch ein Abstecher ins Klosett, Erinnerung an manche Viertelstunde sabotierter Unterrichtszeit weckend, vermag daran nicht viel zu ändern.
Wie ich den Bezirk der alten Straßen verlasse, habe ich so ein gewisses leeres Gefühl. Sympathetische Schrift der Vergangenheit, für Minuten heraufentwickelt, blaßt wieder zurück in ihre Unsichtbarkeit. Dies ist Gesetz: Aller Text muß versickern ins Papier, auf das er geschrieben ward. Zum Ende ist das Papier so leer wie zum Anfang.
Immerhin werde ich jetzt bis zu meiner Tage letztem nicht vergessen, wie der Schuldiener geheißen hat. Er hieß Kutscher. Oder Kürschner? Küttner? Ach Gott, wie hieß er denn nur?
Die Stufe
Das Kinderfräulein bezichtigte den fünfjährigen Hans der Lüge. In der Tat, er hatte gelogen, aber er wollte das durchaus nicht zugeben.
«Also hast du gelogen?»
«Nein.»
«Überlege es dir gut: Du hast nicht gelogen?»
«Nein.»
«Na schön, ich werde es ja bald genau wissen!»
«Wieso wirst du es wissen?»
Das Kinderfräulein hatte veraltete Erziehungsmethoden. Es sagte: «Wir gehen jetzt nach Hause. Hast du gelogen, so wird die dritte Stufe der Treppe, wenn du auf sie trittst, unter dir einbrechen, und du wirst tausend Meter tief hinunterfallen.»
Hans wurde blaß. Er sprach kein Wort mehr auf dem Nachhauseweg. Er überlegte, ob er nicht doch die Lüge gestehen solle, konnte sich aber, denn er war ein Charakter, nicht hierzu entschließen.
Nun standen sie vor der Treppe.
«Ich frage dich zum letzten Mal: Hast du gelogen?»
Der kleine Knabe schüttelte, und sein Herz schlug heftig, den Kopf.
Vor der dritten Stufe machte er eine Sekunde halt. Langsam, sehr zögernd, setzte er die Fußspitze auf sie, probierte vorsichtig, probierte noch einmal etwas kräftiger, stellte den einen Fuß auf die Stufe, schließlich mit heroischer Selbstüberwindung auch den zweiten. Es geschah nichts.
Der Lügner, auf die Stufe deutend, rief strahlenden Angesichts:
«Sie muß verdorben sein!»
Eine Sechzehnjährige
Eine Sechzehnjährige hat sich im Arrest erhängt. Sie kam zur Polizei und bat um ein «Gesundheitsbuch», wie es die weibliche Jugend braucht, um die Geschlechtsfreude, die ihr Leib birgt, im freien Straßenhandel ausbieten zu dürfen. Die Behörde duldet kein wildes Hausierwesen. Auch der Verschleiß von Sexualität ist an Lizenzen gebunden.
Eine Leichtsinnige hätte sich nicht viel um Vorschriften gekümmert. Anna aber war ein polizeifrommes Mädchen, wissend, was Gesetz ist. So ging sie hin zum Vater Staat und bat um die Erlaubnis.
Mit sechzehn Jahren erhalten die Mädchen bei uns daheim noch kein Gesundheitsbuch. Mit vierzehn dürfen sie in die Fabrik, mit siebzehn erst bekommen sie das Prostitutions-, mit zwanzig das Wahlrecht.
Der Polizeimensch, vor dem die Anna stand, mußte sie abweisen. Doch da er ihre Bestürzung sah und wie sie traurig sich wandte, ihres Weges zu gehen, erbarmte ihn der Kleinen, und er rief sie zurück und steckte sie in den Arrest, in dem sich außer Ungeziefer noch drei verirrte Mädchen befanden, die vom Pfade ihrer vorbestimmten Entwicklung zu Dienstboten abgewichen waren.
Was soll man denn mit einer jungen Person anfangen, die keine Tugend hat und noch nicht das gesetzliche Alter hiezu?
Soll man vielleicht gut zu ihr sein und ihr freundliche Worte geben und Ratschläge und ihr zeigen, wo der Zimmermannssohn das Loch gelassen hat, durch das Licht auch in die Finsternis fällt.
Die Löcher, auf die der Polizist Mühselige und Beladene verweist, sind nicht von solcher Art.
Im Arrest ist es still und friedlich. Durch die Mauern, die ihn umgrenzen, dringt der Verführung Stimme nicht. Sicher vor den tödlichen Lockungen des Lichts, der Sonne sowohl wie der Bogenlampe, bist du, kleine Motte. Speise und Trank, die deinen Leib nicht ungebührlich reizen, trägt der sorgliche Wärter dir zu, Stunde um Stunde fließt im Gleichmaß dahin, und deine Seele hat Zeit und Ruhe, sich mit sich selbst vertraut zu machen.
Dennoch war Anna nicht zufrieden.
Sie empfand es nämlich als Treubruch, daß man sie in den Arrest gesteckt hatte. Als einen Überfall, an ihr Wehrlosen, Gutgläubigen verübt. Ihre Freiheit hatte sie unter den Schutz der Obrigkeit gestellt und wurde deshalb von der Obrigkeit ihrer Freiheit beraubt. Das schien ihr Betrug. Die moralische Ordnung, der sie sich eingegliedert wähnte, stürzte zusammen.
Und auch darum, glaube ich – nicht nur aus Furcht vor Besserungs- und Arbeitsanstalt und den Streck- und Quetschmethoden, mit denen dort aus der Balance geratene Individuen auf Gleich gebracht werden – hat sie sich am Fensterkreuz ihrer Zelle erhängt. Weil sie keinen Boden mehr unter den Füßen fühlte und ganz ohne Stützpunkt kein Mensch sein kann.
«Der Mensch»
Da gibt es eine Ausstellung «Der Mensch», die in Bildern, Präparaten, schematischen Darstellungen und bezaubernd anschaulichen Mechaniken den Menschen zeigt, wie er leibt und wie er lebt, wie er sieht, hört, riecht, schmeckt, fühlt, atmet, verdaut, sich abnützt und erneuert, wie sein Herz robotet, seine Nerven spielen, seine Nieren filtern, seine Muskeln schwellen, seine Haare sprießen, sein Darm und sein Hirn anmutig sich winden, kurz, die alles zeigt, was unter, in und auf der lebendigen Menschenhaut sich ereignet. Oh, es gibt Dinge zwischen Schädeldach und Fußsohle, von denen eure Schulignoranz sich nichts träumen läßt!
Vieles erfährt man hier von des Menschen Wohl und Weh und von dem Erstaunlichen, das die Maschine, die er darstellt, leistet.
Zum Beispiel gibt es da einen riesigen gläsernen Kübel voll Himbeerwasser, und dieses ist die Blutmenge, die das Herz in einer halben Stunde durch den Körper pumpt. Oder man sieht eine Eisenzange (an deren Hebeln ein 50-Kilo-Gewicht wirkt) vergeblich bemüht, eine Haselnuß zu öffnen, die unsere Zähne ganz leicht knacken. Was Kiefer imstande sind! Auch wird die Nahrungsmenge gezeigt, die ein erwachsener Mann mit dem Appetit und den Bezügen eines Normal-Bürgers zu Normal-Zeiten im Lauf eines Jahres durch seine Därme jagt. Käse ißt er verhältnismäßig wenig, einen halben Edamer pro anno.
Ja, das ist alles sehr schön und schauenswürdig, was «Der Mensch» zu schauen gibt … aber der Mensch ist nicht nur Körper, sondern, wie bekanntlich schon die indische Sankhyaphilosophie des Kapila lehrt, auch Seele. Und von dieser macht sich die Ausstellung gar nichts wissen. Schade. Ihre Methoden der Darstellung und Veranschaulichung, angewandt auf das Gebiet der Psyche … was für wunderbar lehrreiche, aufregende Schauobjekte gäbe das!
Zum Beispiel einen riesigen Kübel, angefüllt mit Papierfetzen, Staub und zerbrochenem Kram, um zu veranschaulichen, was während eines Lebens von durchschnittlicher Dauer die Seele eines Durchschnitts-Menschen an Illusionen ausscheidet. Daneben, als mikroskopisches Präparat: was sie von ihnen behält. Zur sinnvollen Ausschmückung wäre über dem Kübel bildlich etwa darzustellen, wie ein Jüngling mit tausend Masten in den Ozean schifft, indes über dem mikroskopischen Etwas ein Greis zu sehen wäre, still, jedoch auf gerettetem Boot.
Oder ein anderes Schauobjekt: ein Apparat, der zeigte, wie viele Proteste ein ausgewachsener Wille im Lauf von zwölf Monaten hinunterschluckt, a) ein gerader, unverkümmerter Wille, b) ein in erotische Beziehungen verstrickter.
Oder ein Maschinchen (von jedem Besucher selbst durch Druck auf einen Knopf zu bedienen), das sinnfällig machte, wie der Besucher aussieht und wie er – Druck auf den Knopf – aussehen müßte, wenn das Antlitz in der Tat Spiegel des Innern wäre. Oder eine Tabelle, die ersichtlich machte, welches Übermaß an Hirn- und Nervenkraft das reife Individuum tagtäglich verbraucht, um den Haderlumpen in sich zu bändigen. Nebst einer Zerlegung dieses erschütternden Vorgangs in seine Zwischenphasen. Oder eine Darstellung der langsamen, aber sicheren Abstumpfung, Lähmung, Ertaubung, nekrotischen Zersetzung des Urteilsvermögens durch regelmäßige Zeitungslektüre. Oder: was ein grundehrlicher Mensch in vierundzwanzig Stunden zusammenlügt, a) in der Großstadt, b) in Orten unter zwanzigtausend Einwohnern.
Schade, daß die Ausstellung den Menschen nur zeigt, wie er leibt, und nicht, wie er seelt.
Doch auch halb, wie sie ist, ist sie sehr interessant. Ganz verlegen wird der Mensch, sich so durchschaut zu sehen, ganz kleinmütig macht ihn die Vorstellung, nichts zu sein als lauter Mechanik und Chemie. Aber dann denkt er an die Haselnuß mit dem ohnmächtigen 50-Kilo-Gewicht oder an den Kartoffelberg, den er in zwölf Monaten verschlingt, oder an den rastlosen Fleiß seines Röhrensystems, an die unermüdliche Arbeit seines Inwendigen, auch wenn das Auswendige noch so faulenzt – und gleich ist er wieder arrogant.
Wer in diese Ausstellung geht, geht in sich. Und kommt nicht ohne ein erhebliches Mehr an Demut und Hochmut wieder heraus.
Traktat vom Herzen
Das Herz ist herzförmig, wird gern mit einer Uhr verglichen und spielt im Leben, besonders im Gefühlsleben, eine große Rolle. Da ist es gleichsam das Ding für alles, der Auffänger aller Erschütterungen, die Sammellinse aller Strahlen, das Echo allen Lärms. Es ist der verschiedenartigsten Funktionen fähig. Es kann zum Beispiel erglühen wie ein Scheit Holz, an etwas gehängt werden wie ein Überrock, zerrissen sein wie eben ein solcher, laufen wie ein gehetzter Hase, stillstehen wie die Sonne zu Gideon, überfließen wie die Milch im Kochtopf. Es steckt überhaupt voll Paradoxien.
Der Härtegrad des wunderlichen Gegenstands schwankt zwischen dem der Butter und dem des Felsgesteins oder, nach der mineralogischen Skala, von Talk bis Diamant. Man kann es verlieren und verschenken, tropfendicht verschließen und restlos ausschütten, man kann es verraten und von ihm verraten werden, man kann jemand in ihm tragen (der Jemand muß davon nicht einmal etwas wissen), man kann es in alles mögliche hineinlegen, das ganze Herz in ein Winzigstes, in ein Nichts an Zeit und Raum, in ein Lächeln, einen Blick, ein Schweigen. «Herz» ist gewiß das Hauptwort, das der erwachsene zivilisierte Mensch, sei sein Vokabelschatz groß oder klein, am öftesten gebraucht. Und stünde dieses eine Wort unter Sperre: neun Zehntel aller Lyrik wäre nicht. Daß sich Herz auf Schmerz reimt, wie cœur auf douleur, dürfte mehr sein als Klangzufall, nämlich Symbol einer besonders nahen und häufigen Beziehung.
Zumeist also ist in unserem Denken und Sprechen das Herz metaphorisch gemeint – und solange dies der Fall, bleibt alles, auch wenn es Ernst ist, noch Spiel, Spiel, das sich ändern, Verlust noch immer in Gewinn wandeln kann. Wirklich schlimm ist es erst dann um ein Herz bestellt, wenn nicht mehr in Vergleichen und Bildern von ihm gesprochen wird, wenn die Metaphern sich von ihm zurückziehen (wie Masken sich verlaufen, nimmt das Fest eine unheimliche Wendung), wenn von seinen Bewegungen auch die kühnen und großartigen unerheblich geworden sind, und nur noch die meßbaren, die rein mechanischen etwas bedeuten, wenn es auf seine Melodien gar nicht mehr ankommt, nur noch auf den nackten Rhythmus. In solcher Stunde ist wenig Poesie mehr um das arme Ding. Da wird furchtbar gleichgültig, wofür es schlägt, wenn es nur schlägt, da erlassen wir dem edlen Herzen gern jede Funktion, durch die es sich vom unedlen unterscheidet, wenn es nur die physiologische erfüllt, die es mit ihm gemein hat.
Und doch, gerade in solcher Stunde, wenn das Herz gar keine andere Rolle mehr spielt als die sachliche, die ihm von der Natur übertragen ist, nichts mehr mit seinem Schlag erstrebt als den nächsten, nichts mehr will als sich selbst, keinen Vergleich mehr zu rechtfertigen den Ehrgeiz hat als den mit der Uhr, die geht … gerade in solcher Stunde, wenn es nur noch ein klägliches, verneddertes Maschinchen ist, dem kein Öl mehr hilft, gerade dann erscheint es als ein Ding von unermeßlicher Würde und Hoheit. Und zwischen Farben und Formen ringsum, gespenstig schimmernd im Phosphorlicht des Lebens, ist es wie zwischen üppigem Gesindel eine arme Majestät.
Frühlingsrauschen
Es gibt ein Klavierstück von Sinding: ‹Frühlingsrauschen›, ein gefälliges Stück, überall zu Hause. Eine klavieristische Butterblume, caltha palustris pianof. comm. Heimpianisten werten die Nummer hoch; sie versetzt Ellbogen wie Gemüt in beglückend weiche Schwingungen. Angenehm flutscht das von oben nach unten und von unten nach oben, schwillt an, schwillt ab, säuselt, stürmt, verhaucht und braust daher und dahin … also kurz: Frühlingsrauschen.
Schwer ist die Nummer nicht. Immerhin muß man schon spielen können, um sie spielen zu können.
Irgendwo in meiner nächsten Nähe haust ein Wesen, das spielt manchmal in der Morgenstunde ‹Frühlingsrauschen›. Halbe Monate verhält sich das Wesen ganz still. Dann kommt eine Tagereihe, da Morgen für Morgen der Frühling über die nachbarlichen Tasten rauscht. Ein paar Wochen Pause … plötzlich, acht Uhr früh, das bekannte Rauschen … und dann wieder viele Tage nichts.
Es ist, als ob das unheimliche Geschöpf nur manchmal auftauchte, einen tüchtigen Schluck Frühlingsrauschen zu sich zu nehmen, und dann wieder für längere Zeit verschwände.
Beunruhigend und verwirrend an dem Tun des seltsamen Menschen ist, daß er nie etwas anderes spielt als jenes Frühlingsrauschen. Er bringt nur dieses einzige Stück hervor. Er gibt keinen anderen Klavierlaut von sich. Und könnte es doch (da er dieses kann), wenn er nur wollte. Welcher Fluch lastet auf der beklagenswerten Kreatur, daß ihren Tasten tastenden Fingern alles zu Frühlingsrauschen wird?
Ich kann nicht genau bestimmen, woher der Klavierklang kommt. Jedenfalls aus einer Wohnstatt unter der meinen. Die rechts von mir hegt einen europabekannten Dichter, der nicht Klavier spielt, der nur die Leier schlägt, und dies mit Recht. Und links gibt es kein Quartier mehr. Erst zwei Stockwerke tiefer stößt das Haus an das Nachbarhaus. Über meiner Wohnung das Dach, drüber Dunst und Rauch, drüber atmosphärische Luft, drüber der reine Äther und über ihm, Brüder, muß ein guter Vater wohnen. Diese Gegenden kommen also nicht in Frage. Der Spieler sitzt tiefer und tiefer, erdnäher. Vielleicht, wahrscheinlich, ist es eine Frau. Oder ein Irrer. Ein Geschöpf, durch schreckliches, durch süßes Erlebnis verfallen der Piece …
Warum, Unfaßbarer, immer nur das eine Stück? Warum niemals ‹Die Mühle im Schwarzwald›? Oder ‹Träumerei›? Oder ‹Blümlein traut sprich für mich›?
Der Fall ist, wie immer betrachtet, problematisch. Es wird Leute geben, die sagen, er sei überhaupt nicht zu betrachten, er sei unbeträchtlich.
Aber ist das nicht gruselig, schmerzhaft, das Weltbild trübend, daß einer ein Klavier hat, spielen kann und seit acht Jahren niemals, niemals etwas anderes spielt als ‹Frühlingsrauschen›? Die Welt steckt gewiß voll Monomanen, z.B. Verdienern, die mit ihrem Geld alles mögliche machen könnten und doch mit ihm nichts machen, als wieder Geld verdienen, oder Liebenden, die ihre Phantasie jahrzehntelang zur Verklärung ein und derselben Gans mißbrauchen. Aber diese Traurigen expliziert zur Not das Wort: Leidenschaft.
Wie jedoch verstehe ich den musikalischen Dämon, der, in Menschenhülle gebannt, als einzige Nahrung die Butterblume kaut und wiederkaut?
Ich verstehe ihn ganz und gar nicht.
Er ist eine Pointe, zu der die Geschichte durchaus fehlt.
Sie hinzuzuerfinden, wäre leicht. Aber die Entwicklung geht ja dahin, den Leser von Bevormundung durch den Schriftsteller zu befreien. Dies ist wesentliche, vielleicht wesentlichste Forderung neuer Geistökonomie.
Luftballon
Das Kind des Hauses hatte einen Luftballon. Er war mit gewöhnlicher atmosphärischer Luft vollgeblasen, hatte also wenig Auftrieb. Er war nur ungemein leicht, phantastisch leicht, beglückend schwerlos. Er war hellgrün. Licht, das durch ihn schien, machte ihn zauberisch. Er sah dann aus wie der Mond im Märchen.
Der Ballon stammte aus dem Nachtlokal. Er hatte dort, mit einer Schar vielfarbiger Brüder, zum Spaß der Trinkenden und Tanzenden gedient. Der Herr warf ihn der Dame zu. Das hieß: «Willst du?» Die Dame warf ihn dem Herrn zurück. Das hieß: «Na, ob ich will!» Und wenn sie ihn auch nicht zurückwarf, hieß es doch dasselbe. Mancher Bruder Ballon starb in jener Nacht. Der eine geriet an die brennende Zigarre, der andere wurde an Fräuleins Stelle von einem Eifersüchtigen totgeschlagen, dem dritten schlitzte ein Gentleman aus blankem Übermut das Bäuchlein auf.
Diesen hellgrünen hatte die Mama des Kindes heimgebracht. Einesteils des Kindes wegen, andernteils wegen der Erinnerungen, die um ihn schwebten. Er lag des Nachts neben der Puppe, und der große Andersen hätte die beiden gewiß ein Gespräch führen lassen. Tagsüber hatte er wenig Ruhe. Wer ihn sah, gab ihm einen Schubs, warf ihn hoch und fing ihn wieder oder wog ihn zumindest in hohler Hand und hatte Lustgefühle ob des kaum merklichen Gewichts dieser großen grünen Kugel.
Einmal kam der Ballon in das Zimmer, in dem die Erwachsenen um den Teetisch saßen, die Zeit gesprächsweise verrinnen ließen und in die Zeit verrannen. Der Ballon war gleich Mittelpunkt des Kreises. Zu nett, wie er zwischen Gläsern und Porzellan tanzte, selbst das Gebrechlichste nie gefährdend. Er war so leicht, daß er auf der Blume in der Vase sitzen konnte, ohne den Stengel auch nur um ein geringes hinabzubiegen. Ganz wie ein Schmetterling.
Unter Gelächter und Erhitzung war alles mit ihm beschäftigt. Man spielte Kopfball oder rollte ihn wie eine Kegelkugel oder ließ ihn über Arm und Schulter laufen oder warf ihn einfach einander zu. Einer ließ ihn auf emporgestellter Fingerspitze balancieren, stieß ihn hoch, daß er wieder auf der Fingerspitze landete. Es war eine Laute vorhanden, und wenn man den Ballon auf ihr tanzen machte, gaben die Saiten geheimnisvollen Flüsterton. Wenn er aber auf der Schüssel ruhte, sah er aus wie eine Riesenbeere.
Eine inhaltsreiche, genußvolle Stunde. Das aufgeblasene Stück glasgrüner Haut übte Faszination. Das Leben wurde leicht, die Versammlung Schulklasse, das Zimmer Wiese.
Es war wie Erlösung von der Schwere durch einen Luftballon. Das ist ja schließlich, schon im mechanischen Sinn, Luftballons Mission.
Leider geriet der Grasgrüne an die scharfe Kante eines Metallrahmens. Seine Seele, sich dem All vermischend, fuhr aus der Haut, die, nun ein elendes Stück Runzelzeug, wandabwärts zur Erde kroch. Alle trauerten um den Verlust des Spielzeugs, schämten sich aber ihrer Trauer. Nur das Kindchen war ehrlich und mutig genug, laut zu heulen. Es wurde deshalb auch streng angefahren und aus dem Zimmer geschafft.
Wahrheit führt irre
Das Gesicht ist ein Vexierspiegel der Seele, und die Physiognomie eine unsichere Wissenschaft. Nur wenn man genau weiß, was und wer einer ist, kann man es ihm von den Zügen ablesen. Auf diesen relativ verläßlichen Grundsatz sind die physiognomischen Untersuchungen Lavaters, Goethes Freund, gestützt. Das Antlitz etwa Julius Caesars betrachtend, findet er in der Gesichtsbildung des großen Staatsmanns und Soldaten die unübersehbaren Zeichen staatsmännischer und soldatischer Größe. Fehlt solches Wissen um das Charakteristische der Person, aus deren Aussehen auf ihr Charakteristisches geschlossen werden soll, dann sind Irrtümer kaum vermeidbar. Deshalb ist auch bei dem anregenden Gesellschaftsspiel: «… Sage mir, ohne den erläuternden Text zu lesen, was für eine Sorte Mensch dieses Bild in der Zeitung darstellt …» Fehlraten die Regel, Ozeanflieger werden da leicht für Bankdirektoren gehalten oder umgekehrt, Sechstagefahrer für Nobelpreisträger, prominente Verbrecher für Filmstars.
Das Spiel kann man statt mit Bildern natürlich auch mit lebenden Personen spielen. Hier ist richtig zu erraten leichter, weil ja nicht nur das Gesicht des betreffenden Individuums, sondern auch dessen Haltung, Erscheinung, Gehaben Aufschluß geben. Sollte man meinen.
Ich bin mit dem Freund im Wirtshaus. Es kommt ein Paar herein, nimmt am Nebentisch Platz. Der Freund kennt die zwei und gibt zu raten auf, von welcher menschlichen Art der Mann und von welcher die Frau und wie die Beziehung der beiden zueinander sei. Er fragt das in einem zwinkernden Ton, so als wollte er seine Gewißheit markieren, daß die Antwort falsch ausfallen müsse.
Der Mann am Nebentisch hat gemeine Züge. Einen Schädel wie eine Faust, bösewichtfarbenes Haar, kurzen Hals, Pratzen, eine Stimme, die aus dem Mund hervorkommt wie ein schlechtgelaunter Köter aus seiner Hütte. Er nimmt viel Platz ein. Die Frau sitzt bemitleidenswert klein und arm da, ein Pflänzchen neben einem dicken Stamm, der ihr die Sonne wegnimmt. Er ist unwirsch, sie verschüchtert. Er kümmert sich kaum um die Begleiterin, die von Zeit zu Zeit mit angstvollem Blick zu ihm aufschaut. Er ist ganz Brutalität, sie ganz Zartheit. Er kann nicht lachen, sie, offenbar, darf nicht. Er hat eine Stirn, so flach wie das Brett vor einer solchen, die ihrige ist durchmodelliert, und vieles könnte dahinter wohnen. Er schreit mit dem Kellner, sie legt krankenschwesterlich beruhigend die Hand auf seinen Arm. Er knurrt den Hausierer weg, sie kauft dem Mann ein Paket Zündhölzchen ab und schenkt es dem Pikkolo.
Also antwortete ich, meiner Sache gewiß, ohne Zögern:
«Der Mann ist Künstler, vermutlich Maler, eine differenzierte, empfindsame Natur. Er kann keiner Fliege etwas krümmen, steckt voll Hemmungen, ist scheu, weich, wärmebedürftig. Er weiß nicht, wohin mit der Fülle von Zärtlichkeiten, die sein Nervensystem beunruhigen und ihm das Herz bis zum Platzen spannen. Er liebt die kleine Frau abgöttisch und ist ihr hörig. Er wagt in ihrer Nähe nicht recht zu atmen, aus Angst, sie fortzublasen. Er ist gutmütig bis zur Selbstaufgabe und von pudelhafter Dankbarkeit für jeden Brocken Güte, den ihr Blick, ihr Lächeln ihm hinwerfen. Sie hingegen ist eine Bestie, kalt und böse. Ungeistig, aber von schöpferischer Phantasie, wenn es gilt, ihn zu quälen. Seine rückhaltlose Ergebenheit reizt sie zum Mißbrauch ihrer Macht, sein sanftes Wesen, das er, zum Selbstschutz, hinter rauhen Manieren versteckt, ist ihrer Roheit ein beständiger Vorwurf, der diese steigert. Er brüllt Harmloses, sie lispelt Gift. Sie rächt sich an ihm, weil er, der Schwere und Plumpe, der feine, zarte Mensch ist, der sie zu sein scheint.»
«Ganz falsch!» sagte triumphierend der Freund und schlug eine Lache auf, in der sein Triumph sich spiegelte. «Ganz falsch! Die beiden sind meine Wohnungsnachbarn, ich kenne sie genau. Das mit dem Maler stimmt beiläufig, der Mann ist nämlich Anstreichermeister. Aber sonst stimmt gar nichts. Schau dir die beiden doch an: ihr wahres Gesicht steht ihnen ja auf dem Gesicht geschrieben! Er ist ein ordinärer Kerl in jeder Beziehung. Säufer, und auch im nüchternen Zustand exzessiv wie ein Besoffener. Die Frau ist ein Engel. Er prügelt sie, mißhandelt sie körperlich und seelisch. Und du hast dich mit deinem Scharfblick hundertprozentig blamiert.»
Die beiden waren also genau so, wie sie aussahen! Merkwürdige und schmerzhafte Enttäuschung. Ich empfand diese Übereinstimmung zwischen Äußerem und Innerem, zwischen Oberfläche und Tiefe als unangenehmen Mißklang, den perzipieren zu müssen, ein leichtes Schwindelgefühl hervorrief. Ist also selbst dies Trug, daß der Schein trügt? Wie soll man sich noch halbwegs auskennen, wenn die Masken nicht rechte Masken, sondern wirkliche Gesichter sind?!
Das mit der Blamage des Danebenratens aber war nicht so arg, denn schließlich, wenn einer hinterhältig und mit fallenstellerischer Stimme fragt: «Wieviel, glaubst du, ist zweimal zwei?» kann man doch nicht antworten: «Vier.»
Übrigens hat sich dann herausgestellt, daß die Frau Vergnügen daran findet, mißhandelt zu werden, und der Mann ihr den Gefallen tut. Und daß er sie aus Liebe nicht liebt, weil sie ihn nämlich nicht lieben würde, wenn er sie liebte. Die Menschen sind ja, selbst in bittersten Krisenzeiten, so kompliziert.
Verdacht gegen die Dinge
Es war spätabends und ich der einzige Gast im Lokal, als der Professor (so nannten sie ihn dort) hereinkam. Er schien in dem Stadium: nicht mehr nüchtern und noch nicht betrunken, und da hat der Mensch ein Bedürfnis nach Gesellschaft und Aussprache. Also steuerte er auf meinen Tisch zu. Im Begriff, sich niederzusetzen, zögerte er und verlangte einen anderen Stuhl.
«Wackelt er?» fragte die Kellnerin und rüttelte an dem Stuhl, der nicht wackelte.
«Egal», sagte der Professor, «mir ist der verdächtig.» Wir kamen ins Gespräch, und ich erfuhr, daß er Gymnasiallehrer war (Latein und Griechisch) und seine Schüler haßte. Weil sie ihm böse Streiche spielten. Als die Kellnerin den Rollbalken halb herunterließ, sagte er: «Mein Gott, schon bald Schluß. Ich gehe schrecklich ungern nach Hause.»
«Sie sind verheiratet?»
«Nein. Aber hier ist es so schön still.»
«In Ihrer Wohnung nicht?»
«In meinem Zimmer? O ja, sogar sehr. Nur anders. Nämlich, die Stille bei mir verhält sich nicht ruhig. Besonders nachts. Horcht man ein wenig schärfer hin, so kann man hören, wie sie vor sich hin summt. Und das weckt die Dinge auf.»
Ich muß ihn ziemlich verdutzt angesehen haben, denn er fügte gleich selbst hinzu: «Das klingt ein bißchen seltsam. Aber aus mir spricht nicht der Alkohol. Oder glauben Sie vielleicht, hier –» er tippte auf seine Stirn – «ist etwas in Unordnung? Ich versichere Ihnen, die Trübungen meines Geistes überschreiten nicht das jedem Kulturmenschen in diesem Punkt zugebilligte und auch von ihm kaum vermeidbare Minimum. Es ist nur eben so, daß ich den Dingen in meinem stillen Zimmer nicht traue. Es sind ja nur wenige, aber immerhin viele gegen einen, und ich habe sie im Verdacht, daß eine Art von Kameraderie zwischen ihnen besteht, eine Art von Einverständnis zu tückischem Zweck. Ich lasse die Dinge natürlich nichts merken von meinem Verdacht, tue, als beachtete ich sie gar nicht. Aber ich habe das widrige Gefühl, sie beachten mich.»
«Einbildung», sagte ich, um etwas zu sagen, obwohl mir ganz einleuchtend schien, was er da erzählte. «Ihre ganz persönliche Spezialität von Budenangst.»
Der Professor zuckte die Achseln. «Mag sein. Immerhin, Vorsicht kann nicht schaden.»
«Wie meinen Sie das?»
«Sehen Sie, ich bin in der traurig-lächerlichen Lage des Ehemannes, der ahnt, daß er betrogen wird. Die Gewißheit, daß er’s nicht wird, kann er sich nicht verschaffen, und die Gewißheit, daß er’s wird, würde ihn unglücklich machen. Also scheut er davor zurück, sie zu bekommen. Verstanden, was ich meine? Wenn ich heimkomme, versäume ich nie, noch vor der Tür ein wenig überschüssigen, absichtlichen Lärm zu machen. Ich will nicht überraschen, besser: ich will nicht überrascht werden. Vielleicht haben die Dinge meine Abwesenheit benützt, um sich gehenzulassen und allerlei Unfug zu treiben. Und sollen sie gewarnt sein, rechtzeitig in ihre gewohnte Ordnung zurückzuschlüpfen. Ich will sie nicht in flagranti erwischen. Tatsächlich ist es auch, gottlob, noch nie dazu gekommen. Immer steht, liegt, hängt alles im Zimmer so, wie ich es verlassen habe. Aber immer auch ist mir’s, als spürte ich in ihm noch den Nachhall einer plötzlich abgestoppten Unruhe. So geht’s mir in der Schule mit den elenden Buben. Wenn ich an der Tafel mich plötzlich umdrehe, glaube ich in ihren Gesichtern noch ein Zucken der Grimassen zu sehen, mit denen sie mich hinter meinem Rücken verhöhnt haben.»
Aha, dachte ich, da haben wir’s. Die Dinge in seinem Zimmer sind Symbole für die Jungen in seiner Klasse. Dem Mann sind seine Lehrer-Kalamitäten zu Kopf gestiegen.
«Wenn sie mich schlafend glauben», erzählte er weiter, «werden die Dinge besonders munter. Dann heißt es, ihr Treiben in die Schleife eines logischen Zusammenhangs hineinzukriegen. Zu dem Spiel gehören Nerven, das dürfen Sie mir glauben. Das Stück Papier, das plötzlich zu Boden raschelt, gewiß hing es schon längst über die Tischkante hinaus, glitt lautlos immer tiefer und verriet, daß es in Bewegung war, erst durch deren hörbaren Schlußeffekt. Das Knistern der Wand – vermutlich ein Sprung in der morschen Tapete, der sich erweitert. Ich träumte einmal, daß ich schlafe (auch das kann man träumen) und aus dem Schlaf geweckt werde durch ein Licht, das im Raum herumgeisterte. Angst lähmte mich. Und dann sah ich, daß ein Mann im Zimmer war, eine Blendlaterne in der Hand. Sie können sich nicht vorstellen, wie wohl mir der Anblick tat. Lieblich wie der Mond ging die Kausalität auf! Und meine Angst war weg. Das heißt, ich hatte noch immer welche, der Mensch sah bedrohlich genug aus, aber es war eine mit Behagen gemischte Angst. Ich sah, im ersten Augenblick zumindest, in ihm nicht den Einbrecher, sondern den natürlichen Bundesgenossen gegen die Dinge. Dann wachte ich auf. Das Zimmer war still und finster, der Schrank knarrte ohne jeden zulänglichen Grund, und mir tat’s wahrhaftig leid, daß der Kerl weg war.»