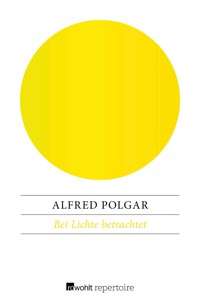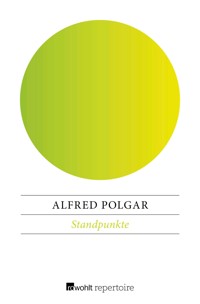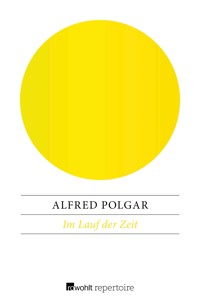
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Alfred Polgars Prosastücke haben in unserer Literatur Seltenheitswert. Es sind geistreiche Idyllen und scharfsinnige Stimmungsbilder, zarte Satiren und behutsame Pamphlete.» (Marcel Reich-Ranicki).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Alfred Polgar
Über Alfred Polgar
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Gespräch über das Alter
Der Philosoph Anaxias, Zeit- und Ortsgenosse des Sokrates, hatte einen harten Tag des Lebens und Schreibens hinter sich und das Bedürfnis, ein wenig Bewegung zu machen. Durch die Straßen schlendernd kam er zu einem Platz, wo Ringer einen Schaukampf zum besten gaben. Anaxias blieb stehen und sah zu. Viel Volk hielt die niederen Mauervorsprünge der Häuser rundum besetzt und ein oder der andere stand auf, dem würdigen, weißhaarigen Herrn seinen Platz anzubieten.
«Danke, ich stehe lieber.»
«Nein doch», beharrte ein Anbieter. «Setz dich nur.»
«Warum soll ich mich denn durchaus setzen?»
«Nun hör einmal! Ein Mann in deinen Jahren?»
Darauf erwiderte Anaxias nichts, sondern ging weiter, weniger leichten Schrittes, als er vorher gegangen war. Auf dem Heimweg trat er in eine Schenke, und der Wirt, nach einem prüfenden Blick auf den Gast, brachte eine Kanne Zider an den Tisch. Anaxias schob das Gefäß von sich. «Keinen Apfelsaft. Wein!»
«Wie du willst», sagte der Wirt, «aber Zider ist gesünder für Leute deines Alters.» Den Dialog unterbrach der Eintritt Phlotions, eines Schülers des Philosophen. Er setzte sich zu dem Lehrer. «Du siehst ein bißchen müde aus, Anaxias. Fehlt dir etwas?»
«Nichts Besonderes.»
«Du solltest dich mehr schonen. Ein Mann in deinen …»
«Fang du nicht auch noch damit an, Knabe», sagte Anaxias ärgerlich. «Meine Jahre würde ich nicht merken, wenn man mich nicht immerzu an sie erinnerte. Mein Alter würde ich nicht spüren, wenn nicht die anderen darauf bestünden, daß ich es zu spüren habe.»
«Das geschieht doch nur aus Sorge um dich.»
«Schöne Sorge, die aufgezwungen wird, ob man sie braucht oder nicht! Glaubst du, es ist angenehm, wenn sich dir, sowie du Miene machst, von deinem Stuhl aufzustehen, eine ungebetene Hand unter die Achsel schiebt, nicht davon abzubringen, dein gemächliches Aufstehen in ein ungemächliches Aufgestandenwerden zu verwandeln? Laß dir sagen, keinen schlechteren Dienst kannst du einem Alten erweisen als ihm zu Bewußtsein zu bringen, daß er einer ist. Erzähle ihm, ich bitte dich, nichts von seiner erstaunlichen Frische! Zwänge ihm kein Kissen unters Gesäß, wenn er lieber hart sitzt! Rate ihm nicht zu Grießpapp, wenn er auf Knoblauchwurst Lust hat! Vom ‹Druck der Jahre› würde mancher, der sie auf dem Buckel hat, weniger merken, wären die guten Nebenmenschen weniger beflissen, auf den Druck zu drücken. Aber mach etwas dagegen! Trägt einer die Last des Alters leicht, so halten das die Leute für einen unnatürlichen Zustand, für eine Illusion, aus der der arme Mann gerissen werden muß … wenn sie’s nicht geradezu als ein ganz besonders bedenkliches Alterssymptom ansehen.»
«Nimm es nicht übel», sagte Phlotion, «aber …»
Anaxias winkte unwillig ab. «Unterbrich mich nicht, wenn ich im Zuge bin … Gewiß, der Spruch hat recht, der sagt: das Alter selbst ist eine Krankheit. Aber muß man sie den von ihr Befallenen bei jeder Gelegenheit zu Gemüt führen? Spricht man von einem, der mit den Nieren zu tun hat, konsequent als von einem Nierenleidenden? Oder von einem Phthisiker immer als: der Schwindsüchtige …? Nein. Aber ist von einem Alten die Rede oder Schreibe, fehlt nie ein Prädikat, das ihn an seine Krankheit, das heißt an sein Alter, festnagelt: der Greis; der Betagte; der Hochbetagte; und was es an Kosenamen dieser Spezies sonst noch gibt. Wahrhaftig, mich wundert’s, daß sie unsereinen mit ‹Guten Abend› grüßen und nicht mit ‹Guten Lebensabend›, damit man nur ja wisse, wo man hält. Ganz zu schweigen von dem perfiderstaunten ‹noch›, das unweigerlich in die Texte einfließt, mit denen zu Geburtstagen, Jubiläen oder dergleichen ein Alter bedacht wird. ‹Der alte Herr duscht sich noch jeden Morgen›; ‹der Hochbetagte ist noch ständiger Gast bei den Wagenrennen›; ‹der Greis trinkt noch seine zwei Kannen thrazischen Heurigen täglich›. Es liegt Vorwurf und Tadel in diesem scheinbar beifälligen ‹Noch›; als sollten die Alten gemahnt werden, sich vielleicht doch schon weniger in die Richtung: Leben, und lieber mehr in die Richtung: Tod zu orientieren … Aber was wolltest du vorhin sagen, Phlotion?»
«Ich wollte fragen, ob dich das viele Reden nicht anstrengt. Und möchtest du nicht eine Decke über die Beine? Hier kommt es kalt herein.»
«Höre», sagte Anaxias, «wenn du willst, daß wir Freunde bleiben, laß diese verdammten Faxen. Wenn mich das Reden anstrengt, höre ich damit auf, und daß frische Luft hereinkommt, ist mir angenehm … Gestern», setzte er seine Diatribe fort, «hatten wir eine junge Freundin meiner Frau zu Gast, und als sie sich zum Fortgehen fertigmachte, half ich ihr, ihren Himation in den richtigen fließenden Falten um die Schultern legen. Bezaubernde Schultern, wie von Phidias modelliert! Nachher sagte meine Chloe, die es, weiß Zeus, gut mit mir meint: ‹Willst du noch immer den Galanten spielen, du alter Esel?› Ihr Götter, wenn sie wüßte, was ich noch alles spielen wollte und könnte! Die Frauen, das ist ein besonders tragikomisches Kapitel in der Geschichte vom alten Mann. Traum und Sehnsucht, ihnen geltend, machen ihn – auch wenn er von der Ehe und ihren sittlichen Bindungen freigeblieben ist – machen ihn der Umwelt, merkt sie etwas davon, zum Gespött. Aus seinem Olymp muß Eros verschwinden! Hat er es noch mit der Liebe, inbegriffen, versteht sich, deren profane Regungen und Wünsche, so wird er zur lächerlichen Figur. Und zu einer abstoßenden überdies. Denn es gilt als etwas Unsauberes bei einem alten Mann, ein Mann zu sein. Ich sage dir, Phlotion, von mir verlangen, daß mich fraulicher Reiz und Zauber nicht mehr in Herz und Nerven treffen sollten, hieße von mir verlangen, bei lebendigem Leibe tot zu sein.» Als er so sprach, kam ein Glanz der Entzückung in seinen Blick, und ein Schimmer jugendlicher Schönheit breitete sich über sein unschönes, von tiefen Narben der Denk- und Lebensmühe zerrissenes Greisenantlitz; so daß Phlotion schon fragen wollte: «Hast du Fieber?» Aber er besann sich und schluckte die Frage hinunter.
«Noch eines, mein Sohn», sagte Anaxias lächelnd. «Wenn ich närrisches Zeug geredet habe, geschah es nicht mit Absicht. Wirr im Kopf nämlich wird der alte Mensch, ohne daß er dies wahrnimmt. Mit der Senilität ist es wie mit der Liebe: sie kommt und sie ist da. Und leider (oder soll ich sagen: den Göttern sei Dank?) liegt es in ihrem Wesen, daß sie dem, bei dem sie sich eingenistet hat, die Fähigkeit nimmt, ihre Anwesenheit zu bemerken.»
Damit erhob er sich und schritt, gefolgt von dem verwunderten Schüler, zum Ausgang der Schenke, wo Phlotion plötzlich schrie:
«Vorsicht, Anaxias, Stufe!»
«Hol dich der Teufel!» murmelte der Philosoph, über die Stufe stolpernd, was ihm ohne des Schülers Warnungsruf bestimmt nicht passiert wäre.
Ein Jahr im Studio
Vor etlicher Zeit nahm ein hilfsbereites Film-Studio in Hollywood ein paar europäische Schriftsteller (ich gehörte zu ihnen) in seine Dienste. Ein durchaus selbstloser Akt des Studios, denn es brauchte uns in keiner Weise und wußte, als wir ihm gehörten, mit diesem seinem Besitz nichts anzufangen. Doch ließ man uns noblerweise nicht fühlen, wie unnütz wir waren, machte uns die Stellung als quantités négligeables leicht. So verbrachten wir, von niemand gekränkt, ein Jahr auf dem gastfreundlichen «lot», zwar nicht beschäftigt, jedoch hierfür bezahlt. Kein idealer Zustand; aber immerhin besser, als wenn es umgekehrt gewesen wäre.
«Mach’ dich so wenig wie möglich bemerkbar!» so lautete der Rat in Studio-Dingen erfahrener Freunde. Und das war auch der Wunsch der Studio-Herren. Sie äußerten ihn nicht in klaren Worten, aber er war ihnen von den Augen abzulesen bei den spärlich gebotenen Gelegenheiten zu solcher Lektüre. Ich darf mir das Zeugnis ausstellen, daß ich redlich bemüht war, der Aufgabe, mich nicht bemerkbar zu machen, nachzukommen. Kein Verdienst, denn sie harmonierte aufs beste mit meinen persönlichen Anlagen und Neigungen.
So wäre das Jahr in ungetrübtem Frieden verlaufen, ohne das Zwischenspiel mit Mr. Bogojan.
Mr. Bogojan, balkanischer Herkunft, hatte in Europa mit dem Verleih von Filmen zu tun gehabt, nichts mit deren Produktion. In Hollywood fand er bei der Firma, für die er im alten Erdteil kommerziell tätig gewesen war, Unterkunft. Aber keine Beschäftigung. Ganz unser Fall also. Das Studio wußte mit Bogojan nichts anzufangen, wie es mit uns nichts anzufangen wußte. Was lag da näher als der Gedanke, diese zerstreut herumliegenden Non-Valeurs zusammenzutun? Das Studio entsann sich des Satzes, daß zwei Verneinungen eine Bejahung ergeben – «Litotes» nennen das die Grammatiker –, und unterstellte unsere Kompagnie der Führung des Mr. Bogojan.
Er war ein guter Mann, ohne sichtbare Flecke an seinem Charakter. Nur hatte er eine lästige Leidenschaft, nämlich: Leidenschaft. Dauernd befand er sich, grundlos, in feurigem Zustand. Wenn er das Gleichgültigste sagte, funkelte doch sein Auge, hatte seine Stimme den Tonfall stürmischer Bewegtheit. Und wenn er schwieg, schwieg er temperamentvoll. Er war wie ein stets straff gespannter Bogen. Ohne Pfeil. Den Filmen, die er uns, zur Einführung in die Kunst der Story-Ersinnung, vorführen ließ, saß er, obschon im Umgang mit pictures alt und grau geworden, in kindlicher Unblasiertheit gegenüber, schluchzend bei den traurigen, von Lachen geschüttelt bei den heiteren Szenen. Und es bedurfte wirklich voller Konzentration auf den vorgeführten Film, um von Gram und Freude, zu denen er unseren Mentor hinriß, nicht angesteckt zu werden. Es war nicht seine Schuld, daß die Inspirationen, die er uns aus eigenen geistigen Beständen zuteil werden ließ, auf unfruchtbaren Boden fielen.
«Ein Mann trifft eine Frau» – so beiläufig skizzierte er, flammend, was ihm als dankbarer Film-Stoff vorschwebte – «eine Frau, ein Weib, ein solches Weib», (er ballte die Fäuste) – «und er muß sie haben und – Sie verstehen – sie ist verrückt nach ihm, aber eben deshalb – Sie wissen, was ich meine. – Und da ist eine andere Frau, und – also mehr brauche ich Ihnen doch nicht zu sagen – und da folgt dann eine spannende Szene auf die andere – und zum Schluß nimmt das Ganze eine Wendung – eine Wendung …» (er knirschte mit den Zähnen) «– Sie wissen, was ich meine?»
Bogojan erlebte Enttäuschung über Enttäuschung an seinen hoffnungslosen Zöglingen. Die Gefühle, mit denen er uns schließlich von der Lohnliste scheiden sah, mögen wie die eines Feldherrn gewesen sein, dessen hohe strategische Pläne nur an der elenden Truppe gescheitert sind.
Ich hatte die Chance, noch anderen interessanten Figuren des Studios zu begegnen.
Da war z.B. der freundliche Mann, der am Nebeneingang, durch den ich das Studio betreten und verlassen mußte, Wache saß. Sein Gruß hatte gleich am Tag meines ersten Erscheinens einen solchen Beiklang wissenden Mitgefühls, als sähe er schon den meines letzten herandämmern. Und als dieser letzte Tag gekommen war, wußte er’s. Sein Herz mag es ihm zugeflüstert haben; oder vielleicht das für Torwache-Angelegenheiten zuständige Department. Ich will lieber an die rührende Version glauben, daß es sein Herz gewesen war. An diesem Tag zum erstenmal sagte er nicht: «nice day» oder «nasty day», wie sonst jeden Tag, zur Begrüßung, sondern er sagte gar nichts. Wie taktvoll! Denn «nice day» hätte wie Ironie geklungen, und «nasty day» wie peinliche Anspielung.
Und da war der bezaubernde Negerknabe, der immer um 12 Uhr mittags, nach Schluß der Filmkinderschule, an meinem Fenster vorbeikam, und zwar fast jeden Tag mit einem anderen Hut auf dem Kopf. Er besaß – keiner, der meine Aufzeichnungen darüber, ein Jahr hindurch geführt, einsieht, wird das bestreiten wollen – die größte Anzahl von Hüten, die je ein Negerkind in den Vereinigten Staaten besessen haben mag. Hüte von verwirrender Vielfalt der Form, Farbe und des Materials. Der graue, hohe aus Filz mit dem schottischen Band wurde mein erklärter Liebling.
Dann die Stars. Sie sind, anders als die ebenso genannten Himmelskörper, auch bei Tageslicht deutlich sichtbar. Und unterscheiden sich von jenen noch dadurch, daß man sie nicht nur entdecken, sondern auch erfinden kann. Stars leiden sehr an ihrer Popularität. Das Interesse, das ihnen gilt, würde sie zur Verzweiflung treiben, wäre nicht ihre beständige, tiefe Angst, es könnte aufhören.
Die Gelegenheit sei nicht versäumt, der vielbemühten Spezies der Studiosekretärinnen Anerkennung zu erweisen. Es sind ungemein liebenswerte, gefällige und geduldige Geschöpfe, wunderbar immun gegen Stories und Screenplays, deren Verblödungs-Giften ihr Verstand zumindest vierzig Stunden in der Woche ausgesetzt ist. Geistigen Samen der Studio-Dichter und -Denker aufnehmend und weitertragend, erfüllen sie im Bezirk der Filmschöpfung eine ähnlich verdienstvolle Funktion wie im Pflanzenreich die Schmetterlinge und Bienen, die sich dort als Pollensammler und -Übertrager nützlich machen.
Als exemplarische Studio-Figur bewahre ich in Erinnerung den begabten und erfolgreichen Kollegen, der, obschon bei den obersten Lenkern der Filmplantage bestens angeschrieben, um seinen Job zitterte. Das taten und tun, mit höchstem Recht, alle anderen auch. Aber das Tremolo des Kollegen war pausenlos. Er hielt die Luft um ihn, als wäre sie erwärmt, in beständiger leiser Schwingung, die, nach den Gesetzen der Wellenbewegung sich fortpflanzend, auch das Nervensystem der in der Nähe Befindlichen zum Vibrieren brachte. Er verhielt sich zu den Schicksal-bestimmenden Personen des Studios wie ein kluger Atheist zu Göttern, von deren Gottheit er nicht überzeugt ist, denen er aber, aus Vorsicht, jedenfalls opfert. Er befruchtete den Produzenten, für den er arbeitete, ihn hierbei in der Täuschung lassend, daß er seinerseits von ihm befruchtet werde. Er praktizierte ihm die Einfälle, die er selbst hatte, listig in die Tasche und empfing sie von dort als Originaleinfälle des Vorgesetzten dankbar wieder.
Der Produzent mochte ihn gut leiden.
Es geschah einmal, daß der Oberste des Studios in der Tür zum Speisesaal erschien. Auf den Kollegen wirkte die Erscheinung zugleich elektrisierend und lähmend. Ein Ausdruck gehemmter Ehrerbietung trat in seine Züge, er pflanzte Messer und Gabel senkrecht auf den Tisch hin wie «Habt Acht» stehende Schildwachen und saß stramm. Was anders konnte er unter den gegebenen Umständen für den Chef tun?
Gewiß, überall in heutiger Zeit und Welt, wo Arbeit ein Glücksfall ist und kein selbstverständlicher Anspruch, wird um den Job gezittert. Aber nirgendwo so heftig wie in Hollywood. Daher kommt es wohl, daß in dieser Gegend, in der Erdbeben nichts Seltenes sind, sensitive Leute oft ein solches verspürt haben wollen, auch wenn keines stattgefunden hat.
Hollywood ist ein Paradies, über dessen Tor geschrieben steht: «Laß, der Du eintrittst, alle Hoffnung fahren.» Das ist aber in Kalifornien nicht so einfach. Der Pessimismus braucht dort eine Weile, um sich gegen den Optimismus durchzusetzen, zu dem Klima und eine von Schaffenslust überquellende Natur verleiten. In Kalifornien blüht der Rosenstrauch viele Male im Jahr. Hollywoodisch gesprochen: wenn eine story, die er produziert hat, ungepflückt verdorrt ist, beginnt er sogleich an einer neuen zu arbeiten.
Der Hase
Der Schneidermeister Sedlak brachte Anfang November einen Hasen nach Hause. «Füttere ihn gut», sagte er zu seiner Frau, «auf daß er fett und stark werde und wir zu Weihnachten einen Braten haben.»
Ob der Schneidermeister «… auf daß» sagte, ist nicht sichergestellt. Aber dem Sinn nach lautete seine Rede so. Frau Sedlak selbst hat sie mir gleich andern Tags, nachdem der Hase ins Haus gekommen war, berichtet.
Frau Sedlak ist die bravste Frau, die jemals für eine fremde Wirtschaft Sorge getragen hat. Sauberkeit ohne Fehl wirkt ihre geschäftige Hand, und Kleider, Wäsche, Schuh’, von ihr betreut, sagten, wenn sie reden könnten, gewiß «Mutter» zu ihr.
Sie besitzt kein Kind. Aber als der Hase kam, da hatte sie eines.
Sie erzählte viel von seiner Possierlichkeit und seiner Zutraulichkeit, und wie er auf den Pfiff herbeikäme und mit welcher Neugier und welchem Interesse er ihr mit den Augen folge. Und wenn er auch Schmutz und Arbeit verursache, sie trüge diesen kleinen Mühezuwachs gern um des Spaßes willen, den das Tier mit seinen Kapriolen und seiner nimmermüden Spiellust bereite.
Der Hase erhielt eine alte Kiste zur Wohnstatt und Abfälle von Küchenabfällen zur Nahrung. Die Küchenabfälle selbst kommen auf den Sedlakschen Mittagstisch.
Und der Hase gedieh. Er bekam einen Bauch und volle Backen. Frau Sedlak erzählte, ihrem Mann laufe das Wasser im Mund zusammen, so oft er das Tier nur ansehe. Ihr lief es in den Augen zusammen, wenn sie dachte, welchem Schicksal der Hase entgegenschwoll.
Daß er so mächtig Fleisch ansetzte, erfüllte sie wohl mit hausfraulichem Stolz, und daß dem Weihnachtstisch ein Braten gewiß, war ihr keineswegs eine unangenehme Vorstellung. Jedoch Frau Sedlak hatte auch ein Herz im Leibe, nicht nur einen Magen; und was des Magens Hoffnung, wurde des Herzens Not.
Der Schneider setzte das Datum der Schlachtung fest und verpflichtete den Hausmeistersohn, der die Kriegsmedaille hatte, zur Metzgertat.
Von dem Augenblick an, da das Urteil über den Hasen unwiderruflich gefällt war, begann die brave Frau über ihn zu schimpfen. Sie sprach von ihm nur mehr per «der Kerl». Die ganze Wohnung stinke nach ihm, bei Nacht rumore er in seiner Kiste herum, daß man nicht schlafen könne – die Kiste würde längst dringend als Heizmaterial benötigt –, und soviel Kohlstrünke und Gemüsemist gebe es gar nicht, wie der Kerl auf einen Sitz verschlingen könne. Am Ende sei sie froh, daß nun bald Weihnachten käme und der lästige Wohnungsgenosse wieder verschwinde.
Auch über den Fleisch-Ertrag, den sie sich von dem Kerl verspreche, redete sie, doch mit so kummervollem Appetit in der Stimme, daß es klar war, sie übertreibe diese Einschätzung vor sich selbst, um mit dem Gewicht des köstlichen Hasenfleisches ihr Bangen zu erdrücken.
Dem Hasen selbst muß das Dilemma seiner Gebieterin aufgefallen sein. Oder soufflierte ihm, der doch nun einmal dahin mußte, ein höherer Lenker, womit er der Frau für bewiesene Sorgfalt und Güte danken könne? Genug, er tat, der Hase, wie in solcher Lage ein psychologisch geschulter Hase auch nicht anders hätte tun können.
Er biß Frau Sedlak in den Finger.
Freudestrahlend berichtete sie: «Er hat mich in den Finger gebissen.»
Ja, gottlob, nun war unter das Todesurteil, es moralisch stützend, die todeswürdige Tat geschoben. Nun war das verpflichtende Freundschaftsband zwischen Pflegemutter und Hasen von diesem selbst entzweigebissen. Nun war Appetit auf Hasenbraten: Gerechtigkeit.
Sie hatte trotzdem Tränen in den Augen, die Frau, als sie von des Hasen Ende erzählte.
Und es hing noch wie Schleier trauernder Liebe um das Lächeln, mit dem sie sagte: «Schön fett war er.»
Das Fell ist zum Trocknen aufgespannt; es hat seinen Wert. Ein wenig Fett ist noch in der Speisekammer als Superplus des Feiertagsbratens. Die Wohnung stinkt nicht mehr nach tierischem Exkrement. Kein nächtliches Rumoren in der Küche stört den Schlaf der braven Leute.
Aber die alte Kiste ist nicht zu Brennholz zerhackt worden. Sie bleibt Kiste.
Denn Herr Sedlak ist entschlossen, wieder einen Hasen zu erwerben.
Und Frau Sedlak wird, vermute ich, sich vom Fleck weg seelisch so zu ihm stellen, als ob er sie schon gebissen hätte.
Kommentar zur Dichtung? Geister werden nicht besser sichtbar, wenn man Licht macht.
Die Handschuhe
Auf dem Waldspaziergang äußerte die Frau plötzlich, daß sie auch einen Stock haben wolle.
«Nichts leichter als das, einen Augenblick», sagte der Mann.
Er legte seine Handschuhe auf den Boden und verfertigte aus einem abgebrochenen Zweig eine Art von Spazierstock für die Frau. Dann gingen sie weiter, und als sie müde waren, legten sie sich ins Gras. Da bemerkte der Mann, daß ihm seine Handschuhe fehlten. «Sie müssen noch dort liegen, wo ich dir den Stock gemacht habe. Ich hole sie. Gleich bin ich wieder da.»
Er ging nun den Weg zurück, den sie gekommen waren, und überdachte hierbei, gewohnt, Fehlleistungen zu deuten, was es mit dem Vergessen der Handschuhe für Bewandtnis haben möge. Sie waren ein Geschenk der Frau; also nichts wahrscheinlicher, als daß sich in ihrem Verlieren der heimliche Wunsch kundgegeben hatte, die Frau irgendwo liegen zu lassen. Indem der Mann diesen Gedanken wog und erwog, schritt er über den Platz, wo die Handschuhe lagen, ohne sie zu sehen, hinweg und fast bis zum Ausgangspunkt des Spaziergangs zurück.
Unterdessen hatte die Frau, besorgt, wo ihr Begleiter so lange bleibe, sich aufgemacht, ging selbst den Weg, auf dem sie dem Wiederkehrenden begegnen mußte – es kam kein anderer in Frage – zurück und fand die Handschuhe dort, wo er sie hätte finden müssen. Das konnte sie sich nun ganz und gar nicht erklären. Und da sie sich den Vorfall nicht erklären konnte, bekam sie, wie das oft zu sein pflegt bei gebildeten Frauen, einen rechten Zorn auf den Mann und pumpte sich mit Ärger so voll, daß sie, als sie des Daherkommenden ansichtig wurde, ihn mit häßlichen Worten empfing und ihm die Handschuhe vor die Füße warf.
Der Mann schwankte ein wenig, betäubt durch das ganz und gar Unerwartete, dann hob er mechanisch die Handschuhe auf und wandte sich, Richtung nach Hause.
Sie ihm nach: «Jetzt bist natürlich du wieder böse … und ich vergehe seit zwei Stunden vor Angst.»
«Vor einer halben Stunde erst sind wir vom Hause weggegangen.»
«Also, mir kam es länger vor als zwei Stunden. Wo warst du denn?»
«Ach, lassen wir das …»
«Du hast eine Art, wenn dir ein Thema unangenehm ist, ihm auszuweichen, die aufreizend ist. Die Handschuhe …»
«Ja, natürlich, wo waren die denn?»
«Genau dort, wo du sie hingelegt hast.»
«Komisch, ich habe sie nicht bemerkt.»
«Komisch nennst du das? Ich nenne es stupid.»
Hierbei gingen sie eben über eine kleine Brücke, unter der ein Bächlein floß, und er warf die Handschuhe hinein. Diese für seine Verhältnisse leidenschaftliche Tat erschreckte die Frau so, daß sie liebevoll den Arm des Mannes nahm und lispelte: «Muschi!» Nach einigem Schweigen setzte sie hinzu: «Wie häßlich du doch sein kannst! Warum schweigst du? Warum zankst du nicht mit mir, wenn du böse bist? Warum schlägst du mich nicht?»
«Ich will dir das erklären», sagte der Mann. «Wenn ich dir eine Ohrfeige gebe – tatsächlich oder metaphorisch – so brennt meine Wange, und ich fühle mich geschlagen und gedemütigt. Wenn ich dir in der Wut etwas sage, um dich zu kränken, so empfinde ich meine Wut und deine Kränkung dazu, bin also doppelt übel dran. Ich kann dir nichts tun, ohne es mir