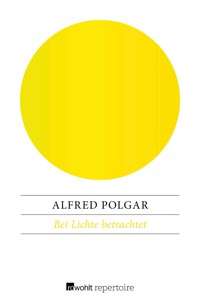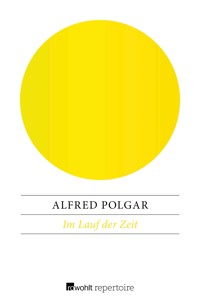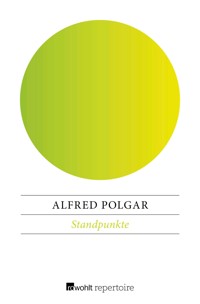9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kleine Schriften
- Sprache: Deutsch
«Es ist überhaupt wahrhaft unbeschreiblich, wie wohlwollend spitz dieser unbestechliche Beobachter sein Unbehagen zu beschreiben vermag», meinte ein Kenner über den Theaterkritiker Alfred Polgar, und dieses Urteil gilt auch und vor allem für «Theater II», den sechsten Band der «Kleinen Schriften». Hier sind unter dem Titel «Sätze und Grundsätze» Polgars beste Feuilletons und Betrachtungen zum Theater abgedruckt, hier wurden Besprechungen großer Regieleistungen aufgenommen, etwa jener von Otto Brahm («Brahms Ibsen») und Max Reinhardt. Hier finden sich aber auch die berühmten Schauspielerporträts und Kurzcharakteristiken, in denen Polgar mit wenigen Worten mehr zu sagen wußte als andere in langen Abhandlungen. Schauspielkunst des 20. Jahrhunderts wird da lebendig, wir erleben die Duse, Raoul Aslan, Fritzi Massary, Alexander Moissi, Max Pallenberg, Elisabeth Bergner und Paula Wessely. Den Abschluß bildet eine kleine Auswahl von Polgars eigenen Arbeiten für die Bühne, unter anderem der – gemeinsam mit Egon Friedell verfaßte – klassische Kabarettsketch «Goethe» und die antimilitaristische Satire «Soldatenleben im Frieden». «Er erzählte vom Theater, und er rezensierte den Alltag», schrieb Marcel Reich-Ranicki. «Theater II» beschließt die Edition der Werke Polgars im Rowohlt Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Alfred Polgar
Kleine Schriften Band 6: Theater II
Herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki
Ihr Verlagsname
Über Alfred Polgar
Über dieses Buch
«Es ist überhaupt wahrhaft unbeschreiblich, wie wohlwollend spitz dieser unbestechliche Beobachter sein Unbehagen zu beschreiben vermag», meinte ein Kenner über den Theaterkritiker Alfred Polgar, und dieses Urteil gilt auch und vor allem für «Theater II», den sechsten Band der «Kleinen Schriften».
Hier sind unter dem Titel «Sätze und Grundsätze» Polgars beste Feuilletons und Betrachtungen zum Theater abgedruckt, hier wurden Besprechungen großer Regieleistungen aufgenommen, etwa jener von Otto Brahm («Brahms Ibsen») und Max Reinhardt.
Hier finden sich aber auch die berühmten Schauspielerporträts und Kurzcharakteristiken, in denen Polgar mit wenigen Worten mehr zu sagen wußte als andere in langen Abhandlungen. Schauspielkunst des 20. Jahrhunderts wird da lebendig, wir erleben die Duse, Raoul Aslan, Fritzi Massary, Alexander Moissi, Max Pallenberg, Elisabeth Bergner und Paula Wessely. Den Abschluß bildet eine kleine Auswahl von Polgars eigenen Arbeiten für die Bühne, unter anderem der – gemeinsam mit Egon Friedell verfaßte – klassische Kabarettsketch «Goethe» und die antimilitaristische Satire «Soldatenleben im Frieden».
Inhaltsübersicht
Alfred Polgar, der leise Meister der Kritik
Polgar, meint 1926 Robert Musil, lasse «die Dinge laufen, wie sie behaupten, es zu können; er sieht ihnen bloß zu und beschreibt sie». Das gilt auch und vor allem für seine Theaterkritik.
Aber kann man ein Kunstwerk beschreiben? Nein, antwortet Polgar, und es sei auch noch keinem gelungen, denn: «Im Nicht-mit-Sinnen-Wahrnehmbaren, in dem, was sich nicht wägen, messen, spiegeln, isolieren läßt, liegt sein Entscheidendes. Dort, wo Wirkung ist ohne erkennbare Ursache.» Damit wäre schon angedeutet, worin Polgar seine vornehmste Aufgabe sah: Ein Leben lang versuchte er, literarischen Kunstwerken und theatralischen Kunstleistungen, auch und gerade wenn sie sich der Beschreibung entziehen, eben doch mit den Mitteln der Sprache beizukommen. Er wurde nicht müde, nach den heimlichen, den kaum oder überhaupt nicht erkennbaren Ursachen der künstlerischen Wirkungen zu forschen: Ihn reizte es immer wieder, das Undefinierbare zu definieren und das Unwägbare zu wiegen.
Tatsächlich vermochte er seinen Lesern mit einer von keinem deutschen Kritiker unseres Jahrhunderts übertroffenen Anschaulichkeit das Charakteristische, das Einzigartige eines Bühnenstücks, einer Inszenierung, einer schauspielerischen Persönlichkeit und Darbietung zu vergegenwärtigen. Hierzu benötigte er weder viele noch außergewöhnliche Vokabeln: Meist genügten ihm klare und einfache Sätze sowie die Wörter und Wendungen der Alltagssprache.
Stets bemühte er sich um eine ebenso knappe wie natürliche, ebenso genaue wie melodische Diktion. Doch wie schön sie auch klingt, selbstgefällig oder prunkvoll mutet sie niemals an. Im Gegenteil: Er liebte eine scheinbar anspruchslose Ausdrucksweise, er war ein leiser Meister der Kritik, ein Virtuose des diskreten und unauffälligen Stils. Was er meinte, sagte er unmißverständlich, er verpönte es, sich hinter dehnbaren oder undeutlichen Formulierungen zu verbergen. Der Holzhammer und der Nürnberger Trichter gehörten freilich nicht zu Polgars Werkzeugen: Noch die strengsten seiner Urteile kamen auf Zehenspitzen, auf leisen Sohlen.
In seiner Rezension einer «Faust II»-Inszenierung heißt es: «Der Dichter wird unbarmherzig beim Wort genommen.» Von Polgar ließe sich sagen: Er nahm die Sprache beim Bild und das Bild beim Wort. So schrieb er über den Dialog in einem Drama von Franz Werfel: «An solchen sehr getragenen, wie von Klassikern abgelegten Wendungen ist das Werk nicht arm.» Brechts Baal sei «ein Kerl, der über seine eigenen Ufer getreten ist». Bernard Shaw habe in «Caesar und Cleopatra» das Heldentum nicht verkleinert, sondern vermenschlicht: «Er pustet einen Heiligenschein aus; aber nun leuchtet der Kopf, den er gedeckt hat, um so schöner, kraft seiner eigenen, innersten Helle.» Und: «In Sternheims Sprache geht es zu wie auf dem Exerzierplatz. Scharfe Kommandi. Mitteilungen in knappster Fassung. Entgegennahme ebenso … Strammes Deutsch, für Ernstfall sichtlich bereit.»
Mit einer einzigen Formulierung konnte Polgar auf die entscheidende Schwäche, auf das fragwürdige Zentrum eines Bühnenwerks verweisen. In Hauptmanns «Michael Kramer» – meinte er – «werden Ur-Fragen gestellt und sehr feierlich nicht beantwortet». Über die Titelfigur in Brechts «Mutter» lesen wir: «… dieser Entwicklungsprozeß, den der Dichter ihr macht …» Sudermanns «mehraktige Stücke» verglich er 1905 mit mehrstöckigen Zinshäusern, die dem Geist des besser situierten Publikums Wohnstätten «mit Tränenspülung» bieten, und «Cristinas Heimreise» von Hofmannsthal mit einer Wiese, «die, wenn auch erfüllt von kleinem Leben und vieler Geschäftigkeit, doch zum Schlummer einlädt».
Nach der Uraufführung der Tragikomödie «Das weite Land» (1911) bemerkte er mit sanfter Ironie: «Ohne ein paar Tropfen Verwesungsparfum im Taschentuch geht die Schnitzler-Muse niemals in Gesellschaft.» Und im Nachruf auf Schnitzler zog er das Fazit: «Den Boden seines Werks decken welke Blätter vom Baum der Erkenntnis. Er verwertet ihr Rascheln musikalisch.» Worum geht es in Shaws «Pygmalion»? Polgars Rezension beginnt mit dem Satz: «Komödie von dem Mann, der aus einem Mädchen eine Dame macht, aber dabei das Weib übersieht.»
Für die alte Erfahrung, daß auch anerkannte Autoren oft, kaum daß sie gestorben sind, in Vergessenheit geraten, fand er den denkbar sparsamsten Ausdruck: «Die Toten sterben rasch.» Die Kamera, mit der Jürgen Fehling, der Regisseur, die Welt aufnimmt, habe «eine besonders zwielichtstarke Linse». Das Burgtheater nannte Polgar (es war 1918) eine «Schatzkammer ohne Schätze», eine «edle Truhe, die einmal Kostbarkeiten barg»: Leidenschaftliche Wiener «wachen sorgenvoll, daß aus der leeren Truhe nichts wegkomme». Mit einem Paradoxon charakterisierte er Elisabeth Bergner: Man könne sich verlieben «in ihre Gebrechlichkeit, die ihre Stärke ist».
Im Unterschied zu Kerr wollte Polgar von Literatur- und Theaterpolitik nichts wissen. Niemals war er daran interessiert, Direktoren zu stürzen oder zu unterstützen, Schauspieler zu fördern oder gar zu erziehen: Ein Taktiker war er nicht, den Rezensenten, die taktisch vorgingen, mißtraute er allemal. Der tief verwurzelte Argwohn, den er gegen Ideologien und Programme hegte, bildete von Anfang an das Fundament seines literarischen Werks – und hat natürlich auch seine Kritik geprägt. Um die Schulen und Richtungen, Tendenzen und Strömungen kümmerte er sich wenig, die Theorien waren ihm offenbar gleichgültig, wenn nicht suspekt.
Er zog es vor, sich stets aufs neue über Konkretes zu äußern, seine Sache war es, Stücke zu referieren, über Inszenierungen zu berichten, Schauspieler zu porträtieren und Regisseure zu charakterisieren. Er blieb ganz dicht am unmittelbaren Gegenstand seiner Betrachtung – und wußte dennoch stets die Distanz zu wahren. Aus seinen Referaten und Berichten, Porträts und Charakteristiken ging wie von selbst hervor, was man von ihm erwartete: Deutung, Analyse und Wertung.
Allerdings hielt es Polgar für angebracht, die Leser seiner gesammelten Kritiken zu warnen. Wer glaube, aus ihnen «Aufschlußreiches über die dramatische Kunst» erfahren und sein «Wissen um Geschichte und Entwicklung des Theaters» vermehren zu können, der werde enttäuscht sein. Er habe nie den Ehrgeiz gehabt, hinter den Zauber der Bühne zu kommen, vielmehr wollte er immer nur diesem Zauber «ein empfängliches Objekt» sein: «So geben die hier zum Buch vereinigten Besprechungen» – schrieb er 1926 – «weit weniger über das Besprochene Aufschluß als über den Besprecher.» Und: «Es ist kein System in diesen Kritiken.»
Das stimmt und stimmt nicht, ist teils aufrichtig, teils kokett und verbindet Treffendes mit Falschem. Mit Sicherheit läßt sich in Polgars Kritiken ein System nicht aufdecken, auch für ihn gilt Fontanes Wort, «daß es mit den Prinzipien und einem Paragraphen-Codex nicht geht» und daß man sich «auf seine unmittelbare Empfindung verlassen» müsse. Nichts anderes meinte Polgar, wenn er sich als ein für die Wirkungen des Theaters «empfängliches Objekt» bezeichnete.
Es trifft auch zu, daß er mit seinen Kritiken niemals wissenschaftliche Absichten verfolgte. Zustimmend zitierte er Egon Friedell, demzufolge nur der Dilettant eine wirklich menschliche Beziehung zu seinen Gegenständen habe: «Der Fachmann weiß zu viele Einzelheiten, um die Dinge noch einfach genug sehen zu können, und gerade damit fehlt ihm die erste Bedingung fruchtbaren Denkens.»
Dies ändert nichts an der Tatsache, daß Polgar über ein enormes und vielseitiges Wissen verfügte. Unvorstellbar jedoch, er hätte je mit seiner Gelehrsamkeit geprotzt – vielmehr war ihm daran gelegen, sie, soweit nur möglich, zu verbergen, ja sogar den Lesern einzureden, seine Bildung erinnere an den Emmentaler Käse, «indem sie gleich diesem größtenteils aus Lücken besteht».
Auch essayistische Ambitionen waren ihm eher fremd. Er schrieb in der Regel kurze Rezensionen, deren Themen von den Spielplänen der Wiener oder der Berliner Theater abhingen und die dem Bereich der Feuilletonistik zuzurechnen sind. Nur haben wir es mit Feuilletons zu tun, die von den Schwächen oder Untugenden dieses Genres frei sind. Polgars Aufsätze sind weder redselig noch vordergründig und nähern sich niemals unverbindlichen Causerien. Zu ihren wichtigsten Kennzeichen gehören der in der Kritik nicht häufige Hang zum Epigrammatischen und die Lust am Aphoristischen – und in solchen Äußerungen erreichen sie ihre Höhepunkte.
Freilich wurde hier alles mit leichter Hand geformt und serviert: Er gab sich viel Mühe, die Mühe, die ihm seine Arbeit bereitete, zu verheimlichen. Dies hatte wiederum zur Folge, daß oberflächliche Beobachter bisweilen glaubten, der Kritiker Polgar sei zwar mit Esprit, Humor und Anmut reichlich gesegnet, doch fehle ihm die Tiefe, wenn nicht gar der gehörige Ernst. Er fand sich damit ab: Lieber wollte er als ein charmanter Plauderer und geistreicher Conférencier gelten denn als ein gewichtiger Praeceptor. Und wer gar meint, man könne seinen Rezensionen mehr über ihren Autor als über ihre Gegenstände entnehmen, der ist ihm auf den Leim gegangen. In Wirklichkeit bieten sie außerordentlich viel über das Drama in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts und auch in der ferneren Vergangenheit – ihr hoher Wert sowohl für die Theaterwissenschaft als auch für die Literaturgeschichte ist unzweifelhaft. Wie alle guten Kritiker schrieb Polgar stets für seine Zeitgenossen und machte sich keine Gedanken, ob die Nachgeborenen seine Arbeiten lesen und was sie von ihnen denken werden. Gerade deshalb sind seine Kritiken auch nach sechzig und mehr Jahren nicht verblaßt: Schon damals wußte man, daß er auf die neuesten dramatischen Werke überaus feinfühlig und scharfsinnig reagierte, doch erst heute können wir ganz ermessen, wie treffend er diese Stücke beurteilte, wie exakt er sie durchschaute.
Hofmannsthals «Elektra» sei – schrieb er 1909 – «Sophokles mit Koloratur. Drama in einem Akt, in einem Atem. Welches Portamento …» Gleichwohl ließ sich Polgar nicht beirren: «Die Verschmelzung von Sophokleischem Marmor mit Hofmannsthalschem Gips scheint täuschend geglückt.» Als 1922 Hofmannsthals «Salzburger Großes Welttheater» uraufgeführt wurde, zeigte sich Polgar enttäuscht: «All dies besteht nur vor einer völlig unkritischen, auf selige Infantilität eingestellten Hörerschaft. Wenn also Hofmannsthal auch nichts von Calderón entlehnte – eines entlehnte er von ihm: das Publikum, das heißt: eine supponierte Gemeinde von Gläubigen, deren Geistigkeit auf dem gleichen Punkt steht, wo sie um 1650 stand …»
Die «Dreigroschenoper» sei «sehr nett», und wo das Spiel «Musik wird, Gesang und Reim … noch viel mehr als nett». Aber das Stück löst bei Polgar doch ein gewisses Unbehagen aus: «Rauhes Wort und krudeler Witz rücken das Spiel aus dem Sentimentalen … wohin? In eine Sentimentalität zweiten Grades, um eine Schraubenwindung höher als die gemeine.» Wenig später, 1929, macht Polgar schon mit den ersten Zeilen seiner Rezension die Atmosphäre des Dramas einer Unbekannten bewußt: «Pioniere in Ingolstadt bauen, unter Kommando von Marieluise Fleißer, eine Brücke zwischen Scherz, Satire und tieferer Bedeutung. Pioniere haben nach Dienstmädchen, Dienstmädchen nach Pionieren Bedürfnis; und geben ihm freimütigen Ausdruck. Doch in Pionier- wie besonders in Dienstmädchenkreisen ist die Jugend langsam fertig mit dem Wort, und wes’ das Herz voll ist, das tropft nur schwer von der Lippe.»
Das linke Agitationstheater betrachtete Polgar aufmerksam und freundlich, ohne es jedoch ganz ernst nehmen zu können: «Tendenz erhält der Zuschauer als Fertigware. Es wird ihm zum Vorgang auch der Reim geliefert, den er sich auf ihn zu machen hat.» Dies betrifft ein längst vergessenes Stück von Friedrich Wolf, das Erwin Piscator 1931 aufführte. Ein wenig resigniert klingt Polgars milder Spott: «Zuschauer, die der gleichen Meinung sind wie das zu deren Propagierung gespielte Stück, werden für diese Meinung gewonnen und zu dem politischen Glauben, den sie in das Theater mitbrachten, bekehrt.» Über ein offenbar sehr schwaches sowjetisches Kabarett, das 1927 in Berlin gastierte, bemerkte Polgar kühl: «Tanz, Musik, Spiel dieser schlichten Kabarettiers haben kein Eigenlicht; sie beziehen alles Licht vom Sowjetstern.» Ist dieses Ensemble trotzdem oder eben deshalb erfolgreich? Polgars Befund lautet: «Furchtbar groß ist hier die Angst, im Strom der Zeit sich als Nichtschwimmer zu blamieren.»
Nur in Ausnahmefällen ging er auf programmatische Äußerungen von Dramatikern ein, dann freilich traf er ins Schwarze – so hat er 1932 jenen Widerspruch aufgezeigt, den manche Brecht-Anhänger noch Jahrzehnte später nicht sehen wollten: «Brechts Theorie verwirft das Theater, das sich an das Gefühl im Zuschauer wendet, aber er verschmäht nicht die Hilfe der Musik, die gar nichts anderes tut, gar nichts anderes tun kann, als Gefühl wecken. Was hat ihr obstinates Trommeln, ihr Drohen, Klagen, Aufpulvern und Verheißen mit der Ratio zu tun, auf die allein es dem epischen Theater, theoriegemäß, ankommt? Es vermittelt dem Zuschauer Kenntnis und Erkenntnis auf kaltem Wege, nicht ohne ihm durch Klavier, Trompete, Posaune und Schlagwerk einzuheizen.»
Als gegen Ende der Weimarer Republik die Diskussion über die Zeitstücke und das Zeittheater immer stärker die Gemüter erregte, erkannte Polgar haarscharf das fundamentale Mißverständnis, das hervorgerufen sei dadurch, «daß die einen unter Theater mehr ein Kunstphänomen verstehen, die anderen mehr einen Apparat, dazu tauglich – Kunst hin, Kunst her – etliche hundert Menschen auf einmal unter moralisch-geistigen Druck zu setzen».
Mit ähnlicher Unbefangenheit und Entschiedenheit schrieb er über die Meisterwerke der Vergangenheit: Wie Fontane, wie Kerr und Siegfried Jacobsohn hatte auch er keine Hemmungen, von den ehrwürdigen Dramen der Weltliteratur den Staub wegzublasen und zu zeigen, was dann zum Vorschein kam. Über die «Antigone» des Sophokles: «Ungetrübt durch den Jahrtausend-Nebel wirkt die Majestät der geistigen Landschaft. Aber das Tragische des Geschehens werden wir nicht erjagen, weil wir’s nicht mehr fühlen.»
Für ein unkritisches oder gar devotes Verhältnis zu den Klassikern hatte er nicht das geringste Verständnis. Als man 1918 in Wien ein Trauerspiel von Grillparzer inszenierte, stellte Polgar fest: «Die Zensur steht gesenkten Bleistifts vor dem Werk, und die Kritik hütet sich, an ihm herumzunörgeln, um nicht in den Verdacht der Bilderstürmerei oder zumindest pietätloser Monumentbefleckung zu kommen.» Molières «Geizigen» verurteilte er 1917 mit einem kühnen Paradoxon: «Tot, im Buchsarg, ist die Dichtung unsterblich; zum Leben erweckt, stäubt der Moder von ihr. Einfacher gesprochen: ein Zehntel des Werks ist noch amüsant, neun Zehntel durchaus langweilig …«
Unvoreingenommen und aufgeschlossen für alles Neue blieb der Kritiker Polgar bis zum Ende. Der bald Achtzigjährige verwies 1953 auf einen damals kaum wahrgenommenen Schriftsteller, auf das Buch «Aus dem Leben eines Fauns» von Arno Schmidt. Er hielt ihn – trotz des «großen Durcheinanders», das eine Folge der zahllosen Gedankensprünge sei und in dem der Leser sich weniger wohl fühle als der Autor – für den interessantesten unter den neuen deutschen Prosaisten. Doch zugleich sah er sofort, was diesen Erzähler am stärksten bedrohte: «Arno Schmidt, glaube ich, könnte ein bedeutendes Buch gelingen, wenn er es einmal nicht darauf anlegte, ein tolles zu schreiben.»
In Polgars allerletzter Kritik, die er wenige Stunden vor seinem Tod abgeschlossen und abgeschickt hat – sie betrifft drei Shakespeare-Vorstellungen in der Bundesrepublik – sprüht und funkelt seine schriftstellerische Kunst noch einmal so hell und so klar, daß man sich keine Übertreibung zuschulden kommen läßt, wenn man behauptet, sie habe niemals nachgelassen.
Seine Rezensionen seien geschrieben – bemerkte er 1917 –, «als ob wir mitsammen gar keine andern Sorgen hätten». Bei anderer Gelegenheit bekannte Polgar: «Wie er so lässig dasitzt, liebe Schauspieler, der Kritiker im Parkett, kreist sein Denken nicht um euer Pensum, sondern um das seine, er schwitzt schon unter der Aufgabe, die ihr ihm stellt, er überlegt sie mit allem Unbehagen des Schülers, den die Sorge plagt, ob er bestehen werde …»
Marcel Reich-Ranicki
Sätze und Grundsätze
Zum Beginn
NUN ist es Herbst und kühl, der Senne muß scheiden, die Natur hört auf, und das Theater beginnt. Gar schöne Spiele spielt es mit dir. Und zeigt dir Leben in vielerlei Gestalt, Leben, wie es dem Schöpfer nicht eingefallen ist, wie es ihm aber hätte einfallen können. Indem du, Mensch, dich selbst auf der Bühne siehst, wirst du deiner vergessen; indem du dich zerstreust, wirst du dich sammeln; und je mehr du vom Spiel eines erfundenen Schicksals gefesselt bist, desto mehr wirst du dich vom Ernst des wahrhaftigen Schicksals befreit fühlen.
Oder auch nicht.
Ich habe mit meiner Cousine, als wir beide Kinder waren – vier Wochen hinter Weihnachten oder einige Jahrhunderte vorm Krieg war das – oft Theater gespielt. Einer machte den Zuschauer, der andre das Theater. Es bestand im wesentlichen aus einem hölzernen Schemel, in dessen Brett eine schlüssellochförmige Öffnung war; durch diese Öffnung liefen zwei Spagatschnüre, an ihren untern Enden hing je ein Holzklötzchen, die obern hatte der Spielleiter in der Hand. Er ließ die Klötzchen allerlei Bewegungen gegeneinander machen, in die Höhe schnellen und zu Boden stürzen, und sprach dazu einen Phantasietext. Der Zuschauer saß mit Herzklopfen zwei Schritte vom Theater auf dem Fußboden und war entrückt.
An den Höhepunkten der Handlung (oder wenn ihr nichts mehr einfiel) sprach meine Cousine folgenden geheimnisvollen Satz: «Ivn istn, eivn istn, kolin, molin, zin, zin, zin!» Ich weiß bis heute nicht, was er bedeutet, und sie hat es vermutlich überhaupt nie gewußt. Aber er schloß eine ungeheure Menge von Möglichkeiten in sich. Er klang wie Gottes Richterspruch, unverstehbar den Sterblichen; oder wie eine Extrakt-Formel für des Lebens und des Theaters Unvernunft; oder wie ein magischer Satz, der die Holzklötzchen aus der Verzauberung zu beseelten Figuren wieder in die tote Unempfindsamkeit ihrer Holzklötzchenschaft entließ.
Ich glaube, in den kindischen Worten, die keinen Sinn hatten, nur Klang, lebte was vom geheimnisvollen Zauber der Kunst: Rhythmus, der einlullt und zu Träumen anregt.
Und wenn wir den Sinn des Daseins, rückblickend vom Höhepunkt der Handlung, in eine letzte, knappste, erschöpfende Formel fassen wollen: könnte sie viel anders lauten wie der Zauberspruch meiner Cousine?
Heute ist sie Versicherungsbeamtin. Eine ältere Dame mit spitziger Suada. Damals, in den Tagen des Holzschemels, wollte sie Tragödin werden oder Tramway-Kondukteur.
Das Zweite war auch mein Herzenswunsch.
Jetzt bin ich aber Theaterkritiker. Ich sitze, so oft es was Neues gibt, vor dem herabhängenden Vorhang und warte auf den Augenblick, da der Zuschauerraum vom Dunkel überfallen wird, das Geschwätz der Menschen jählings verstummt, als ob eine Riesenfliege endlich den Ausweg durchs Fenster gefunden hätte, da der Gong tönt und es aufrauscht wie ein Schwarm von tausend Plüsch-Vögelchen. Das ist der herrlichste, der eigentliche Herzklopf-Augenblick des ganzen Theaterabends.
Hier ist niedergeschrieben, was ich dann weiter, nach jenen schönsten Augenblicken, im Theater erlebt habe. Getreulich niedergeschrieben, mit Nutz- und Schadenfreude, und so, als ob wir mitsammen gar keine andern Sorgen hätten.
Ivn istn, eivn istn!
Schauspieler und Kritik
DIE Wiener Schauspieler, vertreten durch ihren Bühnenverein, hatten beschlossen, künftighin die Kritik nicht zu den Generalproben zuzulassen. Sie behaupteten, erst am Premierenabend, vor großem Publikum, in «Stimmung» zu sein, und wollten nicht nach ihrem Generalprobenspiel kritisch gewertet werden.
Die Kritiker waren infolgedessen übereingekommen, von nun an nur noch über die Stücke zu referieren, von den schauspielerischen Leistungen aber keine Notiz zu nehmen.
Das war den Mimen, die ja der Erwähnung im Journal aus Ruhmes- und Karrieregründen recht sehr bedürfen, vermutlich unangenehm. Und so haben sie ihre Generalprobensperre wieder aufgehoben. Damit scheint der Zwist zwischen Theater und Zeitung zu beiderseitigem Frommen, zu Frommen vor allem dieser theaterdürstenden Stadt, beigelegt.
Mir, für meinen Teil, wäre die Aussperrung von den Generalproben fatal, denn ich hasse die Stimmung, die Gesichter, den Geruch, die herzbeklemmend widerwärtige Gesellschaft der «Premieren» und ihre penetrante geistige Ausdünstung.
Der Einwand der Schauspieler gegen Zulassung der Kritik zu Generalproben: es fehle da die so wichtige, Wellen der Wirkung verstärkende Schallwand einer teilnahmsvollen Hörerschaft, ist kaum stichhaltig. Die Kritik mag vielleicht sogar besser werten und urteilen, wenn ihre Meinung nicht von Publikumsaffekten gestoßen werden kann und kein trübender Stimmungsnebel sich zwischen Leistung und kritischen Betrachter schiebt. Auch der Einwand, daß Generalproben noch unfertig, noch nicht auf den letzten Glanz herausgeschliffen seien, ist hinfällig. Im wesentlichen sind Regisseur und Schauspieler, wenn einmal von einer Generalprobe gesprochen werden kann, mit ihrer Arbeit wohl fertig. Und klappt denn bei der Erstaufführung immer alles? Ist nicht eigentlich jeder Spielabend ein Zufallsprodukt der augenblicklichen Laune, Stimmung und «Form», in der sich die Darsteller befinden?
Ja, aber – sagen die Mimen – wir sind eben vor einem gespannten, neugierigen, nervös-beweglichen, mit Lachen und Tränen freigebigen Publikum in einer ganz andern Spielverfassung als vor einem kalten Parkett abgebrühter, unnaiver, von ihrer zu liefernden Leistung mehr als von der unsrigen benorhmener Rezensenten. Wir brauchen diesen Kontakt mit einer kontaktwilligen Hörerschaft. Wir brauchen Echo, um zu unsrer eignen Stimme Mut zu bekommen. Wir brauchen das Fluidum, das, von tausend schaugierigen Augen ausgestrahlt, belebend durch unser Nervensystem fließt. Wir brauchen die Erregung, die Angst, den Kampf des Premierenabends, um das Beste, Stärkste aus uns herauszuzwingen.
Und damit haben die Schauspieler vielleicht recht. Hier, in diesem irritierenden Bewußtsein eines entgegenwirkenden, mit Neugier, latenter Roheit und Begeisterung vollgespeicherten Zuschauerraumes, hier liegt ohne Zweifel eine halb gemeine, halb mystische Komponente schauspielerischer Kunst. Vom abendlich-festlich-vollen Haus zum Darsteller zieht ein motorischer Nervenstrang, der bei Proben und Generalproben abgekappt erscheint.
Die Kritik aber sagt, daß sie sich dieses kleine Mehr an Beschwingtheit, Wärme und Motion des Schauspielers leicht hinzudenken könne, denn sie sei eben die Kritik, das heißt: wissend, befähigt, Hilfen wie Hemmungen des darstellenden Künstlers als solche zu erkennen und ins wertende Kalkül zu ziehen; und sie sei auch mit hinreichend schöpferischer Phantasie begabt, um sich das bei Generalproben vielleicht matter brennende Genieflämmchen des Darstellers in jener vollen Funkelkraft vorzustellen, in der es der Sauerstoff zuführende Premierenabend aufleuchten lassen würde und müsse.
Es wäre also nur nötig, daß die Schauspieler von den sie beurteilenden Zeitungsherren eine genug hohe Meinung haben, um ihren Widerstand gegen die Generalproben-Kritik als sinnlos und schikanös aufzugeben. Die Frage steht demnach eigentlich so: Haben die Kritiker ein Recht, solche Meinung von den Schauspielern zu fordern? Antwort: Die Kritiker, als eine Gruppe bestimmter Einzel-Individuen, vielleicht ja, «Die Kritik» als öffentliche Erscheinung: nein.
Nur um einmal das zu sagen, lohnt es sich, coram populo von dieser Wiener Theateraffäre zu sprechen, die ja sonst (angesichts der skandalösen Affären, die derzeit das Welttheater erschüttern) nicht allzu bedeutsam erscheint.
Aber sie gibt Anlaß, einmal eine innere Schwäche der Stellung zu bekennen, die die Kritik im öffentlichen Kunstbetrieb einnimmt.
Die Kritik übt ein öffentliches Amt auf Grund privater Mandate – das macht ihre Position zweideutig und ihre besondern Ansprüche gegenüber den Theatern anfechtbar. Der Kritiker ist weder gewählt, noch ist ihm sein Amt als reife Frucht irgendwelcher – zu diesem Amt besonders qualifizierender – Schul- und Lernzeit in den Schoß gefallen, noch besitzt er irgendein Diplom für die Ausübung seiner Tätigkeit, das von irgendwem respektiert werden müßte. Wenn die theaterkritische Arbeit gewissenhaften und verständigen Männern anvertraut erscheint, so ist das in jedem einzelnen Fall: ein Zufall.
Das Maß von Achtung, Einfluß, Erleichterung der Arbeit (zum Beispiel: Generalprobenzulassung), das die Kritiker von den Theatern fordern, fordert vielleicht jeder einzelne rechtens: auf Grund seiner persönlichen Würde und Geltung. Wenn aber die gesamte «Kritik», eine Institution, die nur aus eigner Machtvollkommenheit besteht, die nur anerkannt wird, weil sie eben, sua sponte, vorhanden und mit der Fähigkeit, zu nützen oder zu schaden, begabt ist, wenn die «Kritik» fordernd auftritt, dürfen solcher Forderung, glaube ich, Schauspieler die Zweifelfrage entgegensetzen: «Wer oder was legitimiert denn grade euch, in eurer Gesamtheit, als unsre Richter, Wert- und Schicksalsbestimmer? Ihr übt eine Tätigkeit, zu der ihr nur dadurch berechtigt erscheint, daß ihr sie eben übt. Ihr seid Publikum wie die andern, nur mit dem einen Unterschied, daß euer Beifallklatschen oder Zischen sich in Druckerschwärze auf Zeitungspapier manifestieren darf. Diese mechanische Besonderheit eurer Meinungskundgebung scheint uns aber nicht ausreichend, um euch irgendwie eine Ausnahmestellung zuzubilligen.»
Im wesentlichen deckt sich, wie man merkt, das Problem der Kritik – nur verschärft durch die besondere Empfindlichkeit der ihr überlieferten Materie – mit dem des Journalismus überhaupt, welcher sich darstellt: als eine Tätigkeit, die erst und nur aus ihrem quale ein Recht auf ihr Sein folgern darf. Ein Antilogicum, das ja sein Ungesundes und Schiefes, aber auch sein Anreizendes und Verführerisches hat.
Fiesco, neu inszeniert
DER künstlerische Leiter des Theaters, mit 17 ½ Prozent am Ertrag der Bühne beteiligt, die zu 82 ½ Prozent der Firma Braunschweiger gehört – Klosettschüsselerzeuger und moderner Buchverlag –, schlug seinem Kompagnon vor: «Spielen wir ‹Fiesco› von Schiller.»
«Ich kaufe keine Katz’ im Sack», antwortete Braunschweiger, «erst muß ich das Stück lesen.»
«Nein», sagte er nach der Lektüre. «Bolschewistische Sachen passen mir nicht. Und die spanischen Kostüme möchten ein Heidengeld kosten.»
«Das Stück spielt in Italien, Herr Braunschweiger. Es ist klassisch und doch zeitgemäß.»
«Wieso zeitgemäß? Der Schiller ist doch schon achthundert Jahre tot?»
«Sie verwechseln ihn mit Goethe. Jedenfalls werden die Zeitungen das Stück nicht verreißen können. Es ist nämlich geradezu modern. Verrina sagt seiner Tochter: ‹Werde du eine Hure!› Ich werde das als Regisseur so herausarbeiten, daß die Leute glauben sollen, sie sind bei Hans Müller.»
«Warum spielen wir dann nicht gleich Müller?»
«Müller bekommt Tantiemen. Schiller bekommt keine Tantiemen.»
«Dafür kosten die türkischen Kostüme ein Heidengeld. Müller, Schiller, gehupft wie gesprungen.»
«Ich werde Ihnen einen Voranschlag machen. Wenn wir das Stück modern inszenieren, wird es ein Bombengeschäft.»
Der künstlerische Leiter machte den Voranschlag. Für Kostüme setzte er nur eine geringe Ziffer ein. Im wesentlichen wollte er sich mit dem Fundus von «Kobi auf dem Maskenball» behelfen, jenem Werk, dem die materielle Gesundung des Theaters zu danken war. Hingegen belastete den Voranschlag ein mächtiger Posten «Bühnen-Vorbau und Holzstiege ins Parkett».
«Ausgeschlossen», sagte Braunschweiger, «zu teuer.» Der künstlerische Leiter erklärte kategorisch, daß er auf Vorbau und Stiege bestehen müsse. Das sei er sich als moderner Regisseur schuldig. Das Genueser Volk müsse aus dem Parkett auf die Bühne kommen, auch der Mohr solle über die Holzstiege sich anschleichen. Hingegen ließe sich vielleicht die Meerdekoration der letzten Szene ersparen durch Heranziehung der noch vorhandenen Leinwandbogen aus dem «Böhm in Amerika».
Braunschweiger blieb hart. Der Regisseur sprach ihm ins Gewissen, daß ein Theaterdirektor doch nicht nur dem Geschäft, sondern auch dem Zeitgeist Rechnung zu tragen habe. Der Zeitgeist verlange die Holzstiege. Man könne über neueres Theater denken, wie man wolle, aber eine moderne Inszenierung ohne Treppe sei eine solche Unmöglichkeit wie ein Klosett ohne Wasserspülung.
«Reden Sie nicht in Sachen drein, von denen Sie nichts verstehen. ‹Fiesco›, gut, ‹Fiesco›. Aber mit Holzstiegen und Schauspielern, die aus dem Parkett kommen, lassen Sie mich in Ruhe. Im Parkett brauche ich keine bezahlten Schauspieler, im Parkett brauch’ ich zahlendes Publikum.»
«Herr Braunschweiger! Wenn ich keinen Bühnen-Vorbau und keine Holzstiege bringe, werden die Leute sagen: Vieux jeu!»
«Sollen sie! Antisemitische Beschimpfungen lassen mich kalt.»
«Vielleicht, wenn wir nicht Eiche nehmen, sondern Sekunda-Fichte. Da kostet der Meterzentner ab Säge nur vier- bis fünfhundert.»
«Nicht zu machen.»
«Und wenn ich Ihnen mein Wort gebe, wenn ich Ihnen schwöre, ja wenn ich Ihnen versichere, daß ‹Fiesco› mit Holzstiege ein Bombengeschäft sein wird?»
«Dann werde ich Ihnen sagen: Machen Sie das Geschäft allein! Mir ist lieber, Sie verdienen tausend Mark, als ich verliere hundert.»
«Also schön, Herr Braunschweiger …, dann leihen Sie mir das Geld. Ich kann aus eigenen Mitteln die Inszenierung, wie ich sie mir denke, nicht bestreiten. Strecken Sie mir das Geld vor, und ich mache ‹Fiesco› auf eigene Rechnung und Gefahr.»
Der Kompagnon willigte ein. Vorbau und Stiege wurden angeschafft. Die Genueser liefen treppauf, treppab, vom Parkett auf die Bühne, von der Bühne ins Parkett. Der Mohr schlich aus mystischer Niederung an. Die Verschworenen saßen wie Hühner auf ihrer Steige, und Verrina schmiß den Fiesco die Treppe hinunter ins Meer. Das Stück fiel jämmerlich durch. Die Leute warfen österreichische Zigaretten auf die Bühne, weil sie nichts übler Riechendes bei sich hatten. Braunschweiger zitterte um sein Geld.
Er bekam es jedoch einen Tag nach der Absetzung des «Fiesco» vom Spielplan auf Heller und Pfennig zurück.
«Sie staunen, daß ich zahlen kann», sagte der künstlerische Leiter, «aber der glänzende Erfolg meines Regie-Einfalls …»
«Erfolg?»
»Nun natürlich. Der Gedanke, der mich bei meiner Neuinszenierung leitete, war: die Tendenz der Holzpreise ist eine steigende. So habe ich für Vorbau und Stiege den Meterzentner gezahlt mit dreihundertachtzig. Und konnte jetzt um sechshundertvierzig verkaufen. Oder glauben Sie, ich inszeniere so ins Blaue hinein? Habe ich Ihnen gesagt, daß das Stück ein Bombengeschäft sein wird, ja oder nein? Ihre Schuld, wenn Sie nicht dabei beteiligt sind … Übrigens, wissen Sie, was wir jetzt inszenieren? ‹Hamlet›! Dazu brauche ich unbedingt zweihundert Quadratmeter prima roten Plüsch. Das bin ich meinem Ruf als moderner Regisseur schuldig.»
«Ich will mir’s überlegen», sagte Braunschweiger zaghaft. «Aber schön war es nicht von Ihnen, daß Sie mich mit ‹Fiesco› so drangekriegt haben. Kunst, einen armen Kaufmann hineinzulegen, der nichts vom Theater versteht!»
Don Juan
ZU schön, diese «Don Juan»-Aufführung in der Wiener Oper, als daß, wer sie gesehen hat, ihrer jemals vergessen könnte.
Wenn es nach mir ginge, müßte «Don Juan» mit Petroleum beleuchtet werden. An der Rampe eine Reihe von gelben Dochtlichtern in Glaszylindern, durch ein blechernes Schirmchen abgeblendet. Die Dekoration wie aus dem Modellierbogen geschnitten, giftgrüne Bäume, Brunnen mit heraussprudelndem gemaltem Blau-Wasser, alles duftend nach Kleister, von dem phantastischen Reiz umwittert, wie er nur elendem Pappendeckel erblüht. Die Kostüme knatternd in Buntheit, die kein Maler abgestimmt hat, aus der Maskenleihanstalt oder aus der Werkstatt eines Puppenschneiders, der Tabak schnupft. Die Donna Anna müßte natürlich pechschwarz gehen und vom Hute Don Juans eine ganz große Feder wimpeln. Jedenfalls eine Ausstattung, der keine Künstlerhand sich in die Nähe getraut, und an der kein Stilwille sich patzig gemacht hat.
Nun, von einem Theater europäischer Geltung kann man so was nicht verlangen. Auch nicht, daß es sich zu einer Naivität bekenne, die, weil seiner Zeit und seinen Mitteln ungemäß, als absichtsvoll verstimmen müßte. Deshalb gab es in der Oper keine Petroleumlampen und keinen Kleisterduft. Aber es war immerhin so, daß nicht Abbruch geschah dieser wundervollsten Spiel-Sache «Don Juan», ihrer himmlisch-naiven Theater-Magie, ihrer Fülle und Freude und Gruseligkeit und Lieblichkeit, die allesamt so ganz und gar aus dem Urbegriff «Theater» geboren scheinen, als wären sie dem Holz der Szene nicht eingepflanzt worden, sondern geradeswegs aus ihm hervorgeblüht, nun hingebreitet wie Sommerwiese, mit der Papillons und Sonne und Gewitter ihr Spiel und ihren Ernst treiben. Also gleich die Szene, wie Don Juan den Gouverneur ersticht, im Halbdunkel, war bezaubernd. Und das große Händeringen und stumme Klagen der Dienerschaft rührte alles zu Tränen.
Elvira, die wunderlichste traurige junge komische Alte der Weltliteratur, ließ, auf einer Gartenbank sitzend, den Kopf hängen und die Registerarie über sich ergehen. Sie war zu hin und zerbrochen, um abzuwehren. Es ist in Ordnung, daß Elvira sitzt, so entschieden sitzt, daß sie gar nicht mehr aufstehen zu können scheint. Erstens, weil anders die Sängerin müde würde, zweitens, weil es unverständlich wäre, daß die Donna, hätte sie nicht Kummers Blei in den Beinen, nicht einfach dem Humor des dickhäutigen Leporello aus dem Schuß ginge.
Niemals vergesse ich die drei Masken vor dem großen Tor des Palastes, aus dem schon Töne des Menuetts klingen und sich wie versprühte Springbrunnentropfen dem Abendwind an die Schwingen hängen. Das Tor, im Rückenmark spürt man’s, ist: Schicksals Pforte. Und erst der Saal im Schloß. Oh, welches Lustgetümmel und: es lebe das Leben! Vorne, im Zierschritt, tänzelten die Vornehmen, hinten, in der kleinen Bauernstube, stampften die Landbewohner, und durch das Fenster sah man den Regen regnen und die Blitze zucken. Wann denn soll Gewitter sein, wenn nicht zu solcher Stunde?
Aber noch lenkt das Fatum den Blitz von Don Juans Haupt. Das Fatum? Nein. Der Wille dieses Prachtmenschen tut es, dieses höchst tadelnswerten Ritters ohne Furcht. Den Degen in der Faust, schlägt er sich durch das haßerfüllte Gedränge. Fort ist er, und die Feinde haben das Nachsingen.
Ich kann nicht alle Einzelheiten dieser unvergeßlichen «Don Juan»-Aufführung rühmen, Gott segne den Beleuchter, der um die Friedhofsszene so furchtbares Nachtschwarz ballte und dann einen Mondstrahl, der wie Stich durchs Herz fuhr, auf den steinernen Gouverneur hinzittern ließ. Das Schönste vom Schönen jedoch brachte der Schluß. Ein Dämchen rechts, ein Dämchen links, so verzehrte Don Juan das unheiligste Abendmahl. Wie denn anders? Soll in seines Sünderlebens letzter Stunde das Weib fehlen? In flagranti erwischt ihn der unheimliche Gast. Er greift ihn mit der Steinhand, die ärger brennt, als aller Feuer Feuer. Dreimal ruft der Trotzige sein «Nein!», dann muß er mit, hinab in die Versenkung. Der Teufel hat Don Juan geholt und fährt mit ihm zur Hölle. Herrlich!
Es ist noch anzumerken, daß diese Herrlichkeit vor etwa zwanzig Jahren in der Oper zu erleben war.
Der jetzige «Don Juan» sieht ganz anders aus. Stilisiert, viereckig, modern, dekorativ edel vereinfacht. Das Theater ist weg, der Zauber ist weg, die Süßigkeit ist weg, der Spuk ist weg. Eine Künstlerhand hat gewaltet, Akademiker haben geschneidert, Denker haben inszeniert. Es ist zum Weinen.
Elvira steht. Es ist nichts da, worauf sie sich setzen könnte. Die Pforte (eingelassen in eine nüchterne Kastenwand), durch die die drei Masken eintreten sollen, ist keine Pforte, nicht einmal ein Pförtchen, sondern ein Türl. Sie werden herumkomplimentieren müssen, wer dem andern den Vortritt läßt. Im Ballsaal ist Konkurrenzblasen dreier Tanzmusiken. Don Juan denkt nicht daran, sich durchzuschlagen. Er singt hin, die andern singen her, dann singen sie miteinander, und dann bleiben alle stehen und warten, bis der Vorhang fällt. Auf dem Friedhof kannst du die Heiratsannoncen im Tageblatt lesen, so hell und gemütlich ist es. In der letzten Szene sitzt Don Juan allein und läßt sich’s schmecken; man könnte meinen, sein eigentliches Laster sei die Gefräßigkeit. Nach der Unterredung mit dem steinernen Gast, indes Dampf aus einer offenbar schadhaften Zentralheizung ins Zimmer kommt, legt sich Don Juan im weißen Seidentrikot flach auf die Erde und stirbt an Gasvergiftung.
Ein Glück, daß all’ die Stilisierung, Versteifung, Veredlung machtlos gegen Mozart ist. Mag der Sänger auf der Bühne liegenbleiben: Don Juan wird doch zur Hölle geschleift, hinauf und hinab die unsterbliche Tonleiter d-Moll, die gefeit ist gegen jede Neuinszenierung.
Komische Figuren
DER Possenschreiber stand vor dem ewigen Richter. Abgewogen war Für und Wider, und die Sache schien für den Mann, der sich auf vieles Gelächter zur Milderung seiner sündhaft elenden Schreiberei berufen konnte, günstig zu stehen. Da erschienen aber vor dem Tribunal, wider ihn zu zeugen, «die komischen Figuren». Sie stellten sich als sogenannte Typen vor: ein unübersehbares, finsteres, drohendes Heer.
«Ich bin die Schwiegermutter», sprach eine alte Frau, «dieser Mann und die andern seiner schäbigen Profession haben es bewirkt, daß die Leute schon grinsen, wenn sie nur den Namen hören: ‹Schwiegermutter›. Ich bin eine alte Frau. Ich liebte, das ist vorbei; ich war Gattin, das ist vorbei; das einzige, was mir blieb, war meine Mutterschaft. Da nahm mir einer das Kind, und mein Leben wurde sinn- und zweck- und inhaltslos. Ich versinke ins Nichts. Ich klammere mich in Herzensnot an das Geschöpf, das mir ‹Mutter› sagt, man schlägt mir auf die Hände, daß ich loslasse. Ich halte mich mit den Zähnen fest, und die Leute schreien: die bissige Alte! Mich quält ein unabweisbares Verlangen, betreuen und sorgen zu dürfen: denn solches Sorgen-Dürfen ist meine moralische Alters-Pension, ohne die ich nicht leben kann. Man verweigert sie mir. Sie nennen mich ‹Drache›, aber ist das nicht ein erbarmungswürdiger Drache, der nichts, gar nichts mehr zu hüten hat? Ich bin eine tragische Figur, nicht lächerlicher denn die leibhaftige Todesangst.»
«Mich, den Traurigsten von allen», sagte ein anderer Zeuge, «hat dieser Mensch dem Hohn preisgegeben. Ich bin der impotente ältere Mann. Ermißt einer das Elend, wenn müder Leib die unermüdete Seele verleugnet? Die namenlose Beschämung, wenn du bei der Geliebten bist, des Gottes voll, und dir die Kraft fehlt, ihn zu bekennen? Wenn dein Herz schwillt von Melodie, und die Lenden den Text vergessen haben? Finsterer Eros, wer kennt dich, wenn nicht ich? Ich brenne und kann nicht Wärme geben. Ich bin Musik und klinge nicht, und die Gassenhauer-Gröhler spotten meiner. Wie erbärmlich und gemein, daß die Possenschreiber Gelächter schinden aus der Demütigung, die die heilige Idee der Liebe durch der Liebe unheiligen Mechanismus erleidet.»
Der ewige Richter stützte den Kopf in die Hand, als versänke er in Nachdenken, aber er wollte gewiß nur seine Heiterkeit verbergen.
So zeugten viele wider den Possenschreiber, führten Klage, daß er ihre Traurigkeiten verhöhnt und gegen ihr Mißgeschick Schadenfreude aufgereizt habe. Die alte Jungfer mit ihrem Mops erschien und fragte, ob denn ein Weib, das nicht geliebt habe, nicht Gefährtin, nicht Mutter werden konnte, gar so spaßhaft sei? Es kam der Schüchterne, der Stolperer und Stotterer, alle, denen das Leben eine tödliche Verlegenheit ist, in die sie ohne Schuld geraten sind. Es kamen die Schwachen und Lädierten, die Nachhinkenden und Stürzenden, die Fehlerhaften und Mißlungenen, die Plumpen und allzu Zarten, die am Fluch der Dummheit oder Häßlichkeit Tragenden, die Kümmerlichen und Einsamen, es kam die ganze zahllose Schar der Lächerlichen, und alle behaupteten, tragische Figuren zu sein, des Mitleids würdig, nicht des Spottes.
«Was hast du darauf zu erwidern?» fragte der Ewige. «Darauf habe ich zu erwidern», antwortete der Possenschreiber, «daß der Mensch, leider, überhaupt eine durchaus komische Figur ist, und der, der es nicht sein will, die komischste. Alle Heiterkeit der Welt rührt her von ihrer Traurigkeit, wie die Welt selbst geboren ward aus der Finsternis. Ich kann nichts dafür, möge der Mensch seinen Schöpfer zur Verantwortung ziehen. Dich, den Bildner, nicht mich, den Abbildner.»
Es kam nicht zum Urteilsspruch, denn der ewige Richter lehnte sich als befangen ab.
Kritik, wie sie eigentlich sein müßte
DIE Aufführung der «Räuber» mußte auch dem, der nicht sehen wollte, den künstlerischen Tiefstand unseres Schauspielhauses offenbaren. Wir drücken uns milde aus, wenn wir die Darstellung unzulänglich nennen.
Karl Moor, schon in Kenntnis davon, daß sein Vertrag mit dem Theater nicht erneuert würde, und durch zahlreiche fehlgeschlagene Versuche, anderes Engagement zu finden, seelisch zermürbt, entwickelte die Leidenschaft eines Murmeltiers zur Winterzeit. Da ihm unablässig der Text des beschwörenden Briefes, den er an den Theaterdirektor zu schreiben gedachte, im Kopf herumging, fiel er zu wiederholtenmalen aus Schillers Text, und der Souffleur mußte sehr laut flüstern, um die quälenden inneren Stimmen des Darstellers zu übertönen. «Du weinst, Amalia?», das sprach Karl Moor mit einer ganz sinnfremden Bitterkeit und betonte hiebei – zum Befremden der Kritik, die auf richtige Betonung im Vortrag der Klassiker Wert legt – das Wort «Du», als wollte er sagen: Du weinst, Amalie, Du, die einen neuen Kontrakt mit Höchstgage in der Schreibtischlade hat?
In den Händen ihres jetzigen Darstellers erwies sich die dankbare Rolle des Franz Moor nichts weniger als dankbar. Der Schauspieler, dessen Mutter sich morgen einer Laparatomie unterziehen muß, entwickelte gerade noch knapp ein Existenzminimum teuflischer Verworfenheit. In völliger Verkennung des zu gestaltenden Charakters brachte er, der sehr an seiner Mutter hängt, in das psychische Bild des Franz einen Zug der Hilfs- und Anlehnungsbedürftigkeit, der zur Figur so paßt wie das Auge unter die Faust. Wichtige Sätze sprach er, gleichsam nur ihrem Klang und nicht ihrem Sinn verbunden, erschreckend leer, gab hingegen – die alte Dame ist Diabetikerin – Stellen, wie dem belanglosen «tröpfle mir auf Zucker!» einen auch von der laxesten Schiller-Auslegung kaum zu rechtfertigenden schweren Akzent. Kurz, er spielte einen Franz Moor, der nicht in der Gemüts-Verfassung ist, keines zu haben. Eine sehr anfechtbare, über-originelle Charakterdeutung, von der der grüblerische Künstler hoffentlich, mit fortschreitender Rekonvaleszenz seiner Mutter, wieder in den Bezirk der gesunden Tradition zurückfinden wird.
Als Kosinsky bot unser jugendlicher Liebhaber, dessen Ausgleich mit seinen Gläubigern gescheitert ist, eine unausgeglichene Leistung. Den Pater spielte der Komiker des Theaters. Doch gerade in puncto Humor wies die Darstellung dieses Künstlers, dessen Wassermannscher Befund (Näheres hierüber in unserer Rubrik «Theater, Kunst und Kultur») leider wieder aktiv ist, ein Passivum auf.
Der Mime, der den Spiegelberg verkörperte und dem vor kurzem die Frau durchgebrannt ist, ließ in den lästerlichen Reden des Räubers einen hellen, optimistischen Unterton mitschwingen. Er sprach recht wie ein überzeugter Libertiner, und durch die gemeinen Farben, in denen er das Bild des freien Lebens malte, schlug eine starke Grundierung von Hoffnungsgrün. Solche Auffassung des Spiegelberg als eines Mannes, dem der Rausch der Freiheit zu Kopf gestiegen ist, als eines Freiheitstrunkenboldes sozusagen, scheint uns sehr gewagt. Der Darsteller gab sie übrigens später, beim Gedanken an das Geld, das die Frau hatte mitgehen lassen, selbst wieder preis. Er vergaß, o wunderbare Macht der Kunst!, im Eifer des Spiels offenbar ganz, daß er die Frau los war, und gab, als warte sie noch daheim auf ihn, dem Spiegelberg jenen Ton ohnmächtiger Wut, den die Schiller-Exegese als den allein richtigen anerkennt.
Unsere jugendliche Heroine war als Amalia von Edelreich so flau wie die Börse, an der ihr Vermögen zerrinnt, und nur die Haßausbrüche gegen den Darsteller des Franz Moor, der die Beziehungen mit ihr abgebrochen hat, flammten in Lebensfarben. Aller Ingrimm darüber, daß er so gar kein sinnliches Verlangen mehr nach ihr spüre, bebte in der Stimme, mit der sie rief: «Dieses Stilett soll deine geile Brust durchbohren!»
Ganz gerecht dem Dichter und seinem Werk wurde nur die Gestaltung des regierenden Grafen von Moor. Der treffliche Schauspieler, der diese Rolle darstellt, hat noch das alte echte Schiller-Pathos, vier kleine Kinder daheim, die Minimalgage, und ein vorgeschrittenes Hungerödem. Die Szene im Turm – «so ward ich kümmerlich erhalten diese lange Zeit usw.» – spielt ihm gleich lebenswahr kein Prominenter nach.
Zusammenfassend wäre zu sagen, daß dem Kritiker vor der Aufführung so mies war wie ihm, das Vorwort zeitlich verstanden, schon vor der Aufführung gewesen ist. Übel wie er sich fühlte, fühlte er Stück und Spieler, und die Schärfe, mit der ihm das Leben zusetzt, floß in sein Urteil. Nein, diese «Räuber»-Vorstellung ist nicht zu vergleichen mit jener unvergeßlichen vor zehn Jahren, in der viel schlechtere Schauspieler beschäftigt waren, die Verdauung noch keiner purgativen Nachhilfe bedurfte, Elfriedens Knie das seine berührte und mit diesem stumm übereinkam, daß es gut wäre, spätestens nach dem zweiten Akt wegzugehen. Welch hinreißende klassische Vorstellung, Schiller-jung bis in die Zwischenakte, durchweht vom glühenden Atem der Leidenschaft! Elfriede – wer, der sie heute sieht, möchte es glauben? – wog damals kaum zweiundfünfzig Kilo.
Premiere
PREMIERE im Berliner Staatstheater. Der Nachbar, gearbeitet nach einer Vorlage von George Grosz, zeigt der Nachbarin die bedeutenden literarischen Männer des Parketts. Manche sehen genau so aus, wie ich mir sie vorgestellt habe; manche noch genauer.
Hinterm Vorhang harrt eine frisch geschaffene Welt. Noch steht sie still. Punkt sieben wird sie zu kreisen beginnen. Schön, bedeutsam, herrlich ist das Theater, ehe es ist.
Ein Summen und Surren wie auf sommerlicher Wiese. Noch wiegen die Häupter, insbesondere der Kritik, sich sanft im Winde; im Morgenwinde, obschon es Abend ist. Dann wird es dunkel: Natur verstummt, Kunst hebt zu sprechen an.
Die Bühne zeigt einen Wolkenrahmen. Im Hintergrund ist die Sonne gemalt, ein schlichter Rohentwurf von Sonne, die Andeutung eines Kreises, der Strahlen aussendet. Doch genügt das als Stichwort für die Phantasie des Zuschauers. Wenn Tag sein soll, wird die Sonne beleuchtet; soll Abend werden und Nacht, wird ihr das Licht vorenthalten. O wunderlich verkehrte Welt, in der die Sonne beschienen sein muß, damit sie leuchte.
Es treten auf: Noah und seine Söhne, zwei Engel, Gott persönlich, einmal als «vornehmer Reisender», dann als «Bettler».
Die Engel tragen an den Schulterblättern Flügel, zusammengefaltet wie Schmetterlingsflügel. Aber wozu brauchen Himmlische Flügel, das heißt einen Apparat, der ihnen Fortbewegung in Lüften gestattet? Unterliegen sie denn dem Gesetz der Schwere? Müssen Überirdische sich den Geboten irdischer Mechanik fügen? Ach, auch unsere Wunder sind Kinder der Vernunft. Rübezahl zieht Stiefel an, um durch den Schnee zu waten, und dicke Pelzhandschuhe, damit ihm in den Fingern nicht friere, die Engel haben Flügel, um zu fliegen, Gott selbst, will er niedersitzen, braucht hiezu mindestens etwas Wolke. Unsere Märchen und Mythen kommen in keinem Punkt um das Kausalgesetz herum. Zum Beispiel: die Sintflut. Der Allmächtige müßte doch, sollte man glauben, nur «Aus!» sagen, ja «Aus!» nur denken, und alles Leben wäre vorbei. Doch nein. Er veranstaltet eine Noyade, er setzt zwischen seinem Willen und dessen Erfüllung ein Exekutivorgan: Wasser, er sorgt für eine physikalisch-stichhaltige Begründung des Untergangs, zu dem er alles organische Sein verurteilt hat.
Wie war das übrigens mit den Fischen? Nahm Noah auch ein Fisch-Pärchen in seine geräumige, die Kontinuität des Lebens sichernde Jacht? Für Kiemen-Atmer konnte doch die Sintflut nicht Schrecken haben noch Verderbnis.
Gott, im vorgeführten Spiel, erscheint einmal als «vornehmer Reisender», ein andermal als «Bettler» mit Krücken. Zwei Engel stellen sich hinter den Ewigen und versichern, daß sie ihn auch in der Maskerade erkennen. Solcher Scharfsinn seiner Cherubim kann den Herrn nicht erheitern, denn er ist voll des Grams über die Schlechten, die wider ihn tun und denken. Welch ein Gott nach des Menschen Ebenbilde! Ein Gott, der lamentiert. Gerade, daß er sich nicht den Bart rauft, dieser enttäuschte, gekränkte, aus allen Himmeln gefallene Herr über alle Himmel. Da er den Irrtum des sechsten Tages («und Gott sah, daß es gut war») erkennt, da er beschließt, die erste, mißlungene, Fassung der Welt zu verwerfen, die krause Schrift des Lebens, die seine Hand geschrieben, mit nassem Schwamm zu löschen, scheint er allen Schmerz und alle Müdigkeit des Künstlers zu verspüren, der jetzt noch einmal von vorn anfangen muß.
Ein beklagenswerter Gott! Calan, der Kritiker von der Opposition, versucht ihn auf den Boden theologischer Spitzfindigkeiten zu stellen. Noah, der Gott-Offiziöse, begnügt sich damit, zu loben und zu preisen. Bekenntnis ist seine Sache, nicht Erkenntnis. Alles Üble, alles Widersinnige im moralischen Weltgefüge nimmt er als «von Gott gewollt» gehorsam hin. Das heißt: seine Lippe redet und beteuert so. Lobgesang seines Mundes überschreit den Wehruf seines Herzens. Doch damit ist Gott zufrieden. Solche Rezensenten sind ihm wohlgefällig.
In dieser fromm-lästernden Dichtung wechseln vielfach die Methoden, die Distanzen, die Winkel der Anschauung. Es ist, als ob verschiedene Stimmen in eine Feder diktierten. Zuweilen gibt die Absolutheit eines inneren Wissens, das zu tief ist, um Worte zu haben, den Ton an, zuweilen wird logisch begründet. Langen die dichterischen Mittel nicht hin, wird der Kredit des Pentateuchs in Anspruch genommen. Kommt die Argumentation an einen toten Punkt, so steckt sie sich hinter die Unverantwortlichkeit höherer Erleuchtung. Aus der sakralen Ruhe zeit- und ortloser Grundsätzlichkeit fällt das Geschehen in die Erregung eines kleinen, persönlich wie sachlich ganz bestimmten Konflikts, Symbole haben Blut und Nerven, Gott selbst tut, als ob es ihn nicht gäbe, redet, der Allmächtige, im Tonfall der Ohnmacht, und ein irdisch-nervöses, unbeherrschtes Mienenspiel verzerrt das Gesicht der Ewigkeit.
Alle Wege führen zu Gott: so versucht es diese beladene Dichtung mit allen Wegen. Und mit allen Arten der Bewegung. Bald wird gezogen, bald gestoßen, bald geht es durch tiefen Sand, bald durch die Lüfte, bald sind Menschenfäuste, bald Atem der Engel die wirkende Kraft.
Eine mühevolle Reise. Viel Gegend, durch die sie führt, liegt im Nebel. Doch gibt es, das Programm des Staatstheaters in der Hand, kein Sich-Verirren. «Der Gottbegriff in diesem Drama«, sagt der Mentor, «ist weder ein theologischer noch ein literarischer, er ist körperlich schlechthin.» Über den Gott der Dichtung sind wir also im klaren: ein schlechthin körperlicher Begriff. Was ist’s mit ihren Menschen? «Die Menschen scheinen in einer seltsamen Fremdartigkeit von uns abzurücken, ja von ihren eigenen Oberschichten sich loszulösen.» Das klingt wie eine feine Umschreibung für: aus der Haut fahren.
Schon während der ersten Bilder schienen manche Zuhörer von einer sonderbaren Not und Unruhe befallen, als wären sie dabei, sich von ihren eigenen Oberschichten loszulösen. Während der großen Pause dann rückten ganze Trupps in einer seltsamen Fremdartigkeit ab. Ist das Werk zu tief, zu hoch?
Alle Zweifel behob anderen Tags die Kritik. So lautete der eine Spruch: «Ohne Phrasen geredet, es ist reiner Dilettantismus, maßlose Langweiligkeit, ein scheintiefes Mißdrama», so der andere: «Ein großer unvergeßlicher Abend. Das Werk überwältigt.»
Ich, für mein Teil, bin ganz der Meinung der beiden Herren.
Warnung als Vorwort
LIEBER Käufer, wenn du diese drei Bände gesammelter und doch sehr zerstreuter Theaterkritiken, Urteile und Vorurteile, Sätze und Grundsätze, Würdigungen von Stücken und Spielern, Glossen zu vielerlei Kunst und Kitsch der Szene, Wiedergaben von Inhalten und Inhaltlosigkeiten, Darstellungen von Darstellungen, wenn du also diesen Komplex von Bericht und Meinung erwirbst in der Annahme, aus ihm Aufschlußreiches über die dramatische Kunst der letzten fünfzehn Jahre zu erfahren, dein Wissen um Geschichte und Entwicklung des Theaters zu vermehren, Aussichtspunkte zu erreichen, von denen deinem Geist große Zusammenhänge und fundamentale Gesetze sich offenbaren, so wirst du nicht auf deine Buchhändlerrechnung kommen. Denn ich bin durchaus nicht Kenner der Bühne, sondern ihr gegenüber chronischer Laie, ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, hinter ihren Zauber zu kommen, immer nur den, diesem Zauber ein empfängliches Objekt zu sein – noch heute ist für mich der Augenblick, da es im Zuschauerraum dunkel und eine Stille wird, jener verwandt, die vor allem Anbeginn über den Wassern lag, voll Geheimnis und Schauer eines rechten Schöpfungsmoments –, ich bin immer zum erstenmal im Theater, nie ist es mein, immer bin ich sein Stoff, und keine Zeile Kritik über das Theater habe ich geschrieben, die nicht als Kritik über mich gelesen werden könnte. So geben die hier zum Buch vereinigten Besprechungen weit weniger über das Besprochene Aufschluß als über den Besprecher.
Zum rechten Kritiker fehlt mir manches. Vor allem durchaus so Lust wie Eignung zum Magister-Spielen. Ich hatte nie das leiseste Interesse, irgendwelche Theaterpolitik zu treiben, Direktoren zu festigen oder zu stürzen, für irgendwen oder -was Wege zu bereiten, Schauspieler zu erziehen, mit Lob und Tadel – wie man sich so den ernsten Kritiker vorstellt – auf ihre künstlerische Entwicklung Einfluß zu nehmen. Gütige Fügung hat mich davor bewahrt, jemals Autorität zu sein. Das ist ein trostreicher Gedanke. Als ich, nach vieljähriger Tätigkeit an der «Wiener Allgemeinen Zeitung», mit meinem kritischen Amt zu einem anderen Blatt übersiedelte, hatte ich die Genugtuung, daß auch nicht eine Postkarte an die «Allgemeine» kam, die gefragt hätte, wo denn meine Referate blieben, und daß auch nicht ein Abonnent oder Leser der Zeitung untreu wurde, weil er meine Chiffre nicht mehr in ihren Spalten fand. Ich konnte immer rückhaltlos schreiben, was mir zu schreiben war, denn von dem Geschriebenen hing niemandes Wohl oder Wehe ab als das meine. Der Gedanke, daß einer – oder gar eine! – mit Herzklopfen drauf warte, welche Note er von mir bekäme, daß von meiner Laune Karrieren, Gagen, Schicksale abhingen, solcher Gedanke (der mir jede Freude am Handwerk, das papierenen Boden hat, genommen hätte) blieb mir erspart. Über gekränkte Eitelkeiten ist der Schade, den ich angerichtet habe, nie hinausgegangen, die letzten Nichtskönner sind unter meinem starren Nein schön aufgeblüht, die übelsten Stückemacher, indes ich beharrlich ihre Armseligkeit verkündete, reich geworden, und kein Talent ist durch meine schwärmerische Anerkennung um die heilsame Bitternis des Mißerfolgs, um das süße Martyrium des Verkanntwerdens betrogen worden.
Ich möchte bei diesem Anlaß eine sehr verbreitete falsche Vorstellung vom Zeitungsrezensenten berichtigen. Viele, insbesondere die Schauspieler, sehen ihn als strengen Prüfer, vor dem die zitternden Schüler – Dichter und Darsteller – ein Examen ablegen. Aber die Falte, die seine Stirne furcht, ist oft genug keine des bedrohlichen Professors, sondern eine des bedrohten Kandidaten. Wie er so lässig dasitzt, liebe Schauspieler, der Kritiker im Parkett, kreist sein Denken nicht um euer Pensum, sondern um das seine, er schwitzt schon unter der Aufgabe, die ihr ihm stellt, er überlegt sie mit allem Unbehagen des Schülers, den die Sorge plagt, ob er bestehen werde, und manchmal soll es sogar vorkommen, daß er froh ist, wenn ihm wer einsagt. Der Gefürchtete hat zumindest so viel Angst vor dem Theater wie das Theater vor ihm.
Ich wiederhole: die hier vorliegenden Kritiken verhelfen zu keiner anderen gründlichen Kenntnis als zu einer solchen von ihrem Verfasser. Sie sind Linien und Zeichen, hervorgerufen aus dem mehr minder belichteten Geist des Schreibers durch das Theater als Entwickler. Und nicht wer über dieses, sondern nur wer über jenen einiges erfahren will, wird sie mit Nutzen lesen. Es ist kein System in diesen Kritiken. Sie sind entstanden nach dem Zufall der Spielpläne, es fehlen in der Reihe der betrachteten Dramen und Dramatiker zahlreiche der Betrachtung werte, und der Figuren-Zug der Mimen, den das Buch vorüberschreiten läßt, ist ein sehr lückenhafter. Bestimmend für die Auswahl – aus dem Material für zehn Bände sind deren drei geworden – war nicht die Erwägung, ob das Stück wert sei, kritisiert, sondern nur, ob die Kritik wert sei, gelesen zu werden.
Daß in diesen Kritiken viel Arbeit steckt, Form-Mühe, Mühe um den präzisesten Ausdruck, das deutlichste Bild, die inhaltssatteste, knappste Formulierung, will ich nicht verschweigen, denn am Ende könnte der freundliche Leser es nicht bemerken. Oh, man möchte nicht glauben, was für Plage es oft macht, den Nagel so zu biegen, daß er auf den Kopf getroffen ist, und wieviel Geist gerade der Kritiker bisweilen aufwenden muß, um zu verhehlen, wie wenig er hat!
Aus einem Handbuch für Kritiker
Wir Kritiker. Die Güte hat genau so viel sichere Techniken, Listen, Schleichwege und geniale Finten, sich durchzusetzen, wie die Bosheit. […]
Klassisches Lustspiel. Im Buch-Sarg ist es unsterblich. Auf der lebendigen Bühne steht es wie ein Skelett in Kron’ und Purpur.
Gogol. Ein helles Licht wird angezündet, damit man sähe, wie finster es ist. Heiter strahlt Niedertracht, Dummheit verbreitet komödischen Glanz.
Theater der jungen Leute. Hoffentlich findet das Bemühen der jungen Leute Förderung, und sie müssen ihre Ideale nicht versetzen. Viel bekämen sie doch kaum dafür, denn es liegt leider im Wesen der Ideale, daß sie ein Wert sind, wenn man sie hat, aber keiner, wenn man sie verklopfen will.
Gerade ein zweifelhaftes Schauspiel brauchte starke Darsteller, ebenso wie gerade noch nicht zulängliche Darsteller ein starkes Stück brauchten. Schwankende Schauspieler und schwankende Dichtung stützen einander wie die Karten das Haus, das sie bilden. Ein Hauch bläst beide um.
Zu hohe geistige Räume haben schlechte Akustik. Da wird des Dichters Stimme von ihrem Widerhall zugedeckt.
Der rechte Komödiant hat, sowie er die Bühne betritt, auch schon Heimatsrecht in der Welt außerordentlicher Seelenabenteuer und Innenschicksale, muß sich’s nicht erst, recht und schlecht, erschauspielern.
Lustspiel von Shakespeare. Ein Strauß, gepflückt im Paradiese, noch leuchtend vom Abglanz des göttlichen Lächelns, das dort über aller Landschaft ruht.
Emilia Galotti. Es mag nicht leicht sein für Emilias Mutter, Würde zu wahren, wenn sie auf das Ersuchen, nicht zu schreien, antworten muß: «Was kümmert es die Löwin, der man die Jungen geraubt, in wessen Walde sie brüllt?» Hier, und anderswo sollte die Lessing-Pietät scheu werden und einen Satz über den Satz machen.
Lustspiel von Bahr. Wenn der Shaw so mit der Marlitt mang die Felder jeht.
Der Conferencier. Wie fest muß so ein Russe in der deutschen Grammatik sein, um sich auch nicht ein einziges Mal zu irren und zum Hauptwort den richtigen Artikel zu erwischen!
In den «Räubern» interessieren uns doch nur die Räuber. Amalie um die Bande … und den alten Moor mit Vergnügen dazu!
Die Gruppen auf der Szene standen da wie nach Blitzlicht schmachtend.
Die Graziöse. Sie haucht dem Geist des Spiels ihren Körper ein.
Im rechten Lustspiel geht die Sonne nie unter, und auch die Tränen, die geweint werden, dienen nur zur farbigen Zerstreuung des Lichts, das sie spendet.
Mancher bemüht sich vergebens, die Mängel seines Talents durch Defekte seines Charakters auszugleichen.
Die Heiterkeit, von einer entfesselten Claque entfesselt, fuhr wie Sturmwind durch die Galerie und schüttelte einen kurzen Schauer von Gelächter auf die vertrocknenden Schauspieler herab. Aber was war das für ihren Durst!
Der Mimiker. Man hört ihn schweigen.
In der finstern Begebenheit wirkt sein licht- und lachfrohes Wesen wie Gesundheit im Spital.
Vieux Genre. Der Dialog klingt wie aus einer alten Lust-Spieldose.
Ihre Herzenstöne sind das reine Gefrorene: so süß und kalt.
Ein Tragöde. Er wächst, je mehr er Boden unter den Füßen verliert.
Reim am Schluß reimloser Verse. Das Ohr empfängt ihn so gierig wie Ausgetrocknetes einen Tropfen Feuchtigkeit.
Über der Aufführung schwebte ein Gestirn à la Homunkulus. Ein künstlich erzeugter, eingesperrter, oft entschwindender, schwach leuchtender Geist, dem aber nachzurühmen ist, daß er «gern im besten Sinn entstehen möchte».
Er spielt den Schlaumeier und den: ach, was bin ich für ein Schlaumeier!
Eine Rolle, mit der verglichen der Löwe des Androklus perfid erscheint, so dankbar ist sie.
Lyrik. Ein Privatleben wünscht Öffentlichkeit.
Ihr Körper ist von bewundernswerter Klugheit. Was für intelligente Schultern, witzige Ellbogen, schlagfertige Wendungen in der Taille!
Der geschmeidige Komiker