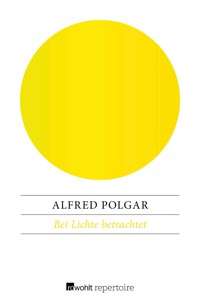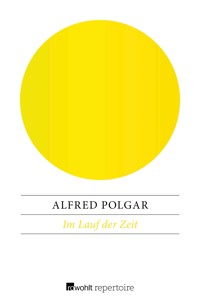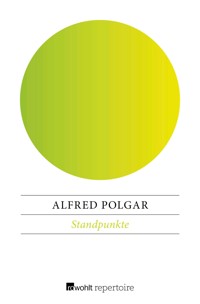
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Jede dieser Skizzen ist eine kostbare Essenz, ein wohlriechender Extrakt, gepreßt aus dem Duft, den tausend Lebenserfahrungen zurückgelassen haben.« (Egon Friedell)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Alfred Polgar
Über Alfred Polgar
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Standpunkte
Gespräch mit einem Meister
SCHÖN, DASS DER BRAVE PRATTNER [JOSEF] noch lebt und noch immer seinen Laden hat an dem engwinkligen, von Bomben verschont gebliebenen Platz, gegenüber der uralten Kirche mitten drin, die gottlob ebenfalls den Segen von oben überdauert hat. Denn weit herum könnte einer reisen und würde doch kaum eine zweite so bezaubernd zartgliedrige Kirche finden wie diese hier, die dazu auch noch den lieblich-bildhaften Namen führt: Maria am Gestade. Ebenso schwer würde er Schuhe finden gleich denen, die Prattner verfertigte. Sie standen auf dem Boden unglaublich parallel zu diesem, ein großer Fuß erschien in ihnen, obgleich er’s bequem dort hatte, klein, ihre Eleganz war so unauffällig, daß man sie erst richtig merkte, wenn man den Preis erfuhr, und sie hielten ihre Form jahrzehntelang. Von keinem, ginge er noch so zerlumpt daher, aber in Prattner-Schuhen, sie mochten so alt sein wie sie wollten, könnte man sagen: »Ein Bettelmann von Kopf bis Fuß.« Man müßte sagen: »… von Kopf bis Fußknöchel«, denn von dort ab nach unten schiene er noch immer ein Kavalier. Kräftige Preise allerdings verlangte der gute Prattner, und abhandeln ließ er sich nichts von ihnen. Sein Kaufmannsherz war zäh und undurchlässig wie Boxcalf, sein Schusterherz aber weich wie Antilopenleder, auch Samtleder genannt, mit dem man die Linsen der empfindlichen optischen Instrumente putzt. Dies will sagen: er liebte seine Erzeugnisse. Auf der Rechnung, mit der er sie ablieferte, stand: »Bon voyage«. Das galt den Schuhen. Er hatte wenig Klienten, war immer unzufrieden mit ihnen und nahm Bestellungen entgegen, als erwiese er damit dem Besteller eine ganz ausnahmsweise Gefälligkeit. Er sah aus wie und war ein richtiger Gentleman, leise, ein bißchen zeremoniell, sprach in gewählten Ausdrücken und stets mit einem launig-höflichen Lächeln um die Lippen. Mein Freund Bruno Frank, der Autor, leider schon tot, und ich, wir schrieben ihm Lobesbriefe über seine Arbeit, und er hängte die Briefe an das Ladenfenster, so daß die Passanten sie lesen konnten. Nachher änderten sich die Zeiten, und er nahm unsere Briefe wieder weg vom Fenster.
Während eines Aufenthalts in der Heimat besuchte ich ihn, versteht sich. Die Distinktion und das Lächeln waren noch da, aber dieses jetzt unbeweglich, eingeklemmt zwischen zwei scharfen Falten rechts und links, die ihm gleichsam die mimische Zufuhr absperrten. Anfangs war ich ein wenig unsicher, wie immer bei Begegnungen mit lieben Landsleuten daheim, und da saß auch der viereckig ausgesparte, helle Fleck an der schmutzfarbenen Wand. Aber vielleicht hatte dort nicht das gewisse Bild gehangen, sondern das von Prattners Großmutter, und er hatte es fortgenommen, weil er im Testament der Alten nicht bedacht worden war. Ich entschied mich für diese Lesart.
Das Wiedersehen mit alten Bekannten verläuft typisch. Die Bestürzung, wie sehr der alte Bekannte sich verändert hat, benimmt jedem im ersten Augenblick den Atem, den er doch für den zweiten dringend braucht, um dem alten Bekannten zu versichern, wie völlig unverändert er geblieben ist. »Herr Prattner, Sie sehen wirklich ganz unverändert aus.«
»So?« sagte er mißtrauisch. »Sie auch.« Er setzte die Brille auf, sah mich an und setzte sie gleich wieder ab.
»Und die Gesundheit? Alles in Ordnung?«
»Bißchen was mit der Lunge, wie bei jedem Schuster … Und die Nerven natürlich.«
»Es waren auch böse Zeiten für euch hier, wie?«
»Wenn Sie es nur wissen«, sagte er ein wenig unwirsch.
»Sie haben nicht mitgetan bei der Schweinerei, Herr Prattner, davon bin ich überzeugt.«
»Na ja … Na freilich …« Er nahm die angebotene Zigarette. »Die Bomben. Hernach die Russen.«
»Und wie geht das Geschäft? Zufrieden mit der Kundschaft?«
Er lehnte mit einer Handbewegung ab. »Die hat ja keinen Begriff. Heute noch weniger als früher … Ich mache Arbeit, wie sie kein zweiter macht. Glauben Sie, die Leute erkennen Qualität? Und erkennen sie an?«
»Wem erzählen Sie das, Meister!«
»Meister! Meister!« wiederholte er mit etlicher Bitterkeit. »Da meistert sich nix. Die Herrschaften merken’s einfach nicht, wie so ein Schuh aus meiner Werkstatt gebaut ist. Sieht aus, als hätte er sich von selbst gemacht. Ja, oder was! Da steckt sehr viel Gustiererei und Prüferei und Überlegung in so einem Ding, mein Lieber. Aber das verstehen Sie ja nicht.«
»Und ob ich es verstehe! Ich kenne doch Ihre Arbeit. Alles genau bedacht, bis auf das kleinste Komma … bis auf den kleinsten Nagel, wollt’ ich sagen.«
»Schauen Sie einmal eine Naht von mir an, wie die gestichelt ist … auf Kosten meiner Augen freilich. Aber ich würde mich eben kränken, wenn man …«
»… wenn man die Naht merkte. Natürlich. Ich kann Ihnen das so gut nachfühlen!«
»Und lohnt sich die Mühe? Bis man nur sein bißchen Geld hereinbekommt!«
»Da haben Sie absolut recht. Mit den Honoraren ist es ein Jammer.«
»Mich freut das Ganze nicht mehr.«
»So dürfen Sie nicht reden, Herr Prattner«, sagte ich mit aller Überzeugung, die ich für die fromme Lüge aufbringen konnte. »Ihre Kunst muß Ihnen Freude machen – oder sie wäre keine. Es schafft doch Genugtuung, etwas fertigzubringen, von dem man sich selbst sagen kann: Das ist richtig. Da ist nichts zuviel und nichts zuwenig. Da läßt sich keine Silbe wegnehmen oder hinzufügen.«
»Glauben Sie! Aber es gibt Kunden, die lassen meine Schuhe korrigieren! Prattner-Schuhe! Wenn ich mich weigere, macht es ein anderer Schuster. Wissen Sie, was so einer vor kurzem getan hat? Einem glatten Vorfuß von mir – Sie werden es nicht für möglich halten – hat er eine gesteppte Kappe aufgesetzt!«
Er hatte sich warm geredet. Und mich auch. »Ein starkes Stück, so etwas!« rief ich voll echter Teilnahme an seinem Kummer. »Selbstverständlich, die geringste Änderung an solcher Präzisionsarbeit – und das ganze Stück ist aus der Façon.« – »Am liebsten würde ich überhaupt nur für die paar Menschen Schuhe machen, die ich gern habe«, sagte er.
»Goldene Worte, Herr Prattner! Aber – um ein x-beliebiges Beispiel zu wählen – davon, daß ein Dichter seiner Frau seine Verse vorliest, kann er nicht leben.«
»Na, dichten muß man ja nicht unbedingt«, brummte er. »Aber Schuhe braucht der Mensch.«
»Wieviel verlangen Sie heute für ein Paar?«
Er nannte eine grotesk hohe Ziffer und setzte hinzu, indes sein eingeklemmtes Lächeln versuchte, sich freizuringeln: »Zumindest man selbst wird doch die eigene Leistung richtig einschätzen dürfen, wenn es schon die anderen nicht tun.«
»In der Praxis muß man’s aber billiger geben.«
»Übrigens, wenn es Sie interessiert«, sagte Prattner, »Ihre Maße hab’ ich noch.« Er holte ein langes, schmales, hochbetagtes Registrierbuch aus der Schublade. Richtig, da standen sie. Unter dem Datum vom 12. Dezember 1927.
Ich will’s nicht verschweigen – es rührte mich ein wenig, daß solche Spur von meinen Erdentagen noch erhalten geblieben war.
Künstler
IN DEN KLEINEN LANDORT SIND KÜNSTLER gekommen. Artisten. Auf dem Grasplatz vor der Bude der Obstfrau haben sie ihre Pfosten und Bretter aufgeschlagen und quer über die Stangen, die den Eingang markieren, ein breites Band mit der Aufschrift »Variété« hingenagelt. Zwei Reihen Holzbänke rechts und links, angeordnet im Halbkreis, stellen Verbindungen her zwischen Eingang und Hintergrund des Schauplatzes. Den Hintergrund bildet der Wagen. Er ist Wohnraum, Eßraum, Schlafraum, Waschraum, Magazin, Künstlergarderobe und noch vieles andere mehr. Seine Wände sind außen bemalt; die Malerei hat der Regen heruntergewaschen, was ihr gut bekam, denn jetzt scheint sie, obschon kaum ein paar Monate alt, wie von lange her. Armut kommt rasch zu Patina! Der ganze Wagen ist so, als hätte ihn eine längst entschwundene Zeit hier verloren und vergessen, und wenn das kleine Auto, das dem Wagen angeschirrt ist, mit ihm loszieht, sieht es aus, als führe der Enkel den Urgroßvater. Der Enkel selbst lahmt auch schon, zermürbt von Wettern und Strapazen.
Chef des Unternehmens ist Herr Billon, der vom frühen Frühjahr bis zum späten Herbst mit seinem Variété durch die österreichischen Lande fährt. Direktor Billons künstlerisches Personal ist sehr einheitlich: es besteht aus der Familie Billon. Und die Familie wiederum aus elf Personen: aus Vater, Mutter, einem Neffen, der als Clown sich betätigt, und acht Kindern des Ehepaares, von denen das älteste neun Jahre, das jüngste vierzehn Monate alt ist. Die Kinder turnen, tanzen, arbeiten an Trapez und Ringen, der Vierjährige macht einen dummen August en miniature, der Neunjährige ist bemerkenswert im Handstand auf einem schwankenden Bau übereinandergestellter Stühle, deren unterster mit den vier Beinen auf vier Flaschen aus Holz steht. Wenn der Neffe Clown nach vollbrachtem Exerzitium die hölzernen Flaschen von der Bühne trägt, versäumt er, zu meiner leisen Enttäuschung, aus ihnen einen tüchtigen Schluck zu tun. Dennoch bekommt der Clown, nach altem Brauch, vom Direktor, den er zum Narren hält, viele Ohrfeigen, die aber nur klatschen, nicht treffen. Der Geist ist immun gegen die Roheit der Materie.
Das Vierzehnmonat-Baby trainiert auch schon. Es übt Purzelbaum und Kopfstand, lernt bereits die Kerze und den Rückwärtsbogen. Früh krümmt sich, was ein Parterreakrobat werden soll. Gefaulenzt wird nicht in der Truppe Billon. Bei meinem Besuch zur Mittagsstunde, während der Topf mit Suppe umging, übte am Gerät, sprang, schlug Rad, was nicht eben löffelte, und zwei Hündchen, die Vater Billon auch noch ernährt, damit sie helfen, ihn und die Seinen zu ernähren, gingen, ohne daß es ihnen wer geschafft hätte, auf den Hinterpfoten, gleichsam mitgerissen von der allgemeinen artistischen Bewegung.
Direktor Billon hat kein leichtes Leben. Der köpfereichen Familie, zwei Hunden und einem Auto muß sein Variété die Existenz ermöglichen. Dazu kommt: Instandhaltung der Geräte, Kostüme, Steuern, Musik, und in Orten, wo die Eingeborenen kein Herz für die Kunst haben, auch noch Platzmiete. Der Direktor schafft es, und allein hierzu schon gehört echte artistische Begabung. Die Kinder, wirtschaftlich gesehen, sind freilich, weil Arbeitskameraden, nicht nur fressendes, sondern auch zinsendes Kapital, aber ihre Leistungsfähigkeit steht mit ihrem Appetit in einem verhängnisvollen Zusammenhang. Der Sommer, in dem für das ganze Jahr verdient werden muß, dauert fünf Monate, der Winter eine Ewigkeit. Da ist die Truppe festgefahren, wirklich auf totem Geleise, denn ihre Winterquartiere sind zwei ausrangierte Eisenbahnwaggons am Rande der großen Stadt, wo diese schon abtröpfelt ins Ländliche.
»Möchten Sie den Artistenberuf aufgeben, wenn Sie anderswie Ihr Brot verdienen könnten?«
Der Direktor glaubt durchaus nicht an die Möglichkeit eines solchen Anderswie. Auf dieser wirtschaftlichen Einsicht ist seine Liebe zur Kunst gegründet. Es bleibt ihm wie so vielen [von der Wirklichkeit im zwiefachen Sinne des Wortes: abgestoßenen] Zeitgenossen wenig anderes übrig, als sich dem Ideal zu verdingen, das noch schlechter zahlt als jene und überdies größtenteils nicht in bar, sondern mit inneren Befriedigungen und anderen Nonvaleurs. Herr Billon will das nicht wahr haben. Er folgt, indem er Variété im Umherziehen betreibt, väterlicher und großväterlicher Überlieferung, angeborener Passion, unabweisbarer Bestimmung. Er setzt Hoffnungen in das Talent seiner Sprößlinge, denen bald das richtige Variété winkt, verspricht sich auch einiges von der neuen Tyrolienne der zwei Jüngsten und der Clownszene mit dem Hut. Aber die eigentliche Glanznummer des Variétés, die auch vor anspruchsvollerem als Dorfpublikum sich sehen lassen könnte, bleibt doch Direktor Billons wirtschaftlicher Balanceakt. Nur wenig Schillinge beträgt sein Tagesbudget, und auf so dünnem Draht hält er, zehn Menschen auf dem Buckel, das ökonomische Gleichgewicht. Qualis artifex!
Die Kinder blicken ein bißchen ernst drein, aber keineswegs unglücklich. Applaus, sagen die Eltern, ist den Kleinen lieber als Schokolade.
Während der Abendvorstellung machte der helle Mond die zwei Glühbirnen überflüssig. Er goß eine feine Tunke von Unwirklichkeit über Kunst und Künstler, und wie aus seinem Licht gesponnen funkelte das Silberflitterröckchen der kleinen Suse am Trapez.
Wozu braucht ein Engel Flügel?
VON EINER FAUST-AUFFÜHRUNG, VOR LANGEN Jahren, des Wiener Burgtheaters haften im Gedächtnis die drei Erzengel, die den »Prolog im Himmel« einleiten. Sie standen auf wolkig getarnten Piedestalen und sprachen, so feierlich-entrückt sie konnten, die unbegreiflich hohen Worte von den unbegreiflich hohen Werken, die herrlich sind wie am ersten Tag. Es waren, fürs Auge, überzeugende Engel, als solche beglaubigt durch ihr Flügelkleid, weiße Fittiche, die, größer als ihre Träger, von deren Schultern majestätisch in die Höhe ragten. Manche Zuschauer mögen, Schein und Wirklichkeit durch einen gedanklichen Kurzschluß ineinander mengend, sich verwundert haben, wie Engel mit solch enormer Flügel-Spannweite es fertiggebracht hätten, ins Burgtheater hineinzufliegen [das damals noch nicht von Bomben zerlöchert war].
Wozu braucht ein Engel Flügel? Die scheinbar erledigende Antwort: »um zu fliegen«, ginge daneben – so zutreffend sie wäre auf die Frage: Wozu braucht ein Mensch Flügel? Beziehungsweise einen Apparat, der sie ersetzt. Engel aber sind den Ordnungen und Satzungen unserer materiellen Welt nicht unterworfen. Wozu dann brauchen sie Flügel? Das heißt: einen nach den Regeln der Physik gebauten Mechanismus, der ihnen die Schwerkraft überwinden hilft? Ich glaube, Engel haben Flügel einzig und allein zu dem Zweck, unser Kausalitäts-Bedürfnis zu befriedigen. Denn auch Überirdische, für die der Kodex, den wir »Naturgesetze« nennen, nicht gilt, können wir uns nicht anders vorstellen, als mehr oder minder doch eingeflochten in das Netz irdischer Bedingtheiten, als doch der Realität, wie wir sie kennen, verhaftet. Also denken wir die Engel mit Flügeln ausgestattet. Hiermit aber tun wir ihrem Übernatürlichen Abbruch, versündigen uns gleichsam an ihrer Unbegreiflichkeit. Als ob himmlische Wesen, zwecks Fortbewegung in der Luft, auf ein System von biegsamen Rippen und Federn angewiesen wären wie die Vögel!
Wie denn also sollten wir uns Engel vorstellen? Das alte Testament gibt hierauf erschöpfende Antwort: »Du sollst dir kein Bildnis machen weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist.« Danken wir dem weisen Gesetzgeber, daß er unsere Phantasie von der verzweifelten Aufgabe losgesprochen hat, sich Nichtvorstellbares vorzustellen.
Auch die unwahrscheinlichsten Fabelwesen, jemals von Dichtern oder bildenden Künstlern ausgedacht, sind doch immer nur [mehr oder weniger kühne] Abwandlungen, Verzerrungen, Deformierungen menschlicher oder tierischer Erscheinung. Ein Phantasiegeschöpf zu erfinden, in dessen Bau kein Stückchen menschlicher oder tierischer Anatomie enthalten wäre, ginge über die Grenzen auch der höchsten Einbildungskraft. Unsere Gespenster haben Augen zum Sehen und Hände zum Greifen, und wenn sie den Kopf unterm Arm tragen, so tragen sie ihn doch immerhin, weil er sonst zur Erde fiele. In Kurzem: unsere Phantasie, gebärde sie sich noch so zügellos, schweift an der Leine.
Der abstrakte Künstler, allerdings, weiß sie abzustreifen. Wenn er etwa einen Engel, die Idee: »Engel« darstellen wollte, würde er nicht nur die Flügel weglassen, sondern vermutlich auch den Engel, beziehungsweise ihn durch eine Anordnung von Graphit- oder Farbspuren ersetzen, die »Engel« bedeuten könnte. Besonders wenn ein Bildtitel das Stichwort zu solcher Deutung gäbe. Die Endphase dieser vom Gegenständlichen unabhängigen Kunst wird das leere Blatt sein. Auf ihm erschiene die Eingebung des Künstlers in einem letzten, nicht mehr überbietbaren Grad von Abstraktion ausgeformt.
Verdacht gegen die Dinge
ES WAR SPÄT ABENDS UND ICH DER EINZIGE Gast im Lokal, als der Professor [so nannten sie ihn dort] hereinkam. Er schien in dem Stadium: nicht mehr nüchtern und noch nicht betrunken, und da hat der Mensch ein Bedürfnis nach Gesellschaft und Aussprache. Also steuerte er auf meinen Tisch zu. Im Begriff, sich niederzusetzen, zögerte er und verlangte einen anderen Stuhl.
»Wackelt er?« fragte die Kellnerin und rüttelte an dem Stuhl, der nicht wackelte.
»Egal«, sagte der Professor, »mir ist der verdächtig.« Wir kamen ins Gespräch, und ich erfuhr, daß er Gymnasiallehrer war [Latein und Griechisch] und seine Schüler haßte. Weil sie ihm böse Streiche spielten. Als die Kellnerin den Rollbalken halb herunterließ, sagte er: »Mein Gott, schon bald Schluß. Ich gehe schrecklich ungern nach Hause.«
»Sie sind verheiratet?«
»Nein. Aber hier ist es so schön still.«
»In Ihrer Wohnung nicht?«
»In meinem Zimmer? O ja, sogar sehr. Nur anders. Nämlich, die Stille bei mir verhält sich nicht ruhig. Besonders nachts. Horcht man ein wenig schärfer hin, so kann man hören, wie sie vor sich hin summt. Und das weckt die Dinge auf.«
Ich muß ihn ziemlich verdutzt angesehen haben, denn er fügte gleich selbst hinzu: »Das klingt ein bißchen seltsam. Aber aus mir spricht nicht der Alkohol. Oder glauben Sie vielleicht, hier …« – er tippte auf seine Stirn – »ist etwas in Unordnung? Ich versichere Ihnen, die Trübungen meines Geistes überschreiten nicht das jedem Kulturmenschen in diesem Punkt zugebilligte und auch von ihm kaum vermeidbare Minimum. Es ist nur eben so, daß ich den Dingen in meinem stillen Zimmer nicht traue. Es sind ja nur wenige, aber immerhin viele gegen einen, und ich habe sie im Verdacht, daß eine Art von Kameraderie zwischen ihnen besteht, eine Art von Einverständnis zu tückischem Zweck. Ich lasse die Dinge natürlich nichts merken von meinem Verdacht, tue, als beachtete ich sie gar nicht. Aber ich habe das widrige Gefühl, sie beachten mich.«
»Einbildung«, sagte ich, um etwas zu sagen, obwohl mir ganz einleuchtend schien, was er da erzählte. »Ihre ganz persönliche Spezialität von Budenangst.«
Der Professor zuckte die Achseln. »Mag sein. Immerhin, Vorsicht kann nicht schaden.«
»Wie meinen Sie das?«