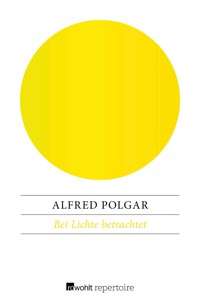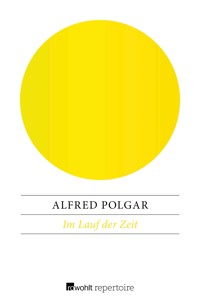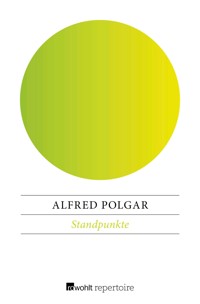9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kleine Schriften
- Sprache: Deutsch
Den Erzähler und Theaterkritiker Alfred Polgar kennt man schon lange. Doch der Virtuose der «kleinen Form», der von sich behauptete «Ich kann keine Romane lesen», hat sich immer wieder zur großen Literatur geäußert, zu Büchern und Autoren, zu Problemen des Schreibens und Lesens – und dies auf seine unnachahmliche Weise: mit Witz und Kunstverstand, mit Skepsis, spielerischem Ernst und manchmal voll Betroffenheit. «Literatur», der vierte Band der auf sechs Bände angelegten Alfred-Polgar-Werkausgabe, enthält eine Sammlung kritischer Prosa von ungewöhnlicher thematischer Vielfalt. Das Themenspektrum reicht von Arthur Schnitzler, Robert Walser und Peter Altenberg über Joseph Roth, Egon Friedell und Karl Valentin bis zu Hemingway und Arno Schmidt; von der Frage «Wie helfe ich mir beim Dichten?» bis zur «Theorie des Café Central». Der passionierte Zuschauer Polgar hat auch im Kino mehr gesehen als so mancher professionelle Filmkritiker. Ein eigenes Kapitel präsentiert eine Auswahl von Filmbesprechungen, Satiren und Geschichten aus dem Filmmilieu, darunter klassische Texte wie sein Porträt von Charlie Chaplin oder den Hymnus auf Eisensteins «Panzerkreuzer Potemkin». Die in diesem Band zusammengetragenen mehr als 130 Prosastücke, ob Kurznotiz oder ausführlicher Essay, zeigen eine weniger bekannte Seite Alfred Polgars.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Alfred Polgar
Kleine Schriften Band 4: Literatur
Herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki
Ihr Verlagsname
Über Alfred Polgar
Über dieses Buch
Den Erzähler und Theaterkritiker Alfred Polgar kennt man schon lange. Doch der Virtuose der «kleinen Form», der von sich behauptete «Ich kann keine Romane lesen», hat sich immer wieder zur großen Literatur geäußert, zu Büchern und Autoren, zu Problemen des Schreibens und Lesens – und dies auf seine unnachahmliche Weise: mit Witz und Kunstverstand, mit Skepsis, spielerischem Ernst und manchmal voll Betroffenheit.
«Literatur», der vierte Band der auf sechs Bände angelegten Alfred-Polgar-Werkausgabe, enthält eine Sammlung kritischer Prosa von ungewöhnlicher thematischer Vielfalt. Das Themenspektrum reicht von Arthur Schnitzler, Robert Walser und Peter Altenberg über Joseph Roth, Egon Friedell und Karl Valentin bis zu Hemingway und Arno Schmidt; von der Frage «Wie helfe ich mir beim Dichten?» bis zur «Theorie des Café Central».
Der passionierte Zuschauer Polgar hat auch im Kino mehr gesehen als so mancher professionelle Filmkritiker. Ein eigenes Kapitel präsentiert eine Auswahl von Filmbesprechungen, Satiren und Geschichten aus dem Filmmilieu, darunter klassische Texte wie sein Porträt von Charlie Chaplin oder den Hymnus auf Eisensteins «Panzerkreuzer Potemkin».
Inhaltsübersicht
Literatur
Ferdinand Raimund
September 1936 feierte man seinen hundertsten Todestag
AN der Spitze des Zuges wunderlicher und liebenswerter Gestalten, die Ferdinand Raimund, dem Mann aus dem Volke, als fürstliche Suite in die Unsterblichkeit folgen, schreitet der Rappelkopf. Er ist um einen Kopf höher, um ein Herz reicher, um ein paar Nervenbündel komplizierter als die andern, und seine Stirne zeigt das Faltenzeichen der tragischen Würde, die der Titel Mensch verleiht. Zur Schöpfung dieser Figur hat der Dichter den Dämon, der ihn selbst plagte, in Dienstpflicht genommen. Und ihm glückte hier, mit den arglosen Listen des Zauberstücks, in Possen- unnd Märchenfarben, ein Charakterbild, das viele spätere Psychologie und Pathologie genialisch vorwegnimmt. Rappelkopf ist ein Kranker. Seine Seele hat, wie man heute sagen würde, ein «Trauma» erlitten, das Gifte des Mißtrauens und des Hasses zeugte. Eine natürliche Disposition war freilich auch vorhanden: Rappelkopf, wie das kostbare Lieschen sagt, hatte «was Düsteres, selbst wie er noch Buchhändler war». Aber der Strom von Bitterkeit, der ihm aus dem Busen springt, schleppt soviel Skurriles und Launiges mit, daß er die Landschaft mehr heiter als düster belebt; sein warmes wienerisches Herz kann keinen Winter vormachen, höchstens einen verregneten Sommer. Die Heilung des Misanthropen vollzieht sich nach neuesten Methoden: der gute Alpenkönig – ein gemütvoller Zauberer, trotz seiner bei so naturverwandtem Wesen wunderlichen Sympathie für die Jägerei – verdoppelt das Ich des Rappelkopf und erzielt damit die gleiche Wirkung, als ob er es gespalten hätte. Nun sieht er sich selbst, der Menschenfeind, das Schlimme, das er in Tiefen herbergte, kommt ihm zum Bewußtsein, wird dort gefaßt und hinausbefördert. Im Märchenspiel geschieht das so, daß Rappelkopf, der in der Tinte sitzt, wo sie am galligsten ist, vom Alpenkönig mit der Kratzbürste reingescheuert wird. Die Heilung des Gemütskranken vollzieht sich hier noch mit allem Aplomb einer moralischen Besserung. Der Geist, der des Dunkels Herr wird, erscheint nach außen projiziert, als leibhaftiger Geist mit Kron’ und Bart, den Tempel der Erkenntnis deckt ein marmornes, kein Schädel-Dach, und der gleiche Mechanismus, der die Kulissen bewegt, bewegt auch die Seelen.
Aber wieviel echte Magie wirkt der kindliche, theatralische Zauber! Wieviel Blutwärme und Lebenston hat diese prinzipielle Figur des Menschenfeinds von dem Dichterherzen, an dem sie gelegen, abgekriegt! Wie grünt und blüht der Pappendeckel, aus dem die Welt des «romantisch-komischen Märchens» geschnitten ist! Wie kräftig atmet die gemalte Erde, wärmt die Sonne aus Goldpapier! Ganz erfüllt von Menschenliebe scheint dieses Spiel von Menschenhaß. Mit welch gütigem Humor, wie zärtlich-nahe ist das Lumpenvolk in der Köhlerhütte gesehen, wieviel frohe Bejahung selbst des elenden Lebens in der Realistik dieser unvergleichlichen Szenen!
Auch die Tränen, die in diesem Märchen geweint werden, sind ein Spiegel, der der Welt schmeichelt, ihre Bosheit und Torheit zu Schönheitsfehlern herabmildert. Und das tiefste Stimmungsdunkel, das erreicht wird, ist das eines melancholischen Optimismus.
Nestroy
Opus virumque cano
NESTROYS Figuren sind ein Produkt der Luft, die sie atmen, der Sonne, die ihnen scheint. Sie stecken in ihren Gassen und Stuben, in den Stätten ihrer Arbeit und ihres Vergnügens, in den Tugenden und Lastern, die das moralische Klima des besonderen Erdenflecks gedeihen läßt, wie in ihrer Haut, aus der sie nicht können. Der Geist der Dinge, um die ihr Sinn im engsten Kreise kreist, ist in sie gefahren. Es gilt nicht nur so zum Spaß, daß sie Zwirn, Leim, Knieriem heißen: das Handwerk, das sie üben, übt sie.
Nestroys Stücke sind leichthin konstruierte, spielerisch bewegliche Modelle der Welt, die ihm Heimat war. Dem Klaren und Trüben, dem Witz und Aberwitz, Geist und Ungeist, Charakter und Uncharakter dieser Welt gab er Gestalt und Wort. Seine Hellhörigkeit vernahm die Naturstimmen des Lebens, der Land- und Menschenschaft um ihn, und sein Genie fand die witzigsten Zeichen, sie zu fixieren.
Über seinen Gestalten schwebt das Lächeln der Götter, zumindest jener, die mit Wien etwas zu tun haben. Denn Nestroys Menschen sind artikulierte Natur, seine Schwänke lustigste, weiseste Menschen-Fabeln. Man muß diese närrischen, vom Dichter belebten Lebewesen aus dem Wiener Busch, auch die Argen und Schlimmen, die Faulen und Gefräßigen, die Tölpel und die Übertölpelten, lieben, man kann Reineke Mensch sowenig böse sein wie Reineke Fuchs. Nestroy war kein Moralist. Wenn bei ihm die Tugend das Laster besiegte und Hochmut vor dem Fall kommt, so ist das ein sittliches Ordnungmachen weniger um der Sittlichkeit als der Ordnung willen. Nur keine Schlamperei.
Den Kleinen von den Seinen kam er als Erlöser. Er lockerte ihnen das Herz und die schwere Zunge: nun reden sie im Idiom ihres Mundes das Idiom ihrer Seele. Er gab der Einfalt Witz, sich zu bekennen, den Armen im Geiste die Philosophie dieser Armut, der Narrheit Grazie, den Plumpen und Schweren die Impertinenz ihres bessern Gleichgewichts, den Vagabunden die goldene Laune der Freiheit, den Habenichtsen den Humor des Unbelastetseins und Nichtsmehrverlierenkönnens. In der Komik dieser Figuren löst sich alles Niedrige ihrer Art und Gesinnung. Verwandelt und verklärt ist das Gemeine (das uns alle bindet) durch das Lächerliche (das dies auch tut). Unvergleichlich heitere Landschaft der engen Horizonte, Fata Morgana einer allerfidelsten Kleinbürgerei, holder Trug der Wienerluft-Spiegelung! Weich im Raume stoßen sich die Menschen. Pathetische Substanz wird zerbröselt und weggeweht von Gelächter.
Nestroy hat den absoluten Humor der Welt, in der er zu Hause ist, gesehen, ihre konstitutionelle, nicht zufällige Possierlichkeit. In den Figuren, die er, sie entdeckend, erfand, scheint der Typus auf seine letzte Spaßigkeitsformel gebracht, seine innerste Komik befreit, herausgesprengt aus allen Bindungen. Naturalistisch ist an diesen Figuren, trotz ihrer himmlischen Echtheit, gar nichts. Von den Sternen, unter denen sie geboren sind, leuchten nur die goldpapierenen. Eine beglückende astrologische Konstellation, der die Hausknechte und Lehrbuben die Luzidität ihrer Dummheit, die Kommis ihre hinreißende Beredsamkeit, die Kutscher, Kellner, Wächter das Bezaubernde ihrer Gefräßigkeit, Grobheit und Habgier verdanken.
Nestroys Dichtung ist das schönste Monument, das je dem Mutterwitz eines Volkes errichtet wurde. Er selbst, dieses Witzes souveräner, schonungsloser Gebraucher, sah durch ihn die Menschen, die er sah, in allen Farben und Ultrafarben. Und baute aus solcher Buntheit den heitern Regenbogen seines Possenwerkes: als Zeichen der Versöhnung zwischen Schöpfer und Kreatur.
Oscar Wilde
ER hat «das Gegenteil» der Phrase erfunden. Schlechtweg: «das Gegenteil». Und so auch natürlich das Gegenteil des Gegenteils, womit endlich erwiesen scheint, daß alles wahr und ebenso falsch ist. Und er hat aus alledem die Erkenntnis destilliert, daß es nicht darauf ankommt, sich auszukennen – was ja weder möglich noch nötig ist –, sondern darauf, die verzwickte Illusion des Daseins sich so schön, so stilvoll und allen Sinnen so wohltuend wie möglich auszugestalten. Was mit andern Worten heißt: das Leben als das eigentlichste Kunstwerk und die Kunst als das eigentlichste Leben zu betrachten.
Um das Gerüst einer absichtsvoll skurrilen Handlung schlingen sich, aus Glanzpapier kunstfertig geschnitten, Ketten von witzigen Spruchbändern. In der Sonne vergangener schöner Tage mag das Ding ein froher Anblick gewesen sein. Im trübseligen Grau heutiger Zeit hängt der ganze buntpapierne Zauber leblos, verwaschen, hinfällig.
Über den lächerlichen Ernst dieser Lustspiele ist der Witz gezogen, wie über eine derbe Hand ein seidener Handschuh. Bagatellisierung des Theaters. Vorgänge sind Vorwände. Ganz rohe, pyrotechnische Gerüste stehen da, von denen des Spieles Ironie in breiten Fassaden abbrennt. Seinerzeit hat diese Feuerwerkerei sehr entzückt. Jetzt wirkt sie gespenstisch. Der ganze reizvolle Plunder von Esprit hat was Melancholisches wie verstaubter Jahrmarktsflitter, die ganze feine Gaukelei von Antithesen und Paradoxen etwas so Rührendes wie die Mechanik einer zerbrochenen, alten Spieldose.
O Fügung! Grade die Paradoxie, grade das, wodurch der exklusive Oscar von Vulgarität sich am weitesten zu entfernen glaubte, grade das wurde Beute – der Vulgarität. Mit dem ersten Aperçu, zu dem der Dichter sich entschloß, hatte er tausende. Man kann sie nach Herstellungsmethoden ordnen: der den Vordersatz aufhebende Nachsatz; das verkehrte Sprichwort; der Tausch von Schluß und Prämisse; die Pyramide mit der Spitze unten und der Basis oben; die Behandlung einer moralischen Frage als ästhetische; das Einmaleins als Geschmackssache; die Umdrehung platten Sinns zu apartem Unsinn. Wilde hat das Geist-Metier bis zur Grenze ausgeschritten. Er hat noch die, welche die Ironie ironisieren, ironisiert, also den Kubus der Ironie erfunden.
Regie und Darsteller müssen verstehen, daß nicht Seelen und Schicksale, sondern Geist und Worte der Inhalt dieser Stücke sind.
Peter Altenberg
(Nachruf I)
PETER Altenberg ist gestorben. Trauer, Kälte, Vereinsamung fallen die Seele an, die diesen Mann und seine Bücher geliebt hat. Er war ein Genie, das einzige unter den österreichischen Dichtern unserer Zeit. Das stärkste Temperament, der originellste Mensch, der heiterste, verwegenste, zärtlichste, grimmigste Geist. In ihm brannte unverlöschlich eine Flamme der Leidenschaft, mit der er Lügen-Welten einzuäschern beflissen war, an der er Gottesdienste des Lebens zelebrierte, die er, als Feuerzeichen zur Schönheit weisend, leuchten ließ, und an der er auch seine sonderbaren Gesundheitstränke und Geheim-Mixturen kochte. Er war ein Elementargeist ekstatisch in Bejahung und Verneinung, von verführerischer Beredsamkeit der Liebe und des Hasses. Er war ein Dichter, der den kleinen Dingen ihre geheime Größe entschaute, dem Klang der Alltäglichkeit seine geheime Musik enthörte. Das Leben bezauberte ihn, und er gab ihm die Bezauberung mit Zinsen wieder. Er war durchaus ein Eigener, eine so starke, volle, von geistigen und seelischen Spannungen so durchsättigte Persönlichkeit, daß er ihm Wesensfremdes niemals aufnehmen konnte. Er hatte das freieste, empfindlichste, auf kleine Reize mit einer Funkenkette von Entladungen reagierende Gehirn. Und er hatte den prachtvollsten Humor, eine wahrhaft schöpferische Heiterkeit, die ihn hoch trug, hoch über alles und alle, über sich selbst, über die dumpfe Qual irdischer Bedingtheiten. Sein Lebenswerk ist in den Büchern, die von ihm da sind, nicht erschöpft: es gehörte, als buntester und phantasievollster Teil, sein Leben hinzu. Aber das Genie wird sich kaum finden, das denen, die es nicht miterlebt, von Peter Altenbergs tausendfarbig sprühender, in ihrer Mischung von Kindlichkeit und Tiefsinn, Fanatismus und Geschmeidigkeit, Nüchternheit und Bizarrerie unvergleichlicher Erscheinung ein Abbild zu geben wüßte.
(Nachruf II)
DIE erste in Druck erschienene Skizze von Peter Altenberg hieß «Lokale Chronik». Es war Gefühls- und Gedankenparaphrase über ein Zeitungsnotizchen, das vom Selbstmord eines jungen Mädchens berichtete. In dieser Skizze leuchtete schon, unverkennbar, das Genie-Zeichen. Sie erinnerte an kein Vorbild. Kein Dunsthauch irgendwelcher literarischen Küche hing an ihr. Neue Worte, von einem neuen Atem belebt, in neuem Rhythmus hingesprochen. Aus Zwischentönen baute sich süßeste, unsüßlichste Melodie. Erde und Himmel, im Aug’ eines neuen Eros widergespiegelt, schnitten einander in neuen Horizonten. Ein neues Mitleid streichelte das arme Leben, ein neues Lächeln der Güte gab sanftesten Schimmer. Wirklichkeitsfarbe bekam Märchenglanz. Eine neue Chemie, Alchemie des Erlebens übte lautlosen, berückenden Zauber: im Staub der gemeinsten Alltäglichkeit, durch des Dichters schöpfende Schöpfer-Hand rieselnd, glitzerte es golden.
Solcher Skizzen wuchsen ihm dann viele hunderte. Aus der Tiefe. Aus der flachen Hand. Kunstprodukte einer großen, reichen Natur, die Gott, Frauen, Kindern nahe war. Durch sie tönend wurde Geräusch Musik. Altenbergs Dichtung ist zum Großteil solches Reinigen, Sieben, Erlösen gebundener Schönheit, Gewinnen von Wahrheits-Werten aus Lüge-Rohstoff. Erhöhen durch Verstehen. Erklärung durch Verklärung. Sein Hirn gab das Licht, sein Herz die Wärme, unter deren Strahl im Keim gehehlte Blüte für eine mystische Sekunde sich öffnete. Seine Dichtung war Schatzgräberei; oft in härtester, schmutzigster Erde. Er schrieb die Sprache der stummen Geschöpfe auf, die Poesie der Unpoetischen, die Weisheit der Unbewußten. Aus dem üblen Atem der Welt filterte er Gottes Atem; und wurde überschwenglich, wo er ihn rein, unmittelbar zu verspüren glaubte. So mußte Altenberg ekstatischer Verkünder des schönen Menschenkörpers, fraulicher Grazie und Holdheit sein. So mußte er Natur-Fanatiker sein. Die lieblichsten Liebesgedichte, die der Liebe-Reiche geschrieben, gelten ihr. Er hat sie mit der ganzen Inbrunst, die seines Wesens Wesen, erfühlt und ihren Zauber in schlichtesten Formeln kodifiziert. Das rührselige Motiv vom «Trost in der Natur» klingt in seinen Büchern nicht auf. Sie ist dort vielmehr die große Schallverstärkerin, die Alleinsein in Einsamkeit, Bekümmernis in Schwermut und das Gefühl innerer Leere in das hoffnungsloser Zernichtung wandelt. Sie ist das heilige Symbol untadeliger Freiheit und Echtheit. Die standen dem Dichter am höchsten. Er liebte das Ungebundene der Seelen, der Körper, der Trachten beider; die Künste des Varietés, ausdrückend Abschüttelung der Schwerkraft-Tyrannei, die Straßenmädchen und ihre Freunde, frei vom dummen Plunder bürgerlicher Wichtigmacherei, die undressierten Kinder, die Nacktheit schöner Menschen, Wald und Wiese, die kein Gärtner zum Park vergewaltigt hatte, ein Leben, das unbeirrt von Sitte- und Mode- und Angst-Geboten und -Verboten organischer Notwendigkeit gemäß. Er liebte die letzten Aufrichtigkeiten. Er war in des Wortes edelstem Sinn: ein Libertiner.
Altenbergs Skizzen – nicht die Manifeste und Predigten seiner späteren Zeit – sind kleine Wunder an erlesenster Zartheit und komprimiertester Kraft, schmeichlerisch, überrumpelnd, hinreißend. Was ihm Herz und Hirn durchströmte, schloß und erschloß sich hier, rätselvollem Innen-Gesetz folgend, zu kristallischer Klarheit und Gedrängtheit. Licht wird listig gesammelt und listig verteilt. Was gesehen werden soll, tritt plötzlich wie unter Scheinwerferstrahl aus dem Dunkel. Altenberg schrieb eine Prosa von höchstem lyrischen Reiz, Sätze, weit über ihren Sättigungspunkt hinaus mit Empfindung voll; Gedankenstriche, besser: Gefühlsstriche fangen den Überfluß auf. Sein selbstgeschaffenes und nur für seine Musik taugliches Sprach-Instrument spielte er mit vollendeter Virtuosität. Das Pedal arbeitete mächtig. Angeschlagener Ton sollte hallen, nachhallen. Aber welch subtilste Reinheit in dieser Klangfülle, welche Kunst, gerade die leisesten Stimmen allerhellst dominieren zu lassen, das Laute zum unbestimmten, obstinaten Lebens-Geräusch, zur weltsingenden Atmosphäre zu verwischen. Eine ganz neue Art dichterischer Erfassung bezauberte: eine, die den Dingen ins Herz griff, ohne sie anzurühren. Eine ganz neue Art indirekter Darstellung bezauberte: im Unwesentlichsten spiegelte sich das Wesentlichste. Eine ganz neue Art von Empfindsamkeit bezauberte: die wortlos-überberedte. Altenbergs schönste Skizzen, die, in denen er nicht von seinem transportablen Berg Sinai herab predigte, sind in einer wundervoll graziösen Ausspar-Technik verfaßt: das Nichtniedergeschriebene ist ihr eigentlichster, von dem Geschriebenen nur herausschattierter Inhalt. In den Zeilen ist Ruhe, zwischen ihnen tobt das Drama. Später gewann der Rhetoriker über den Dichter die Oberhand. Da schrieb er dann am liebsten Fortissimo; und pfefferte, zur Ton-Verschärfung, die Ausrufungszeichen wie aus der zerbrochenen Gewürzbüchse nur so hinein.
Seine Dichtung war unentrinnbare Bestimmung. Das scheidet ihn meertief von den literarischen Ortgenossen. Jeder Satz, den er geschrieben, ist er selbst, ist treueste Kopie seines Ingeniums, Abdruck seiner Persönlichkeit im Material seiner Sprache. Zwei Zeilen P.A.’s über eine Wiese, das sind ebenso zwei Zeilen der Wiese über P.A. Seine Kunst war überschüssiges Leben, nicht Lebens-Ersatz wie bei den Sitzfleisch-Romanciers und -Dramatikern. Daher ihre Saftigkeit, ihr starker Duft, ihre Blut-Röte und -Wärme. Er war ein Elementargeist, aufregend, beunruhigend, entgleitend. Er war kein Büchermacher. Er hatte keinen Schreibtisch, und kein Schreibtisch hatte ihn.
Er ist das stärkste erotische Temperament, das jemals in deutscher Druckerschwärze Spuren seines Erdenwandels hinterlassen. Sein Leben war pausenloses Sich-Verlieben und Sich-Verhassen. Den verzauberten Prinzessinnen, den schlafenden Dornröschen galt seine ganz große romantische Leidenschaft. Er hatte die potenteste Seele, in der ein nie zu sättigender Durst nach erlösender Hingabe brannte. Sie befruchtete, was sie umarmte. Sozusagen: wo P.A. hintrat, wuchs Gras. War es keine Frau, so war es ein alltägliches Gebrauchsding, irgendwelche vom Zufall hergewehte Winzigkeit, an der sich sein ewig lüsternes Aug’ und Herz genug taten, die er streichelte, besang, vergötterte, idolisierte. Dann wurde die Frau, um die eben sein Begeistern feuerwerkte, zur überhaupt allerschönsten, einzigsten, und die Zahnputzpasta, die eben seinen Wünschen entsprach, zu aller Pasten Königin. Sein Herz begattete sich mit jeder großen und kleinen, belebten und unbelebten Schönheit, die «der Tag ihm zutrug». Ohne Wollust der Entzückung konnte es nicht sein. Seines Reichtums sicher, strömte es unerschöpflich in Werbung, Zärtlichkeit, Huldigung, Ekstase aus. Treu der Idee, treulos der Erscheinung! Altenberg brachte es fertig, von einem Abführmittel so zu sprechen, als spräche er Liebeserklärung. Er brachte es, zum Ausgleich, allerdings auch fertig, die geliebten Frauen als eine Art Purgativ einzuschätzen.
Denn er war bei aller leidenschaftlichen Rabies, mit der er die Gaukelbilder des Lebens in sein Gefühl riß, doch ein innerlich ganz Freier, ein erbarmungsloser Durchschauer der Majestäten von der Menschen-Seele Gnaden, einer, der sich von sich selbst distanzieren konnte und auch das kluge und schöne Dasein nur als eine Summe kluger und schöner Fiktionen wertete. Es gibt eine höhere Wahrheit als die höchste Wahrheit: das Lächeln über die Wahrheit. Peter Altenberg hatte dieses Lächeln, diese sprühende Bösewichtlaune, die den Trugbau aus Geist und Sinnen wieder ins Chaos zusammenwarf, diese letzte, lichte, feinste Heiterkeit, zerblasend finstere wie rosige Nebel. Sie gab seiner Persönlichkeit das unwiderstehlich Anziehende, seinen Dichtungen ihre sternenzart schimmernde Helle. Ernster Philosoph, das ist ein Oxymoron. Wie könnte einer Philosoph sein und nicht letzten Endes die Philosophie belächeln? Wie könnte ein Genie völlig des Humors entbehren? Das können nur die Expressionisten. Darum ersticken sie auch im Krampf und Schweiß ihrer Bedeutsamkeit. Und sind, obzwar von oben bis unten und rundherum und zwischendurch Geist und nichts als Geist, stöhnend vor Geist, Lasten von Geist mit Möbelpacker-Anmut in die höchsten Stockwerke der Erkenntnis schleppend, doch der Geheim-Verbindung mit dem Spiritus sanctus weit weniger verdächtig als der Impressionist Peter Altenberg, den sie, eine recht hübsche Nummer von gestern, leutselig abtun.
Er war sechsunddreißig Jahre, als er seine erste Skizze schrieb. Im eignen Feuer ausgeglüht, gehärtet, schmiegsam gemacht. Er war fertig, als er begann. Und die kommenden zwei Jahrzehnte nichts als eine einzige Ernte, dem fruchtbarsten Herzen mühlos abgewonnen: der leiseste Hauch, die Windstille selbst entschüttelte ihm den Segen. Ein Geringes seiner Fülle ist in den zehn Büchern gesammelt, der Großteil in vielen tausenden Briefen und Reden verschenkt, in wilden, genialischübermütigen, verzweifelten, verzückten, von Liebe und Haß tobenden Episteln, in Tischgesprächen von beispielloser Schwungkraft, hinreißend durch ihren tyrannischen Überzeugungswillen, durch den Hexen-Luftritt ihrer phantastischen Gescheitheit, durch ihre himmlisch-gewalttätigen Verstiegenheiten und Narreteien, Negative der Weisheit, durch die Gewitterpracht eines Temperaments, das sich da, Blitz der Idee und Donner nachstürzender Worte, elementar entlud. Den Rest verbrauchte eine Lebensführung, deren blühende Sonderbarkeit so durchaus allen Formulierungs-Versuchen spottend wie durchaus folgerichtig war.
Es war gut in seiner Nähe. Sein geistig Wesen hatte solche Strahlkraft, daß auch die fahlsten Gesichter der Umgebung einen Hauch von Farbe bekamen. An seiner einzigartigen Beweglichkeit schmarotzten sich die dumpfesten Gemüter etliche Lockerung, an seiner Hitze die frostigsten Burschen ein paar Grade. Von seiner explodierenden Originalität splitterte auch den Gewöhnlichsten etwas Besonderheit in die Tasche. Mit den verfaulten Abfällen seines Humors noch machten andere einen Laden auf; und sich selbständig. Von den Gebärden seines Ingrimms und seiner Güte aber, von dem Tempo und Wortschatz seiner Begeisterung nahmen die Jünger gierig gern zu Lehen, am Ende überzeugt, es sei ihr angestammter Besitz. Die Wiener Dichter betrachteten Altenberg als Außenseiter. Das war er nun allerdings. Aber sie hatten dessenungeachtet was übrig für den närrischen Kollegen. Sie freuten sich seines hängenden Schnurrbarts und seiner sonderbaren Kleidung und seiner Riesen-Zwickerschnur und sagten: «Du Peter», und waren überhaupt sehr amüsiert von ihm.
Gulliver unter den Zwergen.
Wirkung der Persönlichkeit
IN das manuskriptraschelnde Café Griensteidl kam er, mit wehender Pelerine, und hielt Reden über das Christentum. Zahlkellner Heinrich schwenkte das versoffene Haupt. Seine Macht war machtlos gegen dieses Gastes Tempo.
Die Literatur, um Tischchen amikal und strebevoll versammelt, lächelte dem wilden Menschen zu. Aber er war ihr schon damals unheimlich. Sein ganzes Wesen hatte so was Anti-Papierenes, Schreibtisch-Müh’-Entwertendes, Etikette des Berufs Mißachtendes. Die saubere Dreiteilung der Literaten-Existenz – Leben, Reden, Schreiben – schien in dieses Sprechdichters Person umgestürzt und aufgehoben. Er tobte Essays, stegreifte Dramen, lebte Lyrik. Seine Tinte war: Nervensaft.
Er hatte keinen Schreibtisch, nur einen ambulanten Schreitisch. Wo er hinkam, entstand Unruhe, Verlegenheit, Stockung im glatten Ablauf sicherster Kausalitäten. Die Heftigkeit, mit der sein Hirn Glühendes und Kaltes, Tiefsinn und Abersinn auswarf, beschämte das Temperament ringsum. Der allen Widerspruch umreißende, schäumende Zustrom von Einfall, Bild, Witz, Paradoxie, der seine Reden speiste, machte der Zunft Ohrensausen.
Die Angelangten, die Großen, kehrten sich bald von ihm, dessen unproduktive Fülle ihre produktive Armut entschleierte.
Die Beginnenden, die Kleinen, hielten ihr Töpfchen unter den sprudelnden Überfluß.
Am Tisch, an dem er saß, war nur er. Die anderen? Publikum, Staffage, Stichwortbringer. Aber sie kamen auf ihre Rechnung.
Er war eine Persönlichkeit von solcher Starkspannung, daß in ihrer Nähe sein schon zu erhöhtem Ich-Gefühl verhalf. Der Widerschein seines Feuers schon lieh geflissentlich nah hinzugestreckten Gesichtern eine Helligkeit, die sie aus inneren Lichtbeständen niemals hätten produzieren können. Er ging so weit ab dem Gewöhnlichen, daß, wer bei ihm sich hielt, auch schon der Illusion eigener Ungewöhnlichkeit teilhaftig wurde, süße Schicksalsbestimmung zur Abgetrenntheit vom Dutzendmenschen im Busen wähnte. Schon vom Wind, den er machte, strich den anderen erquickliche dunstverjagende Frische ums Hirn. Von den Katarakten seiner Wut und Begeisterungen übersprüht, deuchten sich die Genossen der Stunde in Wildnis-Bezirken hoher Leidenschaft heimisch und den Gemsenpfaden seiner herrlich verstiegenen Suada folgend, fühlten sie sich immerhin Hochtouristen im Geiste.
Sie kamen auf ihre Rechnung, die sie im Wirtshaus für ihn zahlten.
Alles an ihm war besonders, überraschend, seine Optik vergrößerte, was ihm augenblicklich die Netzhaut reizte, zum «Höchsten», verkleinerte, was sie unberührt ließ, zum «Letzten». Was ihm galt, hieß ihm «heilig», was ihm nicht galt, «tierisch».
Die Umgebung, gelehrig, gab ihrem Urteil gleiche Unbedingtheit. Von matten Lippen sprangen da seine Superlative, und stimmlose Geister fistelten das dreigestrichene C der Bejahung und Verneinung. Das war nicht einfaches Nachahmen, sondern unbewußtes Deckung-Suchen hinter den Ausdrucksformen seines extremen Geistes vorm Gefühl der eignen Mittelmäßigkeit, das jener wachrief. Seine leidenschaftliche Antwort auch auf kleinste Reize machte, daß den anderen mies wurde vor der Lauheit, Halbheit, Dumpfheit, Wackeligkeit ihrer Reaktionen. Solcher Beklemmung entflohen sie in seine Worte und Gebärden. Wie komisch das war, die zaghaftesten Bursche Fäuste gen Himmel recken und mit einfältigen Augen Ekstase rollen zu sehen!
Seine Geste, Mimik, Rede, hemmungslos hinausgeschleudert aus bewegtem Innern, trug solcher Herkunft Merkmal. Nicht um ihrer Schönheit oder Prägnanz, sondern um dieses Merkmals willen (dem eigen schien, vor Gott und Menschen bedeutend zu machen) wurden sie von den Schülern übernommen. Das große Spiel seiner Aufgeregtheit war Bote ungemeinen Innenlebens, und wer gleich livrierter Boten sich bediente, auf dessen ungemeines Innenleben war Rückschluß zwingend.
Weithin breitete sich ein Geschlecht in jeder Hinsicht verstohlener Jünger, die, eigner Sprache nicht mächtig, den Argot seiner Persönlichkeit stotterten. Er gab, in des Wortes Sinn, den «Ton» an. Mode wurde so zum Beispiel seine Art, starr in verzücktem Schauen der geliebten Frau an ihr Kleid, ihr Haar mit einer so Andacht wie heftigste Passion ausdrückenden Geste zu rühren, eine sanfteste Hand, deren Tremolo die mächtige Arbeit des inneren Motors verriet, auf ihre Hand zu senken und vor sich hin und doch ihr zu Worte zu murmeln, die wie Blasen einer von Zärtlichkeit überkochenden Seele auf die Lippen stiegen.
Die Freunde wußten gar nicht, wie großes Recht in dem Unrecht war, mit dem er ihre erotische Beute als sein Eigentum reklamierte.
Ein Schauspiel, wenn Schriftsteller und Künstler gesicherter Geltung an den Stammtisch kamen, dem Außenseiter gütig zuzulächeln. Wie verdufteten, in der Mischung des Gesprächs, vor seinen Essenzen ihre schwachen Zusätze! Wie waren im Nu die Solisten zur Statisterei abgedrängt!
Alles Gefestete, im Wert Bestätigte, Sichere wurde, eben weil es das, irgendwie lächerlich neben ihm, der das menschgewordene Prinzip der Beweglichkeit war, stets in Auflehnung gegen das Gesetz der geistigen Schwere, sein Lebtag immer wieder, treulos Ruhe-Verträgen, in heiße, freilich oft donquichotische Gefühls- und Gedanken-Abenteuer verstrickt.
Widerspruch schien blaß neben der heftigen, in späteren Jahren unheimlich apoplektischen Röte seiner Meinung. «Vernunft»-Einwände schleuderte seine wirbelnde Irrationalität schon fort, ehe sie überhaupt heran gekonnt. Er war immer «hingegeben», immer «außer sich». Alles in den Paradiesgarten seiner Illusion Eingelassene – Speisen, Kunst, Huren, Freunde – bekam Flügel, und erbarmungslos arbeitete das Flammenschwert.
Nie war der ungeheure Appetit dieses heißhungrigen Herzens gestillt. Es konnte immer noch.
In seine Natur hineingestellt schien anderes Menschentum immer irgendwie Theaterkulisse: gefärbt, zurechtgeschnitten, gekleistert, mühevoll befestigt. In seiner Wärme verschrumpelte aller Pappendeckel.
Gebrannte Jünger schützten sich vor der Gefahr durch Imprägnierung mit Liebe oder Spott.
Er war Agitator. Immer für andere und anderes und ebendadurch zwingend für sich selbst. Das machen ihm die Schüler nicht nach. Ihre Agitation vermeidet die Umwege.
Er war kein Sparer mit sich und kein bescheidener Zurückhalter.
Im karierten Anzug mit zu kurzen Hosen, den Ledergürtel sportlich umgeschnallt, ohne Hut, sandalenklappernd, die Zwickerschnur breit wie ein Meßband, den keulenförmigen, knolligen Stecken unterm Arm, stocherte er, schäumend im Selbstgespräch, über den Graben. «Sie machen zu viel Aufsehen!» sagte der Wachmann.
«Zu wenig!» schrie der arme Peter, «zu wenig!»
Fliegen war seines Leibes und Geistes Sehnsucht.
Und dies kränkte die Umgebung am tiefsten, daß er so gar nicht zu domestizieren war, nicht einzufrieden, nicht festzuhalten bei Meinung, Liebe, Haß. Nicht einmal beim Stammtisch.
Er hatte auch wirklich etwas von Loge, dem Schweifenden, nicht zu bändigenden, Flamme-Verwandelten.
Nur war seine Wandelbarkeit und Treulosigkeit kein Verstandes-, sondern ein durchaus erotisches Phänomen: bedingt durch ungezähmt sinnliche Verliebtheit in die Welt, durch grenzenlose Gastfreundschaft, die er gegen das Leben übte. Sein Herz mußte immer Platz machen für neue Einquartierung. Das ging nicht ab ohne Hinauswurf und Kränkung.
Er war überhaupt ein Tyrann, der Worte und Wahrheiten, wie es seine Laune, in Gnaden nahm oder in den Dreck verstieß, mit Adelserhebungen so wenig knauserte wie mit Todesurteilen, Augenblicke zu Ewigkeiten ernannte, Tribut und Lehenszins nahm, und auf Einbrüche in den Harem mit orientalischer Grausamkeit die furchtbarsten Strafen setzte.
Über ihn hinweg kam keiner. Es galt, ihn zu lieben oder zu meucheln. Ganz Vorsichtige taten beides.
Zum Glück war er bei all seiner unvergleichlichen Genialität auch ein gewaltiger Narr, voll Marotten, Kinkerlitzchen, wüster Absonderlichkeiten. So ließen sich doch archimedische Punkte finden, von denen aus die Beklemmung, die seine Persönlichkeit erzeugte, wegzuhebeln war.
Vor das Außergewöhnliche haben die Götter das Pathologische gesetzt. Zum Schutz der Gewöhnlichen.
Jerome K. Jerome
Der Nebel steigt
AUS dem Englischen des Jerome K. Jerome hat Hermynia zur Mühlen dieses ungemein liebe Buch übersetzt (sehr feinfühlend übersetzt; der wunderliche Imperativ «Spreche die Wahrheit», S. 340, dürfte ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein). Der vor wenigen Jahren verstorbene englische Autor, deutschen Lesern meist nur als Humorist bekannt – durch seine köstliche Geschichte: «Drei Mann in einem Boot» –, war ein Dichter. Das bezeugen seine, von grotesken wie unheimlichen Einfällen belebten Novellen und sein schönes Schauspiel «Der Fremde», in dem, angetan als Mensch wie du und ich, der Heiland sich unter kleine Leute mischt. «Der Nebel steigt», im Ich-Ton erzählt und wohl auch autobiographisch gemeint, ist mit der Zartheit seines Humors und seiner Traurigkeiten so deplaciert im Bezirk des dröhnenden Heute wie etwa ein Blumenbeet auf einem Schlachtfeld. Jerome K. Jerome hatte den ergiebigsten Blick für die Lächerlichkeit der Kreatur und ihrer Bemühungen, das Leben zu meistern, aber er hatte auch den Blick für das Schicksalhaft-Bedingte unseres Tuns und Leidens, er sah (und verspottete gutmütig) das Irren, Stolpern, Fallen der Menschenkinder auf ihrem Lebensweg, aber er sah auch die Dunkelheit dieses Weges und wußte um die Unzuverlässigkeit der Sterne, die dem Wanderer, scheinbar, etliches Zurechtfinden gestattet. So schlägt durch all den bezwingenden Humor, den er produziert, Melancholie als die eigentliche Grundstimmung seines Werkes. Auch in dem hier besprochenen Buch, dessen skurrilste Figuren und Begebenheiten noch zudem überschattet sind von der Schwermut der Distanz, die das Alter zur Kindheit hat. Jerome zeigt sich in dieser Biographie – sie reicht bis zur Lebensmitte – als Menschenschilderer par excellence, als Meister des Erzählens, eines Erzählens allerdings, das von den guten Geistern der Stille und des geruhigen Betrachtens gesegnet, heute Seltenheits-, aber kaum Marktwert hat. Erkenntnisse und Lebensweisheiten, einfach formuliert und zwanglos in den Fluß der Darstellung gemischt, geben der Erzählung ihr besonderes geistiges Aroma. (Ich zitiere als Beispiel das schöne Wort: «Die Gedanken sind immer da, wir erleben nur allmählich ihre Sprache.») «Der Nebel steigt» ist ein Friedensbuch, beschwört eine Welt herauf, wo Haß und Wut zwar gewiß auch vorhanden waren, aber nicht im heutigen Zustand der Voll-Mobilisierung, Lesern von jetzt wird deshalb der vortreffliche Jerome K. Jerome ziemlich altväterisch erscheinen.
Ein Vergessener
NEBEN den Schreibenden heutiger Zeit steht Francis Jammes ganz einsam, als höchst unwahrscheinlicher Märchengreis, als weltgläubiger Eremit, der um Glück und Qual der Kreatur Tiefes weiß und auch Wesen und Dingen, die keine Sprache haben, ihren Text ablauscht.
Was wir «Leben» nennen, erfühlt dieser abseitige Poet mit zu höchst gesteigerter Eindringlichkeit, die seine Seele in fruchtbaren Rauschzustand versetzt: das Bild geschauter Welt widerspiegelt sie in Farben von unvergleichlicher Zartheit und Leuchtkraft.
Es lebt kein Dichter, dem Naturgeheimnis so verbunden wie Francis Jammes. Sein Herz kommuniziert mit den Herzen der Geschöpfe, denen seine Liebe gilt, sein Wort entzaubert das Unbelebte aus dem Bann der Unbelebtheit. Werden, Sein, Vergehen, die drei Grundstimmen im Chorus der Erscheinungen, durchklingen, kunstvoll kontrapunktiert, das Werk dieses hymnischen Geistes. Hingegebenheit an den unlösbaren Bund, in den alles, was lebt, einbezogen ist, erfüllt es ganz.
Jammes ist im großen Sinn des Wortes das, was man einen Pantheisten nennt. Tier und Pflanze, Wasser, Stein und Wind sind ihm verwandt und wesensnah, sind ihm Träger der gleichen wirkenden Gottidee, die im Menschen ihre irdisch höchste Verkörperung findet.
Die Welt ist schön: das sagt Jammes mit jedem seiner Sätze, die wie Liedertexte sind, welche ihre Musik in sich gesogen haben. Was sein Gefühl anrührt, offenbart ihm Schönheit. Und selbst Schmerzen und Tod vernimmt sein Ohr nicht als harmoniefremde Töne in der Melodie des Alls. Die Natur, in weitester Spannung des Begriffs, ist sein dauerndes Entzücken; und so bejaht er auch ekstatisch die Liebe, die große Leidenschaft, das unentrinnbare Gebot des Blutes! Seine verschwenderischste Zärtlichkeit gilt dem naturnahen Menschen, als dessen feinste, reinste Inkarnation er das junge Mädchen sieht, das mit den Gaben der Schönheit und der unverbildeten Empfindung gesegnet ist.
Jammes schreibt eine lyrische Prosa, die in klaren Wellen dahinströmt, durchsichtig bis auf den Grund. Seine Sprache, die vom Pathos der Einfachheit überlegenen Gebrauch macht, ist immer ein wenig getragen, feierlich, sie sublimiert die Dinge und Geschehnisse, von denen sie erzählt, rückt sie in eine höhere Sphäre der Betrachtung. Ihr Reichtum an Bildern von bezaubernder Originalität und Anschaulichkeit ist unerschöpflich. Und mit einer Ausdrucksfeinheit sondergleichen weiß sie zarteste Schwebungen des Gefühls in Worte zu fassen.
Die Farben des Humors fehlen auf der Palette dieses franziskanischen Meisters.
Er hat so wenig Gemeinschaft mit der «Literatur», und seine ewigen Probleme liegen so fernab von jenen, die die Schreibmaschinen der Dichter in Bewegung setzen, daß im Geschrei des Tages die Stimme dieses wahrhaften Poeten kaum noch vernehmbar ist. Er schrieb von sich selbst einmal: «Ich gehe meinen Weg wie ein beladener Esel, über den die Kinder lachen; und der Esel senkt den Kopf.»
Jammes ist ein hoher Sechziger. Er wurde in dem baskischen Städtchen Tournay geboren. Die wichtigsten seiner Bücher («Der Hasenroman», «Marie», «Der baskische Himmel») sind von Jakob Hegner mit sicherem Gefühl für die Schönheit und sprachliche Eigenart des Originals in ein dichterisches Deutsch übertragen worden.
Arthur Schnitzler
Gutachten über Brunner (Zum Fall «Reigen»)
ICH bin der Überzeugung, daß bei Aufführungen wie «Reigen», bei Publikationen wie «Venuswagen» und dergleichen selbstverständlich die sexuelle Reizung des Hörers oder Lesers ins Kalkül gezogen wird. Solche Stücke werden gespielt und solche Bücher werden gedruckt, weil sie geeignet sind, ein Publikum sinnlich aufzuregen, und in dieser Eignung liegt sowohl ihr wesentlichster Reiz wie ihr kommerzieller Wert. Nun ist natürlich dagegen gar nichts einzuwenden, und ich bin durchaus für Kunst, bei deren Genuß man eine Erektion hat. Nur soll man nicht sagen, daß man diese um jener willen (seufzend) in den Kauf nimmt, sondern zugeben, daß es umgekehrt ist. Man dürfte nicht heucheln: Wir sind weit entfernt, etwa im «Reigen» ein Produkt zu erblicken, geeignet, auf die Genitalien zu wirken – sondern man sollte das Recht des Schriftstellers behaupten, sein Publikum, wenn’s ihm paßt, zur Sinnlichkeit zu verführen, sofern nur er dies auf graziöse oder witzige oder sonstwie geistig Niveau haltende Art zu tun vermag. Wenn ich von den ethischmelancholischen Fundamentalabsichten des «Reigen» höre oder von der keuschen Kunst-Institution der «Separatdrucke», geht mir das Brechen an.
Der Theaterdichter Schnitzler
ER hatte als Dramatiker eine so sichere wie weiche Hand. Die volle Plastik gelang ihm weniger gut, als das formenzarte Relief.
Er war ein romantischer Skeptiker. In seinen Dramen werden die Versuche, des eignen Schicksals Schmied zu sein, als ohnmächtig, die schrullenhafte Ordnung, in der das irdische Geschehen abrollt, als undurchschaubar erkannt, und über Tod und Leben, Größe und Kleinheit, Wollen und Können das Zeichen eines wehmütig fatalistischen Lächelns gesetzt. Auch das Bittere und Böse in seinen Stücken ist unroh dargestellt. Auch wo Anklage erhoben wird, geschieht dies mit dem merkbaren Vorbehalt, daß der Kreatur, schon weil sie dies ist, mildernde Umstände zuzubilligen sind. Selbst das Tragische bei Schnitzler hat eine Art von Sanftheit. Langsam öffnet sich die Hand der Nacht und läßt das Finstre frei. Das Unheil kommt auf Zehenspitzen.
In den Dramen dieses Wieners scheint das Schwarze noch wie konzentriertestes Blau.
Schnitzlers Theaterfiguren haben Neigung, in sich selbst zu schauen, aus Kellern ihres Bewußtseins Versenktes ans Tageslicht zu fördern. Es sind geistgepflegte Menschen, fein und verhalten, die auf gepflegten Lebenspfaden lust- oder trauerwandeln. Ihr Verhängnis ist, daß sie, was sie tun, zu spät oder zu früh tun. So ist überhaupt das Leben im Schnitzlerschen Spiegel: nichts kommt rechtzeitig, aber gewiß kommt der Tod. Und vor ihm die große Einsamkeit.
Zwischen den Lebenden fließt ein Dunkles, sie reichen darüber hin die Hand, aber kaum ihre Fingerspitzen berühren einander. Wie ein Kunstläufer zieht das Schicksal gewagte Kurven, die sich schön und sinnvoll ineinander schlingen. Beziehungen verschwinden spurlos, wirken unterirdisch weiter, tauchen überraschend wieder ans Tageslicht, Parallelen gehen lange nebeneinander, bis sie erkennen, daß sie sich erst in der Unendlichkeit schneiden, Sieger werden besiegt, festeste Bindungen reißen, zarte erweisen sich stark wie Eisenketten.
In Schnitzlers dichterischem Charakter verschmelzen Heiterkeit des Herzens und Melancholie des Geistes. Er war mißtrauisch gegen diesen. Den Boden seines Werks decken welke Blätter vom Baum der Erkenntnis. Er verwertete ihr Rascheln musikalisch.
In der wienerisch weichen Luft seiner Bühnenspiele hat noch die Satire Gemüt, die Langeweile Anmut, die Gleichgültigkeit Kultur; und alle Oberfläche eine Opalfarbe, die verhehlt, ob die Stelle seicht ist oder tief.
Auffallend, wie häufig in seinen Theaterstücken das Präsens vom Perfektum erschlagen wird, ein gewesenes Drama ins Gegenwärtige hineinspielt, wie oft Gespenster erscheinen – «revenants» sagt präziser die französische Sprache –, um die Lebenden zu verwirren. Ibsen in Wienerwaldes Luft. Immer scheint Schnitzler bemüht, die eherne Folgerichtigkeit alles Geschehens, als weltanschaulichen Grundgedanken, zur Geltung zu bringen. «Man muß die Zusammenhänge begreifen», meint, im «Ruf des Lebens», Leutnant Max.
Fast jede seiner dramatischen (und auch epischen) Arbeiten rührt an das Problem des Todes. Das ist, unter anderm, auch ein Kunstmittel: im Licht der untergehenden Sonne werfen selbst kleine Dinge große Schatten.
Schnitzlers berühmte Verszeile «Wir spielen immer, wer es weiß, ist klug», gibt den Extrakt seines Weltgefühls. Auch was Wahrheit heißt, galt ihm nur als fragwürdiger Sinn, solchem Spiel – einem Vernunft-Bedürfnis folgend – unterlegt, ohne daß es dadurch andres würde als Spiel; ein Spiel, in dem der Masken mehr sind als der Gesichter, der leidenschaftlichen Gebärden mehr als der Leidenschaften, und in dem die Spieler mehr Blut und Geist fatieren, als sie haben. Er blickt auf das Leben heiter, weil es immerzu wieder aus dem Tod entspringt, und mit Resignation, weil es immerzu wieder in den Tod mündet. Er betrachtete die Welt liebevoll und gestaltete liebevoll, was er sah. Aber als sie ins Wanken kam, kamen schlechte Zeiten für geruh- und empfindsame Betrachter, und im Angst- und Wutgeschrei einer von Panik ergriffenen Welt verhallte das Wort des Dichters, der, trotzdem die Konjunktur so dringend dazu riet, nicht aufhören mochte, einer zu sein.
Gabriele d’Annunzio
75JAHRE alt ist er gestorben. Und wie sich das für einen großen Literaten geziemt: am Schreibtisch. Es dürfte ein besonders schöner Schreibtisch gewesen sein, reich geschmückt, in edelstem Stil und aus edelstem Material. D’Annunzio an einem ganz gewöhnlichen Schreibtisch sitzend und dichtend …, das konnte man sich nur schwer vorstellen.
Eine sehr merkwürdige Kulturerscheinung tritt mit diesem Dichter vom Schauplatz des Lebens ab. Er war ein Dichter, trotz allem Schwulst und aller sinnlichen Ekstatik und aller Wort-Überzüchtung, die seine Bücher für den, der des Glaubens ist: simplex sigillum veri (das Einfache ist Zeichen der Wahrheit) ungenießbar machen. Er betete, auf seine brünstige Art, das Schöne an; die große, arme Eleonora Duse hat an der Offenherzigkeit dieser Anbetung – der die Verleugnung bald genug folgte – bitter zu leiden gehabt. Als er 1897 in die Kammer gewählt wurde, sagte er von sich: «Je suis le député de la beauté.» Ein sonderbarer Deputierter! Von den Konservativen gewählt, wechselte er mitten in einer Kammersitzung plötzlich von äußerst rechts zu äußerst links hinüber! Er war Reiter, Fechter, Automobilist, Flieger, Politiker, Soldat, Eroberer. Aber vor allem war er, in des Wortes krassester Bedeutung: Ästhet. «Schön» und «nicht schön» galten ihm als sittliche Begriffe. Er hatte unbändige Einbildungskraft («Einbildung» im zwiefachen Sinn verstanden) und eine außerordentliche Sprachgewalt, mit der er die Bilder, die ihm seine hochfliegende Phantasie zutrug, in prunkendes Wort zu fassen wußte. In seinen Büchern erscheint der natürliche Glanz der italienischen Sprache bis zum Blendenden überschliffen, und ihre natürliche Melodie erdrückt von allzu reicher Instrumentierung. Viel Künstliches steckt in der Kunst dieses Meisters. Sein dichterisches Werk, voll Wort-Pomp und üppiger Bilderpracht, mutet wie eine hypertrophierte Pflanze an, hochgezogen nicht unter freiem Himmel, sondern in einem Treibhaus der Literatur. Stücke, in denen die Dekoration ein Wichtigstes ist, nennt man Ausstattungsstücke – so könnte man d’Annunzios Romane: «Ausstattungsromane» nennen. Die politische Tätigkeit des unbestreitbar genialen Mannes ist in den Nekrologen, die ihm galten, ausreichend gewürdigt worden. Daß auch ungezügelter Geltungsdrang einer der Beweggründe war, die ihn als Politiker vortreten ließen, komödiantische Lust, nicht nur auf der gemeinen Schaubühne, sondern auch auf der Bühne des großen Welttheaters zu Wort zu kommen, mag stimmen. Aber gewiß stimmt, daß er sein Vaterland glühend liebte und Träumen von dessen Größe und Ruhm nicht nur als Träumer nachhing, sondern sie mit vollem Einsatz seiner Persönlichkeit verwirklichen zu helfen suchte. Das Charakterbild d’Annunzios schwankt in der Geschichte. Ein großer italienischer Staatsmann von heute, gefragt, warum denn der Alte vom Gardasee immerzu mit Ehren und Geld überhäuft werde, soll hierauf geantwortet haben: «D’Annunzio ist wie ein hohler Zahn – man muß ihn ausreißen oder mit Gold füllen.»
Wedekind
WEDEKIND – Der Wedekind-Zug, tief eingekerbt in seine und in seiner Dichtung Physiognomie: ein dünnlippiges, dabei beleidigend höfliches Grinsen, das die Weltordnung quer durchstreicht.
Wedekind phantasiert eine neue Moral. Keine Moral, die den Urquell der Triebe verschüttet und versandet, indem sie nach Zweckprinzipien reguliert, sondern eine, die ihm sprudelnde Kraft und spiegelnde Klarheit sichern sollte. Der Antichrist Wedekind erachtet Begierde nicht als «gemein»; gemein dünkt ihn deren heuchlerische Verfälschung und Verwendung zu Handelszwecken. Wedekind will sie zur Regeneration des Geschlechts ausgebeutet wissen.
Beachtenswert, wie sehr es der Zirkus – er zog einmal mit dem Zirkus durch Deutschland – dem Dichter angetan hatte: als eine Welt, in der harter Wille über die Materie Herr wird, über Bestien Herr wird; eine Welt, in der das Tierische zu seiner höchsten Noblesse, Klugheit, Schönheit gelangt. Endzweck: Befreiung vom Gesetz der Schwere.
Wie eine Flagge steht auf dem First seiner Gedanken- und Gefühlsbauten: die Peitsche.
Wedekinds neuer Ton wurde durch die Schalltrichter: Leidenschaft, Selbst-Einsetzung, nicht verstärkt, sondern ins Schrille, Burleske hinübergedreht. Wie wenn einer, um deutlicher sichtbar zu werden, auf Stelzen ginge. Je höher er in die Luft wächst, desto komischer wirkt er.
Es gibt Stücke von Wedekind, in denen des Dichters Marotten sich von seinem sie bedingenden Genie losgelöst, gewissermaßen sich selbständig gemacht und auf eigene Faust ein Drama gegründet haben. Wedekind in Wedekinds Maske. Da scheint Ironie zur unbeweglichen Grimasse erstarrt, Leidenschaft wie ein steifer Park geometrisch verschnitten, die anklägerischen Gebärden von einer puppenhaften, ellbogenspitzen Eckigkeit, die Löcher in den Ernst des Zuschauers stößt. Sogar das Mitleid mit der gequälten Kreatur wird durch die spöttische Forciertheit des Vortrags verdächtig («Musik»).
Er hatte einen staubtrockenen Fanatismus, der sich dem Hörer mehr auf die Lunge als aufs Herz schlug. Sein Dämon wählte gern die Mienen und den Ton eines Mittelschullehrers. Seine Phantasie war von pedantischer Sachlichkeit.
Er hatte einen Humor auf Tod und Leben. Aus der steinernen Ruhe seiner Menschen brechen Trieb und Instinkt mit schamloser Grimasse vor wie die gotischen Tiere aus der Kirchenfassade. Moderne Walpurgisnacht.
Er hat, wie kein Dramatiker vor ihm, den superlativischen Mann gezeichnet: den Fanatismus der Idee; und die superlativische Frau: den Fanatismus des Triebes.
Seine Charaktere haben gellenden Fanfarenklang. Von ihm erschüttert, kommt es zu einer Art Zusammenbruch der Tatsachen, zu diesen Hauseinstürzen der Handlung, die der Dramatiker Wedekind so sehr geliebt hat.
Die Poesie kommt nicht zu kurz. Sie ist da, wie etwas Höheres, Unbedingtes, von keiner Düsterkeit menschlichen Schicksals zu Verdunkelndes. Wedekinds Dramen: Schlachtfelder, über die die Sonne scheint.
Der Reiz, das Tempo dieser starken, absonderlichen Intelligenz wirkte, auch wo ihre Absicht dunkel schien. Über des Schützen Ziel ruhte Nebel, aber die Kraft seines Bogens war bewundernswert, und der Klang seiner schwirrenden Pfeile eine sinnliche Freude.
Vom Schöpfer-Martyrium, von der Qual, die jeden Versuch zur Gestaltung einer Idee mit Schmerzen ohnegleichen würzt, trägt Wedekinds Werk reichlich Spuren. In der formgebändigten Sprache dieser Dichtungen schwingt ein Unterton, der wie Heulen eines verwundeten Tieres klingt.
Grundton des Dramas «Simson»: Der Schmerzensschrei nicht der gequälten Kreatur, sondern des gequälten Kreators.
Er hatte die Miene eines Verkünders, dem seine gute Botschaft in die Pfütze gefallen war. Er ging daher wie ein Heiland, der Pech gehabt hat und es mit schweigendem Anstand trägt. Wie stellte er sich den andern dar? Wie jeder invertierte Held: als Komiker, als Narr. Aber als Narr mit Heiligenschein.
Nützen die Propheten?
ROMAIN Rolland, der große Friedensfreund und leidenschaftliche Kämpfer für Völkerversöhnung, feierte seinen siebzigsten Geburtstag. Ich entsinne mich eines Kriegsstückes von ihm, eines Stückes gegen den Krieg, geschrieben im Jahre 1909. Es heißt: «Die Zeit wird kommen», spielt in den Tagen des Burenkrieges und wendet sich gegen die Methode, Streit zwischen den Völkern dadurch zu bereinigen, daß diese einander abzuschlachten versuchen. Das Stück schließt mit dem trostreichen Hinweis auf eine kommende Zeit, in der «der Löwe neben dem Lamm weiden wird» (eine Nachbarschaft, à part bemerkt, gegen die der Löwe seinerseits niemals etwas einzuwenden hatte). Dieses gütige Schauspiel, fünf Jahre vor dem großen Krieg geschrieben, und bestimmt, Friedens-Hoffnung in die Herzen zu pflanzen … zeugt es nicht, nach allem, was geschah, und was neuerdings sich vorbereitet, für die Hoffnungslosigkeit der Menschendinge? Wie, da war einer, der das Unheil kommen gefühlt, gesehen, der beschworen und gewarnt hat … und der Effekt? Daß wir sagen können: es war einer, der schon vor Jahren sprach, was später eine gemarterte Welt mit Millionen Zungen schrie. Wozu verhelfen uns die Vorläufer, die Ahnungsvollen, die Wissenden? Dazu, daß wir uns, wenn es zu spät ist, an der Tatsache, es habe Vorläufer und Wissende gegeben, erbauen können. Wem nützen die wahren Propheten? Bestenfalls dem Ruhm ihrer seherischen Begabung, den das Hereinbrechen des Übels, das sie weissagten, offenbarte. Die Zeit wird kommen, da das Lamm neben dem Löwen weidet? Möglich. Aber da werden dem Löwen die Krallen ausgefallen oder dem Lamm welche gewachsen sein!
«Der Seelensucher»
ICH möchte einem Buch Leser gewinnen, das kaum seinesgleichen hat unter deutschen Büchern, einem nicht literarischen Buch, aber von eigentümlichster spiritueller Schärfe, die ihre Zeichen ins Hirn des Lesers ätzt. Was sonst als deutsche Prosa Humor übt, scheint Wasser neben dieser Quintessenz.
Das Buch heißt: «Der Seelensucher», ein psychoanalytischer Roman von Georg Groddeck.
So was Freches, Ungeniertes, raffiniert Gescheit-Verrücktes ist von Erzählern unserer Sprache noch nicht gewagt worden. Man muß zu den Großen satirischer Dichtung, will man die Patrone dieser Schrift nennen. Von Jonathan Swifts unsterblicher Galle kreist ein Tropfen in des Seelensuchers Bitterkeit; an Cervantes erinnert der Ritus, nach dem hier einer zugleich den Priester und das Lamm seiner Narrheit abgibt, erinnert die Durchsetzung dieser Narrheit mit Idee und Idealität; in der Rabies ihrer Witzigkeit aber gespenstert das Überdimensionierte der Gargantua-Komik.
Die Gestalterkraft der Meister fehlt dem Georg Groddeck. Er schreibt wie ein gebildeter Dilettant, sein Buch ist kunstlos ungebaut. Es stehen nur Wände für ein Flechtwerk von Gedanke und Reflexion. (Immerhin schlägt manchmal auch ein gemütliches Fabuliertalent deutschblaue Augen auf.) Die Figuren haben beiläufige Kontur. Auch der Held, Thomas, der als Don Quichote Sigmund Freudscher Weltanschauung seiner fürsorglichen Schwester Agathe durchbrennt, streitbar durch die deutschen Lande zieht, in die wunderlichsten Händel und skurrilsten Abenteuer gerät, als Ritter seiner Dulcinea Psychoanalyse die erbittertsten Rede- und andere Schlachten schlägt, aller Orten – wie der de la Mancha Burgen, Ritter, Burgfräuleins – aller Orten Symbole, insbesondere erotische Symbole sieht, erfüllt von der heil’gen Gewißheit, daß die Menschen ihre Psyche zwischen den Beinen tragen und ihre Genitalien an jeder Stelle Körpers und Geistes.
Ich kann hier von der Art, in der der fahrende psychoanalytische Ritter alle Erscheinungen in sein gefügiges System hinüberlistet, von der besonderen Eloquenz dieses weisen Toren leider nur die wenigst saftigen Proben geben. Aber auch aus den folgenden zwei schwachen Beispielen ist der eigenartige Ton herauszuhören, mit dem des Thomas Mühle mahlt. Über die Weiber äußert er gelegentlich:
«Aber so sind die Weiber. Sie bilden sich immer ein, das Denken sei wie Strümpfe stricken, das man beliebig unterbrechen und wieder aufnehmen kann, und bei dem es auf ein paar fallengelassene Maschen nicht ankommt. Übrigens ist es ein Irrtum zu sagen: Ich stricke einen Strumpf, zum mindesten ist es ungenau, man kann ebensogut sagen, der Strumpf strickt mich, ja erst mit dieser Wendung zeigt man, daß man eine Ahnung vom Verlauf der Weltgeschichte hat. Der Mensch macht nicht, sondern er wird gemacht. Wenn Agathe mir einen Strumpf strickt, so weiß ich, daß ich demnächst eine neue Fußbekleidung haben werde, und kann mich darüber freuen. Sage ich aber, der Strumpf strickt Agathen, so sehe ich auf einmal die Geschichte des weiblichen Geschlechts vor mir, wie es sich jahrtausendelang in der Beschäftigung mit dem Kleinen verderben ließ und verdarb. Sieh dir einmal meine Schwester an. Du denkst, sie ist dieselbe Agathe wie vor zwanzig Jahren, ein wenig älter geworden, aber im Grunde dieselbe. Weit gefehlt. Weißt du, was sie ist? Agathe ist eine Hutschleife … ja, sicher. Als sie damals ihren seligen Willen geheiratet hatte und sehr bald dahinter kam, welche Dummheit sie begangen hatte, wollte sie vernünftig werden. Und um sich dazu zu zwingen, schaffte sie sich den würdigen Kopfputz der Mütter, den Capothut mit langen Bändern an und knüpfte jeden Tag gewissenhaft eine regelrechte Schleife. Das ging so eine Zeitlang. Jetzt aber ist sie schon seit Jahren anders. Agathe wird von der Schleife geknüpft. Die Bänder zerren sie durchs Leben, wie das Seil des Metzgers ein Kalb.»
Zur Erscheinung des Beamten hat er dieses anzumerken:
«Der Beamte betrachtet das Publikum als Wickelkind, muß es so betrachten, er hält sich für verpflichtet, dieses hilflose Wesen, das nur saugen und heulen kann, zu leiten, hat aber neben und durch dieses Verantwortlichkeitsgefühl auch die Größenidee, das Säuglingspublikum zu strafen. Dabei ist er sich jedoch seiner Unvollkommenheit bewußt, da ihm das wichtigste zur Amme, die Milch, fehlt, was sich in den beiden weggelassenen Buchstaben m und e ausspricht. Und gerade aus dem Mangel der Milch, aus diesen fehlenden zwei Buchstaben, erklärt sich auch die Abneigung des Publikums. Es befindet sich dem Beamten gegenüber im Zustand der Entwöhnung, die Brüste schmecken bitter, weil sie mit Chinin bestrichen sind, und es sucht sich durch versteckte Auflehnung dafür zu rächen, daß diese verstümmelte Amme Gehorsam verlangt, ohne dafür süße Milch zu geben. Dieser Ammencharakter hat sich in der Gewohnheit der unteren Beamten erhalten, der Mutter der Kompagnie beispielsweise, ein Notizbuch vorn zwischen die Brustknöpfe zu stecken. Sie betonen so die Milchwirtschaft und reizen damit das Säuglingspublikum noch mehr, das solches Betonen eines Mangels ja als Hohn auffassen muß. Bei der Polizei ist die Sache noch schlimmer. Da liegt in der ersten Silbe das Wort Popo drin, mit den fatalen Erinnerungen an die Haue, die man bekommen hat. Die zweite Silbe li ist abgekürzt aus Liebe und weckt den Gedanken an die geradezu ungeheuerliche Anmaßung der Erzieher, daß man sie auch noch dafür lieben soll, wenn sie einem die Hosen stramm gezogen haben. Und das zei ist nun gar die Tatsache, daß man nachher in die Ecke gestellt wurde, bis man um Verzeihung gebeten hatte.»
Eine Figur, wie dieser Thomas, so voll der kostbarsten Narrheit – die nicht Narrheit, sondern Ernst-Clownerie – ist noch durch keinen deutschen Roman gewandelt. Hier lehrt einer, zum Gaudium des Lesers, die Welt über den psychoanalytischen Stock springen. Alles muß drüber, Mensch und Tier, Politik, Kunst, Wissenschaft; und mit etlicher Gewalt und Schlauheit glückt es bei allen. Eine drolligste demonstratio ad rem et hominem von der Unfreiheit der Erscheinungen. Wie sich hier Sinn zu Hanswurstiaden übersteigert, Geist in närrische Aktion umsetzt, Dogma possenreißerisch sich behauptet, Erkenntnis, ihrer Unverletzbarkeit hochmütig gewiß, ins dichteste Gelächter stürzt – solche lustige Abenteuerfahrt des Gedankens hat noch kein deutscher Mann gewagt.
Es ist eine tolle Persiflage der Psychoanalyse und, in den Hohn hineinverschlungen, die bedingungsloseste Huldigung vor der Souveränität der Lehre, gewissermaßen: «Wir dürfen uns sogar erlauben, lächerlich zu sein.» Aus der unbedingten Anwendung der Methode erfließt die Komik, die Methode selbst erleidet keinen Schaden.
Es stellt sich das Buch dar als eine Reihe von merkwürdigen Erlebnissen der hohen Theorie in Bezirken der niederen Praxis. Ungemein ergötzlich ist die dialektische Fechtkunst dieser Theorie, der Schwung, mit dem sie anrennt gegen Menschen und Dinge, die joviale Roheit ihrer Kampfführung, die treuen Hundeaugen, die sie macht, wenn Unheil und Verwirrung durch sie angestiftet worden sind. Ein Feuerwerk von Funken gibt es, wo und wie immer der Querkopf des Thomas mit dem Leben zusammenstößt. Wenn ihn schließlich der Eisenbahnzug zerquetscht, bedauern wir sehr, von diesem prachtvollen Narren, von diesem gescheitesten dummen August, endgültig Abschied nehmen zu müssen. Im Gedächtnis bleibt, wie er von der Wanze in seinem Bett innerlich gewandelt wird, bleiben die grotesken Gesichte, die er hat, das Ungemach, das er, den schwerfälligen Leib opferfroh ausliefernd an ein lebhaftestes geistiges Tempo, erleidet, der trockene Glanz seiner Beredsamkeit, das beglückte Märtyrerlächeln, mit dem er Schläg’ und Stöße des Geschicks hinnimmt, die halsbrecherische Sicherheit, mit der er auf dem geduldigen Klepper seiner Logik phantastische Schule reitet. Die Konsequenz aber, mit der er im Gewebe der Erscheinungen seinen roten psychoanalytischen Faden verfolgt, hat mehr als Komik, hat fast Größe.
«Der Seelensucher» ist das zweite Buch deutscher Sprache, das den Namen humoristischer Roman verdient (das erste heißt: «Auch Einer»). Seine besondere Schmackhaftigkeit verdankt es einer Bindung, die der literarischen Küche selten gelingt: Phlegma und Spiritus.
Vicente Blasco Ibañez «Die apokalyptischen Reiter»
DAS Buch eines Spaniers, geschrieben «aus Haß gegen den Krieg, den Militarismus, die Monarchie» (Vorwort). Ein Roman vom Kriege. Ein Bild von ihm, gemalt in durchaus französischen, leuchtkräftigen Farben. Der Roman ist unbeträchtlich; aber das Bedrückende, Atemraubende, Schwefelfarbene der Atmosphäre, in die des Romans gleichgültige Figuren hineingestellt sind, ist mit Erzählerkunst getroffen.
Die Deutschen dieses anklägerischen Buchs haben Krampus-Format. Schwarz von Bosheit, rot von Blut und Feuer, Satansboten, die Geißel in haariger Pranke, die Zunge herausstreckend gegen Gott, eine Kiepe zum Forttragen geraubten Gutes auf dem Rücken. Sie plündern, morden, schänden; zwischen zwei sentimentalen Liedern am gestohlenen Klavier erteilen sie ihre Mordbefehle. Auf der andern, der französischen Seite, Güte, Heroismus, hundertkarätige Vaterlandsliebe, nur Ritter Bayards, Kreuzfahrer der Gerechtigkeit und Menschenliebe. Das Einzige, was dem Deutschen zugestanden wird, ist kriegerische Härte und Knotigkeit. Aber auch seine Todesverachtung hat etwas von der des Viehs, das um Glanz und Schönheit des Lebens zu wenig weiß, als daß es seinen Verlust richtig werten könnte.
Aus solcher Volksstück-Exaktheit im Scheiden der Guten und Bösen hebt sich das Buch nur in lahmem Schwung zur Höhe überparteilicher Betrachtung. Aus Haßdünsten sammelt sich die Wolke, der der milde Segen der Menschenliebe entträufelt. So will es das bessere literarische Gehört-sich. Der Standpunkt «pour l’honneur du drapeau national» wird sozusagen nur «pour l’honneur du drapeau littéraire» verlassen.
In der Schilderung zeigt sich Ibañez als Könner. Sein Erzählen ist panoramisch. Aus tausend kleinen scharfen Linien und spitzen Pünktchen formt sich das Zeichen: Krieg, aus ein paar breiten Strichen erstehen ihm die perspektivischen Hintergründe.
Erfindung und Phantasie, in romanischem Überfluß vorhanden, werden solchem Buch zu Stilfehlern. Die Tatsachen des Krieges, über allem Erfinden und über aller Phantasie, widerstreben der Paraphrase wie der Phrase. Kein Greuel-Dichter kann den Reporter erreichen.
Es ist lächerlich, die Hölle noch bengalisch illuminieren zu wollen.
Gorki
68JAHRE alt starb der einzige Dichter Rußlands von Format, den das neue Regime aus der Literatur vor diesem übernehmen konnte, ohne auch nur eine Zeile seines Werkes als «bürgerlich» verzeihen oder verleugnen zu müssen. Gorki war der Dichter des Proletariats, lange ehe dieser Begriff großen politischen Inhalt hatte. Er schrieb, wie Dostojewskij, von den «Erniedrigten und Beleidigten», aber, anders als der große Seelendurchleuchter, auch für sie, als ihr Anwalt, das Herz voll Trauer und Groll über das irdische Schicksal seiner nach Millionen zählenden Clientèle. Er begnügte sich nicht, Erklärer und Versteher der Elenden zu sein, er nahm Partei für sie, forderte für sie, predigte nicht Duldertum, sondern den Willen, daß es anders und besser werde. Er wollte nichts vom Himmel herunter holen für seine armen Brüder; das Gute – kündete sein Werk – müsse die Erde hergeben, die jener Müh’ und Arbeit wohnlich und behaglich macht für die Besitzenden. Schon aus dem «Nachtasyl», dem Drama, das Gorkis Ruhm (von Deutschland her) über die Welt verbreitete, klang dieser Ton, der revolutionäre Ton stark durch für jene, die Ohren hatten, zu hören. Die Schuldlosigkeit der Elenden an ihrem Elend wurde in dieser, scheinbar nur schildernden, jeder Anklage oder Forderung sich enthaltenden Dichtung offenbar, erschütterte und zwang zum Nachdenken, ob es wirklich die beste aller Welten sei, in der neben Glanz und Glück so bergehoch Not und Verzweiflung sich türmen. Ein anderes Meisterwerk, «Die Mutter», populär geworden durch Pudowkins genialen Film, steht schon ganz im Zeichen des Kampfes, gibt ein großartiges Bild von der Pflichterfüllung des anonymen proletarischen Menschen im Dienst der allgemeinen Sache, im Opfer für sie. Auch in seinen streitbarsten Schriften blieb Gorki stets Dichter, Künstler. Manche Partien in seinem erzählenden Werk sind von einer lyrischen Schönheit und Weichheit, die eingebettet in das Harte und Unerbittliche der Gorkischen Welt- und Menschenanschauung, den Leser nur um so tiefer anrührt. Humor, wie er bei keinem der russischen Epiker fehlt, selbst nicht bei Dostojewskij und Tolstoi, hatte auch Gorki, aber einen bis zur Unkenntlichkeit mit Galle versetzten Humor. Zwischen den Polen: Liebe und Zorn gab es kaum Zwischenstufen in seiner Beziehung zu Welt und Mensch; und wunderlicherweise gerade in den letzten Lebensjahren, wo er doch Früchte seiner Arbeit reifen, Träume seines Herzens Gestalt annehmen sah, wurde er nicht milder, sondern strenger, schrieb und sprach er, als müsse er seinen Namen Gorki, «der Bittere», rechtfertigen. Der Verehrung und Liebe des Volkes für seinen größten zeitgenössischen Dichter tat dies keinen Abbruch; kaum eine Arbeiter- oder Studentenbude im großen Rußland, an deren Wand das strenge Antlitz mit den Kalmückenknochen, den gefährlich prüfenden Augen und dem struppigen Nietzscheschnurrbart fehlt.
Heinrich Mann
HEINRICH