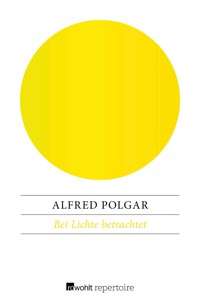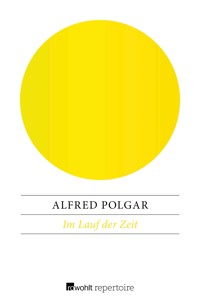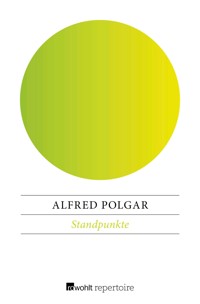9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kleine Schriften
- Sprache: Deutsch
Das Theater war seine Welt – mehr als fünf Jahrzehnte ist Alfred Polgar professioneller Beobachter von Wiener und Berliner Bühnen gewesen. Er hat Autoren, Stücke und Spieler allzeit weniger beurteilt als beschrieben. Dies allerdings in dem unverwechselbaren Deutsch, das seine Kritiken legendär werden ließ – in ihrem spielerischen Ernst, dem boshaften Witz, der undogmatischen Klugheit, vor allem aber auch in dem charakteristischen Ineinander von Erzählen und Analysieren. Nicht ohne Grund nannte Polgar seine gesammelten kritischen Schriften «Ja und Nein», denn selten überließ er sich dem uneingeschränkten Enthusiasmus, und nur in wirklichen Ausnahmefällen war seine Ablehnung unerbittlich und total. So war der Kritiker Polgar geachtet, ohne gefürchtet zu sein, und seine Worte, so schwerelos er sie zu machen wußte, hatten Gewicht. Polgars Texte über und für das Theater, gesammelt in zwei Bänden, bilden den Abschluß der «Kleinen Schriften». «Theater I» vereinigt 224 Aufsätze über Stücke und deren Verfasser, Aufsätze, die zwischen 1905 und 1952 entstanden sind. Ein kritisches Lesebuch, wie es wenig andere gibt, zugleich aber ein unentbehrliches Nachschlagewerk über Dramatiker der Weltliteratur: von Strindberg bis Schnitzler, von Shakespeare bis Hauptmann, von Horváth bis Dürrenmatt. «Er erzählte vom Theater, und er rezensierte den Alltag», schrieb Marcel Reich-Ranicki.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Alfred Polgar
Kleine Schriften Band 5: Theater I
Herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki
Ihr Verlagsname
Über Alfred Polgar
Über dieses Buch
Das Theater war seine Welt – mehr als fünf Jahrzehnte ist Alfred Polgar professioneller Beobachter von Wiener und Berliner Bühnen gewesen.
Er hat Autoren, Stücke und Spieler allzeit weniger beurteilt als beschrieben. Dies allerdings in dem unverwechselbaren Deutsch, das seine Kritiken legendär werden ließ – in ihrem spielerischen Ernst, dem boshaften Witz, der undogmatischen Klugheit, vor allem aber auch in dem charakteristischen Ineinander von Erzählen und Analysieren.
Nicht ohne Grund nannte Polgar seine gesammelten kritischen Schriften «Ja und Nein», denn selten überließ er sich dem uneingeschränkten Enthusiasmus, und nur in wirklichen Ausnahmefällen war seine Ablehnung unerbittlich und total.
So war der Kritiker Polgar geachtet, ohne gefürchtet zu sein, und seine Worte, so schwerelos er sie zu machen wußte, hatten Gewicht.
Polgars Texte über und für das Theater, gesammelt in zwei Bänden, bilden den Abschluß der «Kleinen Schriften». «Theater I» vereinigt 224 Aufsätze über Stücke und deren Verfasser, Aufsätze, die zwischen 1905 und 1952 entstanden sind. Ein kritisches Lesebuch, wie es wenig andere gibt, zugleich aber ein unentbehrliches Nachschlagewerk über Dramatiker der Weltliteratur: von Strindberg bis Schnitzler, von Shakespeare bis Hauptmann, von Horváth bis Dürrenmatt.
Inhaltsübersicht
Für Sudermann
ICH weiß nicht, warum alle loshämmern auf den guten Sudermann. Weil er rasch und gern mehraktige Stücke schreibt, welche sind wie mehrstöckige Zinshäuser, Wohnstätten für den Geist besser situierten Publikums? Was ist denn Schlechtes daran? Die Leute befinden sich wohl in den Sudermann-Häusern. Alles ist dort neu, bequem, licht, Ordnung und Reinlichkeit überall, das Gute und das Böse schön separiert voneinander, die Tapeten lebhaft gemustert, und alle Fenster führen auf die Straße, wo «das Leben» vorbeihastet. Auch die Örtlichkeiten, in denen sich Kehrseiten des menschlichen Daseins zu enthüllen pflegen, sind in Sudermann-Dramen komfortabel eingerichtet; mit Tränenspülung.
Warum also hämmern alle auf den guten Sudermann los? Er dichtet, wie er kann. Soll man ihm böse sein, weil er sich nicht wichtiger macht, als er ist? Er kann Stücke schreiben und schreibt Stücke. Nun höhnt man ihn, daß diese Stücke keine Dichtungen sind, statt froh zu sein über so kluge Selbstbeschränkung. Er hat die Courage zu seiner Flachheit. Er bleibt bei seinem Leisten. Ob er sich für einen Dichter hält, ist gleichgültig, ob er seine Arbeit zu hoch einschätzt, ist seine Privatsache. Jedenfalls gehört er nicht zu den Schelmen, die mehr geben, als sie haben.
Im Namen der Kunst wird gegen Sudermann protestiert. Aber was tut er denn schon der Kunst? Er schädigt sie dadurch, daß er den Geschmack des Publikums verdirbt! Als wenn es so was gäbe, wie «Geschmack des Publikums». Theaterpublikum, das heißt: die unhomogene Masse von Stadtbewohnern, die allabendlich von der Langeweile, der Neugier oder dem Bedürfnis, ihres Daseins Nüchternheit zu entlaufen, ins Theater getrieben wird, hat gar keinen Geschmack, nicht einmal schlechten. Es ist Gefäß für jeden Inhalt. Der einzelne hat seine eigensten erregungshungrigen Punkte im Nervensystem, wo ihm das Gekitzeltwerden besonders angenehm ist. Aber gemeinsam ist der Masse nur eines: die Bereitwilligkeit, sich erregen zu lassen. Das nützt Sudermann wunderbar aus. Er reißt seine Zuhörer in gerührte, heitere, beklommene Stimmungen, und dann, ohne ihnen das geringste getan zu haben, gibt er sie wieder frei. Er «packt» die Leute, aber – und darin liegt das Geheimnis seiner Unschädlichkeit – er läßt sie um 10 Uhr wieder los. Muß sie loslassen, weil er gar nicht die Kraft hätte, sie zu halten. Beim Nachtmahl ist alles wieder vergessen. Er schädigt den Geschmack des Publikums nicht, weil es den nicht gibt, und er nützt den Verstehens- und Empfindungsmechanismus des Publikums nicht ab, weil er ihm keine Leistung zumutet, die jener nicht mühelos und glatt vollbringen könnte. Er gibt nach Theaterschluß jeden einzelnen intakt der Familie, dem Ehebett, dem Arbeitszimmer zurück.
Sudermann hat etwas Primushaftes. Er ist Vorzugsschüler: er versteht es, dem Professor die Neigungen abzugucken und ihnen mit kleinen Diensten zu schmeicheln. Aber wenn wir auch den Vorzugsschüler nie recht leiden mochten, wir konnten doch nicht sagen, daß er seine Position nicht verdient hätte. Er war ja wirklich fleißig, sittlich, musterhaft, war immer wohlpräpariert und hatte immer ein Löschblatt in seinen reinlichen Heften. Er erreichte stets als Erster «das Ziel der Klasse» und zog als sieghaftes Vorbild durch den feindlichen Irrgarten der Schule, worauf er sich dann, im Leben, ziemlich spurlos verlor, bis man ihn, Jahre später, als tyrannischen Beamten oder so was wieder traf. Sudermann wird nie unreine Arbeit liefern, nie werden ihm Vokabeln fehlen, nie wird man merken, daß er schlecht gelernt hat, nie wird er sich den Unwillen seines gütigen Lehrers und Vorgesetzten, des Publikums, zuziehen, nie wird er richtig durchfallen. Und legte er’s selbst darauf an, maskierte sich als Meister, schriebe edles Theater … würde es was nützen? Eine Szene käme ja doch vor, so pulvervoll und funkennah, daß den Leuten das Herz bis in den Hals hinein klopfte, und sie sich, wär’s überstanden, die Aufregung von der Seele wegapplaudieren müßten.
ANDRÉ GIDE
Der König Kandaules
EINE Tragödie mit dem leichten Schritt der Operette. (Den Hebbel lassen wir aus dem Spiel.)
Die psychologische Arbeit des «roi Kandaule» ist im wesentlichen ein Abstecken von Grenzen, die auszuschreiten dem Geist des Lesers überlassen bleibt: das Stück gibt den Augenblick, da eine Idee befruchtend ins Gehirn seines Helden fällt, und den Augenblick, da als Konsequenz dieser Befruchtung Tat geboren wird. Über die Zwischenvorgänge, über das Werden der Tat – die eigentliche Interessensphäre des psychologischen Dramas – schreitet der Franzose mit überlangen Schritten hinweg.
Aus all dem vielen, das nicht da ist, gewinnt das Drama eine Tugend: Leichtigkeit. Und daß es eine Tragödie, die solcher Tugend teilhaftig, ist das ganz Originelle an ihr. Tragödie? Es gibt Tote im «roi Kandaule», der Rauch vergossenen Blutes hängt über der Dichtung. Trotzdem fließen die drei Akte mit der Heiterkeit eines Spiels vorbei, eines um die Gyges-Fabel erdachten Spiels vom rätselreichen Eros.
Von der Zeitbestimmung des Stückes an (Très anciennement sagt Gide) bis zur letzten Szene ist dieses Mitschwingen der ironischen Saite zu vernehmen. Ein Beispiel: Dritter Akt, vorletzte Szene: Kandaules’ Gattin hört von Gyges, daß er, unter dem Schutz des geheimnisvollen Ringes, heute nacht die Rolle des Ehemanns gespielt habe. Nyssia rast («verletzte Scham» sagen die Erklärer). Sie drängt in Gyges, den König zu töten, aber jener wehrt ab, will den Freund nicht morden, und Nyssia, ganz ratlos vor diesem Sträuben, schreit auf: «Aber einer von euch beiden muß doch eifersüchtig sein!»… Vor die Tugend haben die Götter den Schweiß, hinter sie die Malice gesetzt.
Im Grunde ist «roi Kandaule» ein Drama der erotischen Eitelkeiten. Der eitle Kandaules, der so freigebig dem Freund die schönste Nacht gönnte, kann, am Morgen nachher, von der Schönheit dieser Nacht nicht ohne Kummer reden hören. Der eitle Gyges muß, hört er Nyssia die heut genossenen Süßigkeiten preisen, gleich als Autor dieser Süßigkeiten sich bekennen. Die eitle Nyssia wünscht den Kandaules tot, weil er sie nicht hoch genug einschätzt, um sie ewig für sich allein haben zu wollen. Vanitatum vanitas.
Es ist, als ob aus allen Konflikten zwei Türen nach außen führten: eine in den Tod, eine in die lebenserhaltende Skepsis. Die Figuren des Stücks gehen durch die dunkle Tür; aber die andere steht beständig offen, und es tönt von draußen herein wie Gelächter.
Ein siegreicher Militärschwank
DIE Gründe, denen «Husarenfieber», der siegreiche Schwank von Kadelburg und Skowronnek, seinen großen Publikumserfolg dankt, sind hinreichend tief und breit erörtert worden. Sprechen wir einmal von den Gründen, die das Unbehagen und die Unlust bedingen, von denen schließlich doch die meisten Zuhörer jener Militärposse befallen werden. Die künstlerische Wertlosigkeit, der platte Witz, die trübe Sentimentalität der Komödie, das und anderes mehr zwängen dem Zuschauer gewiß schon das böseste Urteil ab, aber noch immer keine Grimasse des Ekels. Wie kommt es schließlich doch dazu? Woher dieser fast physiologische Widerstand, zu dem vier Akte «Husarenfieber» auch den sanftesten Menschen am Ende reizen? Woher diese nervösen Schlingbewegungen, mit denen jeder auch nur ein wenig empfindliche geistige Magen den eben verschluckten humoristischen Fraß am liebsten gleich wieder retour gäbe? Ich glaube, die Gründe sind typisch für die ganze Gattung der deutschen Militärposse und ihrer sind vor allem zwei.
Erstens: Militär, Kaserne, Soldatenleben – das löst in uns primär, mit der ganzen Gewalt einer zwingenden Ideenassoziation, eine Gruppe von häßlichen, schmutzigen, zuwideren Vorstellungen aus. Wenn man uns nun einen ganzen Abend lang zwingt, unsere Empfindungen in einen unmöglichen Kausalnexus einzustellen, auf den Begriff «Militär» immer mit «Heiterkeit», auf «Husar» immer mit «gerührtem Frohsinn» zu antworten, so tut solche Verbiegung unserer natürlichen Reaktionen am Ende weh. Wie wenn einer vier Akte lang über die Cholera Witze und nur Witze machen möchte. Unser solcherart nach einer falschen Seite gewaltsam hinübergekrümmtes Empfinden schlägt, so oft der Lustspieldichter locker läßt, doppelt kräftig nach der anderen Seite aus, eben nach jener, auf der die Unlust und das Unbehagen hausen. Und wie locker lassen die Dichter des «Husarenfiebers»! Die Franzosen, die ein feines Ohr für die Harmonien des Lachens haben, die (mit weit empfindlicheren Nasen als die Deutschen) auch den traurigsten Dingen des Lebens den Zusatz an Lustigkeit entschnüffeln, kennen auch das Genre der Militärposse. Aber bei ihnen klingt immer, immer eine starke satirische Note durch, die mit dem Thema ein wenig versöhnt, weil sie es auch ein wenig verhöhnt. Solch klebrige Süßigkeit, wie die des «Husarenfiebers», gibt es dort nicht. Die französische Militärposse ist immer ein wenig satirisch angesäuert und darum genießbar.
Zweitens: Man verträgt die rosige Lüsternheit der Militärschwänkler, hier der Herren Kadelburg und Skowronnek, nicht. Man verträgt diese keusche Geilheit nicht, diese gehäufte niedliche Lustspielbrunst. Daß die Uniform, als färbig-lebhaftes Kraftsymbol, auf Frauen wirkt, weiß man. Im «Husarenfieber» ist diese Wirkung pathologisch gesteigert. Der Effekt der blauen Hosen auf die weißen Kleidln ist elementar, und zum Schluß wird genau nach dem Theaterzettel, wie beim Fußexerzieren, «paarweise abgefallen». Aber das ist nicht das Widerwärtige. Das Widerwärtige ist die schämige Erotik des Herrn Kadelburg, die mir in ihrer Lieblichkeit und Reinheit unendlich weit unappetitlicher scheint als alle von Blumenthal oder Sudermann «gegeißelte moderne Perversität». Der zweite Akt des «Husarenfiebers» ist, seinem Wesen und Inhalt nach: das Gewieher der Stuten bei Ankunft der Hengste. Aber ach, in welch neckische, beblümelte Tonart transponieren die Dichter ihr Thema! Der verführerische Oberst trifft die verführerische Witwe, und gleich malen sie einander aus, wie sie in der Kaminecke gemütlich en deux Tee trinken werden und Whist spielen. Tee trinken und Whist spielen. Und allen Mädchen puppert, wie die Husaren kommen, das Herz im Leibe. Das Herz.
Daß der erste Akt des «Husarenfiebers» im Burgtheater so gut gefallen hat, ist das Verdienst des Herrn Treßler. Oder besser: die Schuld des Herrn Treßler. Dieser Künstler zeigte in seinen Gliedmaßen mehr Witz, als die Dichter in ihrem Cerebrum. Er hat die Beweglichkeit, den körperlichen Humor eines echten Clowns und ist dabei Künstler genug, um, im Übertreiben, zu charakterisieren. Er macht die Leute nicht stellenweise lachen, wie Herr Thimig. Er bringt sie in gute Laune, kaptiviert sie. Er ist ein Temperament und eine Intelligenz. So darf er sich, als Komiker, die Zügel schießen lassen.
HERMANN SUDERMANN
Einakter-Trilogie
DA ist ein Rechtsanwalt. Er ist sonor von der Frisur bis zu den Stiefeln. Seine Männerbrust strotzt von biederm Sinn, und sein Vollbart ist lackiert mit Rechtlichkeit, die kein Schicksalsregen je herunterwäscht. Er trägt ein Herz im Gehrock, das fest ist und tapfer und Kalorien abgibt und auch sonst Ähnlichkeit mit einem Ofen hat. Jungfrauen, wärmet an ihm eure weißen, anämischen Hände. Aber die Jungfrau im Stück ist keine Jungfrau mehr. Vor drei Jahren ward ihre Blüte geknickt. Und dies durch einen Mann, von dem man im Schauspiel nur erfährt, daß er Baron und Schurke ist. Margot, die Gefallene, spricht sehr ärgerlich von ihm. Einmal nennt sie ihn «Vieh». Und als endlich, nach drei bangen langen Jahren, der Schurke Baron durch den warmen Rechtsanwalt so weit gebracht ist, daß er Margots Fehltritt legitimieren, ihn zu einem früh behobenen Vorschuß auf eheliche Seligkeit umadeln will, da mag Margot nicht mehr. Denn inzwischen hat sie den Rechtsanwalt lieben gelernt. Längst, guter Leser, hast du es auch erraten, daß der Rechtsanwalt für seine Klientin ganz andres als rein advokatorisches Interesse hegt. Und so stünde einem freundlichen und raschen Aktschluß nichts im Wege, wenn nicht der Dichter Sudermann eine psychologische Barrikade aufgerichtet hätte, über die die beiden nicht hinüberkommen. «Ich hasse den Schurken», sagt Margot. – «Nun also», sagt der Rechtsanwalt. – «Aber anderseits … seit jenem Tag … da ist ein gewisses Etwas in mir, ein Begehren, ein Drängen … da treibt es mich fast wieder zu ihm.» – «O Himmel!» sagt der Rechtsanwalt. – «Ich liebe aber dich! Sonach werde ich den Schurken heiraten und mit dir ein Verhältnis haben!» sagt exaltiert Margot. – «Ha, Verworfene!» antwortet beiläufig der Ofen im Gehrock, «solch ehrlose Kompromisse denkst du dir aus? Nimmermehr! Und heute, wisse es, habe ich bei deiner Mutter um dich angehalten!» Worauf der Rechtsanwalt, sonor, in einen Stuhl zusammenknickt. Nun wird Margot bitter und vergleicht sich mit einer Rose, die man entblättert. Dieses originelle Bild hat sie aber nicht aus dem Stegreif erdacht, sondern den Anlaß hiezu in einem Bukett gefunden, das auf des Rechtsanwalts Schreibtisch steht; oder besser, dem Dichter zu Ehren, glüht. Solch ein Rosenbukett erhält der Anwalt seit langem tagtäglich von einer Unbekannten zugeschickt, und jene Unbekannte – wie listig greifen des Schicksals Zahnrädchen ineinander – ist Margot. Sowie diese rührende Tatsache in den Ofen geschoben wird, flammt er von neuem zärtlich auf, der Rechtsanwalt stürmt der Davoneilenden nach und will sie nun dennoch zur Gattin. Aber in Margot hat sich sittliche Umwandlung vollzogen. Sie fühlt sich seiner nicht wert. Sie wird fortziehen, ins Leben hinaus, und zu ihm erst wiederkommen, wenn sie rote Hände hat. Rote Hände: das Sudermann-Symbol der Tugend.
Es kommt noch eine alte Dame im Stück vor, Margots Mutter, die keine Ahnung hat und von der Reinheit und Ausgekühltheit ihres Töchterchens spricht, damit der Zuschauer nachher wehmütig-belustigt rufe: O mütterliche Blindheit! Und dann kommt noch etwas sehr Wichtiges vor: ein Vermögen von anderthalb Millionen Mark. Welch ein poetisches Vermögen in diesen Sudermann-Dramen! Welch eine vermögende Poesie!
Hinter schwarzer Portière liegt der im Duell erschossene Rittmeister aufgebahrt. Durch das Tuch flackert düsteres Moll-Licht von Kerzen. Ein Offiziersbursche weint. Ein gegen Wehmut immunisierter Leichenbestattungsunternehmer ist geschäftig, hängt Kränze hin, ordnet an, und seine gleichmütig-kühle, fast gut gelaunte Rede zerteilt wie ein frisches Lüftchen die traurigen Dünste des Totengemaches. Kleines Mädchen in Schwarz, Daisy, huscht, einem Nachtschmetterling nicht übel vergleichbar, durch das Zimmer. Stimmung, Todes-Orgelpunkt. Dann kommt Leutnant Wolters, des Verstorbenen bester Freund, und kündigt den Besuch einer Dame an, die von niemand erblickt werden wolle. Abgemacht. Nur Daisy bleibt, um aufzupassen, daß kein Fremder störe. Die Dame erscheint, tief verschleiert, tief bekümmert. Einen Strauß weißer Rosen legt sie auf den Sarg und plaudert dann mit Leutnant Wolters. Sie ist es, derethalben es geschah. Innig, mit einer von Tränen glatt gemachten Kehle, in der die Worte ausgleiten und nur mühsam vorwärtskommen, spricht sie über den toten Geliebten. Aber dann wickelt sie ihren miserablen Charakter aus. Nicht der Kummer, nicht die Liebe trieb sie zu dem Toten, sondern der Wunsch, ihre Briefe zurückzuhaben. Sicher steuert sie auf ihr Ziel los, umgarnt den netten Leutnant, drängt ihn dazu, den Schreibtisch zu öffnen. Die Briefe sind fort! Die unbekannte Dame – als herzlose Kokette entpuppt sie sich immer mehr und mehr – geht aus der Wehmut zum Schimpfen über. Das hört der Nachtschmetterling, flattert ins Gemach. «Hier haben Sie Ihre Briefe, Madame!» sagt Daisy stolz und einfach. Sie sagt zwar nicht «Madame», aber es ist doch so, als ob sie «Madame» sagte. «Hier haben Sie Ihre Briefe! Er gab sie mir, damit ich sie Ihnen zurückstelle.» – «Ihnen? Und wer sind Sie?» – «In der Nacht vor seinem Tod bin ich seine Frau geworden! Und hier, bitte, nehmen Sie Ihre Rosen wieder vom Sarg; … ich habe Sie über den Toten so häßlich reden gehört!»
Dreier Menschen Geschick schneidet sich hier scharf in einem Punkt; der eine Mensch ist tot, und von der Fülle seines Daseins schwebt noch etwas Wolke über der Szene. Das Romanerlebnis, sonst die Sonne der Sudermannschen Stücke, ist hier schon untergegangen, sein roher Glanz gedämpfterm Licht gewichen. Ein kleines Mädchen benimmt sich stolz und heldenhaft. Blitz der Leidenschaft schlägt reinigend durch Trübes.
Und daß ich nicht vergesse: Daisy erbt das große Vermögen des Rittmeisters.
Der jugendliche Cand. phil. hat im Landwirtshaus ein Gespräch mit der Prinzessin. Aber er weiß es nicht, daß er mit der Prinzessin spricht. Und er spricht mit der Prinzessin über die Prinzessin. Ungeniert natürlich. Es ist ein Kitzel, glaubet nur! Ein wahres Ameisenlaufen des Behagens, eine rechte Wollust der überbrückten sozialen Distanzen. Und der guten Marlitt, die im Himmel Strümpfe strickt, entfällt eine Träne und eine Masche. Die arme Prinzessin! Warum nennt sie der Dichter eigentlich nie «Prinzeßchen»? Sie ist blaß, verschüchtert, kränkelnd; der Kandidat aber strotzt von Kraft, Frische, Lebenslust. Er öffnet ihr – wie sagt der Dichter? – «einen Blick ins Leben». Und sie hat Sehnsucht – wie sagt der Dichter? – «nach einem stillen, kleinen Glück». Zu traurig, diese fürstliche Dame, die in ihrer hohen Einsamkeit verzichten muß auf die Freuden bürgerlicher Ungebundenheit. Und zu lieblich, wie der junge Schwärmer zur armen wirklichen Prinzessin von seiner illusionären reichen Prinzessin spricht. Mit einer Spannung, die fast schon Glück ist, denkt der Zuhörer: Wann wird er’s erfahren, mit wem er da so ungeniert gesprochen hat, wie wird er’s erfahren? Und was für ein Gesicht wird er machen, ach, was für ein Gesicht er machen wird! Auch die Rosen kommen vor, aber es wäre allzu kompliziert, zu berichten, wie sie der Dichter hier in sein Spiel geflochten hat.
Das Gemeinsame der drei Akte bildet der Titel: «Rosen». Es könnten auch überall Tulpen sein oder bellis perennis. Oder Veilchen. Diese würden im Drama ein- oder das andre Mal «bescheiden» genannt werden. Aber Sudermann wählte Rosen. Da ist die Liebe und die Schönheit nicht weit und das Gebrochenwerden und Stechen und Welken und das Üppigsein und die Entblätterung und der Duft. Und wenn alle billig und seit jeher und von Rechts wegen dazugehörenden Rosen-Assoziationen versammelt sind, ist’s an sich schon ein stattliches Aufgebot dichterischer Heeresmacht.
Ein weiteres Gemeinsames der drei Stücke ist das Anekdotische in ihnen. Ihre Isoliertheit im Raum menschlichen Denkens und Fühlens. Sudermann-Dramen sind Räubergeschichten. Schreckliche Abenteuer eines jungen Mädchens auf der Prärie der guten Gesellschaft. Kämpfe eines edlen Bleichgesichts gegen grausame Konventions-Indianer. An Marterpfählen wird psychologisch gewimmert; gräßlich heulen Instinkte und Triebe durch die Schicksalsnacht.
Gemeinsam ist den drei Einaktern die Fähigkeit, den Zuhörer hungrig zu machen: nach einer Spannungslösung, nach dem Moment, da Bösewichter und Prinzessinnen sich endlich developpieren, da die Flamme endlich zum Pulver vorgekrochen ist, nach dem Augenblick, da gestockte Tränen endlich fließen, verhaltener Zorn endlich losbricht und seelische Geschwüre befreiend platzen.
Friedrich Hebbel äußert sich prophetisch über seinen nachgeborenen Kollegen Sudermann in einem Brief an Frau Dr. Schoppe vom 25. Mai 1837: «Das ist auch das Zeichen des Genius: er steht immer in bezug auf das Unendliche und erzeugt in jeglichem Werk ein Anagramm der Schöpfung; es braust wie ein Sturmwind durch den ganzen Baum und nun überschütten uns Blumen und Früchte. Das Talent und das hermaphroditisch-ekelhafte Zwitterding, was ich Affengenie nennen möchte, erwischen hie und da ein einzelnes Zweiglein mit einer dürftigen Frucht, einer vertrockneten Blüte und stillen höchstens – einen Hunger, niemals eine Seele.»
Henry Bernstein
SEIT einigen Jahren hat die deutsche Bühne in jeder Saison ein bis zwei Henry Bernstein-Dramen zu überstehen. Der Kulturvermittler Rudolf Lothar ist es, der den Import übernommen hat. Nun könnte er sich aber schon beruhigen. Gegen den Zauber dieses schwadronierenden Theaters, dieser dampfenden «Technik», dieser wie geboxten Dialoge sind wir allmählich immun geworden. Hingegen hat sich der Ekel vor dieser Sorte geschriebener Kulissenreißerei nicht unwesentlich vertieft, Herrn Bernsteins überhitzter Dramen-Mechanismus interessiert uns nicht mehr, und ein paar Minuten voll Herzklopfen und Atemlosigkeit scheinen uns mit einigen Stunden des Degouts zu teuer erkauft. Der diesjährige Bernstein heißt «Simson» (eigentlich «Foudre!») und wurde kürzlich im Wiener Deutschen Volkstheater abgeknallt. An diesem «Simson» mag einmal das Essentielle der Bernsteinschen Kunst betrachtet werden.
Wenn man dem Dichter sagte: «Herr, Ihre Kunst geht mir auf die Nerven!» würde er erwidern: «Eben das soll sie!» Denn ihr Trick ist: Nervenreize – unter intellektuellen Vorwänden. Eine Dramatik, die, ernst und bedeutungsvoll schauend, als wünsche sie, des Hörers Seele zu alterieren, doch nur auf seine Magengrube zielt. Es gibt nichts ähnlich Verlogenes wie diese Bernsteinschen Dramen. Ihr Erzeuger hat Geist und Kenntnis genug, um die Allüren des bessern Schauspiels anzudeuten: Seine Komödie langt mit ein paar banalen Scheingriffen nach gesellschaftlichen Problemen, ihre blutunterlaufenen Augen blinzeln psychologisch, sie keucht Tiefsinn. Und Herr Bernstein tut so, als sei «das Theater» stärker als er. Als sei er ein nachdenklicher, von dichterischen Intuitionen und Absichten vollgestopfter Mann, der nur immer durch sein ungeheures Temperament hingerissen, durch seine Leidenschaft aus allen zartern Bedenken fortgeschleift werde. Er tut so, als seien seine Werke au fond durchaus noble Komödien, Geburtsaristokraten der Literatur, die, in der Tropenluft der Bühne, von einer Art Theaterkoller überfallen, unwiderstehlich zu Gewalttat und Exzeß geschleppt würden. In Wahrheit ist’s gerade umgekehrt. Die Bernsteinschen Dramen sind, wenn man so sagen darf: Parvenüs. Es sind ganz gemeine, ordinäre Kolportagestücke, die sich durch literarische Listen und manuelle Geschicklichkeiten eine Art Adel zu erzwingen wußten. Und es ist charakteristisch, daß er von der Börse nicht loskommt, von dem Thema des Geldes mit seinen Kräften, ein Individuum in gewaltige Höhen zu tragen oder es in die tiefsten Keller der Erniedrigung zu schmettern. Es waltet ein der Genialität nicht entbehrendes, großartiges Spekulantentum in der Bernsteinschen Dramenmache. Er ist im Literarischen ein Faiseur großen Stils. Es ist eine mächtige Gier in seinen Komödien, ein, oft bezwingender, Wille zur Wirkung, ein gänzlicher Mangel an Nervosität, ein riesiger Appetit und ein unbedenkliches Ausnützen der Muskelkraft. Schon ihre Titel sind wie Griffe an die Gurgel: «Rafale!» – «Voleur!» – «Foudre!» Es sind Zeitungsdramen, in dem Sinn, in dem man von Zeitungsromanen spricht. Man sehe nur die Aktschlüsse; sie sind immer ungefähr so: «Da erhob der Graf den Revolver, zielte, drückte den Hahn herab und …» (Fortsetzung folgt). Die gewaltigste Spannung der Bernstein-Dramen liegt in den Zwischenakten. Das Publikum japst vor Gier nach der «Fortsetzung». Henry Bernstein ist ein großer «Techniker», gewiß. Er hat vor allem eine Kunst der Retardierung, die staunenswert ist. Ein krachendes Unabänderliches kündigt sich am fernen Horizont an. Nun kommt es näher, immer näher, aber wie langsam, wie quälend schrittchenweise! Wenn es endlich da ist und endlich explodiert, ist’s ein allgemeines Aufatmen, ein Erlöstsein, und im Applaus schafft sich die zum Platzen emotionierte Zuhörerschaft ein befreiendes Ventil. Er ist ein Techniker, zweifellos. In diesem «Simson», wie in fast all seinen Stücken, tobt eine brandende Dialektik: Im dritten Akt spritzt der Schaum wütender, gehässiger, verzweifelter Worte so hoch, daß der Zuhörer in seiner Angst und Erregung wahrlich Sturmesnot verspürt. Und sich dann dreifach behaglich auf den sanften Gewässern des vierten Aktes schaukelt, in dem Liebe, Versöhnung, Lohn für Tugend, Dank für Treue und ähnliches dramatisches Öl alle Wogen geglättet haben. Herr Bernstein wird immer Erfolg haben. Er ist ein «Techniker», er hat einigen zwischen giftig und süßlich schwankenden Humor, er ist gegen die Sittenverderbnis der großen Gesellschaft und für die heiligen Rechte des starken Individuums. Er hantiert überdies immer mit mehreren Millionen, in der mystischen Zauberlandschaft riesiger Vermögen, im Duft betäubender Summen. Er ist ein Dramen-Journalist. Ein Besorger theatralischer Sensationen, Erhitzungen und Rührungen, wie sie eine großstädtische Bürgerschaft liebt und braucht. Er ist der penetrante Sänger ihrer Träume, ihrer Sehnsucht, ihres Herzensfiebers, ihres verschwiegenen Knirschens und ihrer goldenen Triumphe. Er ist für die Bühne der Romantiker der Bourgeoisie.
KARL SCHÖNHERR
Erde
DAS Elementare scheint Karl Schönherr mehr zu fesseln als das Komplizierte. Die Verspinnung menschlicher Leidenschaften scheint ihn weniger zu interessieren als die Konsistenz der Einzelfaser. Beziehungen und Verwicklungen der Triebe sind ihm eigentlich Nebensache. Wichtig ist ihm «der Trieb» an sich. Sein Wachsen, Großwerden, Großsein, sein Blühen und Verdorren, seine Fähigkeit, elend oder glücklich oder tierisch oder heroisch zu machen. Schönherr ist als Dramatiker Biolog. Darum wohl auch wendet er sich immer wieder zur bäurischen Sphäre. Dort, in Regionen, wo «die Welt mit Brettl’n vernag’lt» ist, wo nichts ins Weite verfließen kann, alles sich im Engen verstaut, wo die Wünsche auf den Nahkampf eingerichtet sind, hart, starr, schwer wie Äxte, wo das Glück nicht erjagt, sondern gezimmert wird, – dort findet der Dichter Schönherr sein biologisches Material. Im Großstädter, der so vielerlei Wunsch und Sehnsucht in schwächlicher Brust herbergt, zeigen sich die Triebe nur in einem Bruchteil ihrer «natürlichen Größe». In der bäurischen Seele sieht man sie, wie im Lehrbuch: «vielfach vergrößert».
Hier ist ein sauberes Spiel natürlichen Wollens gegen natürliche Hemmungen. Die Instinkte kämpfen schildlos, nicht gedeckt hinter einer undurchdringlich-dichtverfilzten Dialektik. Das mag den modernen Menschen langweilen, den Psychologen kalt lassen – den Dramatiker wird es reizen. Und noch eins wird ihn fesseln: daß diese bäurischen Menschen gleichsam noch nicht völlig von ihrem unbeseelten Hintergrund abgelöst sind. So ist selbstverständlicher Zusammenhang zwischen ihnen, eine plastische Einheit, wie sie der Dramatiker sonst erst künstlich und kunstvoll schaffen muß. Die halbe Arbeit ist getan!
Solange Schönherr diesen Zusammenhang, diese Nähe gelten, solange er Elementares elementar sich äußern läßt, solange bleibt er dramatisch, dichterisch. Die Sache sinkt, wird «Bauernstück», wenn die Schönherrschen Helden Distanz zu ihrem Sein gewinnen, wenn sie Bewußt-Bauern werden, zwar im Dialekt ihrer Zunge, aber nicht im Dialekt ihres Herzens, sondern in einem affektierten seelischen Hochdeutsch sprechen. Es ist was andres, ob wir spüren: Bauern, von einem Dichterauge gesehen, oder ob wir spüren: Bauern, die mit Dichteraugen sehen. Dann wird auch die Sprache unecht, so sehr, daß sie manchmal ganz aus der Prosa und ins Metrum gerät. Einmal sagt der dumpfe Hannes: «Laß wachs’n, laß sprießen, laß leb’n und brüten! – Was nützt mir der Acker, solang er nit tragt?» Ein richtiggehender jambisch-anapästischer Zweizeiler.
Das Schauspiel «Erde» ist auch der Erde gleichsam «gewidmet». Schweren Schrittes gehen die Schönherrschen Bauern über ihren Boden, fast als ob sie noch nicht lange vom pflanzlichen Zustand des Festwurzelns befreit wären. Sie lieben diese Erde zweifach: dumpf, unbewußt, als Basis ihres Seins, – und sehr hell, sehr bewußt als erstrebenswertestes wirtschaftliches Gut. Ein potenziertes Heimatsgefühl ist es, das diese Menschen nach einem Stückchen Grundbesitz so gierig sich sehnen läßt. Ein Fleck Erde als Eigentum, das heißt doppelt «daheim», heißt Herr, frei, glücklich sein. Auf dem «Grutzenhof» träumen die beiden alternden Mägde inbrünstig davon, auch der Sohn des Hauses erwacht aus seiner dumpfen Gottergebenheit ins Knechtschicksal, als ihm plötzlich, durch Wort und Beispiel, das Glück eines eigenen Herdes nah vor Augen gebracht wird. Aber der alte Grutzenbauer denkt nicht ans Sterben. Das ist ein Prachtmensch, trotzig, hart, von eisenfestem Willen, unbeugsam, mit einer ausgeprägten Herrenmoral. Nicht nur aus Zähigkeit, aus Herrschsucht und Kraftbewußtsein, sondern aus einer Art Erkenntnis des eigenen Wertes, aus objektiver Einschätzung des eigenen Ich lehnt er’s ab, Jüngeren Platz zu machen. Und vom Krankenlager, das alle (als sein vermeintliches Totenbett) gierig-hoffnungsvoll umstehen, tritt er noch einmal in die Gesundheit, ins Leben, gerade zu der Zeit, da die Frühlingsstürme an den Fenstern rütteln und in der Wintererde die Keime sich rühren. In derselben Stunde, da der zweiundsiebzigjährige Greis über den Tod Herr wird, begraben sie den jüngsten Knecht des Hauses. Derselbe Frühlingssturm, der den Alten nochmals ins Leben weht, lockert die Lawine, die das arme, verträumte «Knechtl» hinschmettert. Dieser «Jungknecht» ist ein merkwürdiger, halb närrischer Romantiker. Er lebt stets in holden Blüten- und Frühlingsphantasien. Er schaut fortwährend in den Himmel hinein, das klare Gegenstück zum alten Grutz, der die Erde immer fest im Auge hält. Die revanchiert sich auch beiden gegenüber, legt noch dem Greis ein Stückchen neuen Lebens zu und schickt dem siebzehnjährigen Schwärmer und Himmelsgucker eine Lawine auf den Hals.
Wie in dem breiten Schatten des alten Bauern die andern welken und verdorren, wie sie ihr Recht oder ihren Wunsch auf ein Stück Erde geltend zu machen suchen, wie sie an der eigenen Schwäche oder an der, dem Tod selbst trotzenden, Kraft des Alten scheitern, wie sie verzweifeln, sich fügen oder ihrer Sehnsucht kümmerliche Erfüllung finden – das bildet den Inhalt des Spiels. Bizarre Figuren, das «Totenweibele» und das «Knechtl» und der Sargtischler, putzen die Komödie auf, machen sie bunter, ohne ihre Welt zu erweitern. Herr, wie der sachlichen Situation des Spieles, so auch der dramatischen und dichterischen, bleibt der alte Grutzenbauer. Ein Lieblingssohn der Mutter Erde, mit ihren besten Kräften der Gesundheit, der Erneuerung begabt. Und wie er sie und das ihr Nächstverwandte, Tier und Pflanze, wieder liebt! Viel mehr als den Sohn, als die treu dienenden Knechte und Mägde. Der alte Grutzenbauer ist die personifizierte Urkraft des Bodens. Seine Erhöhung ins Heldisch-Großartige ist dem Dichter so gut gelungen, daß die andern Figuren daran Schaden nehmen mußten. Unsre Freude an dem großen Alten ist zu stark, als daß uns das Leid der Kleinen rings um ihn viel Interesse abnötigen könnte.
«Erde» ist ein gut komponiertes Drama, vortrefflich in seiner Geschlossenheit und Knappheit. Es hat die bündige Architektur eines Gedichtes. Die Menschen der Komödie, gleich im Wurzelhaften ihres Seins, sind gepaart zu scharfen Kontrasten. So ist Gleichklang und Andersklang in ihnen: sie reimen aufeinander.
Kainz als alter Grutz. Von Breite keine Spur, Schärfe alles. Er rettete sich mit seiner großen schauspielerischen Klugheit in eine Auffassung, die aus Mängeln Vorzüge gestaltete. Er spielte einen konzentrierten, nicht einen entfalteten Willensmenschen. Er herrschte mit kurzen Blicken, kleinen Gesten, halblauten Worten. Er spielte «den Willen» an und für sich, der wirkt, indem er ist. Das war vortrefflich; nur: wo blieb der Bauer? Von Kostüm und Dialekt abgesehen, hätte der alte Grutz Josef Kainz’ ebensogut ein König, ein Großindustrieller, ein greiser Herrenmensch irgendwo, irgendwann sein können. Aber die Komödie heißt doch nicht «Der Herr» sondern «Erde». Die Identität zwischen dieser und dem Alten müßte man unmittelbar spüren, nicht nur von ihr hören.
Frau Bleibtreu als Magd. Sie ist ganz Bäuerin. Ihre Energie bäurische Energie, ihre Schlauheit und Gier und ihr Witz haben was Saftiges, Derbes, Breites, Muskulöses. Ihr Wort, ihr Blick packen zu, roh, hart griff-fest wie Bauernhände.
JOHANN NESTROY
Freiheit in Krähwinkel
DIE «Freie Volksbühne» spielte, im Deutschen Volkstheater, «Freiheit in Krähwinkel» von Johann Nestroy. Thaller gab den Journalisten Ultra. Seine bei aller scharfer Pointierung so behagliche Komik wirkte außerordentlich. Er mischt da eine wahrhaft wohlschmeckende Fülle von Charakterzügen, ist klug und liebenswürdig, frech, gutmütig, beredt, lustig, tapfer, und die Bindung dieser Vielfältigkeit zur Einheit besorgt das Wienerische. Es ist bezwingend viel Freude in seinem Spiel, ein ganz ungeistiges, vegetativ Lustiges. In seinen Mienen ist ein immerwährendes stilles Lachen. Wenn man so sagen darf: er pfeift mit den Augen. Die Posse hatte gewaltigen Erfolg. Dem Szenischen fehlte die Intimität, das drollig Beengte der Kleinstadt. Hier hätte ein Künstler von Talent und von der Laune des Herrn Karl Walser in Berlin inszenieren sollen.
Mit der «Freiheit in Krähwinkel» hat die Volksbühne eine ausgezeichnete Wahl getroffen. In dieser wie in allen Nestroy-Komödien ist ein unvergleichlicher Reichtum an Sauerstoff. Man wird frischer, heller, gesünder förmlich, wenn man ein paar Stunden in ihrer Sphäre atmet. Die «Freiheit in Krähwinkel» ist als Theaterstück ziemlich lässig gezimmert. Aber bei aller Sorglosigkeit, Eile und Beiläufigkeit doch so überlegen sicher, wie es nur einer mit ihren Objekten spielenden Kraft und nie einer bloßen austrainierten Geschicklichkeit gelingen konnte. Die meisten Nestroy-Stücke sind so: durchgearbeitet aus dem Stegreif! Sie sind von einem kultivierten Leichtsinn, dessen Kultur angeboren, nicht erworben scheint. Das Nachlässige wirkt bei ihnen als Geniezeichen. Ihr literarisches Kostüm hat die Lockerheit und die unwillkürliche, legere Anmut, mit der ein natürlich-künstlerisch begabter Mensch, ein Italiener etwa, seinen Mantel trägt; – auch wenn dieser Mantel ein Fetzen ist.
Ich glaube nicht, daß die «Freiheit in Krähwinkel» der Revolution zuliebe geschrieben wurde. Die Revolution erscheint hier kaum als Stoff, an dem das Herz des Dichters entflammte, sondern vielmehr als eine glänzende Gelegenheit, die der Witz des Satirikers wahrnahm. Die Reaktion wird verhöhnt, aber das Pathos der Freiheitler, ihr utopisch taumelnder Wille, ihre Freude an Phrasen, die wie Raketen aufsteigen, einen Augenblick leuchten, blenden und in Rauch zerplatzen – die bleiben keineswegs unbelächelt. Es waltet in der Posse ein Zug des Indifferentismus: des Indifferentismus der bekannten «höhern Warte». Das Spiel der Meinungen, der Mechanismus der politischen Ideen und der von ihnen in Bewegung gesetzten Menschen, das scheint Nestroy doch mehr interessiert zu haben als die Meinungen und Ideen an sich. Man hat bei den Freiheits-Worten, die in der Komödie besprochen werden, nicht die Empfindung, daß hier ein politisches Bekenntnis literarischen Ausdruck fand; sondern vielmehr die, daß hier die schöpferische Lust eines heitern Künstlers am Werk war, den es reizte, die Tagesideen in kräftigen, witzig-prägnanten, schlagenden Worten einzuformen. Von irgend welchem moralisch-politischen Ernst kann dabei kaum die Rede sein. Hinter jedem dieser kernigen, liberalen Aperçus der Posse steht gleichsam ein Ausrufungszeichen und ein Fragezeichen. So wird das Ethos der Komödie bis zur Unsichtbarkeit transparent. Hinter der politischen Ernsthaftigkeit werden die menschlichen Lächerlichkeiten merkbar – und um die hat sich’s Nestroy doch vor allem gehandelt.
Der Witz der «Freiheit in Krähwinkel» ist echtester Nestroy-Witz, gefräßig, kieferstark, scharfzähnig. Dieser Witz hat in seiner Urkraft fast etwas Barbarisches. Er verschlingt mit Haut und Haar die Idee und die Form, nachdem er erst mit den Worten wie mit Opfern katzenartig gespielt hat. Er hat auch darin etwas Raubtierartiges: in seiner Sprungsicherheit, in seiner federnden Agilität, in seiner bei aller Kraft so graziösen Gelenkigkeit. Dabei ist er von erschütterndem philosophischen Gleichmut. Nestroysche Weisheit ist erquickend wie etwas ungemein Gutes, Kühles, Säuerliches, das den Durst löscht. Angesichts der losbrechenden Revolution sagt eine Krähwinklerin: «Ich bin nur froh, daß mein Mann schon tot ist! Wie leicht hätt’ ihm jetzt was passieren können!» Ich kann’s nicht ausdrücken, worin eigentlich der ideelle Reiz solch eines köstlichen Diktums steckt. Aber ich fühle, daß hier ein Humor am Werk ist, der mehr tut, als die Lächerlichkeiten herauszuspüren. Ein Humor, der das Mensch-Sein an und für sich als eine gewissermaßen ridiküle Angelegenheit empfindet.
ERNST HARDT
Tantris der Narr
IN diesem Schauspiel trügt alles: der Verstand, der Instinkt, die Liebe, der Haß. Wahrheit wird zweideutige Lüge, Lüge verrenkte Wahrheit, und Gott selbst legt falsches Zeugnis ab. Es ist allerdings ein empfindsamer Gott, der Text-Finten, Vexier-Vokabeln gelten läßt. Isolde schwört dem Sinn nach falsche, dem Wortlaut nach korrekte Eide. Gott, in seinem Gericht zur Bekräftigung dieser Eide angerufen, läßt sich gnädig vom Wortlaut täuschen, überhört gutmütig den falschen Sinn. Und König Marke ist rundherum der Gefoppte. Mit geschlossenen Augen ist Marke hellsichtig, mit offenen blind. Muß es sein, da Wissen und Verstehen nichts helfen, wenn Gott selbst zu advokatorischen Kniffen sich herbeiläßt. Marke ist weitaus der interessanteste Mensch im Drama. Sein Leiden um Isolde – und er leidet um sie vielleicht mehr als Tristan – hat kein Ziel, keinen Namen, keinen Körper. Er kann es niemals aus sich herausstellen, betrachten, erkennen. Es ist um ihn wie die Luft, die er atmet. Armer König: Er ist sozusagen noch nicht einmal unglücklich.
Diese Dichtung schlägt flach. Man wird getroffen und bleibt unversehrt. In der schönen Sprache macht sich oft ein billiger Lyrismus bemerkbar. «Gold», «golden», «goldenes Gold», «goldenes Haar», «goldenes Lächeln», «Gold» an allen Ecken und Enden! Besingt Tristan Isoldens Schönheit, wird sein Vers schwulstig: «Ein elfenbeinern Gleißen ist ihr weißer Leib», ferner ist er «eine Kirche aus Basalt» und geht «auf Marmorfüßen». Ich bin gegen Mineralien im Dramatischen. Auch gegen Obst. «Purpurfrüchte», «Fruchtkapseln, auf süßen Seim harrend», «Lilienschaft», «Blütenzweige eines jungen Mandelbaumes», die Vegetation ist zu tropisch für neun Verszeilen.
Ein moderner Zug ist das subjektive Ethos, das der Dichter seinen Helden zubilligt. Am schärfsten tritt dieser Zug in Isolde zutage. Sie hat für ihre Unehrlichkeiten einen geradezu heiligen Lüge-Ton, sie spielt so tief aufrichtig Komödie, daß sie selbst im Augenblick kaum weiß, wo Wahr und Unwahr aneinander grenzen. König Marke aber ist der Mann, der in ihrem Tun und Reden Unehrlichkeit wie Ehrlichkeit, das allzu Menschliche wie das Heilige erkennt und verzweifelnd nicht weiß, welche Tat ihm als Frucht der zwei unvereinbaren Erkenntnisse reifen soll.
Kainz als Tristan. Herrlich das Durchblitzen seiner Ritterschaft durchs Siechen- und Narrenkleid. Der schönste Moment aber war die kleine Pause, die er vor der Schilderung von Isoldens Schönheit machte, und die stillverklärte, aus tiefsten Brunnen des Gefühls aufsteigende Stimme, mit der er dann zu sprechen anhob. Es war wie das stumme Heraufbeschwören und dann wie das leise Heranschweben eines seligen Schattens.
ARTHUR SCHNITZLER
Liebelei
WELCHEN Qualitäten dankt dieses kleine Drama seinen lange blühenden Reiz? Dem Zauber wienerischer Neuromantik gewiß nicht. Auch nicht der Luft, die von den Hängen des Kahlenberges … und so weiter. Das Schlampig-Liebenswürdige, die Mischung von Rührseligkeit, Leichtsinn, Jargon, Zartheit, Wehmut und Zynismus schmeckt lau. Kurz, das Wienerische ist’s nicht, worin die «Liebelei» sich so gut konservierte. Was sie wirkungsvoll erhielt, sind ihre dramatisch-technischen Qualitäten: die Einfachheit und Knappheit des Vorgangs, die hellen, lebhaften Kontraste von Dur und Moll, die zarten und bescheidenen Farben des aufgerollten Lebensbildes. Jede einzelne Figur löst sich klar vom gemeinsamen Hintergrund. Eine volle Plastik gelingt nicht, wohl aber ebenso zarte wie scharfe Reliefs. Alle Talente der Schnitzlerschen Leichtigkeit sind in diesem populärsten Produkt seiner Literatur lebendig. Ein unspürbarer Finger schlingt den dramatischen Faden. Alles vollzieht sich leise, unroh, in Anmut und Dämmerlicht. Das unerbittliche Schicksal selbst kommt auf Zehenspitzen und drosselt seine Opfer gewissermaßen mit «leichter Hand». Auch das Schwarz in diesem Drama scheint noch wie ein konzentriertestes Blau. Solchen Tugenden verdankt die «Liebelei» ihre Dauerwirkung, nicht ihrer Empfindsamkeit und ihrem Wienertum.
G.B. SHAW
Major Barbara
DIE Weltanschauung des reichen Kanonenfabrikanten (Geld und Schießpulver) siegt über die Güte-Ideologie seiner Tochter Barbara (als Mitglied der Heilsarmee «Major Barbara»). Das kommt als gewonnenes Terrain zutage, wenn die Debatten-Flut verebbt. Sie wälzt sich über vielerlei problematische Dinge des Lebens, über Reichtum und Armut, Religion und Freidenkerei, schlecht- und wohlverstandene Menschenliebe, über individualistische und soziale Heils-Theorien, über Ehe, Erziehung, Kultur, Geld, Krieg, Branntwein, über moralische Immoral und amoralische Moral, über törichtes Recht und weises Unrecht, über dumme und kluge Methoden, Mensch und Nebenmensch zu sein. Eine unerbittliche Eloquenz rauscht durch die vier Akte. Man hört am Ende kaum mehr was, nur noch, daß sie rauscht. Die Figuren sind Brunnenfiguren, leblos-lebendig, die dramatische Form, sie untereinander verbindend, nur das Becken, das ihre strömende Beredsamkeit faßt und sammelt, und es geht zu wie in Hellbrunn. Das Stück hat vier Akte, könnte aber ebensogut hundert haben. Es endet, weil es endet, weil der Autor die Worte-Zuleitung abdreht. Was er noch zu sagen hat, ergießt sich in Vor- und Nachreden.
Es gibt keine guten oder schlechten Standpunkte, es gibt nur gute oder schlechte Vertretung von Standpunkten. Alles ist Dialektik, und Shaw ein glänzender Dialektiker. Sein Reden ist Überreden, sein Witz mit Liebe und andern warmen Dingen gut wattiert, seine Ironie so scharf wie liebenswürdig, seine Taschen voll von aphoristischem Pfeffer, der blind macht. So behält er immer Recht, selbstverständlich, denn da er, als Vormund aller Münder, die im Stück aufgemacht werden, auch die Gegen-Argumentation zu seiner Argumentation beistellt, ist es ihm ein Leichtes, jene ins Unrecht zu setzen. (Im Ringkampf nennt man das «Schiebung», wenn der Gegner auftragsgemäß so kämpft, daß er unterliegen muß.) Auf jedes Diktum der Komödie könnte hundertfach anders, besser erwidert werden, als erwidert wird, alles hängt schief in der Kausalität, die Prämissen stehen auf den Schlußfolgerungen, die sie stützen sollen, die Wege aus dem Recht-Unrecht-Chaos münden kreisläufig in dieses zurück, rechter Londoner Begriffs-Nebel hüllt, da man sich nicht vorher über Definitionen geeinigt hat, die Debatte ein, logische Unfälle und Verkeilung der Beweisführung verursachend, und das Gegenteil wäre immer auch wahr. Zum Beispiel die schlagend-witzige Antwort des Kanonenkönigs im Dialog mit dem alten Arbeiter: («Ich möchte nicht Ihr Gewissen haben, nicht um Ihr ganzes Einkommen.» – «Und ich nicht Ihr Einkommen, nicht um Ihr ganzes Gewissen») hört sofort auf, schlagend und witzig zu sein, wenn man den Dialog umdreht. (Undershaft: «Ich möchte nicht Ihr Einkommen haben, nicht um Ihr ganzes gutes Gewissen.» – Der Arbeiter: «Und ich nicht Ihr Gewissen, nicht um Ihr ganzes Einkommen!») Jetzt wäre es der alte Proletarier, der es dem reichen Mann gut gegeben hätte und dem das Theater Beifall klatschen würde.
Im Burgtheater wird das Diskutier-Spiel besonders von Herrn Heine, als Kanonenfabrikant, souverän gemeistert. Er produziert ein sehr schmackhaftes Pathos – es braust auf wie der Schaum dieser gut frappierten Weltanschauung –, fest steht er in den Stiefeln, im Stiefel, seiner Lebensphilosophie, und hat auch allen Humor solcher Stand-Sicherheit.
FRIEDRICH HEBBEL
Herodes und Mariamne
EIN Drama der unerbittlichsten psychologischen Schiefbohrungen, der grausamsten chirurgischen Umwege, der Herzstiche, die beim Nacken einsetzen. Zeit: Ungefähr knapp nach der Götterdämmerung. Die Akteure sind nicht mehr Götter und noch nicht Menschen. Die heidnische Götzenburg liegt schon im Staub, aber das Reich Gottes ist noch nicht aufgerichtet. Das Unbedingte legendarisch-heroischer Leidenschaften und Kräfte scheint gemengt mit der Bedingtheit kleinen Menschentums. Willensriesen knicken, vom dialektischen Bazillus zerstört, zusammen. Die Affekte werden schraubenförmig in qualvolle Höhen gewunden (man sehe die Wiederholung der gleichen Herodes-Tat, die das Drama am Ende des dritten Aktes genau dort hinbringt, wo es am Ende des zweiten Aktes stand, nur gerade um eine Schraubenwindung höher); die dramatische Rechnung, die so ungeheure tragische Resultate ergeben soll, müßte mit zu großen Ziffern geführt werden, würde nicht durch die Erhebung der Leidenschaften und Aktionen zum Quadrat ein abgekürztes Chiffrieren ermöglicht. Der Dialog schafft unaufhörlich finsterste Mißverständnisse, logische und Gefühls-Verdunkelungen; alles Licht, sternenhaft blaß, kühl und fern, fließt aus den Selbstgesprächen. Es ist ein fortwährendes Sichkreuzen und Verfehlen von Wunsch und Erfüllung, ein stetes tragisches Knapp-zufrüh- oder Knapp-zuspät-Kommen, ein dämonisches Ganz-nah-aneinander-Vorbeiirren suchender Seelen. Der Tod spielt in diesem Drama eigentlich keine Rolle. Die gedankliche Unersättlichkeit des Dichters ging über ihn hinaus. Sterben ist ihm kein Ende, ist eine Sache des Lebens wie jede andre, gewissermaßen nur eine dramatische Zwischenkatastrophe. Die Seelentragödie geht weiter. Dieser Herodes hat ein Ich-Gefühl, für dessen Vehemenz es kein Erlöschen gibt. Er spinnt es übers Grab hinaus. Und mit dem, was seines Ich stärkster Inhalt ist, mit seiner Liebe, füllt und rötet er noch den Schatten, der, aus seinem Sarge steigend, Gegenliebe für Liebe, Gefolgschaft ins Nichtsein fordern soll. Es ist ein Urproblem, an das hier gerührt wird: der Unsterblichkeitsglaube des Ich. Und die tragische Schuld des Hebbelschen Herodes liegt darin, daß er für diesen Glauben Sicherheit und materielle Bürgschaften sucht, die er nur in der Tiefe des Glaubens selbst hätte finden können.
ARTHUR SCHNITZLER
Der Ruf des Lebens
EINE schöne, wunderliche Komödie, eilig zwischen Tod und Leben hin und wider wandelnd, brutal und zart, resigniert und doch hell von mancherlei milden Zuversicht, voll Blut und Leidenschaft und Schwermut und lyrischer Verschnörkelung, voll großer Fragen und bescheidener Antworten, zweifelnd, anklagend, entschuldigend, unempfindlich und empfindsam, überlegen bis zur Demut und pathetisch bis zur Einfachheit (als des Pathos sublimster Spitze).
Der Begriff: Leben erscheint in diesem Drama vielfach dialektisch gespalten. Der kluge Arzt und der skeptische Offizier verstehen unter Leben schlechtweg: esse, das Vorhandensein allgemeinster physiologischer Voraussetzungen. Die Jugend im Stück versteht unter Leben: Erleben, intensive Stunden, große Inhalte, Höchst-Spannungen des Organismus, Abenteuer und Außerordentliches, Räusche und Ekstasen. Der Ruf des Lebens ist für die einen: ein ruhiger, über allen Dingen schwebender, ewiger Ton; für die andern eine hinreißende, auf Gipfel und in Abgründe verlockende Wirbelmusik (im Vorüberziehen).
Die klugen Betrachtungen über das «Leben» und den «Ruf des Lebens» im Schnitzlerschen Schauspiel ergeben sich eben aus dieser Doppeldeutung des Begriffs. Aber wie man ihn immer deuten mag, nie läßt sich der Begriff «Tod» als sein Kontrast auslegen. Auch wenn man mit den Augen des klugen Arztes die Welt betrachtet, erscheint nicht der Tod als Gegensatz, sondern als Teil, als Stück, als Form des Lebens. Für diesen pantheistischen Mann darf es ja gar keinen Tod geben. Denn Leben heißt ihm: empfinden. Irgend etwas. Lust oder Schmerz, einen schönen oder häßlichen Sinneseindruck, den schlaffen oder starken Reiz eines Gedankens, einen Vorgang, eine Ruhe. Der eigene Tod muß ihm reine Fiktion sein, da er sich weder denken noch empfinden läßt. Dies hieße ja: empfinden, daß man nichts empfindet.
Auch den andern, den nach konzentrierten Augenblicken Begehrlichen, mag der Tod nur eine Variante des Daseins bedeuten. Gerade aus ihm mag der Ruf des Lebens ihnen aufs lauteste tönen. Eine geniale Frau schrieb in ihr Tagebuch: «Der Tod ist das einzige Erlebnis, um dessentwillen es sich verlohnt, auf die Welt gekommen zu sein.»
Die Philosophie über letzte Dinge dünkt mich des Stückes schwächster Teil. Aber sehr fein und virtuos die eigentümlich knappe Relieftechnik, in der hier Tod und Leben aneinandergesetzt sind. Es schwebt über dem Drama wie Ahnung des geheimnisvollen Spuks, der an des Daseins letzten Grenzen sein zynisch-schreckhaftes Wesen treibt, wie unartikulierte Stimmen, die vom Walten einer höhern, nicht erkennbaren, sinnvoll-sinnlosen Welt-Ordnung reden.
Von dem Mechanismus, dessen Geräusch wir Schicksal nennen, wird ein kleines, möglichst viele Zusammenhänge erklärendes Modell versucht. Es ist naturgemäß, daß die Sache ein wenig schematisch ausfallen mußte. Wunderliche Symmetrien, Parallelismen, Ebenmäßigkeiten stören. Aktschluß Eins und Aktschluß Zwei, zum Beispiel, sind seltsam ähnlich. Bei beiden wird über einen eben gemordeten Menschen hinweg durch die Tür geflohen (dem «Ruf des Lebens» gefolgt). Aber vielleicht war’s Absicht, zu zeigen, daß der Weg zum Glück durchaus über Leichen geht.
Der ganze zweite Akt ist so: Modell. Ein dramatischer Mikrokosmos. Ein gedrängter Kursus durch die Nachtseiten der hellen Daseinsdinge: Liebe, Ehre, Mut, Freundschaft.
Die Komödie bekennt, was alles Durchschauens unausweichliches Ende ist, dies: Es könnte wohl so sein, muß aber nicht.
Fülle und Raschheit der Aktion, die jähen Erscheinungen und Tode, besonders aber die geringen Aufenthalte, die Gefühl und Intellekt der handelnden Personen bei all den tragischen Plötzlichkeiten nehmen, geben dem Drama manches von der steifen Eile eines Marionettenspiels. Aber dieses Stretta-Tempo, diese Wiedergabe eines großen Tatsachenkomplexes in verkleinertem Maßstab hat auch ihren Reiz. Der Eindruck weiter Distanz wird vermittelt. Lebenslinien schließen sich zur Schicksalsfigur zusammen. Mit einem Blick sind Anfang und Ende zu umfassen. Zufall enthüllt sich als Notwendigkeit, und göttliche Gerechtigkeit als Produkt einer unbegreiflichen, kalten, spielerischen Laune.
Die Ereignisse des Dramas stehen zueinander in Beziehungen, wie sie etwa zwischen Schall und Echo, Spiel und Gegenspiel, rechts und links herrschen (Beziehungen, die, ich erwähnte es schon, manchmal bis zur steifen Symmetrie stilisiert erscheinen). Da ist die Tochter des bösen, alten Mannes, die durch den Zwang, der über ihrem Leben lastet, zur tragischen Figur wird. Da ist die Tochter der guten, alten Frau, die an der Freiheit zugrunde geht. Da ist ein Mann, der einst, als Soldat auf verlorenem Posten, die Stimme der Pflicht nicht hörte, weil sie vom Ruf des Lebens überschrien wurde. «In diesem Augenblick wußte ich mit einem Male, daß sie uns all das, was uns auf den Fleck gebannt hielt, hundert Ewigkeiten lang, nur vorlügen … Ehre und Vaterland nur vorlügen, um uns sicher zu haben! … Wer lohnt mir’s? Wer dankt mir’s?» Dreißig Jahre später handelt die Tochter ganz konform dem väterlichen Beispiel, läßt den gefährlichen Posten, flieht ins Leben, schüttelt die Hypnose von Kindespflicht und -liebe ab, die sie auf dem Fleck gebannt hielt hundert Ewigkeiten lang. Da ist der Oberst, der sein Regiment dem Tode weiht. Halb und halb schimmert’s durch, daß der große Entschluß aus Zufallsmotiven erwuchs. Ganz ähnlich, wie der Oberst seinem Regiment, benimmt sich das Schicksal den Töchtern der Frau Toni Richter gegenüber. Sie alle, die drei blühenden Mädchen, opfert es der Schwindsucht, dem Tode. Warum? Welche Weisheit oder welcher Unsinn steckt dahinter? Welche Logik oder welcher Zufall? Die Menschen fragen nicht, beugen ihr Haupt dem Geheiß von oben, weinen, lobpreisen den ewigen Namen. Dieser Oberst ist wie der liebe Gott. «Unerforschlicher Ratschlüsse» voll, die Leute heimschickend «mit sublimen Worten», alles wissend, Schuldige mit dem Blitz der Rache treffend, Unschuldige mit dem Blitz grausam-erhabener Entschließungen; und seine Anbeter sprechen zu den Zweiflern: «Ihr versteht ihn alle nicht.»
«Man muß die Zusammenhänge begreifen!» meint Leutnant Max.
Schnitzler liebt das Spiel mit dem Tod, um den Tod herum. Auf dunkelsten Hintergrund malt er mit Vorliebe die witzig-wehmütigen Ornamente seiner feinen, delikaten Geistigkeit. Es ist manchmal billig. In Todes Nähe werfen auch kleine Dinge, Menschen, Gedanken tiefe Schatten.
G.B. SHAW
Der Arzt am Scheidewege
EIN Losungswort dieser Komödie ist der Satz des Sir Ridgeon: «Das Leben hört ebenso wenig auf, komisch zu sein, wenn die Leute sterben, wie es aufhört, ernst zu sein, wenn die Leute lachen.»
Wenn man aber die Linien Tod und Komik verlängert, bis sie einander treffen, so fällt ihr Schnittpunkt in den Bereich der medizinischen Fakultät. Sie vor allem ist es, die in der Nähe des Todes ihr geheimnisvolles, mächtiges und ruhmrediges Handwerk üben darf. Doch die Satire gegen die Doktoren ist nur die alles umspannende Oberfläche, die Haut der Komödie. Nicht ihr Herz.